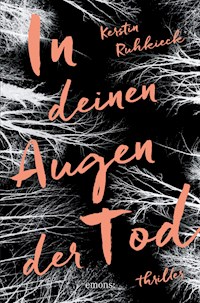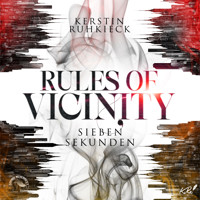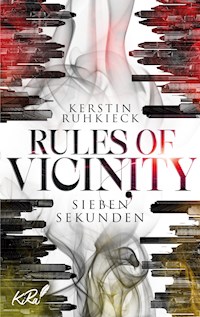Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein vielschichtiger Psychothriller. »Warst du mal wieder auf Seelvlieth Island? Ist schön hier.« – Was aussieht wie eine gewöhnliche Postkarte, versetzt Elena in größte Alarmbereitschaft. Doch nicht nur sie sieht sich im Fadenkreuz des Absenders, sondern auch ihre beiden Freundinnen Teresa und Miriam. Die drei verbrachten vor vielen Jahren einen gemeinsamen Sommer, an den sie sich immer weniger erinnern. Doch mit einem Schlag ist die Vergangenheit zurück und zieht ihre Schlinge immer enger um das Trio, das lange versucht hat zu vergessen . . .
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 544
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Kerstin Ruhkieck schreibt Geschichten, seit sie einen Stift halten kann. Sie machte ihr Abitur auf dem zweiten Bildungsweg und studierte Deutsche Sprache und Literatur in Hamburg. Kerstin Ruhkieck ist verheiratet und hat zwei Söhne.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig. Darüber hinaus beinhaltet der Text sensible Themen, die Auswirkungen auf Betroffene haben können: Tod, psychische sowie physische Gewalt.
© 2023 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, unter Verwendung eines Motivs von arcangel.com/Russ Styles
Lektorat: Lothar Strüh
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-98707-069-3
Thriller
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Dieser Roman wurde vermittelt durch erzähl:perspektive, Literaturagentur Michaela Gröner & Klaus Gröner GbR, München.
Für alle, die es bis hierhin geschafft haben
KAPITEL 66
Das ist die Hölle, dachte sie, ein Gedanke, der sich mit rostigen Nägeln in den harten Knorpel hinter ihrer Stirn rammte, blutige Schlieren hinterließ und hängen blieb.
Es war heiß. Flammendes Licht brannte durch die geschlossenen Lider in ihren Augen, kokelte das dünne Häutchen weg wie ein Bunsenbrenner die erste Eisschicht eines zugefrorenen Sees.
»Alles wird gut«, wisperte jemand frohlockend in der Ferne, und das Versprechen, ob es nun ihr galt oder nicht, machte sie wütend. Es war eine Lüge, niederträchtig und bösartig. Nichts würde gut werden, nie wieder, und jeder, der sich weigerte, die Wahrheit zu akzeptieren, widerte sie an. Sie tat es schließlich auch, sie akzeptierte alles, akzeptierte die hässliche Realität und ihre eigene Rolle darin.
»Wünsch dir was!«, brüllte eine ranzige Stimme, Madita kannte sie, doch die Erinnerung daran war vage, Multiversen entfernt, immer noch zu nah. Sie reckte den Hals, niemand war zu sehen … Nein, niemand war da.
»Wünsch dir was!«, grölte es in ihrem Ohr, Madita wollte sich wegdrehen, abwenden von der Stimme und dem Schmerz, den sie auslöste, doch es gelang ihr nicht.
Eine Wolke, schwül und schwer, waberte den Gang entlang und kam auf sie zu. Ihr eigener Körper erschien ihr fremd, er gehorchte nicht, richtete sich gegen sie, nur deshalb blieb Madita liegen, bewegungslos, als der Nebel sie erfasste, sie einschloss in eine klamme ungewollte Umarmung. Schweiß und Kondenswasser sammelten sich auf ihrer Stirn, durchtränkten ihre Kleidung, klebten den Stoff an ihre Haut. Tote Nervenenden, erstarrte Muskeln und doch spürte sie alles. Die feuchte Dunstwolke, Gewächshausluft, die Madita zu verdauen versuchte, machte ihren wunden Körper zu einem brennenden Inferno. Spitze Finger pikten sie, hielten sie in ihrem irdischen Dasein, ließen sie nicht entkommen aus dem Grauen.
»Wünsch dir was!« Das Dröhnen der Stimme war ohrenbetäubend, ein Höhnen in ihrem Kopf, als fände der lähmende Lärm nur dort statt.
Sie verbot sich zu weinen.
Die Welt setzte sich in Bewegung, Maditas Arme waren taube Stümpfe, sie hatte keine Möglichkeit, sich festzuhalten, um nicht in die Tiefe zu stürzen. Mit zusammengekniffenen Augen ließ sie es geschehen, presste die Lippen aufeinander, erwartete den Moment, in dem sie auf den Boden schlug und aufplatzte wie ein mit Blut und Organen gefüllter Ballon.
Aber sie fiel nicht.
Dann war es vorbei. Madita versuchte, ihre Lider zu heben, sie waren schwer, wollten sie vor dem schützen, was ihre Welt erschüttert hatte, wenn es auch nur die Einsicht war. Aber es gab keinen anderen Weg, es musste sein, wenn der bloße Wille nicht genügte, würde sie sich eben die Augenlider aus dem Gesicht reißen. Keine Wahrheit konnte die Grausamkeit dieser Hölle übersteigen.
Lüge.
Madita wich zurück, verstört, wollte schreien, als sie die Fratze erblickte, doch ihre Stimme starb zeitgleich mit einem Teil von ihr. Hände statt Augen, rot gewundene Hörner wucherten aus einer Stirn und statt einer Zunge eine Python, die sich aus dem Mund schlängelte. Sie schnellte ihr entgegen, des Teufels Tochter lachte, ein erschütternder, bösartiger und grauenvoller Laut, der den Wahnsinn brachte …
Madita schlug die Augen auf. Tageslicht blendete sie, und auch ihre übrigen Sinne schienen sich zurückgezogen zu haben. Sie blinzelte, Sternchen tanzten auf ihrer Netzhaut, und benommen versuchte sie, sich von ihrem Hitzetraum zu lösen. Sie wollte ihn loswerden, ihn von sich schütteln, doch er haftete an ihrem Bewusstsein wie der Schweißfilm auf ihrer Haut. Auf der Seite liegend, nicht wirklich wach, aber auch nicht mehr schlafend, starrte sie auf einen schmuddeligen Holzfußboden. Ihre Wangen fühlten sich heiß an, schienen zu glühen, das dumpfe Pochen in ihrem Kopf glich einer tickenden Zeitbombe.
Und schlagartig war alles zurück, alles, bis ins letzte hässliche Detail, der Alptraum kehrte aus ihrem Verstand in die Realität ein und machte ihn zur Gewissheit. Madita fühlte sich wie geschlagen, fast wünschte sie sich, jemand hätte es getan.
Das Ferienlager.
Die Holzhütte mit den Etagenbetten.
Die anderen Mädchen. Chaos. Innen wie außen.
Was sie Ophelia angetan hatte.
Übelkeit ätzte sich ihre Speiseröhre hinauf. Sie schlug sich die Hand vor den Mund, das Entsetzen war ein Meteoriteneinschlag mit einer Wucht, die alles Leben auszulöschen vermochte.
»Habe ich dich geweckt?« Die samtige Stimme war direkt neben ihr, und Madita erschrak. Beinahe erwartete sie, die teuflische Kreatur aus ihrem Alptraum zu sehen, die sich bereit machte, über sie herzufallen. Doch es war Luzie, die auf Maditas Bett saß und sie aus unergründlichen Augen beobachtete.
Verlegen ließ Madita ihre Hand sinken, setzte sich schwerfällig auf, ihr Kopf eine heftige Verneinung, die sie schwindelig machte. Das ihr vertraute Gefühl, diesem wunderschönen Mädchen mit der bleichen Haut und dem dunklen Haar gefallen zu wollen, überwältigte sie einmal mehr und machte es ihr unmöglich, den Fehler in diesem Gefühlskonstrukt zu erkennen.
Der verstörende Gesang eines Kinderchors aus der anderen Ecke der Hütte, der aus dem Nichts einsetzte und mit Gewalt an dem Stacheldraht in Maditas Magen zog, brachte sie wieder zu Verstand.
»Mach die Scheißmusik aus«, zischte Luzie quer durch die Hütte, und für den Bruchteil eines Augenblicks glaubte Madita, etwas Fremdartiges in dem Gesicht des anderen Mädchens zu sehen, ein kosmisches Flackern, das Luzies Züge beinahe teuflisch entstellte.
Eine Sinnestäuschung, mehr nicht.
Oder eine Offenbarung?
Maditas Kopf drohte zu zerspringen, triefende Fetzen aus Hirnmasse würden ihnen jeden Augenblick um die Ohren fliegen. Schlagartig wurde es still, die Musik brach ab, und was blieb, war der verstörende Krach in ihrem Kopf. Madita spürte den Blick des anderen Mädchens auf sich, mehr brauchte es nicht, Luzie musste sie nur ansehen, um sie zu verunsichern. Nervös ließ sie den Augenkontakt zu, versank in dem tiefen Saphirgrün ihrer Iriden, das sie gleichermaßen anzog und abstieß. Eine verlockende Gefahr ging von ihr aus, doch Maditas schreiender Impuls, die Flucht zu ergreifen, schrumpfte stetig, ihr Herz hingegen begann zu pochen, wild und ungestüm. Tobende Energie fand ihren Weg in ihre Venen, weckte ihren Körper aus seiner Trägheit, und Madita fühlte eine Lebendigkeit, die sie nur bei Luzie empfand. Sie konnte sich nichts Erstrebenswerteres vorstellen als Luzies Aufmerksamkeit, ihre Freundschaft machte Madita erst zu etwas Besonderem. An ihrer Seite war sie nicht länger das hübsche, aber langweilige Mädchen, sondern die schöne, aufregende Frau, die schon immer in ihr geschlummert hatte.
Ophelia, dieses plumpe Mauerblümchen, hatte Madita in der Belanglosigkeit gefesselt, während ihr wahres Ich längst bereit war für den Ausbruch.
Gefangen von Luzies Augen, dem unergründlichen grünen Ozean mit den verborgenen Kreaturen an dessen Grund, wurde Madita verschluckt, erneuert und schließlich als anderer, als besserer Mensch wiedergeboren.
Als sie aus ihnen auftauchte, verachtete sie sich für die Zweifel, die sie manchmal an Luzie gehegt hatte. Auch das war allein Ophelias Schuld gewesen, sie hatte versucht, sie vor Madita schlechtzumachen, dabei war sie selbst es, die ihren Charakter einmal überdenken sollte. Luzie war nicht schlecht. Sie war gut. Sie war Macht und Wille und Verlangen. Luzie war Leben, und das alles wollte Madita.
»Du hast nach mir gesucht«, durchbrach Madita die aufgeladene Stille, eine Erkenntnis, keine Frage, und sie konnte sich nicht erklären, woher sie plötzlich gekommen war.
Etwas in ihr regte sich, ein erbärmliches Aufbäumen der Vernunft, doch das ergab keinen Sinn, also drängte sie es in die Abgeschiedenheit ihres Unterbewusstseins. Sie ahnte nicht, dass nur ihr Gewissen es jetzt noch vermocht hätte, sie zu retten. Zu retten vor ihrem Platz in der Unterwelt, aufgespießt auf Satans Schoß.
Ob sie etwas anders gemacht hätte, hätte sie es gewusst? Vermutlich nicht. Für Luzie war sie zu allem bereit, würde alles ertragen und über brennende Scherben wandern, wenn sie es verlangte.
Luzie nickte, ein wissendes Lächeln umspielte ihre Lippen, als kannte sie ihre Gedanken, und es zog Maditas Blick an, ihr Schönheitsfleck neben ihrem rechten Mundwinkel betörte sie. Mit ansteigender Nervosität verlagerte Madita ihr Gewicht, Sprungfedern bohrten sich in ihre Hüften, der spitze Schmerz erweckte eine dunkle Erregung in ihr.
»Es geht um deine Freundin. Wir müssen es tun«, wisperte Luzie, näher zu Madita gebeugt, ihre Worte waren nur für sie gedacht. Sie streckte ihre feingliedrigen Finger aus und berührte Maditas nackten Oberschenkel, bewegte ihren Daumen in einer sachten Liebkosung, und ein Brennen brach sich von dieser Stelle Bahn, wurde größer und mächtiger, bis Madita unter einem erstickten Stöhnen langsam nickte. Etwas tobte in ihr, etwas Mächtiges, und sie schwelgte darin bis zur Unerträglichkeit. Sie wusste, was Luzie von ihr verlangte.
Ophelia.
Madita und Ophelia waren zusammen ins Ferienlager gekommen, augenscheinlich als Freundinnen, doch die Wahrheit lag wie so oft viel tiefer vergraben. Erst Luzie hatte ihr die Augen geöffnet, ihr aufgezeigt, dass die scheue und reizlose Ophelia sie mit ihrer sozialphobischen Einfältigkeit bremste, sie im Schatten hielt und ihr das Licht verwehrte.
Damit war es nun vorbei. Madita wollte ins Licht, endlich. Sie beugte sich vor, bis sie Luzies Gesicht nahe war. So nahe, es fehlte nicht viel, bis sich ihre Lippen berührten. Mit einem Lächeln, das den letzten und schlimmsten Verrat an ihrer Freundin Ophelia besiegelte, drang sie tief in Luzies Blick ein und wisperte: »Lass es uns tun.«
***
Mit einem frustrierten Seufzen schlug Buchhändler Matthias Türnagel das Buch zu und legte es mürrisch zur Seite. Er brauchte klug platzierte Pausen beim Lesen, anders war dieses Machwerk kaum zu ertragen. Und Kaffee! Kaffee würde ihn durch das Tal der Trivialliteratur führen, diesen Tiefpunkt eines Subgenres, um das niemand gebeten hatte. Er jedenfalls nicht. Das vereinbarte Interview mit der Autorin versuchte er derweilen auszublenden. Er erwartete nicht, an diesem Punkt des Romans, kurz vor dem Ende nämlich, noch etwas zu finden, das er positiv hervorheben könnte, und ihm war bereits jetzt klar, dass die Autorin alles andere als dankbar für seine Anmerkungen sein würde.
Allerdings, so entschied er, konnten er und die Literaturwelt darauf keine Rücksicht nehmen.
ELENA
Fremdartige Schemen hingen im kahlen Geäst, das Knirschen der Schritte kam verzögert, als wären es nicht ihre, und doch wusste sie, bliebe sie stehen, um die Umgebung zu ergründen, wäre niemand dort. Niemand, der sie verfolgte. Ein suchender Blick, der die blaugraue Dunkelheit abtastete, würde es nur bestätigen: Sie war allein.
Also ließ sie es sein, lief stoisch weiter, seit drei Jahren jeden Morgen die gleiche Strecke. Elena war vertraut mit dem irrtümlichen Gefühl, beobachtet zu werden, nicht ein einziges Mal hatte es sich bestätigt. Und so hatte sie sich gezwungenermaßen daran gewöhnt, hatte ihre unzuverlässige Wahrnehmung als einen unsichtbaren Begleiter angenommen, als zweiten Schatten, dem sie die Beachtung verwehrte.
Die ruhige Elbe zu ihrer Linken, joggte Elena Richtung Südosten, dem Sonnenaufgang entgegen, der noch auf sich warten ließ. Sie war früh dran, trotz der Ferien und der kräftezehrenden Feiertage, die hinter ihr lagen, hatte sie bereits fünf Kilometer auf dem Fahrrad zurückgelegt, von ihrer Wohnung bis zur Jacobs Elbtreppe. Ihre Oberschenkel brannten von der starken Steigung der Strecke und der unbekannten Anzahl an Stufen ihrer drei Auf- und vier Abstiege. Sie hatte schon wieder vergessen, sie zu zählen, ihr Kopf war zu überladen mit der eisernen Selbstgeißelung und den hässlichen Gedankenspiralen. Vielleicht würde sie am nächsten Tag daran denken. Oder an dem darauf.
Die eisige Luft brannte in ihrer Lunge, betäubte die Haut in ihrem Gesicht, nicht aber die vor Kälte triefende Nase. Immerhin ihre Ohren hatte sie unter einer schwarzen Mütze in Sicherheit gebracht. Warmer Schweiß rann ihr den Rücken hinunter, widerlich feucht und klebrig wurde er von dem Bund ihrer Hose aufgesogen. Elena hasste diese Tortur, den Schmerz, die Anstrengung, die zähen Gedanken, die der Sauerstoff in ihrem Kopf freisetzte. Trotzdem zwang sie sich dazu, spürte bereits das Fett an Bauch und Beinen, das sie durch ihre Nachlässigkeit über Weihnachten angesetzt hatte.
Bei ihren Eltern hatte es triefende Gans gegeben, Klöße, Nachspeisen aus Schokolade und Zucker, die drei Tage waren geprägt von selbst gemachtem Gebäck mit Nüssen, Zimt und Krokant, Spekulatius zur steten Verfügung, viel zu viel Wein und Kakao mit Marshmallows. Unausgesprochene Konflikte, wie es sie in jeder Familie gab, und das Wiedersehen mit ihrem Bruder waren zu einem ganz eigenen emotionalen Chaos geworden, das ihre Selbstbeherrschung geschwächt und die Völlerei erst möglich gemacht hatte – ungeachtet der unvermeidbaren Konsequenzen.
Jetzt musste sie leiden, und es geschah ihr ganz recht.
Wolkenschwaden stoben in regelmäßigen Atemstößen zwischen ihren Lippen hervor und trugen ihren Teil zur morgendlichen Nebelwand bei. Die Kiesel am Ufer des Flusses knirschten anders unter ihren Laufschuhen als an wärmeren Tagen, lauter und aufdringlicher und so kalt, wie es war. Bald würde es Frost geben, Elena erwartete Schnee, wie immer gerade rechtzeitig, um dem zurückliegenden unweißen Weihnachtsfest den Mittelfinger zu zeigen.
Einmal mehr bildete Elena sich ein, jemanden hinter sich zu hören, und biss sich auf die Unterlippe, bis sie Blut schmeckte, um sich abzulenken und ihrer Paranoia keinen Raum zu geben. Wenn sie sich jetzt umsähe, käme es einer Niederlage gleich, einem albernen Klischee, also lief sie weiter, ignorierte das Foto, das vor ihrem geistigen Auge aufblitzte, das der Joggerin, das die Medien seit Wochen in Dauerschleife präsentierten.
Die Joggerin, sie war einfach verschwunden, als hätte ein schwarzes Loch sie inhaliert, sie war die achte oder neunte in sieben Jahren, so genau hatte Elena die Berichterstattung nicht verfolgt. Sie verscheuchte das Bild, die Sache betraf sie nicht, Elena entsprach nicht dem offensichtlichen Profil der Frauen, war zu alt, zu brünett und nicht fit genug, für sie bestand keine Gefahr.
»Du siehst nicht älter aus als fünfundzwanzig«, hatte Paul einmal zu ihr gesagt, eine augenscheinliche Lüge, die sie nur aus seinem Mund bereit gewesen war zu glauben.
Bei dem Gedanken an Paul verkrampfte sich Elena, ihre Schritte gerieten aus dem Takt, sie wollte nicht an ihn denken, durfte es nicht, aber es war zu spät, die Selbstermahnung war bereits zu viel, weitere Gedanken kamen, infizierten ihren Verstand.
Seine Stimme, sein Lachen in ihren Ohren …
Elena beschleunigte ihren Lauf, Kieselsteine stoben nach hinten, ihr Rhythmus war längst dahin. Ein vertrauter Druck auf ihrem Brustkorb verlangte nach einem Sprint, ein Wettlauf gegen alles, was sie verfolgte. Also rannte sie, ihre steinernen Muskeln brüllten vor Schmerz, aber sie rannte, versuchte, ihre Ängste und Zweifel und Gefühle hinter sich zu lassen, eine unmögliche Aufgabe, denn sie konnte nicht abhängen, was in unsichtbaren Ketten an ihr hing. Selbst als sie glaubte, blutige Stücke ihrer Lungenflügel könnten aus ihr herausbrechen, trieb sie sich weiter voran, lief quer über eine Hundewiese, um dem sich nähernden Pier 69 auszuweichen, weiter auf dem asphaltierten Elbuferweg, den ausgestorbenen Yachthafen entlang. Stehen zu bleiben würde bedeuten, sich mit den Dingen, die sie hinter sich herschleppte, auseinanderzusetzen. Und deshalb war genau das keine Option, nicht, solange ihr Körper nicht zusammenbrach.
Lindas Schuld, Lindas Schuld,LINDAS SCHULD!, hämmerte ein wütendes Mantra ungewollt in ihrem Schädel, jeder Schritt eine Silbe, ein zorniger Vorwurf, den Elena sich einzureden versuchte, obwohl er nicht der Wahrheit entsprach.
Das musste aufhören!
Sie ließ den Segelclub hinter sich und erreichte das Ende ihrer Strecke. Keuchend kam sie zum Stehen, widerwillig nur, kein langsames Auslaufen, was für den Körper schonender wäre, stattdessen vornübergebeugt, die Hände auf ihre zitternden Oberschenkel gestützt. Ihre Wangen brannten, die eisige Luft schmerzte in ihren Atemwegen, in ihrer Brust, doch es war unmöglich, ihre Gier danach zu kontrollieren. Mit einer Hand zerrte sie sich die Kapuze des Hoodies vom Kopf, ebenso die Mütze darunter, und ließ den Wind ihr erhitztes Gesicht auskühlen. Langsam kam sie zu Atem, Elena spürte die Elbe an ihrer Seite, die ihren in die Ferne gerichteten Blick einforderte.
Ein Containerschiff zog vorbei, keiner dieser Giganten, so hoch wie die Häuser in Mümmelmannsberg, aber dennoch gewaltig. Erste Wellen schlugen am Strand auf, verendeten weitab von ihrer mickrigen Gestalt und waren abgesehen von Elenas Keuchen das einzige Geräusch. Eine seltsame Verlorenheit überkam sie, und sie ahnte, dass sie sich aufzulösen begann, um ein Teil des Nebels zu werden und mit ihm über das Wasser zu schweben. Sie würde verschwunden sein, sobald die Sonne aufging.
Eine tröstliche Vorstellung. Wenn es doch bloß so wäre.
Abgestoßen vertrieb sie die Gedanken. Sie war nicht hier, um sich selbst zu bemitleiden, anscheinend reichten ein paar hundert Meter Sprint nicht aus, um den Schatten zu entkommen. Sie entschied, nicht wie sonst mit dem StadtRAD nach Hause zu fahren, stattdessen würde sie weiterlaufen, um zu sehen, wie weit der Weg sie führte, bis sie alles hinter sich gelassen hatte.
Den Rücken bereits der Straße zugewandt, joggte sie zurück zum Kieselstrand, als Lärm hinter ihr das Geräusch ihrer eigenen Atemzüge übertönte. Quietschende Reifen, ratternder Motor, ihr vor Schreck tobender Herzschlag.
Elena wirbelte herum. Ein silberner Kombi raste wie aus dem Nichts auf sie zu, und, von den Scheinwerfern geblendet, spürte sie, wie ihre Muskeln versagten. Elena starrte dem Fahrzeug entgegen, gefangen in der unumstößlichen Erwartung, der Wagen würde schon noch rechtzeitig abbremsen oder ausweichen. Doch das geschah nicht, das Fahrzeug preschte schnurgerade und mit überhöhter Geschwindigkeit auf sie zu. Das vertraute Konzept von Zeit schien sich für einen Wimpernschlag auszudehnen, und einen Atemzug lang ließ Elena die Vorstellung zu, was geschehen würde, wenn sie sich nicht vom Fleck bewegte. Wenn sie stehen bliebe und es darauf ankommen ließe, dass der Wagen sie erfasste, sie durch die Luft schleuderte, ihr die Beine brach und das Genick.
Die vor Schrecken weit aufgerissenen Augen der Frau hinter der Spieglung der Frontscheibe rissen sie aus der Erstarrung, Elenas Körper reagierte, ehe ihr Verstand eine eigenständige Entscheidung treffen musste, und warf sich zur Seite. Mit einem dumpfen Stöhnen schlug sie auf dem harten Untergrund auf, braungelber Rasen fing ihren Sturz ab, der Aufprall presste ihr die Luft aus der Lunge, sie schlitterte über den Boden, bis sie bäuchlings zum Erliegen kam. Sie hörte einen Knall, splitterndes Glas, doch die Geräusche drangen kaum zu ihr durch, als kämen sie aus weiter Ferne, von irgendwo jenseits dieses Universums.
Ohne zu zögern, rappelte sie sich auf die Beine und entdeckte den Kombi einige Meter weiter kopfüber im leeren Yachthafenbecken, die Räder drehten sich noch, als könnten sie es nicht glauben, dem Asphalt entrissen worden zu sein. Hilflos sah Elena sich um, unschlüssig, doch niemand außer ihr war da. Mit zitternden Fingern zerrte sie ihr Handy aus der Bauchtasche und wählte den Notruf, während sie zu dem verunglückten Wagen rannte, ratterte die relevanten Informationen für den Mann am anderen Ende der Leitung herunter und hörte bereits nicht mehr richtig zu, als er ihr versicherte, ein Krankenwagen würde in wenigen Minuten eintreffen. Mit wild klopfendem Herzen trat sie bis an den Rand des Hafenbeckens.
»Hallo?«, rief sie in angespannter Hoffnung, ein Lebenszeichen aus dem Inneren des Fahrzeugs zu erhalten. Der eisige Wind trug das dünne Stöhnen einer älteren Frau zu ihr, und Elena fluchte leise. Sie musste etwas unternehmen, sie konnte nicht herumstehen und darauf warten, dass jemand kam, um ihr zu helfen. Ohne ihr Vorhaben zu überdenken, ließ Elena sich in das trockene Hafenbecken gleiten.
»Ich bin gleich bei Ihnen, halten Sie durch!«, rief sie außer Atem, ihre Stimme ein seelenloser Laut zwischen den verwitterten Steinwänden. Sie ging in die Knie und krabbelte bis zur Beifahrertür, ihre Knochen protestierten gegen ihr Vorhaben. Ein Blick durch das schmuddelige Seitenfenster bestätigte Elena, was sie bereits befürchtet hatte, und abermals fluchte sie. Im Wagen kauerte eine ältere Frau, angeschnallt hing sie vor dem Lenkrad auf dem Kopf, hochgerutscht bis zum Dach, ihr Hals brachial abgeknickt. Zwei hellblaue Augen blinzelten sie aus einem von Blut überströmten Gesicht flehend an, aus einer Wunde an ihrem Kinn sickerte die heiße Flüssigkeit quer über ihr Gesicht und schien in der Kälte des Tages fast zu dampfen. Elena überlegte nicht, sie handelte. Die Beifahrertür ließ sich leicht öffnen, und auf allen vieren kroch sie in das Fahrzeug.
»Alles ist gut, der Krankenwagen ist gleich da!«, versuchte Elena, die Frau zu beruhigen. Zögerlich streckte sie ihren Arm aus, wusste nicht, wie und ob überhaupt, und legte auf der Suche nach einem Puls ihre Finger auf den faltigen Hals der Verletzten.
Aber sie fand keinen. Elena tastete weiter, er musste irgendwo sein, die Frau war schließlich wach und sah sie an, blinzelte, einen Ausdruck im Gesicht, den sie vor Blut nicht lesen konnte. Sie durfte ihre aufsteigende Panik nicht auf die verletzte Frau übertragen, doch mit jeder Sekunde, in der ihre Fingerspitzen das charakteristische Pochen nicht spürten, wurde deutlicher, dass es nicht an Elenas Unvermögen lag. Es war kein Puls da.
»Es tut …«, ächzte die Frau, und Elena blickte sie erschrocken an. Ein hilfloses Verständnis überkam sie, und sie nickte, um der Sterbenden deutlich zu machen, dass sie ganz bei ihr war. »Ich weiß«, flüsterte sie und strich ihr unbeholfen das graue Haar aus der Stirn. »Sie müssen durchhalten, hören Sie? Nur noch ein paar Minuten, dann ist Hilfe da.« Schwermut erfasste sie, Elena begriff nicht, woher sie kam, oder vielleicht doch, die Frau war zwar eine Fremde, doch dass sie dabei war, während sie starb, den nahenden Tod in ihren stumpfen Augen sah, erschütterte sie tief.
Die Frau schien Elenas Worte nicht zu hören. Mit dem letzten Aufbegehren gegen das Unumgängliche öffnete sie den Mund, ein Röcheln stieg aus ihr empor, und zwischen den rasselnden Versuchen, Luft zu holen, fanden sich neue Worte. »Es … tut … mir … leid …«
Elena schüttelte vehement den Kopf, Tränen stiegen ihr in die Augen. »Machen Sie sich um mich keine Sorgen, mir ist nichts passiert …«
Ihre Stimme knickte ein und gab Raum für das nächste Wort, womöglich das letzte, das sich auf den blutverschmierten Lippen der Frau formte: »Elena.«
Elena blinzelte, begriff erst mit Verzögerung den Grund für ihr eigenes Erstaunen, das jedoch schnell undurchsichtiger Verwirrung wich. Ungläubig starrte sie die sterbende Frau an. Woher kannte sie ihren Namen? Tatsächlich kam es ihr mit einem Mal so vor, als würde sie die Frau kennen.
Eine knochige Hand schob sich in Elenas Blickfeld, sie baumelte leblos neben dem Kopf der Fahrerin, zwischen zwei verkrampften Fingern hielt sie einen gefalteten Zettel, kaum größer als ein geknickter Fünf-Euro-Schein, den sie ihr mit zitternder Dringlichkeit entgegenstreckte.
Verstört beobachtete Elena, wie die Frau das Stück Papier fallen ließ. Es landete zwischen ihren Händen auf dem beigen Bezug des Autodachs, der Blick der Frau bekam kurz einen wilden Ausdruck, wurde zu einer stummen Aufforderung. Elena zauderte, dann hob sie es auf. Zwei Wimpernschläge lang betrachtete sie den unscheinbar wirkenden gefalteten Zettel, der einen übermächtigen Widerwillen in ihr hervorrief. Als Elena das nächste Mal zu der Fahrerin sah, waren ihre Augen geschlossen. Sie hatte aufgehört zu atmen.
***
Sie hatten die Leiche am Boden zugedeckt, nachdem die Bemühungen einer Wiederbelebung erfolglos geblieben waren. Elena saß bei offener Tür in einem der Krankenwagen, sie war untersucht und von der Polizei befragt worden. Eine Rettungsdecke lag um ihre Schultern und knisterte bei jedem Atemzug, eine auditive Erweiterung des Zitterns, das ihren Körper nicht zur Ruhe kommen ließ. Die Sanitäter hatten ihr nahegelegt, mit ihnen ins Krankenhaus zu fahren, ein Knöchel war angeschwollen, zudem befürchteten sie einen Schock. Elena spürte nichts davon, nur Kälte, als wäre sie es, die dort auf Kies und totem Rasen lag. Als wäre sie es, die nicht länger auf ärztliche Behandlung, sondern den Leichenwagen wartete.
Die Sonne war irgendwann in den zurückliegenden Minuten aufgegangen, das diffuse Licht versprach einen schönen Wintertag, doch Elena kam es vor, als wäre sie mit dem Schwinden der Dunkelheit in eine Parallelwelt übergetreten, und alles, was sich im Schatten abgespielt hatte, war dort geblieben. Nur die tote Autofahrerin war mit ins Licht gekommen, vom Tag schonungslos zur Schau gestellt. Elena konnte ihren Blick nicht von dem weißen Tuch nehmen, von der menschlichen Form, die sich darunter abzeichnete. Es flatterte in der leichten Brise, beinahe kokett wie der Saumen eines weiten Kleides.
Noch immer begriff Elena nicht, was geschehen war. Eine Fremde hätte sie beinahe überfahren und war dabei selbst ums Leben gekommen. Dieser Teil lag offen vor ihr, ohne Raum für große Fragen. Unfälle passierten.
Was jedoch an ihrem Verstand nagte, war der unerklärliche Umstand, dass die Frau Elenas Namen gekannt hatte. Sie hatte ihren Namen gesagt, und Elena bedauerte, dass sie die brüchige Stimme der Sterbenden nicht als Einbildung abtun konnte.
Dem Anflug des Erkennens, der bei dem Anblick ihrer wässrigen hellen Augen über sie gekommen war, traute sie hingegen nicht. Genauso gut war es möglich, dass sie bloß geglaubt hatte, ihr bereits begegnet zu sein, weil ihr Name aus dem Mund der Frau es zu verlangen schien.
Mit Eisfingern rieb sie sich über das Gesicht, ihre Hand war schmutzig und stank nach Fäulnis und hörte einfach nicht auf zu zittern. Vielleicht hatte sie wirklich einen Schock.
»Es tut mir leid, Elena.«
Ihr fiel der Zettel wieder ein, das kleine Stück Papier, das sie vor ihr hatte fallen lassen. Abrupt richtete sie sich auf, als hätte ihr jemand einen Stoß zwischen die Rippen gegeben. Über dem Eintreffen der Rettungskräfte, der Leichenbergung und ihrer Untersuchung und Befragung hatte sie nicht mehr daran gedacht. Es steckte in ihrer Bauchtasche, in die sie es hastig geschoben hatte, ohne es sich anzusehen, war hinter ihr Handy gerutscht und verursachte sofort den gleichen Widerwillen. Dennoch holte sie es hervor und faltete es auseinander.
»Kein Unfall.«
Nur zwei Worte, beinahe nichtssagend, und doch mit einer Kraft, die Elena von der Trage zu stoßen drohte. Darunter eine Zahlenreihe. Krakelige Schrift, von alten Fingern geschrieben, zittrig wie Elenas in diesem Moment.
Das ergab keinen Sinn. Sie konnte sich keinen Grund vorstellen, warum diese fremde Frau versucht haben sollte, sie zu überfahren, und Elena dann mit einer Notiz darauf hinwies, dass es Absicht gewesen war.
»Frau Hanisch?«
Erschrocken blickte Elena auf und ließ den Zettel in den Schoß sinken. »Ja?« Sie fühlte sich ertappt, die Nachricht der Fahrerin war ein Beweis, dass hier etwas komplett falsch lief, und doch fiel ihr die Entscheidung, ihn jemandem zu zeigen, ungewöhnlich schwer.
Ein Beamter beugte sich zu ihr in den Krankenwagen, es war der gleiche, der sie bereits befragt hatte, sein Name war Jansen, wenn sie sich richtig erinnerte. Er wirkte freundlich auf sie, ein stämmiger, großer Mann mit blondem Haar und rotwangig von der Kälte. Sicher wäre der Beweis in ihrem Schoß bei ihm gut aufgehoben.
»Ich wollte nur Bescheid sagen, dass wir Sie hier nicht mehr brauchen. Die Sanitäter werden Sie gleich nach Altona ins Krankenhaus fahren. Vielen Dank für Ihre Geduld.«
Nicht dass sie eine Wahl gehabt hätte. »Kein Problem.«
Ihr Blick streifte sein Gesicht, ihre Mundwinkel zuckten in Andeutung eines höflichen Lächelns, der Zettel wog mit jeder Sekunde schwerer in ihrem Schoß. Sie sollte ihn dem Polizisten geben und damit jede Verantwortung von sich schieben. Die Zahlen unter der Nachricht, wahrscheinlich eine Telefonnummer …
»Machen Sie sich keine Vorwürfe, Sie haben alles richtig gemacht«, drängte sich Jansen in ihre Gedankengänge, offensichtlich hatte er ihre in Falten gelegte Stirn falsch gedeutet. Unwillig sah Elena ihn an, sie brauchte mentale Distanz zwischen sich und ihm, Raum für sich. »Es ist nicht Ihre Schuld, dass die Frau gestorben ist«, sprach er mit gesenkter Stimme weiter, Worte der Beschwichtigung, die Elena nicht wollte. »Allem Anschein nach hatte sie am Steuer einen Herzinfarkt, weshalb sie überhaupt erst von der Straße abgekommen ist. Es gibt nichts, was Sie in Ihrer Situation für sie hätten tun können.«
Ein Herzinfarkt. Vielleicht sollte sie Jansen den Zettel zeigen. Ihn nach dem Namen der toten Frau fragen oder danach, woher sie Elenas Namen kannte. Vielleicht sollte sie das wirklich tun.
»Danke«, sagte sie und lächelte schmal. Den Sichtschutz, den sie verstohlen mit ihren Händen über dem kleinen Zettel in ihrem Schoß errichtete, bemerkte er nicht.
***
Am nächsten Tag verzichtete Elena auf ihren Morgenlauf. Sie würde weiter Fett ansetzen, sie spürte es nun auch an Oberarmen und Flanken, aber der verstauchte Knöchel ließ ihr nur wenig Spielraum. Fünf Stunden hatte sie in der Notaufnahme gewartet, war anschließend erschöpft und ohne etwas zu essen, ins Bett gegangen, nur um dort wach zu liegen und stundenlang Gedanken zu wälzen, die sie nur noch mehr ermüdeten. Das blutüberströmte Gesicht der Unfallfahrerin hatte sie heimgesucht, doch es war nicht der Anblick, der ihr den Schlaf geraubt hatte, sondern die aufwühlende Suche nach der Erinnerung, woher die Frau sie gekannt hatte. Denn das hatte sie, daran bestand für Elena nicht länger der geringste Zweifel. Anders konnte es nicht sein. Sie war keine Influencerin, besaß keinen YouTube-Kanal, in den sozialen Medien gab es keine Fotos von ihrem Gesicht. Eine bewusste Entscheidung, die in erster Linie mit ihrer Arbeit zusammenhing und darüber hinaus der Tatsache geschuldet war, dass sie nicht den geringsten Wert darauf legte, auf irgendwelche Klassentreffen eingeladen zu werden.
Sie wollte keine Aufmerksamkeit, und schon gar nicht wollte sie gefunden werden.
Da es somit ausgeschlossen war, dass die Frau sie aus dem Internet kannte, mussten sie sich irgendwann einmal begegnet sein.
Oder hatte ihr jemand ein Foto von Elena gezeigt?
Ihr schwirrte der Kopf, und der leere Magen leistete seinen Beitrag zu dem stärker werdenden Druck in ihren Schläfen, doch obwohl sie in der Küche am Esstisch saß und der vertraute Geruch eines inzwischen erkalteten Kaffees in ihre Nase stieg, bereitete ihr die bloße Vorstellung, ihrem Körper etwas zuzuführen, eine beißende Übelkeit. Es war inzwischen kurz nach zehn, Elena erinnerte sich nicht, wann sie das letzte Mal so spät aufgestanden war. Irgendwann während ihres Studiums vielleicht. Doch statt dass sich Erholung einstellte, quälte sie ein Gefühl von Kontrollverlust, das sich in Form von anschwellender Panik in ihrem Hals bemerkbar machte.
Regelrecht davon abgestoßen betrachtete sie den Zettel der Unfallfahrerin vor sich auf dem Tisch. Die zwei Worte darauf riefen noch dasselbe Unverständnis hervor, doch nun war es die Nummer, die ihre Gedanken einnahm. Sie gehörte zu einem Mobiltelefon in Deutschland, Elena hatte sie bereits in ihr Handy eingegeben, doch das Gerät hatte sie nicht in ihrem Telefonbuch gefunden. Auch in ihrer Anruferliste war sie nicht vorhanden, und nicht einmal Google war sie bekannt.
Die Unwissenheit machte sie wahnsinnig, seit dem Vorfall kreisten ihre Gedanken um nichts anderes. Nervös klopfte sie mit den Fingern auf die Tischplatte, das Geräusch donnerte unnatürlich laut durch ihre wie ausgestorben wirkende Küche. Sie könnte es natürlich tun. Die Nummer anrufen, eingegeben hatte sie sie bereits, sie musste nur den grünen Hörer auf ihrem Display berühren, und das Rätsel wäre gelöst. Doch bislang hatte sie es nicht in Erwägung gezogen, diesen Schritt tatsächlich zu machen. Zuvor wollte sie darauf kommen, wer die Frau war, damit sie zumindest eine vage Vorstellung davon bekam, worauf sie sich gefasst machen musste. Womit sie es zu tun hatte. Elena schnaubte frustriert. Ihr war mittlerweile klar, dass sie mit diesen Kopfschmerzen nicht angemessen denken konnte.
Entgegen ihrer Erwartung kam ihr plötzlich eine andere Möglichkeit in den Sinn. Google kannte zwar nicht die Telefonnummer, aber mit etwas Glück gab es digitale Medienberichte über den Unfall.
Das hübsche Gesicht der verschwundenen jungen Frau dominierte auch online die Berichterstattung, die Presse hatte einen Narren an ihr gefressen und zelebrierte mit reißerischer Sensationslust die unbestätigte Annahme, Hamburg habe es mit einem Serientäter zu tun. Für einen kleinen Unfall blieb da kein Platz, nicht auf den Titelseiten, so etwas passierte jeden Tag.
Mit den Suchbegriffen »Autounfall«, »Blankenese« und »tote Frau« wurde Elena schließlich doch fündig, und ihr Körper verhärtete sich vor Anspannung. Mehrere Nachrichtenportale hatten darüber berichtet, kurze Meldungen zu dem Unfall, kaum mehr als ein paar Zeilen, stichwortartige Informationen ohne Mehrwert.
Elena überflog eine nach der anderen, ihre Augen suchten den Text nach Namen ab. Das Herz schlug ihr bis zum Hals, und ihr brach der kalte Schweiß aus, als sie tatsächlich auf der Homepage einer einschlägigen Tageszeitung etwas entdeckte, das ihr neu war. Ein Schwarz-Weiß-Foto der Unfallstelle mit einer Bildunterschrift, die für einige Augenblicke Atmung und Gedanken lähmte.
In diesem Yachthafenbecken in Blankenese erlag Helga H. (65) einem Herzinfarkt.
Helga H.
H.
»Oh Gott!« Das Handy rutschte aus Elenas feuchten Fingern, schlug dumpf auf dem Tisch auf, der unerwartete Lärm ließ sie zusammenfahren. Schnell presste sie sich beide Hände auf den Mund, damit ihr kein weiterer gequälter Laut entweichen konnte. Sie zwang sich, gleichmäßig zu atmen, doch sie bekam keine Luft, eine ihrer Hände griff nach ihrem Hals, als vermochte sie es, gegen die Enge in ihrer Kehle etwas auszurichten. Ihre Augen begannen zu tränen, und Elena blinzelte, das Gefühl, nicht atmen zu können, weitete sich aus, erreichte ihren Brustkorb und begann dort zu schwelen. Die Lähmung ihrer Gedanken gab den Blick frei auf einen feuerroten Makrokosmos der Abscheulichkeiten.
Sie würgte ein Wimmern hinunter und sprang auf, noch immer bekam sie keine Luft, sie würde sterben, ersticken an ihrem eigenen Entsetzen. Ihr verstauchter Fuß gab nach, ihre Knie folgten ihm, Elena sank zu Boden, kauerte sich zusammen und wartete auf ihren Tod.
Auf das erlösende Ende.
Sie wusste nun, woher sie die Unfallfahrerin kannte.
***
Der Tod kam nicht und ohne ihn auch keine Erlösung. Stattdessen riss das Klingeln an der Haustür Elena aus ihrer Panikattacke. Es war ihr unmöglich, zu sagen, wie viel Zeit vergangen war, sie hatte sich ausgedehnt und wieder zusammengezogen und war zu einem unbestimmbaren Konstrukt geworden. Elena erinnerte sich nur vage, wie mit dem sanften Schaukeln der Selbstregulation eine gewisse Ruhe eingekehrt war, Ruhe im Angesicht eines Sturms, der in ihrem Verstand tobte. Als sie sich mühsam auf die Füße rappelte und zur Haustür humpelte, verachtete sie sich für ihren Zusammenbruch, für ihre jämmerliche Schwäche und würdigte sich keines Blickes, als sie im Flurspiegel ihrer Reflektion begegnete. Stattdessen ließ sie ihre Selbstabscheu gewähren, sie weiter anschwellen und wuchern und schwor sich, niemals wieder die Kontrolle zu verlieren. Nicht über ihren Verstand und erst recht nicht über ihr Leben.
Vor der Tür war niemand, nicht mehr, das Klingeln musste bereits länger zurückliegen. Auf ihrer Fußmatte lag ein Päckchen, bedeckt von einigen Briefen. Sie trug alles in die Küche, zu ihrem Handy, das den Sturz auf den Tisch ohne sichtbare Schäden überlebt hatte.
Misstrauisch betrachtete sie das Päckchen, einen weißen DIN-A5-Luftpolsterumschlag. Sie erwartete nichts, hatte nichts bestellt und nicht die geringste Vorstellung, was sich darin befand. Kein Absender. Sie betastete den Inhalt, ein Buch vielleicht, also riss sie den Umschlag auf und kippte ihn auf den Küchentisch. Stephen King, irgendeine abgewetzte Erstausgabe von »Friedhof der Kuscheltiere«, Elena erinnerte sich dunkel. Sie hatte es auf eBay gekauft, ein Weihnachtsgeschenk für ihren Bruder, das dann aber nicht gekommen war. Sie hatte es als verloren gegangen verbucht, passierte gelegentlich, besonders in der Vorweihnachtszeit, und hatte ihm stattdessen den aktuellen King-Roman besorgt. Mit diesem Exemplar hatte sie nicht mehr gerechnet.
Desinteressiert schob Elena es von sich und ging die Briefe durch. Eine Karte rutschte zwischen den Umschlägen hervor und landete auf ihrem Schoß.
Die eisige Kälte des letzten Morgens kehrte in ihren Körper zurück. Langsam griff sie nach der Postkarte, der Strand auf der Rückseite kam ihr bekannt vor. Verstörend vertraut. Widerstrebend drehte sie die Karte um, betrachtete ihre Anschrift darauf, die Worte auf der linken Seite, in ordentlicher, akkurater Schrift. So schrieb kein normaler Mensch.
Liebe Elena,
ich hoffe, du hast meine Grüße erhalten.
Warst du mal wieder auf Seelvlieth Island?
Ist schön hier. Kinder spielen hier noch draußen.
In Liebe
O. H.
Die Karte sank, Elena hielt sie fest, ließ Ekel und Schmutz ihren Arm emporkriechen und ihren Körper infizieren.
Er hatte sie gefunden.
Sie schmeckte Galle, schluckte sie hinunter. Tränen liefen über ihre Wangen, doch die konnte sie akzeptieren, sie zeugten nicht von Schwäche oder Kontrollverlust, sondern von ihrer Wut. Weil sie wusste, was ihr nun bevorstand und was sie tun musste. Weil er sie dazu zwang, nach all den Jahren, anstatt sie einfach in Ruhe zu lassen. Aber er legte sich mit der Falschen an, und das würde er nun zu spüren bekommen. Nie wieder, so schwor sie sich das zweite Mal an diesem Morgen, die Unterlippe zwischen den Zähnen und Blutgeschmack im Mund, würde sie die Kontrolle verlieren.
Eher wollte sie sterben.
TERESA
Sie spürte die Gefahr wie Dreck an ihren Fersen, sie schwebte über ihrem Kopf, wohin sie auch ging, doch vor ihr wegzulaufen war keine Option. Dies alles geschah aus einem bestimmten Grund.
Das Geräusch schwerer Schuhe folgte Teresa mit einigem Abstand, während sie über den finsteren Parkplatz eilte. Eine einsame, weit entfernte Straßenlaterne brachte gerade genug Licht, um in der Dunkelheit nicht allein auf den Schein des Mondes angewiesen zu sein, der verhangen den Blick abgewandt hatte von dem, was im Begriff war zu passieren. Die harten Bässe des Clubs begleiteten Teresa, doch auch sie ließen sie zunehmend im Stich, je weiter sie sich entfernte. Sie musste sich nicht umdrehen, um zu wissen, dass er hinter ihr war, sie beschleunigte ihre Schritte, dankbar für die Chucks, sie bewahrten sie vor Knöchelbrüchen und Bänderrissen, die sie sich unweigerlich auf hohen Absätzen zugezogen hätte.
Ihre hastigen Atemzüge bildeten Wolken vor ihrem Gesicht, es musste kalt sein, sie fühlte es nicht. In ihrem Inneren brodelte es, Nervosität und Unbehagen trafen auf brennende Furcht und wurden zu einem eruptiven Kochen, als sie den roten Mercedes GLA erreichte. Ihren Wagen. Noch hatte sie die Situation unter Kontrolle, aber es schien nur eine Frage der Zeit, wann ihr die entrissen wurde. Was dann geschehen würde – sie wagte nicht, es sich vorzustellen. Den Schlüssel in der verschwitzten Hand, ließ sie die Zentralverriegelung klicken und riss mit unheilvoller Tachykardie die Tür zur Rückbank auf.
Sie sah sich um, die Muskeln angespannt, zur Flucht bereit, sah ihn näher kommen, die Hände tief in den Taschen seiner Jeans vergraben, die Schultern hochgezogen, einen Ausdruck im Gesicht, den sie bereits kannte und deshalb fürchtete. Konzentrierte Erregung, ein selbstgefälliges Grienen und unter alledem die kaum verborgene Verachtung, weil er sie für eine Schlampe hielt. Seine Verachtung war am gefährlichsten, sie entmenschlichte Teresa und erlaubte ihm alles.
Seinen Namen hatte sie vergessen, war sich nicht sicher, ob sie ihn überhaupt kannte. Sie machte eine antreibende Handbewegung in seine Richtung.
»Komm schon«, zischte sie ihm zu, als er nahe genug war, um sie zu hören, und ließ sich von dem Innenraum ihres Wagens verschlucken. Sie streifte die Chucks von ihren Füßen, zerrte rabiat die Beine aus der blickdichten Strumpfhose, hörte das Material reißen, ein scharfer Laut, der ihre Angst in die Höhe trieb – nicht hoch genug, um ihr Vorhaben abzubrechen. Ohne Umschweife entfernte sie ihren Slip, überging ihren Unwillen und rutschte entblößt über die Rückbank, bis sie mit dem Rücken gegen den Türöffner drückte. Einen Fuß im Fußraum, den anderen auf den schwarzen Ledersitz gestellt, machten ihre gespreizten Beine unter dem hochgerutschten Minirock jede Phantasie überflüssig. Es sah aus wie eine Einladung, aber das war es nicht.
Sein nagerähnliches Gesicht tauchte in der geöffneten Wagentür auf, er gab sich sichtlich Mühe, bei ihrem Anblick nicht zurückzuweichen.
»Du meinst es echt ernst«, keuchte er. Sein Gesicht hatte wirklich etwas von einem Nagetier, einem Biber vielleicht, und einmal bemerkt, konnte Teresa es nicht mehr ungesehen machen. Weit auseinanderstehende Augen, große Nase, schmale Lippen, sein Körper schmächtig, kauerte er in der Öffnung wie zu einem Bau, die Tür im Rücken, und rang mit sich, hin- und hergerissen zwischen der Verachtung für die »dahergelaufene Schlampe«, für die er eindeutig zu gut war, und der einmaligen Gelegenheit, auch mal »zum Stich zu kommen«, angesichts seiner Erfahrung, dass ihm das sonst nie vergönnt war.
Was für ein Dilemma, es kümmerte Teresa nicht, und sie hatte nicht die Geduld, darauf zu warten, dass er sich zu seiner längst getroffenen Entscheidung bekannte.
Sie setzte den zweiten Fuß hinunter, verwehrte ihm den Blick zwischen ihre Beine und verdrehte genervt die Augen. »Dann suche ich mir jemand anderen. Jemanden, der nicht so nett ist wie du.«
Ihre Worte verfehlten nicht ihre Wirkung, er starrte sie an, als hätte sie ihn beleidigt, und in der kranken Welt, in die Teresa ihn zu locken versuchte, war es das auch gewesen. Nett. Ein echter Mann war nicht nett, nicht soft, nicht rücksichtsvoll, und er ließ sich auch keine Gelegenheit entgehen. Ein Satz genügte, und die hässliche Fratze der toxischen Männlichkeit zeigte sich, Bibergesicht war keine Ausnahme. Teresa hatte es darauf angelegt, genau die bei ihm zu triggern, es war absurd, wie leicht es ihr gelungen war, beinahe tat er ihr leid.
Immerhin zögerte er. Teresa stöhnte verärgert auf, klaubte den schwarzen Slip vom Boden ihres Wagens und zog ihn über einen Fuß, die Beine erneut leicht geöffnet, für einen letzten Blick auf das, was er im Begriff war, zu verpassen.
Das wirkte, sein Zögern nur noch Schall und Rauch, kletterte er in den Wagen, die Tür knallte hinter ihm zu, und Teresa zuckte zusammen. Sie war ihm ausgeliefert, ließ es geschehen, als er ihr den Slip vom Knöchel riss und mit brachialer Gewalt ihre Beine auseinanderdrückte, um sich an der Fleischtheke umzusehen.
Sie lehnte sich zurück, den Blick an die Decke gerichtet, das Wasser stand bereits hoch, ihr war nach Weinen zumute. Selbst bei denen, die es ihr schwer machten, war es letztendlich ganz einfach.
Bibergesicht kletterte über sie, beugte sich über ihr Gesicht, feuchte Lippen suchten ihre Haut. Sein Atem stieg ihr in die Nase, er stank bestialisch nach Bier und Zigaretten und kaltem Schweiß, und angeekelt drückte sie ihn an den Schultern von sich.
»Lass das. Kein Küssen, kein Anfassen. Nur wenn du dich an meine Regeln hältst, mache ich, was du willst.«
Sein Mundwinkel hob sich, ihre Ansage machte ihn geil, vermutlich konnte er sein Glück kaum fassen. Er nickte fahrig, setzte sich aufrecht zwischen ihre Beine und hantierte nervös an seiner Jeans. Teresa beobachtete ihn, Bibergesicht wirkte seltsam klein auf dem Rücksitz ihres Mercedes, nur noch vage erinnerte sie sich daran, wie sie im Club auf ihn herabgeblickt hatte, Lichtjahre schien es zurückzuliegen, dabei konnte seitdem nicht mehr als eine halbe Stunde vergangen sein. Sein bloßer Anblick würde es leicht machen, über ihn zu spotten, stattdessen überkam Teresa eine erste Welle von Übelkeit. Blind suchte sie im Fach in der Tür hinter sich nach einem Kondom, fand es und hielt es Bibergesicht entgegen. Ihr Blick fiel auf das Ding in seiner Hand, ein Versehen, hart und bedrohlich ragte es zwischen dem Reißverschluss seiner offenen Hose hervor, und der Unwillen ihres Körpers brüllte verzweifelt nach Gehör.
»Jetzt mach schon«, drängte sie ihn und guckte weg, wollte das alles hinter sich bringen, fixierte die Decke des Wagens, durch das verdunkelte Panoramadach sah sie in die kalte Nacht, während sie im Inneren in einem Alptraum feststeckte, den sie sich selbst antat. Das Quietschen von Latex machte sie benommen, ihr Kreislauf wollte einknicken, also biss sie sich auf die Innenseite ihrer Wange, schmeckte Blut und ließ die Übelkeit geschehen, die sie zu überwältigen drohte. Und über alledem Bibergesichts Ächzen und Schnaufen, er bereitete sich vor, widerwärtiges Schmatzen, sie wollte es nicht wissen und scheiterte bei dem Versuch, die Geräuschkulisse auszublenden.
Ihr blieb nichts anderes übrig, als sich auf ihre Atmung zu konzentrieren, damit sie sich nicht erbrach.
»Du bist so schön.« Er beugte sich über sie, seine Erektion deutete anklagend in ihre Richtung, nannte sie Schlampe und Hure.
»Sei still«, fuhr sie ihn an und versicherte sich mit einem hastigen Blick, dass er das Gummi auch wirklich übergezogen hatte. Sein Penis kam ihr unmenschlich vor, gewaltvoll, und er machte ihr Angst. »Was soll ich tun?«, wisperte sie, ihre Stimme versagte, die Gier in seinen Zügen lähmte sie.
»Bleib so. Ich will dein Gesicht sehen.«
Er drängte sich zwischen ihre Beine, packte sie an der Hüfte und zog sie zu sich, als wäre sie nichts weiter als eine Puppe. Sein harter, zuckender Muskel drückte an ihre Öffnungen, als schiene es ihm egal, in welche er ihn reinstecken konnte. Teresa schloss die Augen und presste die Lippen aufeinander, um nicht in lautes Schluchzen zu verfallen. Bibergesicht stocherte blind weiter, kurz öffnete sie die Augen und sah hin, sein konzentrierter Gesichtsausdruck war unerträglich, also kniff sie sie wieder zusammen und zählte im Geiste die Sekunden, wie lange sie es aushielt.
Bibergesichts zunehmende Frustration machte ihn grob, er verlor die Geduld, bald würde er es mit Gewalt versuchen. Dann ging ein Ruck durch Teresas Körper. Sie riss die Augen auf, ihr Unterleib zuckte zurück, weg von ihm, er sollte ihr nicht zu nahe kommen.
»Ich will das nicht!«, schrie sie ihn an und drückte sich in die hinterste Ecke ihres Autos.
»Was?« Er klang atemlos, fassungslos und rutschte hinter ihr her. An den Füßen versuchte er, sie zurück in eine liegende Position zu ziehen, doch Teresa riss sich von ihm los. »Hör auf!«, brüllte sie ihn an und trat nach ihm.
Bibergesicht hielt inne und starrte sie an, er schwitzte und war von ihrem Ausbruch sichtlich verstört. »Eben wolltest du doch noch.« Er versuchte erneut, sie zu küssen, grapschte nach ihren Handgelenken, um sie festzuhalten, sämtliche Regeln schienen mit ihrer Zurückweisung bedeutungslos geworden zu sein.
Mit Ellenbögen und Füßen stieß sie ihn von sich. »Jetzt will ich aber nicht mehr.« Ihre Bewegungen zerfaserten, unkontrolliert suchte sie nach dem Griff in ihrem Rücken, bekam ihn zu fassen und öffnete die Wagentür. Kalte Luft empfing sie, beinahe stürzte Teresa rückwärts in ihre Arme, doch sie fing sich, half sich selbst aus dem Auto auf die Beine und strich zitternd ihren Rock glatt. Harte Bässe aus weiter Ferne schlugen über ihrem Kopf zusammen.
Bibergesicht war nach vorne gefallen und glotzte sie entgeistert an. »Das kannst du nicht machen!«, protestierte er und rappelte sich gedemütigt auf.
»Verschwinde aus meinem Wagen, sonst rufe ich um Hilfe!«, schrie sie ihn an, um seiner auflodernden Wut keinen Raum zu geben. Sie spannte ihre Muskeln an und machte sich bereit, jederzeit die Flucht zu ergreifen, wenn ihr keine andere Wahl blieb. Mit überlaufenden Augen sah sie ihm dabei zu, wie er aus ihrem Wagen kroch, darum bemüht, seine noch halb vorhandene Erektion zu verbergen. Teresa war sich des einsamen Parkplatzes bewusst, es war noch nicht vorbei, doch die Kälte und der offen zugängliche Ort schienen ihn abzuschrecken, und hastig begann er, seinen Schwanz zurück in die Hose zu zwängen.
Er trat einen Schritt auf sie zu, beinahe rechnete sie damit, dass er ihr eine Faust ins Gesicht rammte, und sie sprang zurück. Bevor er etwas sagen konnte, traf sie eine Entscheidung, rannte um den Wagen zur Fahrertür, während ihr der Asphalt die Haut von den nackten Sohlen raspelte, riss sie auf und sprang hinters Lenkrad.
»Such dir einen Psychiater, du hast sie ja nicht mehr alle!«, rief Bibergesicht ihr hinterher. Teresa glaubte zu sehen, dass er erneut versuchte, auf die Rückbank zu klettern, und trat aufs Gaspedal.
Seine letzten Worte begleiteten sie auf ihrem Weg nach Hause. Sie konnte nicht behaupten, dass er damit falschlag. Was sie tat, war nicht normal.
Dreiundzwanzig Sekunden waren es gewesen, bevor sie schon wieder gekniffen hatte.
***
Mit den Schuhen in der Hand kehrte sie in die Wohnung zurück, das offene Wohnzimmer empfing sie dunkel und leer. Geräuschlos huschte sie am Schlafzimmer vorbei, ohne Umwege ins Bad, darin hatte sie Übung. Sie schloss hinter sich zu, drehte auch den Schlüssel in der zweiten Tür um und hastete zur Toilette. Mit dem Kopf über der Schüssel steckte sie sich den Finger tief in den Rachen, die schlimmste Übelkeit war bereits vergangen, aber sie musste diesen Ekel loswerden, der sich in ihren Eingeweiden festgesetzt hatte. Doch ihr Magen gab nichts her, das selbst herbeigeführte Würgen brachte nichts als Speichelfäden und lautlose Tränen.
Benebelt streifte sie die verbliebenen Klamotten ab und stellte sich unter die Dusche, heißes oder kaltes Wasser, es machte keinen Unterschied. Sie blieb lange dort, regungslos, die Abscheu ließ sich nicht abwaschen, das war ihr noch nie gelungen. Es waren Momente wie diese, in denen sie mit schmerzhafter Klarheit erkannte, dass der Ekel längst zu einem Teil ihrer Persönlichkeit geworden war.
Irgendwann drehte sie schließlich das Wasser aus, trat erschöpft aus der beengenden Kabine und zog ihre Schlafsachen an, die sie schon am Abend bereitgelegt hatte. Die Klamotten der Nacht begrub sie tief im Wäschekorb, wie sie es am liebsten auch mit den Erinnerungen gemacht hätte, doch das gestattete sie sich nicht. Ein Handtuch um ihr nasses Haar gewickelt, drehte sie leise in beiden Türen die Schlüssel um und löschte das Licht im Badezimmer. Auf Zehenspitzen und zitternd schlich sie zum Bett, legte sich neben Gero, seine Atmung verriet den Tiefschlaf. Sie verkroch sich unter der Decke und drehte ihrem Freund den Rücken zu, die Lippen fest aufeinandergepresst. Ihr Körper brannte, und Teresa schloss die Augen, ließ die Bilder kommen, die sie in dieser Nacht und in vielen anderen davor provoziert hatte.
Licht blendete. Teresa drehte sich auf den Bauch, weg von der Helligkeit, ihr Gesicht vergraben unter einem Kissen. Schranktür, Schritte, dann wieder Stille. Sie ließ sich zurück in die Dunkelheit fallen. Das Plätschern der Dusche.
»War gestern wieder spät, oder?« Geros Stimme aus dem Nichts, ein als Interesse getarnter Vorwurf.
»Kann sein«, nuschelte sie ins Laken, nicht bereit, ihren Schlaf aufzugeben.
»Warum hast du mitten in der Nacht noch geduscht?«
Seine Frage rüttelte sie wach, die Erinnerung kehrte zurück, das schlechte Gewissen, die Schuld, ihre Selbstverachtung.
»Ich habe gestunken«, murmelte sie verschlafen, rührte sich nicht, täuschte vor, noch genauso weggedöst zu sein wie vor fünf Sekunden. Doch ihr Puls raste, das Blut rauschte in ihren Ohren und dämpfte alle anderen Geräusche.
»Du hast mich geweckt.« Ein offener Vorwurf, immerhin machte er ihr nicht länger etwas vor.
»Tut mir leid.« Sie bewegte sich nicht, ihre Muskeln waren zu Stein geworden.
»Du weißt, dass ich früh rausmuss.«
»Tut mir leid«, wiederholte sie, ehrlich bemüht, reumütig zu klingen, doch trotz ihrer eigenen Schuld überrollte sie eine Welle der Wut.
»In ein paar Tagen ist Silvester, ich muss noch so viel vorbereiten, und der Großmarkt –«
Teresa hielt es nicht länger aus. »Ich habe gesagt, dass es mir leidtut. Es wird nicht wieder vorkommen, okay?« Sie setzte sich auf und kniff sich in den nackten Oberschenkel, um ihre über Jahre angestauten Aggressionen unter Kontrolle zu behalten.
Gero stand vor dem großen Bett und sah auf sie herab, diesen Ausdruck von arroganter Strenge im Gesicht, als hätte er es mit einem unartigen Kind zu tun. »Du könntest mir ja auch helfen.«
Sie atmete tief durch. »Ich habe Urlaub«, erinnerte sie ihn geduldig, obwohl sie ihn am liebsten angeschrien hätte.
Er griff nach dem schwarzen Gürtel auf der Anrichte und vervollständigte seine geordnete Erscheinung, indem er ihn mit falscher Gelassenheit durch die Laschen seiner Jeans zog. »Ja, richtig. Du hast Urlaub. Ich aber nicht. Genau genommen habe ich nie Urlaub, und schon gar nicht zwischen den Feiertagen, wenn das Chaos von allen Seiten kommt. Es ist so typisch, dass du ausgerechnet in dieser Zeit deinen Urlaub nimmst.«
Er schloss den Gürtel, und bei dem Klirren der Schnalle kam die letzte Nacht in ihrem gesamten hässlichen Ausmaß zu ihr zurück. Bibergesicht. Sein Körpergeruch, ungepflegt und Übelkeit erregend, der Ausdruck in seinem Blick, als er wie ein Stümper versucht hatte, sich in sie zu schieben … Teresa griff sich an die Stirn, als könnten ihre Hände vor den Augen die Bilder in ihrem Kopf vertreiben. Strähnen hingen vor ihrem Gesicht, und aufgewühlt strich sie sie zurück. Ihre Haare waren im Schlaf getrocknet und fühlten sich wirr und struppig zwischen ihren Fingern an.
Gero musterte sie ungeduldig, die Hände in die Hüften gestemmt, schien er ernsthaft eine Erwiderung auf seinen Vorwurf zu erwarten.
Teresa wappnete sich, einen gewissen Anteil ihrer Gedanken für sich behalten zu müssen. Jetzt eine Grundsatzdiskussion vom Zaun zu brechen brächte sie selbst nur unnötig in Bedrängnis. »Ich mache die Buchhaltung in deinem …« scheiß »… Restaurant, du hast genug andere Angestellte, die dir an den …« scheiß »… Feiertagen helfen. Dafür sind sie da.«
Gero schnaubte. »Du bist meine Partnerin, und wenn du mich nicht unterstützt, geht sofort wieder das Getratsche los.«
Teresa war es leid, in das Märchen seiner vorbildlichen Beziehung hineingezogen zu werden, in dem ihre Rolle als seine Partnerin nicht beinhaltete, dass sie eine eigenständige Person war. Alle wussten, dass es eine Farce war, die Fassade lag längst eingestürzt zu ihren Füßen, nur Gero weigerte sich, es zu sehen.
Wut trieb sie aus dem Bett, sie musste sich schleunigst der Situation entziehen, bevor sie eskalieren konnte. »Dann sag ihnen«, begann sie abschließend, während sie das Schlafzimmer durchquerte und zur Tür ging, »dass deine Partnerin ganz normalen Urlaub hat, der ihr zusteht, wie allen deinen Angestellten und –«
Gero packte sie am Arm, nicht fest, aber entschieden, als sie versuchte, an ihm vorbei ins Badezimmer zu verschwinden, und brachte sie damit zum Schweigen. »Warum hast du dich letzte Nacht im Badezimmer eingeschlossen?«
Teresa blinzelte. Er stand ihr gegenüber, sie musste zu ihm aufsehen, was ihr keine Möglichkeit gab, seinem prüfenden Blick zu entkommen. »Was?« Ihre Stimme war brüchig, schuldbewusst, sie merkte es selbst.
Er ließ ihren Arm los. »Du schließt sonst nie ab. Ich dachte eigentlich, wir hätten keine Geheimnisse voreinander.«
Alles in Teresa bäumte sich gegen diesen Mann auf, und abwehrend verschränkte sie ihre Arme vor der Brust. »Was willst du von mir hören?« Sie wusste nicht, warum sie die Türen abgeschlossen hatte, hatte es einfach getan, ohne darüber nachzudenken, vielleicht aus einer Art Selbstschutz heraus, um die Welt auszuschließen.
»Betrügst du mich?« Die Direktheit seiner als Frage formulierten Anschuldigung schockierte sie, dabei schien er nicht einmal wütend zu sein, sondern nur interessiert.
Sie wankte zurück, fühlte sich ertappt, obwohl sie nichts getan hatte und dann wieder doch. »Natürlich nicht«, zischte sie ihn entrüstet an, dabei war sie sich selbst nicht darüber im Klaren, was sie mit diesen Männern in ihrem Auto tat und wie sie sich Gero gegenüber deswegen fühlte.
»Warum hast du dann abgeschlossen?«
Teresa schnaubte genervt. »Herrgott noch mal, Gero! Keine Ahnung, warum ich abgeschlossen habe.« Um alleine zu sein, in Sicherheit, damit die Schuld und Schande, die an mir klebt, von dir ungesehen bleibt. »Ich war ein bisschen betrunken und etwas schusselig. Wenn ich geahnt hätte, dass du deshalb so einen Aufstand machst, hätte ich die Türen natürlich sperrangelweit offen gelassen.«
Trotz aller Unsicherheit wusste Teresa, dass es falsch war, was sie tat, wenn sie nachts alleine unterwegs war. Sie hatte versucht, die Wahrheit unter Selbsttäuschung zu vergraben, doch das war nicht genug. Sie musste mit ihren Taten leben, nichts davon konnte sie rückgängig machen, aber während Gero sie wegen abgeschlossener Badezimmertüren zur Rede stellte, erkannte sie, dass sie zumindest ihm gegenüber keine Schuldgefühle empfand. Alles in ihrem Dasein drehte sich um Gero, er war untrennbar mit ihrem Leben verflochten, hatte Einblick in ihre Arbeit, in ihr Privatleben, in alles. Für jeden Abend ohne ihn musste sie um Erlaubnis bitten, ihre Individualität Tag für Tag erkämpfen. Dieser emotionale Käfig gab kein schlechtes Gewissen ihm gegenüber mehr her.
»Du musst deswegen nicht gleich zynisch werden«, sagte er. Seine Kiefermuskeln mahlten, er schien noch einen Kommentar hinterherschieben zu wollen, überlegte es sich anders und verließ das Schlafzimmer.
Frustriert legte sich Teresa zurück ins Bett und zog sich die Decke über den Kopf. Aus dem Flur hörte sie, wie Gero an der Garderobe seine Arbeitsschuhe anzog.
»Ich muss jetzt ins Restaurant«, rief er quer durch die Wohnung. »Ach, und räum wenigstens die Küche auf, wenn du schon den ganzen Tag zu Hause faulenzt.«
Bevor sie die Gelegenheit bekam, ihm etwas Unflätiges hinterherzurufen, fiel die Haustür ins Schloss und ließ sie mit ihrer schwelenden Wut alleine.
Das Fass war voll, Teresa hielt es nicht einen Tag länger mit ihm aus. Ihr Entschluss war gefasst, sie würde Gero verlassen.
***
Natürlich würde sie Gero nicht verlassen. Teresa hasste ihr Leben mit ihm, alles daran, aber es war unmöglich, sich von ihm zu trennen. Obwohl genau das die einzig vernünftige Konsequenz zu sein schien, die Lösung für all ihre Schwierigkeiten, ging das Konstrukt ihrer Beziehung zu tief und machte eine Trennung eben nicht zur Lösung, sondern zum Problem. Teresa hatte sich in den acht Jahren ihrer Beziehung Schritt für Schritt in völlige Abhängigkeit begeben. Erst die Wohnung, dann ihre Arbeit und damit ihre gesamte finanzielle Situation. Anfangs war es noch verlockend gewesen, sich diesem Mann mit ihrem ganzen Dasein auszuliefern, ein Trugbild von Sicherheit – bis es das irgendwann nicht mehr gewesen war. Sicherheit, so hatte Teresa in den Jahren ihrer Weiterentwicklung erkannt, gab es nicht und war lediglich ein anderes Wort für Gefängnis.
Das alles war schleichend geschehen, die Unzufriedenheit im Stillen gewachsen und hatte ihre Bindung zu einer Dreiecksbeziehung gemacht. Teresa hatte irgendwann gespürt, dass sich etwas zwischen ihr und Gero nicht mehr richtig anfühlte, hatte jeden Tag ein bisschen mehr die Augen geöffnet, obwohl sie nicht hinsehen wollte, bis sie schließlich eine unsichtbare Grenze überschritten hatte und die im Verborgenen errichteten Gitterstäbe aus der Unsichtbarkeit verschwunden waren.
Und da war sie nun. Sie konnte nicht weg, war nicht in der Lage, von vorn anzufangen, ein neues Leben wie vielleicht mit Mitte zwanzig, als sie noch eine eigene Wohnung gehabt und Geld verdient hatte, das nicht ihm gehörte.
Gero. Sie hatte ihn mal geliebt, aber jetzt verachtete sie ihn – beinahe so sehr wie sich selbst.
Obwohl die Müdigkeit mit schweren Gewichten an ihren Lidern hing, hatte Teresa nicht zurück in den Schlaf gefunden. Leise vor sich hin grummelnd, beseitigte sie das Chaos in der Küche, das er veranstaltet hatte. Beim Kochen, so hätte sie gemeint, wäre das Aufräumen ein Teil der Tätigkeit, aber beides machte er in seinem Restaurant »Traumhöhle« schon lange nicht mehr. Er war grundsätzlich ein guter Koch, die Gerichte auf der Karte waren ausnahmslos seine eigenen Rezepte, doch er hatte sich entschieden, nur noch Chef zu sein – und das beherrschte er – menschlich betrachtet – nicht ansatzweise so gut. Wirtschaftlich war es seinem ungebremsten Ehrgeiz geschuldet, dass sein Restaurant dank Lieferservice die Coronapandemie nicht nur überlebt, sondern schwarze Zahlen geschrieben hatte, und Teresa musste das wissen, immerhin kümmerte sie sich um die Buchhaltung.
Das unerwartete Klingeln an der Tür riss sie aus ihrer Arbeit, genervt stellte sie den Topf zur Seite, den sie im Begriff gewesen war, in die Geschirrspülmaschine zu räumen, und ging zur Haustür. Durch den Spion erkannte sie eine Gestalt, die mit abgewandtem Gesicht vor ihrer Tür stand und ungeduldig von einem Fuß auf den anderen trat. Nicht zu übersehen war dabei der gewaltige Blumenstrauß, den sie vor sich in der Hand hielt. Erst auf den zweiten Blick fiel Teresa die blaue Wintermütze mit dem Aufdruck irgendeines Kuriers auf.
Irritiert zog sie die Stirn kraus, und schnell blickte sie an sich herunter. Barfuß, schlabbrige Jogginghose und ein altes Karohemd, so konnte man schon mal die Tür öffnen – besonders dann, wenn die Neugier größer war als das Schamgefühl.
»Teresa Weissenbach?«
Sie nickte, und der Lieferant drückte ihr einen üppigen Strauß roter Rosen und ein kleines, in Zeitungspapier verpacktes Päckchen in die Hände. Dann eilte er davon, ohne ihren verdatterten Dank abzuwarten.
Da Teresa keine Vase fand, stellte sie die Rosen in einen Bierhumpen auf den Wohnzimmertisch, setzte sich davor auf die Couch und betrachtete ihn mit misstrauischem Abstand. Es waren elf, die samtigen Blütenblätter der langstieligen Rosen wirkten wie in Blut getaucht, eine kleine Karte war mit Draht zwischen den Dornen befestigt.
»Für Teresa«.
Geros Handschrift. Er kaufte ihr nie Blumen, und ihr Streit am Morgen war längst nicht so dramatisch gewesen wie andere in der Vergangenheit. Teresa nahm eines der dunkelroten Blütenblätter zwischen ihre Finger, es fühlte sich weich und gleichzeitig kraftvoll an, und argwöhnisch zog sie ihre Hand zurück. Gero würde nicht über seinen Schatten springen und einen Fehler eingestehen.
Oder doch?
Auch das Päckchen hatte sie auf dem Tisch abgelegt, das Gesicht der zuletzt verschwundenen Frau war zur Hälfte darauf zu sehen, der Rest von ihr zur Seite geknickt und mit Tesafilm verklebt, eine geschmacklose Wahl, um eine Überraschung zu verpacken. Denn das musste es sein. Teresa hasste Überraschungen, selten brachten sie etwas hervor, was wirklich Grund zur Freude war, weshalb sie den flachen Karton betrachtete, als könnte er jeden Augenblick in die Luft fliegen.