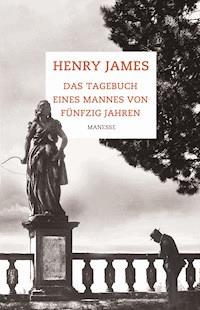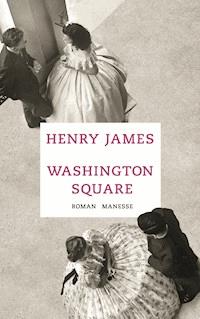
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Manesse
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Er liebt sie, er liebt sie nicht, er liebt sie, er liebt sie nicht … Selten waren Herzensangelegenheiten undurchsichtiger als in diesem Roman. «Washington Square», eines von James’ bekanntesten und beliebtesten Werken, offenbart dessen Meisterschaft in der Analyse menschlicher Abgründe. Die vorliegende Neuübersetzung erschließt die komplexe, anspielungsreiche Sprachwelt des Autors und ermöglicht endlich auch im Deutschen höchsten Lesegenuss.
Catherine Sloper ist ein schüchternes, in jeder Hinsicht blasses Mädchen – und eine der besten Partien New Yorks. Als ihr der attraktive Abenteurer Morris Townsend den Hof macht, geht sie bereitwillig auf sein Werben ein. Doch Catherines Vater, zugleich der Verwalter ihres Vermögens, vermutet in Townsend einen Mitgiftjäger und will eine Heirat um jeden Preis verhindern. Hin- und hergerissen zwischen kindlichem Pflichtgefühl und dem Wunsch nach Selbstbehauptung, ringt Catherine um eine Entscheidung. Hin- und hergerissen ist auch der Leser, denn über die wahren Motive aller Beteiligten – des verarmten Bräutigams in spe, der ebenso naiven wie geschmeichelten Braut, des in seiner Autorität verletzten Brautvaters, der sein Vermögen einst selbst durch Heirat erworben hatte – lässt uns Henry James bewusst im Unklaren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 347
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
HENRY JAMES
Washington Square
Roman
Aus dem Englischen übersetzt und mit einem Nachwort von Bettina Blumenberg
MANESSE VERLAG
ZÜRICH
1
In der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts, genauer gesagt, gegen Ende dieser Zeitspanne, praktizierte in der Stadt New York höchst erfolgreich ein Arzt, der sich wohl in besonderem Maße jener Anerkennung erfreute, die in den Vereinigten Staaten schon immer herausragenden Mitgliedern der medizinischen Zunft entgegengebracht wurde. Dieser Berufsstand war in Amerika stets in Ehren gehalten worden und hatte sich erfolgreicher als anderswo den Anspruch auf die Bezeichnung «liberal» erworben. In einem Land, in dem man entweder seinen Lebensunterhalt verdienen muss, um eine Rolle in der Gesellschaft zu spielen, oder zumindest glauben machen sollte, dass man ihn verdiene, erwies sich die Heilkunst offenbar als besonders geeignet, zwei bewährte Quellen zum Erwerb von Ansehen in sich zu vereinigen. Zum einen gehört sie dem Bereich des Praktischen an, was in den Vereinigten Staaten eine wichtige Empfehlung darstellt, zum anderen wird sie vom Licht der Wissenschaft erleuchtet, ein Vorzug, den man in einer Gesellschaft zu schätzen weiß, in der die Umstände zur Befriedigung der Wissbegierde nicht immer günstig waren und es an der notwendigen Muße fehlte. Zu Dr. Slopers gutem Ruf trug wesentlich bei, dass sein Fachwissen und seine Kunstfertigkeit sich sehr genau die Waage hielten. Zu Recht könnte man ihn einen gelehrten Arzt nennen, doch bestanden seine Verordnungen keineswegs aus abstrakten Begriffen – vielmehr verschrieb er immer irgendein Mittel zum Einnehmen. Obwohl man ihn als äußerst gewissenhaft empfand, waren seine Diagnosen nicht auf befremdliche Weise theoretisch, und wenn er auch manchmal Zusammenhänge ausführlicher darlegte, als es für den Patienten hilfreich schien, ging er doch nie so weit (wie man es von manchen praktischen Ärzten schon gehört hat), sich auf die Erklärung allein zu verlassen, sondern stellte immer eine wenn auch schwer zu ergründende Verschreibung aus. Es gab etliche Ärzte, die das Rezept ohne jegliche Erklärung ausfertigten; aber auch zu dieser Kategorie, die letztlich die meistverbreitete war, gehörte er nicht. Man wird sehen, dass ich einen klugen Mann beschreibe; und darin liegt der eigentliche Grund, warum Dr. Sloper eine stadtbekannte Persönlichkeit wurde. Zu der Zeit, da wir uns hauptsächlich mit ihm befassen, war er etwa fünfzig Jahre alt, und seine Popularität hatte ihren Höhepunkt erreicht. Er war sehr geistreich und galt in der besten Gesellschaft New Yorks als ein Mann von Welt – was er unbestreitbar in hinreichendem Maße war. Um möglichen Missverständnissen vorzubeugen, beeile ich mich hinzuzufügen, dass er nichts von einem Scharlatan an sich hatte. Er war ein zutiefst ehrenhafter Mann – in einem Grade ehrenhaft, dass ihm vielleicht nur die Gelegenheit gefehlt hat, dies in seinem ganzen Ausmaß zeigen zu können. Sieht man einmal ab von dem großen Wohlwollen seines Patientenkreises, der sich allzu gern damit brüstete, über den «brillantesten» Arzt des Landes zu verfügen, rechtfertigte er täglich seinen Anspruch auf jene Fähigkeiten, die ihm von Volkes Stimme zuerkannt wurden. Er war ein genauer Beobachter, ja ein Philosoph, und zu brillieren entsprach so sehr seiner Natur und fiel ihm (wie Volkes Stimme sagte) so leicht, dass er nie auf den bloßen Effekt aus war und keine jener kleinen Tricks und Überheblichkeiten von Leuten mit zweitklassigem Ruf nötig hatte. Zugegebenermaßen hatte das Schicksal ihn begünstigt, der Weg zum Wohlstand hatte sich für ihn als leicht gangbar erwiesen. Im Alter von siebenundzwanzig Jahren hatte er geheiratet, eine Liebesheirat mit einem bezaubernden jungen Mädchen, Miss Catherine Harrington aus New York, die ihm zusätzlich zu ihren Reizen auch noch eine beachtliche Mitgift eingebracht hatte. Mrs. Sloper war liebenswürdig, charmant, kultiviert, elegant, und im Jahr 1820 war sie eines der hübschen jungen Mädchen der kleinen, aber aufstrebenden Landeshauptstadt, deren Häuser sich um den Battery Park1 drängten und die Bay überblickten und deren oberste Grenze von den grasbewachsenen Rändern der Canal Street gebildet wurde. Bereits im Alter von siebenundzwanzig Jahren hatte sich Austin Sloper einen so guten Ruf erworben, dass es nicht als gesellschaftlich unpassend angesehen wurde, als er von einer vornehmen jungen Dame, die über ein Einkommen von zehntausend Dollar und die bezauberndsten Augen von ganz Manhattan verfügte, unter einem Dutzend Bewerbern ausgewählt wurde. Diese Augen und weiteres schmückendes Beiwerk bildeten für den jungen Arzt, der ein hingebungsvoller und sehr glücklicher Ehemann war, etwa fünf Jahre lang eine Quelle höchster Zufriedenheit. Die Tatsache, dass er eine reiche Frau geheiratet hatte, beeinflusste den Lebensweg, den er für sich vorgezeichnet hatte, in keiner Weise, und er übte seinen Beruf mit derselben Zielstrebigkeit aus, als verfügte er auch weiterhin über keine anderen Geldmittel als die aus seinem Anteil an dem bescheidenen Erbe, das ihm mit seinen Brüdern und Schwestern bei seines Vaters Tod zugekommen war. Es war nicht sein vorrangiges Ziel gewesen, Geld zu verdienen, sondern vielmehr, etwas zu lernen und etwas zu leisten. Etwas Interessantes zu lernen und etwas Nützliches zu tun – das war, grob gesagt, der Plan, den er für sich entworfen hatte und dessen Gültigkeit in keiner Hinsicht modifiziert werden musste, nur weil seine Frau zufällig über ein Einkommen verfügte. Er hatte Freude an seiner Praxis und liebte es, ein fachliches Können unter Beweis zu stellen, dessen Besonderheit er sich sehr wohl bewusst war; es lag so offenkundig auf der Hand, dass es nichts anderes gab, wäre er nicht Arzt geworden, was er hätte werden können, dass er durch und durch Arzt blieb, und zwar unter den bestmöglichen Bedingungen. Natürlich ersparte ihm seine angenehme häusliche Situation eine Menge Plackerei, und die Verquickung seiner Frau mit der «besten Gesellschaft» führte ihm in reicher Zahl solche Patienten zu, deren Symptome zwar nicht zwangsläufig interessanter sind als die der unteren Schichten, doch zumindest regelmäßiger auftreten. Er wollte Erfahrungen sammeln, und im Laufe von zwanzig Jahren gelang ihm dies in großem Umfang. Es muss hinzugefügt werden, dass sie auch in solcher Gestalt auf ihn zukamen, die man, wie groß auch immer ihr Wert an sich gewesen sein mag, als das Gegenteil von willkommen bezeichnen darf. Sein erstes Kind, ein außerordentlich vielversprechender kleiner Junge, wie der Arzt fest glaubte, der sich nicht leicht zur Begeisterung hinreißen ließ, starb im Alter von drei Jahren, trotz aller Bemühungen, die die Mutter an Zärtlichkeit und der Vater an Fachwissen aufzubringen versuchten, um ihn zu retten. Zwei Jahre später brachte Mrs. Sloper ein zweites Kind zur Welt, einen Säugling, dessen Geschlecht das arme Kind, nach Ansicht von Dr. Sloper, zu einem ungeeigneten Ersatz für seinen beklagten Erstgeborenen machte, jenen Sohn, den er zu einem bewundernswerten Mann hatte heranziehen wollen. Das kleine Mädchen war eine Enttäuschung; aber das war nicht das Schlimmste. Eine Woche nach ihrer Geburt zeigten sich bei der jungen Mutter, die, wie man so sagt, auf einem guten Weg war, plötzlich beunruhigende Symptome, und noch vor Ablauf einer weiteren Woche war Austin Sloper Witwer.
Für einen Mann, dessen Beruf es war, andere Menschen am Leben zu erhalten, hatte er sicherlich in seiner eigenen Familie nichts Großes geleistet; und ein brillanter Arzt, der innerhalb von drei Jahren seine Frau und seinen kleinen Sohn verliert, sollte vielleicht darauf gefasst sein, entweder seine Fähigkeiten oder seine Zuneigung in Frage gestellt zu sehen. Doch unser Freund entkam jeglicher Kritik: Das heißt, er entkam aller Kritik außer seiner eigenen, welche bei Weitem die sachkundigste, aber auch die schonungsloseste war. Bis ans Ende seiner Tage lastete das Gewicht dieses sehr privaten Urteils auf ihm, und er trug für immer die Narben einer Züchtigung, die ihm die stärkste ihm bekannte Hand in jener Nacht, die auf den Tod seiner Frau folgte, beigebracht hatte. Die Welt, die ihn, wie ich schon sagte, hochschätzte, bemitleidete ihn zu sehr, als dass sie hätte spotten mögen; sein Unglück machte ihn nur noch interessanter, verhalf ihm sogar dazu, zum Gesprächsthema zu werden. Es wurde bemerkt, dass selbst Arztfamilien den besonders heimtückischen Krankheiten nicht entrinnen können und dass Dr. Sloper schließlich auch noch andere Patienten außer den zwei von mir erwähnten verloren hatte; das stellte einen ehrenwerten Präzedenzfall dar. Seine kleine Tochter blieb ihm, und obwohl sie nicht das war, was er sich gewünscht hatte, nahm er sich vor, das Beste aus ihr zu machen. Er verfügte über einen Vorrat an unverbrauchter Autorität, von dem das Kind in seinen frühen Jahren reichlich mitbekam. Es war, das versteht sich von selbst, nach seiner armen Mutter benannt worden, und sogar in ihrem frühesten Säuglingsalter nannte der Arzt sie nie anders als Catherine. Sie wuchs zu einem sehr robusten und gesunden Kind heran, und wenn ihr Vater sie so ansah, sagte er sich oft, dass er bei ihrer Konstitution wenigstens nicht fürchten müsse, sie zu verlieren. Ich sage «bei ihrer Konstitution», weil, um bei der Wahrheit zu bleiben … doch das ist eine Wahrheit, auf die ich lieber später zurückkommen möchte.
2
Als das Kind etwa zehn Jahre alt war, lud er seine Schwester, Mrs. Penniman, zu sich ein, und bat sie, bei ihm zu wohnen. Es hatte nur zwei Miss Sloper gegeben, und beide hatten früh geheiratet. Die jüngere namens Mrs. Almond war die Frau eines wohlhabenden Kaufmanns und Mutter einer blühenden Kinderschar. Auch sie selbst sah blühend aus, und sie war eine anmutige, sorgenfreie, verständige Frau, die bei ihrem gescheiten Bruder in besonderer Gunst stand, denn dieser war in Bezug auf Frauen, selbst wenn sie nahe mit ihm verwandt waren, ein Mann von ausgeprägten Vorlieben. Er zog Mrs. Almond seiner Schwester Lavinia vor, die einen armen Geistlichen von kränklicher Konstitution und blumiger Beredsamkeit geheiratet hatte und schließlich im Alter von dreiunddreißig Jahren als Witwe zurückblieb, ohne Kinder, ohne Vermögen – mit nichts weiter als der Erinnerung an Mr. Pennimans blumenreiche Rede, von der immer noch ein leichter Duft über ihrem eigenen Gesprächsstil schwebte. Dessen ungeachtet hatte er ihr ein Zuhause unter seinem eigenen Dach angeboten, was Lavinia ohne zu zögern annahm, hatte sie doch zehn Jahre ihres Ehelebens in der Kleinstadt Poughkeepsie zugebracht. Der Arzt hatte Mrs. Penniman nicht vorgeschlagen, auf immer und ewig bei ihm zu wohnen; vielmehr war er davon ausgegangen, dass sie Unterkunft in seinem Haus erhalten sollte, während sie sich nach einer unmöblierten Wohnung umsah. Es ist ungewiss, ob Mrs. Penniman jemals die Suche nach einer unmöblierten Wohnung in die Wege leitete, doch es steht außer Frage, dass sie niemals eine fand. Sie nistete sich bei ihrem Bruder ein, um ihn nie mehr zu verlassen, und als Catherine zwanzig Jahre alt war, gehörte ihre Tante Lavinia immer noch zu den einflussreichsten Gestalten ihrer unmittelbaren Umgebung. Mrs. Pennimans eigene Sicht der Dinge lautete, dass sie dort geblieben war, um sich der Erziehung ihrer Nichte zu widmen. Zumindest hatte sie diese Rechtfertigung jedermann mitgeteilt außer dem Arzt, der niemals nach Erklärungen fragte, die er sich selbst jeden Tag mit neuem Vergnügen ausdenken konnte. Obwohl Mrs. Penniman über ein erstaunliches Maß einer etwas künstlich wirkenden Selbstsicherheit verfügte, schreckte sie doch aus nicht näher zu bestimmenden Gründen davor zurück, sich ihrem Bruder gegenüber als eine Quelle der Gelehrsamkeit darzustellen. Sie hatte keinen ausgeprägten Sinn für Humor, aber immerhin genug, um sich vor diesem Fehler zu bewahren; und ihr Bruder war seinerseits humorvoll genug, sie aufgrund der Umstände dafür zu entschuldigen, dass sie ihm während eines beträchtlichen Teils der Lebenszeit auf der Tasche lag. Darum stimmte er stillschweigend dem Plan zu, den sich Mrs. Penniman ihrerseits stillschweigend zurechtgelegt hatte, dass es für das arme, mutterlose Kind von größter Wichtigkeit sei, eine geistreiche Frau um sich zu haben. Seine Zustimmung konnte sich nur im Stillen vollziehen, denn das intellektuelle Feuer seiner Schwester hatte ihn noch nie blenden können. Bis auf damals, als er sich in Catherine Harrington verliebte, war er noch nie von irgendwelchen weiblichen Eigenschaften geblendet worden; und obwohl er gewissermaßen als «Damenarzt» galt, hatte er keine übertrieben hohe Meinung von dem komplizierteren Geschlecht. Dessen Kompliziertheiten kamen ihm eher seltsam als erbaulich vor, und er hegte eine Vorstellung von der Schönheit des Geistes, die, soweit er dies an seinen Patientinnen beobachtet hatte, nur dürftig befriedigt wurde. Seine Frau war eine kluge Person gewesen, aber sie war eine glanzvolle Ausnahme; unter mehreren Dingen, deren er sich sicher war, stand dies wohl an erster Stelle. Eine solche Überzeugung trug allerdings wenig dazu bei, seine Witwerschaft zu erleichtern oder abzukürzen; bestenfalls setzte sie seiner Anerkennung von Catherines Möglichkeiten und Mrs. Pennimans Fürsorge bestimmte Grenzen. Dennoch nahm er nach Ablauf von sechs Monaten die ständige Anwesenheit seiner Schwester als unumstößliche Tatsache hin, und als Catherine älter wurde, sah er ein, dass es in der Tat gute Gründe dafür gab, warum sie eine Gefährtin ihres eigenen unvollkommenen Geschlechts um sich haben sollte. Er war überaus höflich zu Lavinia, ja von penibler, formeller Höflichkeit; sie hatte ihn nur ein einziges Mal in ihrem Leben wütend gesehen, als er in einer theologischen Diskussion mit ihrem verstorbenen Mann die Fassung verlor. Mit ihr diskutierte er niemals über theologische Fragen, ja er diskutierte überhaupt nie über irgendetwas; er begnügte sich damit, seine Wünsche in Bezug auf Catherine sehr entschieden in Form eines glasklaren Ultimatums bekannt zu geben.
Einmal, als das Mädchen etwa zwölf Jahre alt war, hatte er zu ihr gesagt: «Versuche eine kluge Frau aus ihr zu machen, Lavinia. Ich möchte, dass sie eine kluge Frau wird.»
Daraufhin blickte Mrs. Penniman einen Moment lang nachdenklich. «Mein lieber Austin», antwortete sie dann, «glaubst du, dass es besser ist, klug zu sein als gut?»
«Gut für was?», fragte der Arzt. «Man ist für gar nichts gut, wenn man nicht klug ist.»
Mrs. Penniman sah keinen Grund, dieser Feststellung zu widersprechen; möglicherweise überlegte sie, dass ihr eigener großer Nutzen in der Welt ihren vielfältigen Begabungen zuzuschreiben war.
«Natürlich möchte ich, dass Catherine gut ist», sagte der Arzt am nächsten Tag; «aber sie wird keinen Deut weniger tugendhaft sein, nur weil sie kein Dummkopf ist. Ich habe keine Sorge, dass sie böse sein könnte; in ihrem Charakter wird sich niemals ein Körnchen Bosheit finden. Sie ist so gut wie gutes Brot, wie die Franzosen sagen;2 aber in sechs Jahren möchte ich sie nicht mit einem guten Butterbrot vergleichen müssen.»
«Befürchtest du, sie könnte geistlos werden? Mein lieber Bruder, ich bin es, die für die Butter sorgt; du brauchst dir keine Sorgen zu machen!», sagte Mrs. Penniman, die die Ausbildung des Mädchens in die Hand genommen hatte, sie beim Klavierspiel beaufsichtigte, wo Catherine ein gewisses Talent bewies, und mit ihr zum Tanzunterricht ging, wo sie, wie man zugeben muss, nur eine bescheidene Figur abgab.
Mrs. Penniman war eine hochgewachsene, dünne, hübsche, aber schon etwas verwelkte Frau mit einem durchaus liebenswerten Charakter, einem ausgeprägten Sinn für Anstand, einer Vorliebe für leichte Literatur und einer etwas störrisch wirkenden Unredlichkeit und Abwegigkeit in ihrem Verhalten. Sie war romantisch, sie war sentimental, und sie hegte eine Leidenschaft für kleine Geheimnisse und Heimlichkeiten, eine höchst unschuldige Leidenschaft, da ihre Geheimnisse bisher immer so unbrauchbar gewesen waren wie faule Eier. Sie war nicht wirklich wahrheitsliebend, doch dieser Mangel hatte keine größeren Folgen, da sie niemals irgendetwas zu verbergen hatte. Sie hätte gern einen Liebhaber gehabt, um mit ihm unter falschem Namen zu korrespondieren und die Briefe in einem Laden zu hinterlegen; ich muss gestehen, dass die Intimität in ihrer Fantasie niemals über diesen Punkt hinausgegangen ist. Tatsächlich hatte Mrs. Penniman nie einen Liebhaber gehabt, aber ihr Bruder, der sehr scharfsinnig war, verstand, wie sie dachte. «Wenn Catherine erst einmal siebzehn ist», sagte er sich, «wird Lavinia ihr weiszumachen versuchen, dass irgendein junger Mann mit Schnurrbart sich in sie verliebt habe. Daran wird kein wahres Wort sein; kein junger Mann, ob mit oder ohne Schnurrbart, wird sich je in Catherine verlieben. Aber Lavinia wird die Sache weiterverfolgen und mit ihr darüber reden; vielleicht wird sie sogar, sofern ihr Sinn für heimliche Machenschaften nicht doch die Oberhand gewinnt, mit mir darüber reden. Catherine wird es nicht einsehen und nicht glauben wollen, zum Glück für ihren Seelenfrieden; die arme Catherine ist nicht romantisch.»
Sie war ein gesundes, gut gewachsenes Kind, doch ohne jede Spur von der Schönheit ihrer Mutter. Sie war nicht hässlich, sie hatte lediglich ein gewöhnliches, reizloses, freundliches Aussehen. Sie habe ein «nettes» Gesicht, das war das Äußerste, was je zu ihren Gunsten vorgebracht worden war, und obwohl sie eine Erbin war, hatte noch nie jemand daran gedacht, sie für eine Schönheit zu halten. Die Ansicht ihres Vaters über ihre moralische Reinheit war in höchstem Maße gerechtfertigt; sie war außergewöhnlich und unerschütterlich gut; liebevoll, gelehrig, gehorsam und stets darauf bedacht, die Wahrheit zu sagen. In ihren Jugendjahren war sie ein rechter Wildfang gewesen, und wenn es auch ein heikles Geständnis über die eigene Romanheldin ist, so muss ich doch hinzufügen, dass sie allzu gern naschte. Zwar hat sie, soweit ich weiß, niemals Rosinen aus der Speisekammer gestohlen, aber ihr Taschengeld gab sie für den Kauf von Sahnetörtchen aus. Was das betrifft, wäre ein Verschweigen nicht mit einer aufrichtigen Berichterstattung der frühen Lebensgeschichte zu vereinbaren – und das gilt für jeden Biografen. Catherine war gewiss nicht klug, sie hatte keine schnelle Auffassungsgabe, und auch in allen anderen Dingen war sie nicht schnell. Ihre Unzulänglichkeit war nicht unnormal, und sie eignete sich genug Wissen an, um sich respektabel im Gespräch mit ihren Altersgenossen zu behaupten, unter denen sie, das muss eingeräumt werden, lediglich einen hinteren Platz einnahm. Bekanntlich ist es in New York durchaus möglich für ein Mädchen, einen der vorderen Plätze einzunehmen. Catherine war äußerst bescheiden, hatte nicht das Bedürfnis zu glänzen, und bei den meisten sogenannten gesellschaftlichen Ereignissen hätte man sie irgendwo in einer hinteren Ecke entdeckt. Sie liebte ihren Vater über alles und fürchtete ihn sehr; sie hielt ihn für den klügsten, stattlichsten und angesehensten aller Männer. Das arme Mädchen glaubte sich so vollständig für ihre Hingabe entlohnt, dass ein bisschen furchtsames Zittern, das sich in ihre kindliche Leidenschaft mengte, der Sache eher eine zusätzliche Würze verlieh, als ihr den Reiz zu nehmen. Es war ihr tiefster Wunsch, ihm zu gefallen, und ihre Vorstellung von Glück bestand darin, sicher zu sein, dass es ihr gelungen war, ihm zu gefallen. Über einen bestimmten Punkt hinaus war ihr dies jedoch nie gelungen. Obwohl er im Großen und Ganzen sehr freundlich mit ihr umging, war sie sich dessen völlig bewusst, und über diesen fraglichen Punkt hinauszugelangen schien ihr etwas, wofür es sich wirklich zu leben lohnte. Was sie allerdings nicht wissen konnte, war, dass sie ihn enttäuschte, obwohl sich der Arzt bei drei oder vier Gelegenheiten ziemlich freimütig dazu geäußert hatte. Sie wuchs behütet und in Wohlstand auf, aber bis zum Alter von achtzehn Jahren hatte Mrs. Penniman keineswegs eine kluge junge Frau aus ihr gemacht. Dr. Sloper wäre gern stolz auf seine Tochter gewesen, doch gab es nichts an der armen Catherine, worauf er hätte stolz sein können. Natürlich gab es auch nichts, dessen er sich hätte schämen müssen; das war jedoch nicht genug für den Arzt, der seinerseits ein stolzer Mann war und nur zu gern in der Lage gewesen wäre, sich seine Tochter als ein außergewöhnliches Mädchen vorzustellen. Er hätte es für angemessen gehalten, wenn sie hübsch und anmutig, intelligent und vornehm geworden wäre; schließlich war ihre Mutter in ihrer kurzen Lebensspanne die bezauberndste Frau gewesen, und was ihren Vater betrifft, so kannte der seinen eigenen Wert nur zu gut. Hin und wieder empfand er Verbitterung bei dem Gedanken, ein Allerweltskind hervorgebracht zu haben, und manchmal ging er sogar so weit, eine gewisse Befriedigung aus der Vorstellung zu beziehen, dass seine Frau es nicht mehr erlebt hatte, dies herausfinden zu müssen. Diese Entdeckung machte er natürlich nur allmählich, und erst als Catherine zu einer jungen Dame herangewachsen war, sah er die Sache als entschieden an. Er brachte eine Menge Zweifel zu ihren Gunsten ins Spiel; er hatte keine Eile, zu einer Entscheidung zu gelangen. Mrs. Penniman versicherte ihm immer wieder, dass seine Tochter ein entzückendes Wesen habe; er jedoch wusste, wie er diese Versicherung zu interpretieren hatte. Nach seinem Verständnis bedeutete sie, dass Catherine nicht welterfahren genug war, zu bemerken, dass ihre Tante eine Gans war – eine geistige Beschränktheit, die Mrs. Penniman nur angenehm sein konnte. Aber sie wie auch ihr Bruder übertrieben die Beschränktheiten des jungen Mädchens; denn obwohl Catherine ihre Tante sehr liebte und sich dessen bewusst war, wie viel Dankbarkeit sie ihr schuldete, betrachtete sie diese ohne den kleinsten Funken jener sanften Furcht, die den Grundton ihrer Bewunderung für den Vater angab. Für sie hatte Mrs. Penniman keine Spur von Unermesslichkeit an sich; Catherine erfasste sie gewissermaßen mit einem Blick und war nicht von ihrer Erscheinung geblendet; dagegen schienen sich die großartigen Fähigkeiten ihres Vaters in immer weitere Fernen zu erstrecken und in eine Art lichterfüllte Unbestimmtheit zu verlieren, was besagte, dass sie dort nicht etwa am Ende waren, sondern dass Catherines eigenes geistiges Vermögen ihnen nicht weiter folgen konnte.
Man darf nicht annehmen, dass Dr. Sloper seine Enttäuschung an dem armen Mädchen ausgelassen oder je Anlass zu der Vermutung gegeben hätte, sie habe ihm übel mitgespielt. Im Gegenteil, aus Angst, ihr gegenüber ungerecht zu sein, erfüllte er seine Pflicht mit beispielhaftem Eifer und erkannte an, dass sie ein anhängliches und liebevolles Kind war. Zudem war er ein Philosoph; um über seine Enttäuschung hinwegzukommen, rauchte er Unmengen von Zigarren, und im Laufe der Jahre hatte er sich daran gewöhnt. Er tröstete sich damit, dass er nichts erwartet hatte, wenn sein Gedankengang auch etwas sonderbar war. «Ich erwarte nichts», sagte er sich, «sollte sie mich aber überraschen, wird es ein klarer Gewinn sein. Wenn sie es nicht tut, wird es kein Verlust sein.» Dies war um die Zeit, als Catherine ihr achtzehntes Lebensjahr erreicht hatte, woraus sich ersehen lässt, dass ihr Vater nichts übereilt hatte. Zu diesem Zeitpunkt schien sie nicht nur unfähig, Überraschungen zu bereiten, sondern es stellte sich auch die Frage, ob sie überhaupt welche erleben konnte – denn sie war so ruhig und teilnahmslos. Leute, die sich grob ausdrückten, nannten sie schwerfällig. Sie war aber teilnahmslos, weil sie so schüchtern war, geradezu unbehaglich, bedrückend schüchtern. Dies wurde nicht immer richtig verstanden, und manchmal erweckte sie den Eindruck von Gefühllosigkeit. In Wirklichkeit war sie das mitfühlendste Geschöpf der Welt.
3
Als Kind hatte sie die Erwartung geweckt, einmal sehr groß zu werden, aber mit sechzehn hörte sie auf zu wachsen, und ihre Statur war, wie das meiste an ihrem Körperbau, nicht ungewöhnlich. Sie war jedoch kräftig und gut gebaut und hatte glücklicherweise eine ausgezeichnete Gesundheit. Es ist bereits angemerkt worden, dass der Arzt ein Philosoph war, aber ich wollte mich nicht für seine Philosophie verbürgt haben, wenn das arme Mädchen sich als kränklich und leidend erwiesen hätte. In ihrem gesunden Aussehen lag der wesentliche Grund, ihr Schönheit zuzubilligen, und ihre reine, frische Gesichtshaut, auf der sich weiß und rot gleichmäßig verteilten, bot in der Tat einen erfreulichen Anblick. Ihre Augen waren klein und ruhig, ihre Gesichtszüge eher rundlich, ihre Haare braun und glatt. Ein reizloses, langweiliges Mädchen, so wurde sie von strengen Kritikern genannt – ein ruhiges, damenhaftes Mädchen von jenen, die mehr Fantasie aufbrachten; doch auf keiner Seite wurde sehr ausgiebig über sie gesprochen. Als man ihr zu gegebener Zeit nachdrücklich beigebracht hatte, dass sie nun eine junge Dame war – es verstrich noch eine ganze Weile, bis sie es glauben konnte –, entwickelte sie plötzlich einen lebhaften Geschmack an Kleidern: «lebhafter Geschmack» ist hier genau der richtige Ausdruck. Es kommt mir so vor, als sollte ich das Wort ganz klein schreiben, denn ihr Urteil war in diesem Punkt keineswegs unfehlbar; es war Verirrungen und Verlegenheiten unterworfen. Ihre ausgeprägte Schwäche dafür ergab sich in Wirklichkeit aus dem Wunsch einer eher wortkargen Natur, etwas von sich kundzutun; sie suchte in ihren Kleidern beredt zu sein und ihre Zurückhaltung im Sprechen durch eine erlesene Freimütigkeit in der Kostümierung auszugleichen. Wenn sie sich nun aber in ihren Kleidern ausdrückte, ist den Leuten gewiss nicht vorzuwerfen, dass sie sie nicht für eine geistreiche Person hielten. Es muss hinzugefügt werden, dass sie zwar die Aussicht auf ein Vermögen hatte – Dr. Sloper hatte über lange Zeit durch seinen Beruf zwanzigtausend Dollar im Jahr verdient und die Hälfte davon zurückgelegt –, der ihr zur Verfügung stehende Betrag aber nicht größer war als das Taschengeld, das viele ärmere Mädchen bekamen. In jenen Tagen flackerten in New York noch immer ein paar Altarfeuer im Tempel der republikanischen Einfachheit, und Dr. Sloper hätte es gern gesehen, wenn sich seine Tochter mit klassischer Grazie als Priesterin dieses gnädigen Glaubens präsentiert hätte. Insgeheim verzog er grimmig das Gesicht, wenn er daran dachte, dass sein Kind nicht nur hässlich, sondern auch aufgetakelt sein könnte. Er selbst liebte die Annehmlichkeiten des Lebens und machte reichlich Gebrauch davon, aber er verabscheute die Gewöhnlichkeit und hatte sich eine Theorie zurechtgelegt, nach der sie in der ihn umgebenden Gesellschaft stetig zunahm. Zudem war der übliche Luxus in den Vereinigten Staaten vor dreißig Jahren noch keineswegs so groß wie gegenwärtig, und Catherines kluger Vater hielt an den altmodischen Ansichten über die Erziehung junger Leute fest. Er vertrat keine spezielle Theorie zu diesem Thema; es hatte bis jetzt kaum die Notwendigkeit bestanden, zur Selbstverteidigung eine Sammlung von Theorien bereitzuhalten. Es erschien ihm einfach passend und vernünftig, dass eine wohlerzogene junge Dame nicht ihr halbes Vermögen auf ihren Schultern herumtrug. Catherines Schultern waren breit und hätten eine Menge tragen können, aber unter dem Gewicht des väterlichen Missfallens wagte sie es nie, sie dieser Art von Last auszusetzen; unsere Heldin musste zwanzig Jahre alt werden, ehe sie sich als Abendkleid eine mit goldenen Fransen besetzte Satinrobe leistete; insgeheim hatte sie ein solches Kleidungsstück schon seit Jahren ersehnt. Wenn sie es trug, sah sie aus wie eine Frau von dreißig Jahren; seltsamerweise hatte sie trotz ihres Geschmacks an ausgefallenen Kleidern nicht eine Spur von Koketterie an sich, und ihre Sorge richtete sich darauf, ob die Kleider gut aussahen und nicht sie, die sie anhatte. Über den folgenden Punkt gibt die Geschichte keine genaue Auskunft, doch ist die Annahme berechtigt, dass sie sich in diesem eben erwähnten königlichen Gewand bei einer kleinen Einladung einfand, zu der ihre Tante, Mrs. Almond, gebeten hatte. Das Mädchen stand zu diesem Zeitpunkt in seinem einundzwanzigsten Lebensjahr, und Mrs. Almonds Gesellschaft war der Auftakt für etwas höchst Bedeutsames.
Etwa drei oder vier Jahre zuvor hatte Dr. Sloper seine Hausgötter stadtaufwärts verlegt, wie man in New York sagt. Seit seiner Heirat hatte er ein rotes Backsteingebäude mit granitenen Simsen und einem riesigen fächerförmigen Oberlicht über der Haustür bewohnt, das kaum fünf Minuten Gehweg von der City Hall entfernt in einer Straße stand, die ihre besten Tage (in gesellschaftlicher Hinsicht) um 1820 gesehen hatte. Danach begann sich die modische Strömung unaufhaltsam gen Norden zu bewegen, wie es in New York wegen der kanalartigen Enge, in der die Stadt verläuft, nicht anders sein kann, nur der gewaltig brausende Verkehr rollte rechts und links des Broadway weiter. Zu der Zeit, als der Arzt seinen Wohnsitz wechselte, war das Gemurmel des Handels zu einem mächtigen Lärm angeschwollen, der wie Musik in den Ohren all jener guten Bürger klang, die ein Interesse an der wirtschaftlichen Entwicklung ihrer vom Glück gesegneten Insel hatten, wie sie es gern nannten. Dr. Slopers Interesse an diesem Phänomen war nur ein indirektes – wiewohl es ein unmittelbareres hätte sein dürfen, wenn man bedenkt, dass sich im Laufe der Jahre die Hälfte seiner Patientenschaft aus überarbeiteten Geschäftsleuten zusammensetzte –, und nachdem die meisten seiner Nachbargebäude (die ebenfalls mit granitenen Simsen und großen Oberlichten versehen waren) in Büros, Lagerhäuser und Schifffahrtsagenturen umgewandelt und anderweitig für die Grundbedürfnisse des Handels nutzbar gemacht worden waren, beschloss er, sich nach einem ruhigeren Wohnhaus umzusehen. Das Ideal eines ruhigen und vornehmen Refugiums bot sich 1835 am Washington Square, wo sich der Arzt ein stattliches, modernes Haus mit breiter Fassade und einem großen Balkon vor den Wohnzimmerfenstern errichten ließ, zu dessen mit weißem Marmor umkleideten Portal eine Flucht weißer Marmorstufen hinaufführte. Dieses Gebäude wie auch viele der Nachbarhäuser, denen es aufs Haar glich, galten vor vierzig Jahren als Verkörperung der neuesten Errungenschaften architektonischen Könnens, und bis auf den heutigen Tag sind sie sehr solide und honorige Wohnstätten geblieben. Vor ihnen erstreckte sich der Platz, von Massen anspruchsloser Vegetation überwachsen und von einem hölzernen Lattenzaun umfriedet, was seinen ländlichen und zugänglichen Charakter noch verstärkte; gleich um die Ecke lag der anspruchsvollere Bezirk der Fifth Avenue, deren Ausgangspunkt sich an dieser Stelle befand, geräumig und selbstbewusst in der Wirkung, was die Straße bereits für höhere Ziele prädestinierte. Ich weiß nicht, ob dies der Zartheit früher Erinnerungen zu verdanken ist, aber dieser Teil von New York erscheint vielen Menschen als der reizvollste. Dort herrscht eine Art alteingesessener Ruhe, wie sie sich nicht häufig in anderen Bezirken der langgestreckten, schrillen Stadt findet; er hat ein reiferes, reicheres, ehrwürdigeres Aussehen als alle anderen weiter oben liegenden Abzweigungen von der längs verlaufenden großen Verkehrsader – ein Aussehen, das von so etwas wie einer Gesellschaftsgeschichte spricht. Hier war es, wie man aus gut informierter Quelle hätte erfahren können, wo man in eine Welt eintrat, die eine Vielfalt an Interessantem zu bieten hatte; hier war es, wo die Großmutter in gediegener Abgeschiedenheit lebte und eine Gastlichkeit entfaltet hatte, die für die kindliche Fantasie wie auch für den kindlichen Gaumen gleichermaßen erfreulich war; hier war es, wo man seine ersten Spaziergänge im Freien unternahm, mit ungelenkem Schritt hinter dem Kindermädchen her; den fremdartigen Duft der Götterbäume3 schnuppernd, die damals die verbreitetsten Schattenspender für den Platz waren und ein Aroma verströmten, das man, da man noch nicht kritisch genug war, nicht so sehr verabscheute, wie es das verdient hätte; hier war es schließlich auch, wo einem die erste Schule den Gesichtskreis wie auch den Umkreis der Sinneseindrücke erweiterte, eine Schule in Gestalt einer vollbusigen, breithüftigen alten Dame mit einer Rute, die ständig Tee aus einer blauen Tasse mit einer nicht dazu passenden Untertasse trank. Hier war es jedenfalls, wo meine Heldin viele Jahre ihres Lebens verbrachte; womit ich diesen topografischen Exkurs rechtfertigen will.
Mrs. Almond wohnte viel weiter stadtaufwärts in einer im Ausbau befindlichen Straße mit einer hohen Nummer – in einer Gegend, wo die Ausbreitung des Großstädtischen noch graue Theorie war, Pappeln neben dem Straßenpflaster wuchsen (wenn es so etwas dort überhaupt gab) und ihre Schatten mit den steilen Dächern planlos verstreuter holländischer Häuser mischten und wo sich Schweine und Hühner in der Gosse tummelten. Solche Elemente malerischer Ländlichkeit sind inzwischen völlig aus dem New Yorker Stadtbild verschwunden; aber im Gedächtnis von Leuten mittleren Alters waren sie noch zu finden, vor allem in Stadtteilen, in denen man heute bei der Erinnerung daran erröten würde. Catherine hatte eine Menge Vettern und Cousinen, und mit den Kindern ihrer Tante Almond, neun an der Zahl, pflegte sie einen sehr vertrauten Umgang. Als sie jünger war, fürchteten sie sich ein wenig vor ihr, denn sie galt bei ihnen, wie man zu sagen pflegte, als äußerst wohlerzogen, außerdem strahlte jemand, der eng mit ihrer Tante Penniman zusammenlebte, so etwas wie Vornehmheit aus. Mrs. Penniman genoss bei den kleinen Almonds eher Bewunderung als Zuneigung. Ihr Benehmen war befremdlich und furchteinflößend, und ihre Trauerkleider – sie kleidete sich noch zwanzig Jahre nach dem Tod ihres Mannes in Schwarz, und dann eines Morgens erschien sie plötzlich mit rosa Rosen an ihrer Haube – waren an ungewohnten, unerwarteten Stellen mit Schnallen, Spangen und Nadeln versehen, was einer Vertrautheit nicht förderlich war. Sie ging zu streng mit Kindern um, im Guten wie im Bösen, und hatte eine bedrückende Art, Spitzfindigkeiten von ihnen zu erwarten, sodass ein Besuch bei ihr etwas von einem Kirchgang hatte, bei dem man in der vordersten Bank sitzen musste. Nach einiger Zeit fand man jedoch heraus, dass Tante Penniman nur etwas Nebensächliches in Catherines Leben war und nicht ein wesentlicher Bestandteil und dass das Mädchen, wenn es einen Samstag mit seinen Vettern und Cousinen verbrachte, durchaus für einen «Gänsemarsch» oder ein Bockspringen zu haben war. Auf dieser Basis war ein gutes Einverständnis leicht zu erzielen, und über mehrere Jahre blieb Catherine mit ihren jungen Verwandten verbrüdert. Ich sage «verbrüdert», weil sieben der kleinen Almonds Jungen waren, und Catherine hatte eine Vorliebe für solche Spiele, die am bequemsten in Hosen gespielt wurden. Doch nach und nach wurden die kurzen Almond-Hosen immer länger, und die Träger zerstreuten sich und richteten sich im Leben ein. Die größeren Kinder waren älter als Catherine, und die Jungen wurden aufs Internat geschickt oder in Kontoren untergebracht. Von den Mädchen heiratete die eine sehr pünktlich, und die andere verlobte sich ebenso pünktlich. Das letztgenannte Ereignis sollte gefeiert werden, als Mrs. Almond die von mir erwähnte kleine Gesellschaft gab. Ihre Tochter sollte einen kräftigen jungen Börsenmakler heiraten, einen Burschen von zwanzig Jahren. Man hielt das für eine sehr gute Sache.
4
Natürlich erschien Mrs. Penniman, mit mehr Schnallen und Spangen denn je, zu der Einladung, begleitet von ihrer Nichte; der Arzt hatte versprochen, später am Abend vorbeizuschauen. Es sollte viel getanzt werden, und noch ehe das Fest sehr weit vorangeschnitten war, kam Marian Almond an der Seite eines hochgewachsenen jungen Mannes auf Catherine zu. Sie stellte ihr den jungen Mann als jemanden vor, der den dringenden Wunsch hatte, die Bekanntschaft unserer Heldin zu machen, und als einen Vetter von Arthur Townsend, ihrem Verlobten.
Marian Almond war ein hübsches Persönchen von siebzehn Jahren mit einer sehr zierlichen Figur und einer riesigen Schärpe; ihrem eleganten Auftreten hatte der Ehestand nichts mehr hinzuzufügen. Sie verfügte bereits über das Gebaren einer perfekten Gastgeberin in der Art, wie sie die Gäste empfing, ihren Fächer schwenkte und verkündete, dass ihr bei so vielen Leuten, um die sie sich zu kümmern habe, keine Zeit zum Tanzen bliebe. Sie redete lang und breit über Mr. Townsends Vetter, dem sie einen Klaps mit ihrem Fächer versetzte, bevor sie sich anderen Verpflichtungen zuwandte. Catherine hatte nicht alles verstanden, was sie gesagt hatte; ihre Aufmerksamkeit war ganz darauf gerichtet, Marians gewandtes Auftreten und ihren Ideenreichtum zu bewundern und den jungen Mann zu betrachten, der bemerkenswert gut aussah. Es war ihr jedoch gelungen, was ihr sonst meistens misslang, wenn ihr Leute vorgestellt wurden, seinen Namen zu behalten, der offensichtlich der gleiche war wie der von Marians kleinem Börsenmakler. Catherine war immer aufgeregt, wenn ihr jemand präsentiert wurde; für sie war es ein schwieriger Moment, und sie wunderte sich darüber, dass es manchen Leuten, wie zum Beispiel ihrer neuen Bekanntschaft in diesem Augenblick, so wenig ausmachte. Sie fragte sich, was sie sagen sollte und was es wohl für Folgen hätte, wenn sie nichts sagte. Die Folgen waren diesmal sehr angenehm. Mr. Townsend ließ ihr keine Zeit, verlegen zu sein, und begann mit einem ungezwungenen Lächeln zu reden, als kenne er sie bereits seit einem Jahr.
«Was für eine wundervolle Gesellschaft! Was für ein bezauberndes Haus! Was für eine interessante Familie! Was für ein hübsches Mädchen ihre Cousine ist!» Diese Bemerkungen waren zwar nicht besonders tiefsinnig, aber Mr. Townsend äußerte sie leichthin in aller Unverbindlichkeit, lediglich als Beitrag zu einer neuen Bekanntschaft. Er blickte Catherine direkt in die Augen. Sie antwortete nicht; sie hörte nur zu und sah ihn an; und er fuhr fort, alles Mögliche andere in derselben gelassenen und natürlichen Art zu sagen, als erwartete er keine besondere Erwiderung. Auch wenn Catherine den Mund nicht aufbrachte, empfand sie doch keine Verlegenheit; es schien ihr angebracht, dass er redete und sie ihn dabei nur anschaute. Was die Sache so selbstverständlich machte, war, dass er so gut aussah, oder richtiger gesagt, wie sie es für sich ausdrückte, so schön war. Die Musik hatte eine Zeit lang ausgesetzt, fing aber plötzlich wieder an; da fragte er sie mit einem eindringlicheren, innigeren Lächeln, ob sie ihm die Ehre erweisen wolle, mit ihm zu tanzen. Selbst auf diese Frage gab sie keine vernehmbare Zustimmung; sie ließ ihn seinen Arm um ihre Taille legen – indem sie dies gewährte, wurde ihr lebhafter als jemals zuvor bewusst, dass dies ein einzigartiger Ort für den Arm eines Herrn sei –, und schon im nächsten Moment führte er sie im harmonischen Kreisen einer Polka rund um den Saal. Als sie innehielten, spürte sie, dass sie errötet war; daraufhin unterließ sie es für einige Augenblicke, ihn anzusehen. Sie fächelte sich Luft zu und betrachtete die Blumen, die auf ihren Fächer gemalt waren. Er fragte sie, ob sie weitertanzen wolle, doch sie zögerte mit der Antwort und blickte weiter auf die Blumen.
«Wird Ihnen davon schwindelig?», fragte er in einem sehr liebenswürdigen Ton.
Da sah Catherine zu ihm auf; er war wirklich sehr schön und ganz und gar nicht errötet. «Ja», sagte sie. Sie wusste nicht so genau, warum, denn vom Tanzen war ihr noch nie schwindelig geworden.
«Na gut, wenn das so ist», sagte Mr. Townsend, «dann wollen wir uns hinsetzen und uns unterhalten. Ich werde einen guten Platz für uns finden.»
Er fand einen guten Platz, ja einen entzückenden Platz, ein kleines Sofa, das für nur zwei Personen wie gemacht schien. Inzwischen hatten sich die Räume mit Menschen gefüllt, die Zahl der Tänzer nahm zu, und etliche Leute standen vor ihnen, ihre Rücken ihnen zugewandt, sodass Catherine und ihr Begleiter abgeschirmt und unbeobachtet schienen. «Wir wollen uns unterhalten», hatte der junge Mann gesagt, aber er bestritt die gesamte Unterhaltung allein. Catherine lehnte sich auf ihrem Platz zurück, ihre Augen auf ihn geheftet, lächelte und hielt ihn für sehr klug. Er hatte Gesichtszüge wie junge Männer auf Bildern; Catherine hatte noch nie solche Gesichtszüge – so fein, so vollendet und wie gemeißelt – bei den jungen New Yorkern gesehen, denen sie auf der Straße begegnete und die sie auf Partys traf. Er war groß und schlank, wirkte dabei aber sehr kräftig. Catherine fand, er sehe wie eine Statue aus. Aber eine Statue würde nicht so reden, und vor allem hätte sie keine Augen von so ungewöhnlicher Farbe. Er war noch nie zuvor bei Mrs. Almond gewesen und fühlte sich hier wie ein Fremder; daher war es sehr freundlich von Catherine, sich seiner anzunehmen. Er war ein Vetter von Arthur Townsend, kein sehr naher, vielmehr um etliche Ecken – und Arthur hatte ihn mitgebracht, um ihn der Familie vorzustellen. Tatsächlich fühlte er sich in New York vollkommen fremd. Es war zwar seine Geburtsstadt, aber er war seit vielen Jahren nicht mehr hier gewesen. Er hatte sich in der Welt herumgetrieben und in den entlegensten Winkeln gelebt; erst vor ein oder zwei Monaten war er zurückgekommen. New York gefiel ihm sehr, nur fühlte er sich einsam.
«Sie sehen, die Leute vergessen Sie», sagte er und lächelte Catherine mit seinem strahlenden Blick an, während er sich, schräg vorgeneigt und die Ellbogen auf seine Knie gestützt, ihr zuwandte.
Es schien Catherine, dass keiner, der ihn einmal gesehen hatte, ihn je vergessen könnte; obwohl ihr dieser Gedanke kam, behielt sie ihn für sich, fast so, wie man etwas Kostbares bewahren möchte.
Sie saßen eine ganze Weile dort. Er war sehr unterhaltsam. Er fragte sie nach den Leuten, die in ihrer Nähe standen; er versuchte zu erraten, wer der eine oder andere sein mochte, und machte dabei die spaßigsten Fehler. Er kritisierte die Leute freimütig, auf eine überzeugende, unbekümmerte Art. Noch nie hatte Catherine jemanden so reden hören wie ihn – vor allem keinen jungen Mann. So mochte ein junger Mann in einem Roman reden, besser noch in einem Theaterstück, auf der Bühne, nahe an der Rampe, mit Blick ins Publikum, wo jeder ihn ansah, sodass man sich über seine Geistesgegenwart nur wundern konnte. Doch Mr. Townsend hatte nichts von einem Schauspieler, er wirkte so aufrichtig, so natürlich. Das war höchst interessant; aber mitten in ihre Gedanken platzte Marian Almond, die sich durch die Menge drängte und einen kleinen, amüsierten Schrei von sich gab, als sie die beiden jungen Leute immer noch beieinander fand, sodass sich jedermann nach ihnen umdrehte und Catherine verlegen errötete. Marian unterbrach sie in ihrer Unterhaltung und wies Mr. Townsend an – den sie behandelte, als sei sie bereits verheiratet und er nun ihr Vetter –, sich eiligst zu ihrer Mutter zu begeben, die ihn schon seit einer halben Stunde Mr. Almond vorzustellen wünschte.
«Wir werden uns wiedersehen!», sagte er zu Catherine, als er sie verließ, und Catherine fand diesen Ausspruch sehr originell.
Ihre Cousine nahm sie beim Arm und spazierte mit ihr umher. «Ich muss dich wohl nicht fragen, was du von Morris hältst!», rief das junge Mädchen.
«Ist das sein Name?»
«Ich habe dich nicht gefragt, was du von seinem Namen hältst, sondern was du von ihm hältst», sagte Marian.
«Ach, nichts Besonderes!», antwortete Catherine, und zum ersten Mal in ihrem Leben verstellte sie sich.
«Ich habe nicht übel Lust, ihm das zu erzählen!», rief Marian. «Das wird ihm guttun. Er ist so schrecklich eingebildet.»
«Eingebildet?», fragte Catherine und starrte sie an.
«Arthur behauptet das, und Arthur kennt ihn.»
«Ach nein, sag’s ihm nicht!», murmelte Catherine flehend.
«Ihm nicht sagen, dass er eingebildet ist? Ich habe ihm das schon ein Dutzend Mal gesagt.»
Bei diesem unverblümten Geständnis blickte Catherine voller Verwunderung auf ihre kleine Begleiterin herab. Sie vermutete, dass es mit Marians bevorstehender Verheiratung zu tun hatte, dass sie sich so viel herausnahm; zugleich fragte sie sich, ob solche Heldentaten auch von ihr erwartet würden, wenn sie sich einmal verloben sollte.