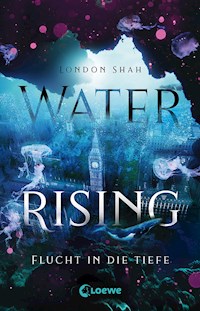
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Loewe Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Water Rising
- Sprache: Deutsch
Die Welt nach der Katastrophe Wie ist es, Regen, Schnee oder Sonne auf dem Gesicht zu spüren? Und wie sehen wechselnde Jahreszeiten aus und fühlen sich verschiedene Temperaturen an? Das alles ist der 16-jährigen Leyla völlig fremd, denn seit einer verheerenden Naturkatastrophe steht die Welt komplett unter Wasser. Leyla kennt nur das Leben im versunkenen London – bis ihr Vater festgenommen wird. Zum ersten Mal verlässt sie zusammen mit dem verschlossenen Ari ihre Heimat, um ihren Vater zu befreien. Doch die britische Regierung stellt sich ihnen in den Weg. Mit allen Mitteln will sie verhindern, dass Leyla eine dunkle Verschwörung aufdeckt. Eine rasante Climate-Fiction für Leser ab 14 Jahren, die ein erschreckendes Szenario darstellt: Was passiert, wenn wir den Klimawandel nicht aufhalten können? Geschickt werden politische Themen wie Diversität und Fremdenfeindlichkeit mit einer packenden Geschichte kombiniert. Düster, actionreich und topaktuell!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 529
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALT
Eysturoy, Färöer-Inseln, Europäisches Nordmeer
Kapitel 1 – London, Weihnachten 2099 …
Kapitel 2 – Ich presse mein …
Kapitel 3 – Über uns funkeln …
Kapitel 4 – Ich lenke das …
Kapitel 5 – Das Observatorium steht …
Kapitel 6 – Es herrscht ein …
Kapitel 7 – Das ganze Observatorium …
Kapitel 8 – Ich steige durch …
Kapitel 9 – »Nennt mich Deathstar. …
Kapitel 10 – »Auf jeden Fall …
Kapitel 11 – Der Albtraum, der …
Kapitel 12 – Bisher habe ich …
Kapitel 13 – »Ein Unheil, meine …
Kapitel 14 – »Das gibt’s doch …
Kapitel 15 – Theos Freundin Sam …
Kapitel 16 – Der Junge ist …
Kapitel 17 – Ich liege mit …
Kapitel 18 – Nach einer Tasse …
Kapitel 19 – Unsere Fahrthöhe werden …
Kapitel 20 – Die Kabul wird …
Kapitel 22 – Jojo schläft tief …
Kapitel 22 – Im Gang wirft …
Kapitel 23 – »Langsam … und …
Kapitel 24 – »Wieso, verdammt noch …
Kapitel 25 – Der Bau ist …
Kapitel 26 – Ich schrecke hoch …
Kapitel 27 – Mir rutscht das …
Kapitel 28 – »Bitte, Leyla«, sagt …
Kapitel 29 – Die Bögen des …
Kapitel 30 – Ich falte das …
Kapitel 31 – Ich sitze schweißgebadet …
Kapitel 32 – Ari geht in …
Kapitel 33 – »Warum verhält sich …
Kapitel 34 – Ich richte mich …
Kapitel 35 – Ich laufe vor …
Kapitel 36 – Ich klettere mit …
Kapitel 37 – Abends wische ich …
Kapitel 38 – Am dritten Morgen …
Danksagung
Für all die anderen Paschtunen.
Auch wir sind es wert,
EYSTUROY,FÄRÖER-INSELN,EUROPÄISCHESNORDMEER
Von aller Hoffnung verlassen, waren sie der Gewalt des Wassers ausgesetzt.
Die großen Überschwemmungen der Alten Welt hatten nicht nur zur Folge gehabt, dass die Menschheit in die Tiefen der Meere verbannt worden war. Den Menschen war auch das Vertrauen genommen worden, dass sie jemals wieder in Frieden leben würden.
Wie sonst ließe sich das alles erklären?
Ari saß stocksteif da, die kupferfarbenen Finger um den Steuerknüppel seines Tauchboots gekrallt. Alle Luft hatte seine Lunge verlassen und ein Steinbrocken schien in seiner Brust zu wachsen – schwerer und scharfkantiger als die versunkenen Berge um ihn herum –, der ihm das Atmen schwer machte. Aris Blick flackerte, als er die Bewegungen in der Tiefe wahrnahm.
Das Meer stand in Flammen.
Sie fanden sich einem Tsunami aus mächtigen Unterwasserschiffen gegenüber. Brutaler und gnadenloser als ein Schwarm hungriger Barrakudas. Starke Stromstöße, grelle Laserstrahlen und Sprengstoffe schossen aus den massiven Unterböden der Schiffe kreuz und quer durchs Wasser. Rundherum schäumte das Meer, als die Tauchboote seines Volks mit erbarmungslosen Waffen in die Niedrigdruck-Bereiche gedrängt wurden. Die Fahrzeuge explodierten direkt vor Aris Augen. Wellen breiteten sich aus und brachten sein Boot gefährlich zum Schwanken. Und dennoch konnte er sich nicht bewegen.
Hier, wo die Wasseroberfläche Hunderte von Metern über ihm von rauen Winden aufgewühlt wurde und das Europäische Nordmeer auf die Nordsee traf, war die unzugängliche Umgebung für die Menschen von Eysturoy immer ein Schutz gewesen. Sie hatten diesen Ort ausgewählt wegen der hohen Berge, die sie rundherum vor der lebensbedrohlichen Kraft der Elemente schützten. Bisher hatte es immer ausgereicht, das wilde und zerklüftete Gelände beim ersten Anzeichen von Gefahr in tiefe Dunkelheit versinken zu lassen, um die gierigen Bestien fernzuhalten, die sein Volk jetzt in nur einem Wimpernschlag vernichten würden.
Denn heute war die widrige Gegend für die Monster kein Hindernis gewesen.
Die gesamte Umgebung war in grelles Licht getaucht, mit dem die feindlichen Eindringlinge die schroffe Landschaft ausleuchteten. Der Schein des Lichts hob jede einzelne Klippe deutlich hervor – und weiter unten, auf dem tiefer gelegenen Plateau, auch jedes Haus – und brachte dessen Bewohner zum Vorschein: Familie, Freunde, Nachbarn.
Ari spähte in die Weiten des brodelnden Meeres, in dem die schrecklichen Folgen des Zusammenpralls von Mensch und Anthropoid bereits ziellos in den Wellen trieben. Körper. Menschen, die er kannte. Lance – der sanftmütigste seiner Freunde. Tot.
Die Worte seines Vaters waren kaum mehr als ein Echo: Vertraue auf die Verteidigung unserer Gemeinschaft, mein Sohn. Verlasse nicht das Haus – lass dich nie von deiner Wut leiten. Und seine jüngste Drohung: Das ist meine letzte Warnung, Ari. Wenn du dich noch einmal in Gefahr begibst, schicke ich dich zu Gideon nach London.
Er sollte also den Dingen ihren Lauf lassen? Die Verluste einfach hinnehmen?
Lance. Ari drehte sich der Magen um. Er ballte die Hände zu Fäusten und schnaubte.
Warum mussten sie sich verstecken? Sie hockten immer nur im Dunkeln, in der Hoffnung, nicht entdeckt zu werden. Warum jagten sie die gegnerischen Schiffe nicht einfach in die Luft und verfütterten die Leichen der Feinde an die Haie?
Er blinzelte und schluckte, sein Atem ging stoßweise. Eine Hitze brannte sich durch sein Innerstes, entfacht durch seinen Verlust. Seine Verzweiflung. Seine Finger bewegten sich über das Schaltpult.
Ari stürzte sich kopfüber in die Hölle.
Omnia mutantur,
nos et mutamur in illis
Alles ändert sich,
und dabei ändern wir uns
1
London, Weihnachten 2099
Die Gesellschaft zur Bewahrung des Erbes der Alten Welt verlangt, dass man zu allen ehrwürdigen Stätten des alten London einen respektvollen Sicherheitsabstand einhält. Der respektvolle Abstand kann mich mal oder einen der Abgründe in der Wildnis runterrutschen, denn ehrlich gesagt verstehe ich einfach nicht, was an Ruinen so toll sein soll.
Ich stelle die krachende Punkrock-Musik, die im Inneren meines U-Boots dröhnt, leiser und spähe noch einmal hinaus in die graugrünen Tiefen auf der Suche nach einem Hinweis auf die Wachsamen Augen – die winzigen Kugelkameras könnten überall sein. Nichts zu sehen, die Strömung ist sauber. Ich steuere mein Tauchboot an der fluoreszierenden Fassade von Big Ben vorbei und nähere mich dem ehemaligen Parlamentsgebäude, dem House of Parliament, aus dessen Mitte das sanfte Licht der Gedächtniskerze aufblinkt. Ein kleiner Schwarm gemusterter Kaninchenfische schwebt in einem der Strahlen. Als Erinnerung an den bevorstehenden Jahrestag leuchten die lilafarbenen Strahlen, so weit das Auge reicht, durch die Gewässer der Stadt.
Gott, wie ich es liebe, mich jedes Jahr in diesem Anblick zu verlieren.
Manchmal steht die Gedächtniskerze für die ganze Menschheit, die Schicht um Schicht durch die Strömungen, die Wellen und den Druck bis nach oben widerhallt, die flüssige Haut der Wasseroberfläche durchbricht und das Universum daran erinnert: Hey, wir leben hier noch, wir machen immer noch weiter! Ein anderes Mal ist das Leuchten ein Gruß in die Ewigkeit, eine Million Umarmungen, Lachen, Erinnerungen und Träume der Alten Welt, die durch die Jahrhunderte reichen und uns den Weg erhellen.
Morgen sind es 65Jahre. Noch vor 65Jahren war hier überall Luft und kein Wasser. Und sonst nichts. Nichts zwischen den Gebäuden, zwischen den Menschen und über ihren Köpfen. Die Menschen haben sich draußen einfach so verhalten, als wären sie genauso sicher wie drinnen. Wenn ich mir vorstelle, ohne den Schutz des Wassers im Freien und so dem ganzen Universum ausgesetzt zu sein! Verrückt.
Mein Armband blinkt. Ich checke die Anrufer-ID auf dem Flexi-Band um mein Handgelenk. »Annehmen.«
Theos Gesicht wird als Hologramm über meinem Armband sichtbar, sein Lächeln erreicht seine hellblauen Augen. »Bist du auf dem Weg, Leyla? Da wartet ein Topf voll Geld mit deinem Namen drauf. Wir haben ein Zeitfenster erwischt – vor weniger als zehn Minuten sind ein paar Wachsame Augen vorbeigekommen, also haben wir jetzt ungefähr eine Stunde. Man sollte meinen, sie würden an Weihnachten mal freimachen, aber von wegen.«
Der Geldtopf. Ich richte mich auf und straffe die Schultern. Ich benötige ihn dringend, wirklich dringend. Als Fahrlehrerin verdient man nicht gerade viel, und wenn ich die Rückmeldung erhalte, auf die ich warte, dann kann ich jeden Cent aus dem Topf gebrauchen. Ich muss das Rennen heute gewinnen.
Als hätte er meine Gedanken gelesen, nickt Theo. »Du schaffst es, das weiß ich. Und mir ist klar, dass du dir nichts ausleihen willst, aber –«
»Hey, ich komm schon zurecht, wirklich. Aber danke. Bin jetzt auf dem Weg.«
»Cool. Wir haben uns an der Brücke getroffen. Alle sind da. Und, ähm, Tabby wird, du weißt schon, ›ungeduldig‹. Aua, Tabs!«
Das Gesicht seiner Zwillingsschwester schiebt sich vor Theos Hologramm. Tabby verdreht genervt die stechend blauen Augen. »Beachte ihn einfach nicht, Leyla. Hm, ich wette, du bist draußen bei der Gedächtniskerze mal wieder auf See verschollen und –«
»Hey«, unterbricht sie Theo, »nur weil du ein Bot bist, heißt das noch lange nicht, dass jeder einer ist. Aua!«
Jedes Mal wenn Theo »Aua« sagt, zucke ich tatsächlich zusammen und muss grinsen. Tabbys Nägel sind so spitz, dass es richtig wehtut, wenn sie einen damit pikt.
»Ich bin gleich da«, erkläre ich. »Und, Tabs, lass Theo in Ruhe!«
Das Gitarrenriff von The Clash dröhnt wieder in voller Lautstärke, während ich aufsteige. Die Strömung fließt ruhig. Ich drücke den Gashebel ganz nach vorn und rase Richtung Tower Bridge, wo meine Freunde warten.
Licht von unzähligen Solarkugeln, die Tausende von Metern über mir auf der Meeresoberfläche schwimmen, erhellt die Tiefe. Jetzt, am frühen Morgen, wirkt London unter mir wie ein riesiges 3-D-Puzzle aus kuppelförmigen Titangebäuden, die durch Transporttunnel aus Acrylglas verbunden werden – eine Komposition aus Schatten und diffusem Licht. Der tintenfarbene Strahl der Themse zieht unter mir vorüber, die Erinnerungen an einen Fluss. Die Londoner fühlen sich dem sagenumwobenen Lauf dieses tiefen Wassers verbunden und seine ehemaligen Ufer sind ständig beleuchtet. Um mich herum schimmert die Stadt. Überall sind Festschmuck und Gedenkzeichen zu sehen.
Ich nähere mich der Tower Bridge, wo das Rennen beginnt. Beim Anblick der Brücke hebt sich wie immer meine Laune. Hier haben die Zwillinge und ich mehr Zeit als an irgendeinem anderen Ort in London verbracht, auch wenn es jedes Mal einen Erwachsenen gab, der sich über unsere versammelten U-Boote beschwert hat.
Aus dem Augenwinkel nehme ich eine schnelle Bewegung in der Nähe des Tower of London zu meiner Linken wahr und kneife die Augen zusammen: Werde ich beobachtet? Aber es ist nur ein glänzender Riemenfisch, der aus einem der oberen Fenster des White Tower hervorkommt. Er erschreckt sich und schwimmt direkt auf die krebsartigen Maschinen zu, die sich an den moosbedeckten Wänden des Turms abrackern, doch kurz darauf verliere ich seinen flachen silbernen Körper aus dem Blick. Ich lasse mein Boot absinken und surrend mitten durch das Bauwerk schweben – Algen hängen von jedem noch verbliebenen Teil der zertrümmerten Brücke herab – und dann entdecke ich die anderen U-Boote, die auf mich warten.
Die Gesichter der Zwillinge kann ich in ihrem blauen Zweisitzerboot, das sie gemeinsam zu ihrem 17. Geburtstag Anfang des Jahres geschenkt bekommen haben, gerade so erkennen. Aber selbst in dieser trüben Umgebung leuchtet mir ihr platinblondes Haar entgegen und die Welt ist gleich viel heller.
Ich werfe einen prüfenden Blick in die Runde. Acht U-Boote in allen Größen und Formen – die üblichen Teilnehmer. Malik darf ich auf keinen Fall unterschätzen; er bezahlt mich für den Unterricht und wird immer besser. Jeder von uns hat seinen Einsatz in den Geldtopf geschmissen und der Gewinner erhält alles. Verlieren ist immer bitter, denn ich weiß, dass die Woche schwierig werden wird, wenn ich ohne meinen Beitrag auskommen muss. Sonst habe ich nur wegen des Nervenkitzels bei den Rennen mitgemacht, aber jetzt ist es anders. Und der Topf diese Woche enthält wegen der bevorstehenden Jahrhundertwende eine viel höhere Summe als je zuvor.
»Okay, lasst uns anfangen.« Keung, der das Rennen organisiert und auch selbst teilnimmt, meldet sich per Gruppenchat: »Die Check-in-Boote an den Stationen sind bereit. Haltepunkte sind: St Paul’s, Clio House am Trafalgar Square und zum Schluss das Island Housing Projekt. Die Regeln sind wie immer – wer auch nur einen einzigen Checkpunkt verpasst, fliegt aus dem Rennen und so weiter. Theo hat die Strecke auf Wachsame Augen überprüft und für die nächste Stunde müssten wir sicher sein, was Verkehrsverstöße angeht. Irgendwelche Fragen?«
Keine. Wir bringen unsere U-Boote an der Brücke in Position. Ich schaue mich noch einmal prüfend um.
»Okay … Alle fertig?«, fragt Keung.
Gleich geht es los. Wie immer fahre ich Tabbys massiven, aber leistungsstarken scharlachroten Einsitzer. Aus dem Cockpit hat man eine 360-Grad-Ansicht auf die Umgebung. Perfekt. Je mehr ich sehen kann, desto sicherer bin ich. Hoffe ich zumindest. Trotz Theos Überprüfung werfe ich sicherheitshalber noch einmal einen Blick in die Runde, ob irgendwo das verräterische Blitzen eines Wachsamen Auges zu erkennen ist. Ich kann mir keine Verkehrsverstöße leisten; drei davon reichen und mein Fahrlehrerinnenausweis wird eingezogen. Zum Glück hat sich Theo bisher noch nie geirrt und auch jetzt ist keine der Titankugeln zu sehen.
Theo ist ein echter Technikfreak und hätte kein Problem damit, wochenlang nichts anderes zu tun, als an den Teilen auf dem riesigen Tisch in seinem Zimmer herumzubasteln. Ich würde die Wände hochgehen, wenn ich nicht regelmäßig raus ins Wasser könnte. Theo hat die Wachsamen Augen beobachtet, die genauen Routen und Strecken auch der entferntesten Kameras verfolgt.
»Auf die Plätze … fertig … LOS!«
In die Schiffe kommt Bewegung. Das Wasser um uns wird aufgewirbelt und mein U-Boot beginnt zu schwanken. Bismillah. Ich schaue nach unten, drücke den Steuerhebel nach vorn und tauche tiefer, bis ich mich knapp über den riesigen Solarbrennstoff-Speicherrohren befinde. Phosphor-Fasern sind darauf gestreut worden und die festlich leuchtenden Stränge vermischen sich mit der grünen Welt der Algen, die sich auf der Oberfläche der Rohre angesiedelt haben.
Aus meinen Lautsprechern dröhnt jetzt ein Album aus dem letzten Jahrzehnt und ich brause Richtung St Paul’s, steige im Takt der Musik auf, sinke ab und fahre Ausweichmanöver. Meine Laune wird immer besser, mein Herz weitet sich.
Ich rase über eine riesige Eiweißpflanze und altmodische Dächer hinweg, die wie Grabsteine der Alten Welt emporragen. Das strahlend weiße Licht der hohen Laternen beleuchtet das dämmrige Gewirr der Straßen wie uraltes Mondlicht von einem vergessenen Himmel.
St Paul’s kommt in Sicht. Das Check-in-Boot schwebt über der Kathedrale, die Scheinwerfer auf das gerichtet, was von der Kuppel des alten Wahrzeichens übrig geblieben ist. Ein riesiger Heilbutt schwimmt gerade durch das offene Dach ins Innere. Die Zerstörung ist die Folge eines Anthropoiden-Angriffs vor 20Jahren – einer der gewalttätigsten dieser Terroristen. Ich blinke, bis das Boot meine Anwesenheit registriert. Im nächstgelegenen Wohnblock gehen gerade die ersten Lichter an, das würfelförmige Gebäude erwacht zum Leben. London wacht auf.
Ich reiße mich von dem Anblick los und mache mich in Richtung Trafalgar Square davon. Ich brause durch eine Straße nach der anderen, lasse Häuserblock um Häuserblock hinter mir, rase vorbei an all den Ruinen, dem Verfall und dem Leben dieser Stadt auf dem Meeresgrund.
Meine größte Schwäche beim Bootsrennen ist, dass ich mich zu leicht ablenken lasse. Es ist zum Verrücktwerden. Etwas zum Anschauen hier, eine andere Sache dort und sofort schweifen meine Gedanken ab und ich bin »auf See verschollen«, wie Tabs gern sagt. Gar nicht gut.
So früh am Morgen gibt es noch nicht viel Verkehr, es ist nur das ein oder andere Fahrzeug unterwegs. Ich erreiche das Clio House in Rekordzeit. Das riesige Bauwerk ist Großbritanniens bisher größtes Gebäude für das Nachspielen historischer Ereignisse, aber mir ist die Holozone der Zwillinge lieber – da sind wir unter uns und müssen uns auch nie verkleiden. Ich checke ein und düse weiter.
Ich schaue mich kurz um, weit hinter mir schwebt ein anderes Boot mit abgeblendetem Licht. Es ist vielleicht keiner meiner Gegner, doch ich will auch kein Risiko eingehen, nicht heute. Unter mir blitzt ein Lichtstrahl auf, als die erste U-Bahn des Tages durch den transparenten Tunnel rauscht und die Meereswesen in der Nähe aufschreckt. Ich tauche darauf zu und gleite über die Trümmer auf dem Meeresboden. Das verrostete Skelett eines Busses, von einem dicken Moosteppich überwuchert, und eine Telefonzelle, die unter einer großen Statue eingeklemmt ist – ein Mann, der auf irgendeinem Tier reitet –, liegen dort eingebettet in Meeresschwamm. Der hat einen Schwarm neugieriger Heringe angezogen. Ich muss weiter.
Da, die letzte Station. Ich steuere geradewegs auf den langen Schatten des Island House Project zu. Das hohe Gebäude ragt vor mir auf.
Die Türme sind mit der Absicht gebaut worden, dass sie nach den Überschwemmungen noch über die Wasseroberfläche hinausragen. Damit sind sie Teil eines weiteren gescheiterten weltweiten Projekts. Kein Wissenschaftler hat damals vorausgesehen, wie katastrophal hoch der Meeresspiegel am Ende steigen würde, und die Türme haben schließlich vollständig unter Wasser gestanden – bis heute ohne irgendeine Verbindung zur Welt darüber.
Das Check-in-Boot schwebt wartend über einem der Dächer. Das ganze Dach ist ein Spiegel der Hoffnungen der Alten Welt: ausgestattet mit allem möglichen Kram zum Überleben, einschließlich eines Hubschrauberlandeplatzes.
Ich rase weiter, zurück zu den Zwillingen an der Tower Bridge. Ein Schwarm schimmernder Lachse stiebt vor mir auseinander und die Fische flüchten vor meinem U-Boot. Meine Augen verengen sich, als sich das Wasser vor mir klärt. Ich erstarre.
Es ist nicht mein U-Boot gewesen, das die Lachse verscheucht hat.
Ein unförmiger Schatten erhebt sich aus den Tiefen und hält direkt vor mir.
Mein Puls beschleunigt sich.
Er ist schwarz wie Öl und so breit wie mein Boot. Ich kann nicht genau erkennen, was es ist, es könnte alles sein. Es wendet den Kopf und schwimmt auf mich zu. Anstelle von Augen hat es zwei milchig-weiße Schlitze, die starr auf mich gerichtet sind, während es immer näher kommt. Was zum …?
Ich weiche aus, umklammere Gas- und Steuerhebel fester und verfehle das Tier glücklicherweise um ein paar Zentimeter. Aber ich habe die Kurve zu eng genommen, das U-Boot beginnt zu schlingern und gerät außer Kontrolle. Ich atme tief ein und aus, während ich der wirbelnden Drehung entgegenwirke, indem ich die Tragflächen neu positioniere.
Kein Grund, sich von der Panik überwältigen zu lassen. Ich bin in Sicherheit. Ich bin zu Hause, in London. Wir sind hier nicht draußen in der Wildnis und ich habe nichts zu befürchten.
Schließlich lässt das Strudeln so weit nach, dass ich bemerke, wie die schattenhafte Kreatur in die Tiefe zurückweicht. Ich erschaudere. Eine Bewegung neben mir fällt mir ins Auge und schon flitzt ein rundes gelbes U-Boot an mir vorbei auf die Tower Bridge zu.
Malik. Nein.
Ich schiebe den Gashebel ganz nach vorn, ziehe den Steuerknüppel durch und steige durch die Wellen, die nun viel unruhiger sind, auf. Komm schon. Ich sehe die Brücke, ihre blinkenden Lichter scheinen mich zu rufen. Malik ist jetzt genau unter mir und rast darauf zu. Ohne die Geschwindigkeit zu drosseln, stürze ich mich in einen 45-Grad-Tauchgang. Ich halte die Luft an. Komm schon, komm schon … Malik ist schnell.
Aber ich bin schneller. Ich überhole sein Boot und schiebe mich weiter voran, während ich mein Fahrzeug wieder gerade ziehe. Bitte, bitte, ich muss Erste werden! Ich werfe einen schnellen Blick in die Runde, sehe aber nur das Schiff der Zwillinge. Ich kippe mein Boot leicht nach rechts, schwebe über die Brücke und blinke wie verrückt mit allen Lichtern. Mein Armband blitzt auf und ich höre die Zwillinge laut schreien: »Du hast es geschafft!«
YES! Meine Schultern entspannen sich. Wenn die Anwälte mit einem Ja antworten – bitte, lieber Gott –, dann ist das Geld so gut wie weg und ohne es wäre ich in echte Schwierigkeiten gekommen.
Ich führe eine Fehlerdiagnose durch – mit dem U-Boot ist alles in Ordnung. Puh! Und ich bin sicher, dass ich das Wesen nicht gerammt habe. Gott sei Dank. Ich sollte mir mehr Zeit nehmen zu trainieren, das U-Boot zu stabilisieren, wenn es in einen solchen Strudel gerät. Die Panik irgendwie bezwingen. Ein freier Fall. Das ist die einzige Möglichkeit.
Nein, nie, niemals wieder werde ich einen freien Fall ausprobieren. Der eine grauenhafte Versuch vor ein paar Monaten, den ich abbrechen musste, hat mir gereicht, und zwar für den Rest meines Lebens!
Während wir auf die übrigen Teilnehmer warten, überlegen die Zwillinge und ich, was wir später am Vormittag noch machen wollen. Auf jeden Fall etwas Leckeres essen, ohne Ende in der Holozone zocken und die Liveübertragung der Auslosung für den Londoner Unterwassermarathon – das jährliche Hindernisrennen durch die Hauptstadt – anschauen.
Das anspruchsvolle Rennen ist eine ziemlich große Sache. Aber es dürfen nur hundert Leute teilnehmen, also erwartet eigentlich niemand, wirklich einen Platz zu ergattern. Wenn ich mir vorstelle, ich hätte die Chance, bei einem so wichtigen und komplizierten Hindernisrennen wie dem London Marathon mitzumachen! Um sicherzugehen, dass die eigentliche Route unbekannt bleibt, werden in der ganzen Stadt nach dem Zufallsprinzip zusätzliche Rennstrecken aufgebaut und wie jedes Jahr bleiben auch die Hindernisse und die verschiedenen Herausforderungen bis zuletzt geheim. Es ist ein unglaublich schwieriger Wettbewerb. Aufregend, aber sehr fordernd.
»Hab einen schönen Morgen mit deiner Familie, Leyla«, sagt Theo.
Ich merke, wie es in meinem Bauch wild kribbelt, als mir einfällt, dass das beste Geschenk aller Zeiten kurz bevorsteht – echte McQueen-Familienzeit –, und ich kann nicht aufhören zu lächeln, während ich nach Hause brause.
Ich beschleunige noch einmal und gröle den Text des alten Poprock-Stücks mit. Schließlich steuere ich auf die Böschung zu und drossele das Tempo, während ich an meinem langen Wohnblock entlangfahre. Das eingeschossige Gebäude ist nicht besonders schön, aber zumindest wasserdicht – ich habe Glück. Ich nehme einen schnellen Scan der unmittelbaren Umgebung vor, um sicherzustellen, dass heute keine Schiffe in den Schatten lauern.
Mit einem schleifenden Geräusch kommt das U-Boot an der Parkwand meiner eigenen Bucht zum Halten und ich manövriere so lange, bis ich den Bug in die richtige Position gebracht habe und höre, wie er einrastet. Die Fahrzeugdichtung tritt an den Rändern der Karosserie aus und bläht sich zu einer großen ovalen Form aus robustem, wasserdichtem Material auf, bis sie an die Dichtung des Docks heranreicht. Ich rutsche auf meinem Sitz herum, ein breites Lächeln im Gesicht. Gleich ist es so weit! Sobald die Dichtungen miteinander verbunden und das Schiff sicher und wasserdicht eingeschlossen ist, wird das überschüssige Wasser herausgesaugt. Die Kuppel meines Boots öffnet sich, als die Tür zum Gebäude freigegeben wird und mir Zugang gewährt. Ich schnalle mich ab und springe in den engen Schacht hinunter. Sobald die Außenklappe hinter mir wieder gesichert ist, öffnet sich die Innenluke und ich stürme in den langen düsteren Gang dahinter.
Ich halte mir die Nase zu, um die unangenehm riechende Feuchtigkeit nicht einzuatmen, renne über den Boden aus Harz, vorbei an endlosen Reihen grauer Metalltüren. Die blassblauen Wände sind rissig, die Farbe blättert ab und überall breiten sich die fleckigen Spuren von Schimmelpilzen aus.
Als ich die Wohnung betrete, springt Jojo sofort schwanzwedelnd um mich herum. »Es ist fast so weit, Baby.« Ich werfe meine Jacke ab und streichle den Malteser-Welpen.
Ich hüpfe auf Zehenspitzen den schmalen Gang vor dem Wohnraum entlang und halte den Atem an. Gleich! Jojo ist zu neugierig, um stillzusitzen. Das weiße Hündchen mit dem flauschigen Fell umkreist meine Beine und bleibt nur stehen, um mit aufgestellten Ohren die dünne Tür des Wohnzimmers zu beobachten.
Dahinter erklingen himmlische Töne, Lieder vergangener Weihnachten. Jojo macht einen Schritt zurück, ihre braunen Augen sind unverwandt auf die Tür gerichtet. Ich schnappe mir das Hündchen, hebe es hoch und atme tief ein.
Es ist so weit.
Die Tür geht auf. Ich betrete den kleinen Raum, schlage mir die Hand vor den Mund und Wärme breitet sich in mir aus. Jojo ist aus meinen Armen gesprungen, wedelt mit dem Schwanz und hüpft wieder um mich herum, aber ich habe nur für eins Augen.
Papa steht vor dem riesigen Fenster.
»Salaam, Gürkchen! Also, wie gefällt’s dir?« Er lächelt sein schiefes Lächeln, seine haselnussbraunen Augen funkeln und er zeigt auf seinen ausgeblichenen roten Weihnachtspullover.
Mein Puls rast. Ich starre ihn an, ohne zu blinzeln.
»Salaam, Papa. Ich … ich finde, er sieht richtig toll aus.« Wärme steigt mir ins Gesicht.
Das »festliche« Muster seines Pullovers ist eigentlich die Karte eines weit entfernten Sonnensystems, das meinen Vater wegen seiner Abgeschiedenheit und seiner Möglichkeiten fasziniert. Die verschiedenfarbigen Planeten sehen jedoch aus wie Baumkugeln und mit der Zeit ist das Oberteil zu seinem Weihnachtspullover geworden. Meine Mutter hat es ihm lange vor meiner Geburt geschenkt.
Ich sollte etwas sagen, aber ich betrachte ihn nur schweigend, mein Lächeln vertieft sich.
»Da ist ja meine kleine Queenie.«
Ich drehe mich zu der sanften Stimme um. Meine zierliche Mutter steht vor der gegenüberliegenden Wand neben der hohen türkisfarbenen Vase, die sie für meinen Vater bemalt hat, und lächelt mich mit ausgestreckten Armen an.
»Komm her, meine Schöne, lass dich von deiner Mama umarmen. Meine kleine Leyla.«
»Salaam, Mama.« Ich trete näher. Ich fühle mich zugleich benommen und hellwach, eine wohlige Wärme breitet sich von meiner Brust in meinem gesamten Körper aus. Mamas grüne Augen, ihre sandfarbene Haut und ihr langes Haar, dunkel wie Ebenholz, gleichen mir auf unheimliche Weise. Wir sind uns so ähnlich. Meine Kabuli Peree nennt Papa uns immer – seine Feen aus Kabul.
Wie zu allen besonderen Anlässen trägt meine Mutter einen traditionellen afghanischen Kameez. Die leuchtenden Farben des langen, fließenden Stoffs lassen diesen tristen Ort gleich freundlicher wirken. Wie ein Regenbogen der Alten Welt nach einem Schauer. Mama neigt den Kopf und lächelt. Von ihrem silbernen Tikka-Stirnschmuck baumeln winzige Perlen herab und tänzeln bei jeder Bewegung.
»Möchtest du uns die Ehre geben, Gürkchen?«, fragt Papa und zwinkert mir zu.
Ich könnte heulen, als ich zum Schränkchen laufe und die schönste Schneekugel aller Zeiten heraushole. Es ist eine McQueen-Familientradition, sie zu besonderen Anlässen zu betrachten. Ich halte sie hoch, damit beide sie sehen können, und Papas Gesicht leuchtet auf. Ich streiche über die glatte Oberfläche der Kugel.
Diese Miniaturdarstellungen, meistens solche aus der Alten Welt, sind begehrte Sammelobjekte. Je älter die Szenerie im Inneren, desto größer der Wert. Manchmal handelt es sich um eine Häuserreihe in einer belebten Straße oder einen mit Bäumen und Blumen bestandenen Hügel oder einen belebten Kinderspielplatz.
Ich mag die eher unbeliebten Wasserszenerien am liebsten.
Ich schüttle die Kugel und halte den Atem an. Winzige Regenbogenfische tummeln sich zusammen mit glitzernden Quallen im türkisfarbenen Meer um ein U-Boot herum, aus dessen Fenstern warmes Licht fällt. Es ist perfekt. Eine ganze Welt in meinen Händen.
Der Weihnachtssong ist vorbei und als Nächstes erklingt laut und fröhlich ein beliebtes Festtagslied. Ich lache, und während ich die Schneekugel abstelle, nicke ich mit dem Kopf im Takt der Musik. Alles ist einfach himmlisch. Ich könnte platzen vor Glück. Es ist fast zu viel. Ob man vor lauter Freude überschäumen kann? Gott, ich hoffe nicht, denn ich möchte, dass dieses Gefühl ewig anhält. Ich beginne zu hüpfen und zu tanzen, während Jojo immer aufgeregter wird. Papa kichert. Mama lächelt.
Ich strahle. Sie sehen beide so glücklich aus. Es kribbelt mich am ganzen Körper. Es ist ein magischer Moment. Ich hätte nie gedacht, dass ich so glücklich sein könnte.
Das Lied hallt laut durch den kleinen Raum. »We wish you a merry-erry-erry-erry …«
Ich halte mitten in meiner Drehung inne, als die Musik ins Stocken gerät.
»And a happy new-w-w-w-w-w-w …«
Jojo fängt beim abgehackten Klang der Töne an zu knurren. Ich lege die Hände auf meinen Bauch. Meine Augen weiten sich; ich wirbele zu Papa herum. Er sagt etwas, aber die Worte überlagern sich.
Er beginnt zu flackern und zerfließt in bunte, lang gezogene Linien.
Dann ist er weg.
»Nein! Nein, nein, nein …« Plötzlich breitet sich Kälte in mir aus. Ich wende mich zu Mama um. Es ist niemand mehr da.
»Nein, nicht jetzt schon, das ging zu schnell! Bitte!«
Jojo hört auf zu bellen und steht ganz still. Es ist dunkel und ruhig. Ich blinzle immer schneller, um das Brennen in meinen Augen loszuwerden, und versuche, an dem Kloß in meinem Hals vorbeizuschlucken. Das Gewicht auf meiner Brust droht mich zu erdrücken. Das Wasser draußen wirft wellige, gespenstische Schatten auf die schimmeligen Wände rundum. Die Hilfsbeleuchtung geht an und taucht den stillen Wohnraum in trübes Dämmerlicht.
Ich bin allein.
2
Ich presse mein Gesicht gegen die Fensterscheibe des dämmrigen Wohnraums und starre hinaus in die Dunkelheit. Jojo winselt auf meinem Arm.
»Hey, du brauchst keine Angst zu haben, du verrücktes Tier«, flüstere ich und schlucke mühsam. »Es ist nur ein Stromausfall. Ich pass auf dich auf, Kleine. Alles wird gut, du wirst schon sehen.« Ich küsse sie auf ihre Knopfnase.
Ich schaue wieder auf die Wand hinter mir. Mit viel Glück melden sich die Anwälte heute noch bei mir; schließlich ist Weihnachten. Aber die Möglichkeit besteht und ich hoffe, der Stromausfall dauert nicht mehr lange an.
Ich ziehe die bunte Decke etwas enger um uns beide und atme den schwachen Duft meines Vaters nach Zitronen und Kräutern, der immer noch in den Maschen hängt, tief durch die Nase ein. Es hat mich monatelange Arbeit gekostet, die verschiedenen Quadrate aus Wollresten zu häkeln. Papa hat steif und fest behauptet, es sei das schönste Geschenk, das er jemals zum Zuckerfest bekommen habe. Mein Herz krampft sich zusammen.
Warum ist ausgerechnet jetzt mal wieder der Strom ausgefallen? Verdammt! Theo hat ewig gebraucht, um die Videoclips, die er aus Papas Dateien ausgegraben hatte, so perfekt zusammenzuschneiden, dass es wie eine einzige richtige Szene wirkt. Dennoch war alles nur eine Projektion. Wenn ich daran denke, dass ich mir ganz heimlich vorgestellt habe, mein Vater könnte heute tatsächlich nach Hause kommen – eine vorzeitige Entlassung vonseiten der Behörden.
Ich lasse den Kopf hängen. Das fröhliche Lachen meiner Mutter aus der Aufnahme klingt mir noch in den Ohren nach. Ich bin erst drei Jahre alt gewesen, als es aufgezeichnet wurde, daher habe ich keine tatsächliche Erinnerung daran. Ich atme tief ein.
»Gott segne dich, Mama. Ruhe in Frieden.« Meine Mutter ist ein Jahr nach diesem Video plötzlich im Schlaf gestorben.
»Halt durch, Papa, wo auch immer du bist«, flüstere ich, lege eine Hand auf die Fensterscheibe und schaue auf das vertraute Unbekannte. In einer Londoner Einrichtung eingesperrt, ist alles, was man mir über seinen Aufenthaltsort gesagt hat. Irgendwo da draußen in dieser Stadt, in ihren dunklen Weiten, ist mein ganzes Leben. Der allzu bekannte Schmerz zieht an mir und haftet sich an jeden meiner Gedanken. Die Abwesenheit meines Vaters ist unerträglich.
Ich klopfe ungeduldig mit dem Fuß auf den Boden und schaue wieder auf die gegenüberliegende Wand. Komm schon.
Weiße Notlichter blitzen durch das grünblaue Wasser dieses frühen Morgens, das sich hoch über mir auftürmt. Etwas Längliches schießt draußen an uns vorbei und Jojo erschreckt sich. Sie steckt ihren Kopf unter meinen Pullover. Das Etwas wird langsamer – es ist ein Aal. Er schlängelt sich am Fenster entlang und schwimmt dann weiter, um den Rücklichtern eines Sicherheitstauchboots zu folgen. Überall im Wasser blinken jetzt Fluoreszenz- und Phosphorlampen, als ein Riesenaufgebot an Polizei-, Kranken- und Sicherheitsfahrzeugen vorbeirast.
»Sieht ernst aus, Jojo.« Ich versuche, den Welpen zu streicheln und meine aufsteigende Furcht zu unterdrücken: Könnte der Stromausfall von Anthropoiden ausgelöst worden sein?
Ein großer kugelförmiger News-Bot, der aussieht, als wäre er aus den Resten eines Wracks und ein paar Knicklichtern zusammengebastelt worden, rauscht an meinem Fenster vorbei. Einige Sekunden später erscheinen weitere, jeder mit dem Logo seines Nachrichtenkanals versehen, und pflügen in rasender Geschwindigkeit durch die Wellen, den Fahrzeugen auf der Spur. Es ist also wirklich ernst.
Da ertönt ein »Ping«, der Strom ist wieder da und statt der dämmrigen Notbeleuchtung flammt grelles Licht im Raum auf. Die Kommunikationswand des Wohnraums erwacht flimmernd zum Leben und zeigt auf meine Interessen zugeschnittene Informationen auf ihrer Oberfläche an.
In der Küche bestelle ich einen Tee bei der Getränkefee und eile mit einer dampfenden Tasse Kahwa zurück zur Wand. Der beruhigende Duft von Safran, Zimt und Kardamom erfüllt den Raum.
Ein Alarmsignal poppt auf: Ich habe meine monatliche Rate an den Entdeckerfonds noch nicht bezahlt. Ich rufe mein Guthaben bei der Bank auf und verziehe das Gesicht bei dem Anblick. Ich wische das Alarmsignal weg und überfliege meine Nachrichten, während ich Jojo anziehe.
Die Vagabunden versuchen mal wieder eine ihrer üblichen Gaunereien, jetzt sind sie angeblich »so kurz davor, das sagenumwobene Festland zu entdecken«, wenn sie von mir nur eine »regelmäßige finanzielle Unterstützung« erhalten. Ich schnaube. Na klar, schnell mal 500Pfund rüberschieben, nichts leichter als das!
Erstens gibt es oben außer ein paar Berggipfeln kein trockenes Land mehr und zweitens würde die Entdeckung von Land mein Problem nicht einmal ansatzweise lösen.
Es folgt eine weitere Warnung der Behörden, in der ich aufgefordert werde, die ständigen Bittschriften und Beschwerden wegen der Verhaftung meines Vaters einzustellen. Verdammt unwahrscheinlich.
Ich schüttle den Kopf und knete meine Finger, als ich am Ende der Morgenpost angelangt bin. Keine Nachricht von den Anwälten.
»Jeeves?«, rufe ich, um den Haushälter zu aktivieren.
»Guten Morgen, Miss Leyla. Was kann ich heute für Sie tun?« Die Stimme, die von der Kommunikationswand kommt, klingt immer gleich, weil die Menschen sie als vertraut und beruhigend empfinden.
»Jeeves, heute Morgen wurde eine Datei abgespielt, als der Strom ausgefallen ist. Ist es möglich, sie noch mal abzuspielen?«
Jojo gibt sich bereits alle Mühe, ihren Festschmuck wieder loszuwerden.
»Es tut mir leid, Miss Leyla, aber der Stromausfall hat die Datei zerstört. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun?«
Ich werde niemals die ganze Szene sehen können. Ich schlucke meine Enttäuschung hinunter.
»Wie ist es zu dem Stromausfall gekommen? Ich will ein paar Weihnachtsbesuche machen – die Zwillinge und Opa. Sind meine Fahrrouten durch den Ausfall beeinträchtigt?«
Jojo kläfft begeistert auf, als es ihr gelingt, das kleine Hütchen vom Kopf zu schütteln. Sie bemerkt, wie ich sie anfunkle, und flitzt davon.
»Miss Leyla, der Stromausfall wurde durch einen Zwischenfall in Marylebone ausgelöst. Obwohl die Behörden zunächst ein Verbrechen nicht ausgeschlossen haben, melden die Rettungsdienste nun ein Seebeben als Ursache. Die darauffolgenden Reisebeschränkungen betreffen die von Ihnen geplanten Fahrten nicht. Möchten Sie, dass ich Ihnen ein Taxi bestelle?«
Ein Verbrechen. Ich schlucke. Die Anthropoiden können von mir aus in die Hölle zurück, aus der sie gekommen sind.
Anthropoiden sind genetisch veränderte Menschen. Sie sind von Wissenschaftlern der Alten Welt in ihrer damaligen Verzweiflung erschaffen worden, sodass sie unter Wasser frei atmen können, hohem Druck standhalten und über große Kraft verfügen – damit sie den Überlebenden nach der Katastrophe helfen könnten, wenn Maschinen nicht reichen würden. Aber stattdessen entwickelten sie ein hohes Maß an Wut und Widerwillen, Blutdurst und Brutalität und wandten sich gegen uns.
Ihr einziges Ziel ist es zu zerstören. Sie sind unglaublich schlau. Im Wasser findet bei ihnen eine genetisch bedingte Transformation statt. Die Hautschicht, die ihnen als Kiemen dient, ist so gestaltet, dass sie wasserdurchlässig und nicht erkennbar ist. Das macht die Anthropoiden für uns noch gefährlicher. Es hat sich gezeigt, dass sie ein wirklich schrecklicher Fehler gewesen sind, für den die Menschheit bis heute bezahlen muss.
Erst letztes Jahr hat einer von ihnen die Gelegenheit genutzt und unschuldige Menschen getötet, als deren Tauchboot bei einem Seebeben in Schwierigkeiten geraten ist. Ein Wachsames Auge erwischte den Anthropoiden dabei, wie er mit Werkzeugen versuchte, das Fahrzeug zu beschädigen, anstatt der Familie darin zu helfen. Innerhalb kürzester Zeit war die Wand des U-Boots durchbohrt und nach allem, was man hört, ist die Familie durch den hohen Druck gestorben, noch bevor sich das Innere überhaupt mit Wasser gefüllt hatte.
Ohne die Bemühungen von Premierminister Gladstone, die Anthropoiden aufzuspüren und aufzuhalten, hätten diese todbringenden Kreaturen noch viel mehr Leben auf dem Gewissen. Als wäre unsere Umwelt, jedes Mal wenn wir uns nach draußen wagen, nicht schon bedrohlich genug.
»Ich brauche kein Taxi, Jeeves, ich habe Tabbys U-Boot. Hast du heute schon Papas Dateien durchsucht? Ich habe angegeben, worauf du achten sollst.«
»Das habe ich, aber es gibt nichts zu berichten. Kann ich sonst noch etwas tun?«
Ich seufze. »Bitte führ noch die täglichen Scans durch.«
Es muss doch irgendetwas zu finden sein, womit ich die Unschuld meines Vaters beweisen kann – auch wenn ich gar nicht weiß, nach was für Hinweisen Jeeves eigentlich suchen soll. Seit der Verhaftung meines Vaters sind nun schon drei Monate vergangen und ich habe nichts entdeckt, was Licht in die schrecklichen Anschuldigungen gegen ihn bringen könnte.
Ich komme an einer mittlerweile wieder komplett ausgezogenen und zufriedenen Jojo vorbei.
»Hey, du Clown, jetzt muss ich dich unterwegs anziehen. Versuch heute brav zu sein, Jojo.«
Das Hündchen lässt den Kopf hängen, springt dann aber in die Hängematte, die Papa für sie gemacht hat, und lässt sich schaukeln.
»Oh nein, lass das, du Faultier! Wir müssen in einer Minute los zu den Zwillingen.«
Nur wenige Leute haben ein echtes Haustier. Haustiere sind so teuer wie Antiquitäten. Ich hatte riesiges Glück. Jojo ist ein Dankeschön von jemandem gewesen, dem mein Vater geholfen hat, als dessen minderwertige Immobilie begann, Anzeichen von Druckschäden aufzuweisen. Damit er die Kaution für eine sichere Wohnung hinterlegen konnte, hat mein Vater ihm etwas von unserem wenigen Geld geliehen.
Mein Armband blinkt: Opa! Ich leite den Anruf auf die gegenüberliegende Wand und das Gesicht meines Großvaters erscheint in Großaufnahme. Jojo wedelt mit dem Schwanz, als sie ihn sieht. Er lächelt und seine hellgrünen Augen verschwinden fast unter seinen buschigen grauen Augenbrauen.
Ich trete näher. »Salaam, Opa! Wie geht’s dir?« Ich kneife die Augen zusammen. »Du siehst noch blasser aus als sonst.«
»Schalom, mein Kind. Unsinn, ich bin fit wie ein Turnschuh.« Er rückt ein Stück von seiner Kommunikationswand ab und ich sehe, dass er sich in seinem Arbeitszimmer befindet. Er hebt seinen Stock und macht ein paar unbeholfene Tanzschritte, die mich wohl beruhigen sollen, aber nur noch mehr bedrücken. Ich starre in sein geliebtes, verwittertes Gesicht. Er hat zwei Wochen nach der Verhaftung meines Vaters einen Herzinfarkt gehabt und sich bis heute nicht vollständig davon erholt.
»Solange du richtig isst, Opa. Wenn ich dich heute Abend besuche und sehe, dass du keine Vorräte dahast, kriegst du es mit mir zu tun!«
»Deswegen rufe ich an, Queenie.« Mein Großvater zieht einen Stuhl heran und setzt sich. Er senkt den Blick. »Der Sohn eines guten Freundes ist vorbeigekommen und ich fürchte, ich bin heute sehr beschäftigt. Könnten wir uns treffen, wenn er wieder weg ist?«
»Oh, ach so … Na gut, aber mach dir einen schönen Tag, Opa, was immer du auch tust.«
»Das verspreche ich. Es tut mir leid, meine Kleine. Du fehlst mir natürlich. Und du hast bestimmt auch genug zu tun, hoffe ich?«
»Oh ja. Ich fahre zu den Zwillingen, sobald wir fertig sind.«
»Gut, gut.« Der Gesichtsausdruck meines Großvaters wird jetzt ernst, die Sorge hat sich in seine Züge gefressen. Er fährt sich über den Kopf im Versuch, das Durcheinander seiner grauweißen Haare zu glätten. »Denk daran, du hast mir versprochen, dass du da draußen immer wachsam bist.« Er bemüht sich um einen lockeren Ton, aber seine Miene ist besorgt. »Dir ist nichts Ungewöhnliches aufgefallen, oder?«
In den letzten Wochen hatte ich häufiger das Gefühl, verfolgt zu werden. Jedes Mal schien es mir so, als hätte ich die Lichter eines Schiffes gesehen, die dann sofort abgeblendet wurden. Aber Opa von diesem Verdacht zu berichten, ist keine gute Idee. Er hat immer wieder darauf bestanden, dass ich jemanden bräuchte, der auf mich achtgibt.
Das brauche ich auf keinen Fall.
»Ich habe dir doch gesagt, ich kann gut auf mich selbst aufpassen, Opa. Mach dir keine Sorgen. Aber … sollte ich beobachtet werden, meinst du, das hängt zusammen mit … du weißt schon … mit Papa?«
Die Verhaftung meines Vaters hat meinen Großvater traumatisiert. Ich will ihn nicht aufregen, indem ich davon spreche, aber jedes Mal wenn wir miteinander reden, ist es das Einzige, woran ich denken kann.
Es ist alles so verwirrend. Großvater ist damals mit meinem Vater zusammen gewesen; sie sind beide Astronomen und arbeiten im Bloomsbury-Labor. Die Polizei hat das Gebäude gestürmt und meinen Vater weggebracht. Trotz seines schlechten gesundheitlichen Zustands versucht mein Großvater seitdem verzweifelt, eine Antwort darauf zu bekommen, in welchem Gefängnis mein Vater festgehalten wird und wie es sein kann, dass man ihn ohne den geringsten Beweis eines schrecklichen Verbrechens beschuldigt. Warum ist sein Fall »zu heikel, um Familie und Freunden den Kontakt zu dem Inhaftierten zu erlauben«? Nein, nichts davon ergibt auch nur irgendeinen verdammten Sinn.
Mein Großvater rutscht jetzt auf seinem Stuhl hin und her. »Alles ist möglich, mein Kind«, sagt er und senkt die Stimme. »Wenn du glaubst, dass jemand hinter dir her ist, begib dich sofort an einen sicheren Ort. Bitte. Du bist ein kluges Mädchen, Queenie. Sei vorsichtig.« Er richtet sich auf, sein Blick huscht unruhig durch den Raum hinter mir. »Ich wünschte, du würdest noch einmal darüber nachdenken, bei mir einzuziehen, Kind. Es wäre ja nur so lange, bis dein Vater wieder da ist. Und du solltest nicht …«
»Du weißt, wie gern ich dich habe, Opa. Aber ich kann jetzt nicht umziehen.« Ich ringe die Hände. »Es tut mir wirklich leid. Doch ich hätte dann das Gefühl, ich würde Papa aufgeben. Er kann jeden Tag zurückkommen, inshallah. Tatsächlich müsste ich jeden Moment eine Rückmeldung von den Anwälten erhalten.«
Zum Glück bin ich bereits 16 und habe überhaupt eine Wahl. Wäre ich zum Zeitpunkt der Verhaftung einen Monat jünger gewesen, hätte ich zu Familie oder Freunden ziehen müssen oder man hätte mich unter die Vormundschaft des Staates gestellt. Ich muss mich weiter darauf konzentrieren, meinem Vater zu helfen, ich muss hier sein, wenn er zurückkehrt.
Mein Großvater dreht sich um, seine Aufmerksamkeit ist auf etwas anderes gerichtet. Wahrscheinlich ist sein Besucher gerade eingetroffen. »Ich muss jetzt Schluss machen, Queenie. Sobald ich wieder Zeit habe, kommst du vorbei. Viel Spaß bei den Campbells und umarme diesen Schlingel Jojo von mir.«
Ich schlucke meine Enttäuschung hinunter. Ein weiteres Gespräch, in dem ich nichts Neues über Papas Situation herausgefunden habe. »So machen wir’s, Opa. Bis bald.«
Der Wohnraum ist ohnehin schon klein, aber manchmal, so wie jetzt, scheinen die Wände noch enger zusammenzurücken. Ich rolle eine große Leinwand neben der Albumwand auf. Darauf befinden sich alle meine wertvollen handgezeichneten Karten, die ich im Laufe der Jahre angefertigt habe. Papa hat es immer irgendwie geschafft, den Kauf des Papiers zu ermöglichen. Sie zeigen alle Gewässer um Großbritannien herum.
Auf einer der Karten klebt ein kleiner Zettel. Ich habe ihn aus dem Mülleimer meines Vaters gefischt, als ich nach der Verhaftung sein Zimmer auf der Suche nach Antworten durchwühlt habe. Es sind nur einige Notizen, Memos für Alltagskram, ein paar Koordinaten für Cambridge – mein Vater reiste für seine Arbeit viel herum –, aber sie sind handgeschrieben. Seine Handschrift zu sehen, beruhigt mich. Außerdem haben die Behörden fast alle seine Sachen abholen lassen und von dem wenigen, was mir noch geblieben ist, werfe ich nichts weg.
Aus dem Augenwinkel nehme ich eine Bewegung auf der Kommunikationswand wahr und schon erscheint dort in einer Ecke ein Avatar mit dem Logo der Kanzlei Dickens & Söhne, Rechtsberatung und Dienstleistungen. Die Anwälte – endlich!
Ich wische über den Bildschirm, um die Nachricht zu öffnen. »Start.«
»Miss McQueen. Vielen Dank für Ihre Anfrage bezüglich der rechtlichen Vertretung von Hashem McQueen. Leider sehen wir uns nicht in der Lage, den Fall Ihres Vaters zu übernehmen. Wir raten Ihnen, die Suche nach einer geeigneten Vertretung fortzusetzen. In der gegenwärtigen Situation, in der unsere Zahlen sinken und unser aller Überleben gefährdet ist, wiegt der Vorwurf, die Seekrankheit auszunutzen, um Beihilfe zum Selbstmord von Bürgern zu leisten, schwer. Alles Gute und freundliche Grüße.«
Was …? Das kann nicht wahr sein! Ich schüttle den Kopf. »Wiederholen.«
»MrDickens«, lege ich los, »mein Vater ist unschuldig. Die Polizei hat einen schrecklichen Fehler gemacht. Er hat niemals Menschen, die an der Seekrankheit leiden, bestärkt, sich das Leben zu nehmen. Er hat ihnen geholfen, wo er konnte. Es gibt keinerlei Beweise für die Anschuldigungen – das zählt doch bestimmt? Bitte überlegen Sie es sich noch einmal. Sie sind meine letzte Hoffnung. Wo in London ist mein Vater? Warum darf ich ihn nicht besuchen? Niemand darf doch einfach so verhaftet werden. Bitte helfen Sie uns.«
Er ist nicht mehr nach Hause gekommen, möchte ich hinzufügen. An diesem Tag vor drei Monaten ist er wie immer zur Arbeit gegangen, aber nicht mehr zurückgekehrt. Was ist hier los? Ich schlucke an dem dicken Kloß in meinem Hals vorbei. Mein Brustkorb wird plötzlich eng, meine Rippen fühlen sich an wie die Gitterstäbe eines Gefängnisses. Ich schnappe nach Luft. »Senden.« Die Nachricht verschwindet.
Das Info-Fenster auf der Kommunikationswand löst sich auf und Rule, Britannia erklingt, während nun ein Bild des »Besonderen Briten des Tages« gezeigt wird. Dazu spricht eine Stimme in feierlichem Ton: »Die heutige Schweigeminute widmen wir der Erinnerung an Wilhelm den Eroberer. Neben anderen herausragenden Leistungen geht die Zusammenstellung des Buch des jüngsten Tages, des ersten Grundbuchs, auf ihn zurück. In diesem Buch sind die alten Zeiten für immer bewa–«
Oh nein, nicht jetzt. »Ruhezustand, Desktop.«
Ich reibe mir über die Arme, schlinge sie dann um mich selbst und starre ins Nichts. Es stimmt, die Seekrankheit fordert viele Leben. Es ist eine schreckliche Krankheit, die das Wasser mit sich bringt. Sie beginnt schleichend – man muss auf die Zeichen achten. Als Erstes denkt man nicht mehr über die Zukunft nach und hört auf, über sie zu reden, weil man das Gefühl hat, sie könne einem nichts mehr bieten. Manche Leute gehen so weit, zu hungern, weil sie sich von ihrem Geld lieber Relikte aus der Alten Welt kaufen. Andere fangen an, wie besessen jeden noch so kleinen Fortschritt der Forschung zu verfolgen, und können es nicht ertragen, dass es keinen genauen Zeitpunkt für die Rückkehr an die Oberfläche gibt. Und dann ist da noch die tiefe Traurigkeit, in der die Betroffenen völlig versinken, und einige von ihnen nehmen sich das Leben.
Aber ich weiß ganz sicher: Papa hat allen Leidenden, die zu ihm gekommen sind, geholfen. Er hat versucht, ihnen neue Hoffnung zu geben. Er wusste, dass die Hoffnungslosigkeit der Auslöser der Seekrankheit ist, und hat alles getan, was er konnte, um ihnen etwas Zuversicht zu vermitteln.
Ich gehe ans Fenster und schaue hinaus in die strömenden Wogen. Wie soll ich meinem Vater jetzt helfen? Dickens & Söhne sind meine letzte legale Hoffnung gewesen.
Aus dem Augenwinkel nehme ich eine Gestalt wahr, zunächst noch weit entfernt, dann immer näher kommend. Ich richte den Blick darauf und schnappe nach Luft. Jojo hüpft aus der Hängematte, flitzt zu mir und springt in meine Arme. Sie hält ganz still und starrt ebenfalls hinaus.
Ein Delfin. Er muss mindestens zwei Meter lang sein. Ich lege meine Hand auf das Fenster. Wie sich das Tier wohl anfühlt? Wenn ich es nur berühren könnte. Es sieht so unbekümmert und glücklich aus.
Anscheinend hatten die meisten Meerestiere vor der Katastrophe verschiedene natürliche Lebensräume und eigene Wanderrouten. Heutzutage werden sie von den Lichtern der Schiffe und der Gebäude angezogen, aber ich habe noch nie gesehen, dass ein Delfin so nah herankommt. Er schwimmt sogar noch näher. Es ist ein Tümmler, der so mühelos durch das Element gleitet, als wäre er das Wasser selbst, als hätte ein Teil des Ozeans vor unseren Augen Gestalt angenommen.
»Schau mal, Jojo, er lächelt uns an«, flüstere ich.
Das Tier hält inne. Es wendet den Kopf und folgt dann dem, was seine Aufmerksamkeit erregt hat, bis es wieder außer Sichtweite ist. Ich hole tief Luft, lehne mich gegen das Fenster und heiße das plötzliche Gefühl von Leichtigkeit willkommen.
Hoffnung ist alles, was ich im Moment habe. Sie ist so unendlich wie der Ozean – und ich muss sie festhalten.
Alles, was ich brauche, ist ein Wunder.
3
Über uns funkeln die Sterne. Ein mitternachtsblauer Himmel, der uns hin und wieder mit einer Sternschnuppe belohnt. Eine sanfte Brise raschelt im Laub, das Mondlicht taucht alles in seinen sanften Schein. Alles an dieser Szene ist absolut magisch.
»Camping« ist so gemütlich und auf jeden Fall mein Lieblings-holozoneprogramm. Jojo bleibt wachsam und blickt mit einem leisen Knurren nach oben. Der Schrei einer Eule durchbricht die Stille.
Obwohl ich eigentlich schon zu viel gegessen habe, nehme ich mir noch Nachtisch. Es ist früh am Abend. Ich bin seit Stunden bei den Zwillingen und das Weihnachtsessen scheint schon wieder ewig her zu sein. Zum Glück ist eins unserer Lieblingsrestaurants in der Gegend vorbeigefahren und auf der Decke, die wir ausgebreitet haben, steht eine Auswahl an Köstlichkeiten, die mir das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Ich häufe mir Mangopudding, ein Kokosbrötchen, etwas Eis und frittierte Banane auf den Teller. Mhm. Theo schaut grinsend auf meine Schätze.
Ich ziehe die Augenbrauen hoch. »Soweit ich weiß, ist der Ramadan zum Fasten da – und alle anderen Gelegenheiten zum Feiern. Und überhaupt, ist dir eigentlich klar, wie viel ich vorhin bei Ripper’s Revels rennen musste? Der Serienkiller persönlich hat mich verfolgt. Ich habe noch nie so viele Runden hintereinander gespielt.«
»Total easy.« Tabby grinst und knabbert an einem Rippchen.
Theo lehnt sich vor und nimmt sich etwas von der Götterspeise und ein paar Kekse. »Was meint ihr, wird dieses Jahr jemand aus London einen Platz ergattern?«, fragt er.
Die ganze letzte Stunde haben wir uns über den London Marathon unterhalten.
Ich zucke mit den Achseln. »Wer weiß … Letztes Jahr haben eine Menge Leute aus dem Norden teilgenommen. Stellt euch vor … den ganzen Weg durch all das Wasser zu reisen, nur um für das Rennen hier zu sein.« Ich schaudere.
Theo richtet seinen Blick auf mich. »Leyla, ich habe mir überlegt … Vielleicht könntest du uns nächstes Mal begleiten, wenn wir die Stadt verlassen, um –«
Ich rutsche mit finsterem Blick auf meinem Stuhl herum. »Nicht das schon wieder, Theo.«
»Bitte«, sagt er. »Mum könnte dir im Handumdrehen Papiere ausstellen lassen, weil du mit uns reisen würdest. Dann müsstest du nicht noch zwei Jahre warten, bis du 18 bist.«
Ich funkle ihn an. »Warum musst du immer wieder davon anfangen? Über die Grenze zu fahren, ist echt nicht mein Ding. Der Rest des Landes interessiert mich nicht, akzeptier das endlich.« Nicht mal für Geld würde ich mich raus in die Wildnis wagen. All die unbekannten Gebiete und Kreaturen und Tausende von Gefahren, die dort überall lauern. Ich schlinge die Arme um meine Knie.
Tabby neigt den Kopf zur Seite und sieht mich mit zusammengekniffenen Augen an. »Du wirst es nicht ewig vermeiden können, London zu verlassen. Und du verpasst so viel, Leyla. Du müsstest unsere Hotels mal in echt sehen – die Filmaufnahmen von ihnen kommen da nicht ran. Theo hat dort alle möglichen technischen Wunderdinge installiert.«
Vivian Campbell, die Mutter der Zwillinge, hat die Hotelkette der Familie nach dem frühen Tod ihres Mannes vor zwei Jahren übernommen, als der Tunnel, durch den gerade sein Zug fuhr, zusammenbrach. Die Hotels sind so gebaut, dass jedes Gebäude an eine bestimmte Epoche der Alten Welt erinnert, ausgestattet mit Relikten und Möbeln aus dieser Zeit. Sie sind zu wahren Touristenmagneten geworden. Theo interessiert sich nur insoweit für das Familienunternehmen, als dass er die Hightech-Illusionen für die Gäste programmieren und installieren darf.
»Und du hast jeden meiner landesweiten Wettbewerbe verpasst«, fährt Tabby fort und schmiert sich Clotted Cream und Marmelade auf einen Scone. »Im neuen Jahr habe ich noch einen in Wales. Ich wünschte, du wärst dabei, wenn ich die so richtig plattmache.«
Tabby ist eine echte Meisterin in verschiedenen Kampfkunstdisziplinen. Ich habe sie beim Training beobachtet und fürchte, allein vom Zusehen schon blaue Flecke bekommen zu haben.
»Und das meint sie ernst.« Theo hält die Hände vor sich, als wolle er sich schützen. »Sie hat hier drin mit Samurai- und Ninja-Kämpfern geübt. Ihre Gegner stehen immer noch unter Schock. Gestern hat sie uns an Bord eines Schiffes in der Ägäis kämpfen lassen. Anscheinend haben wir den römischen General Julius Cäsar gerettet. Diese Piraten haben sie nicht kommen sehen!«
Tabby glättet ihr Haar. »Keiner dieser dämlichen Trottel war mutig genug, um es mit mir aufzunehmen.«
Ich esse auf, ziehe die Beine an und stütze mein Kinn auf den Knien ab. Mein Haar fällt mir wie ein Vorhang um die Beine. »Das ist einfach nicht mein Ding.« Es ist besser, bei dem zu bleiben, was man kennt – immer.
Es wird still. Jojo kaut auf ihrem karierten Kleidchen herum. Sie springt auf und kläfft, als Müller, der neueste Haushälter der Campbells, neben ihr Gestalt annimmt. Er trägt nur Fußballshorts, streckt die Brust heraus, wirft seinen blonden Zopf zurück und zwinkert mir zu. Ich kann mir ein Kichern nicht verkneifen.
Alle paar Monate wählen die Zwillinge abwechselnd eine neue Haushälterin oder einen neuen Haushälter aus. Die Programmierung bleibt dieselbe, nur Aussehen und Persönlichkeit ändern sich. Es ist immer lustig, wen Tabby aussucht. Im Moment handelt es sich um einen berühmten deutschen Fußballspieler aus den 20er-Jahren.
Tabby mustert Müller von oben bis unten und wirft ihm einen Luftkuss zu.
Der Haushälter erwidert die Geste, bevor er sie anspricht. »Eure Hoheit …«
Theo schnaubt und jetzt müssen wir alle kichern.
»… Ihr wolltet benachrichtigt werden, wenn die Marathon-Auslosung bekannt gegeben wird.«
»Ganz richtig«, sagt Tabby. »Danke, Müller. Das wäre dann alles.«
Flackernd verschwindet er aus unserem Blickfeld.
»Ruhezustand«, befiehlt Tabby und im Nu ist die Alte Welt um uns herum nicht mehr zu sehen.
Wir sind in der schimmernden Holozone, dem größten Raum im Haus der Campbells. Die virtuelle Installation ist ein Geschenk ihres verstorbenen Vaters zum 13. Geburtstag der Zwillinge gewesen.
Wir springen auf und entfernen unsere Sensoren und Linsen. Die Geschwister sind beide größer als ich, obwohl sie nur ein Jahr älter sind. Auf dem Weg in den Wohnraum begegnen wir ihrer Mutter, und während Tabby und Theo weitergehen, bleibe ich einen Moment stehen, um mit ihr zu reden.
Vivian, die genauso aussieht wie Theo, nur mit kürzerem Haar, neigt ihren Kopf in meine Richtung. Ein trauriges Lächeln erhellt ihre freundlichen blauen Augen. »Bleib über Nacht, Leyla. Du könntest dir die Jubiläumsfeier hier mit uns anschauen anstatt morgen in einem überfüllten Pub.«
»Das würde ich gerne, Viv. Nur … mein Vater und ich haben uns die Jubiläumssendung immer im Pub angesehen. Und obwohl er dieses Jahr nicht da ist, will ich trotzdem hin. Aber ich gehe noch nicht heim. Wir wollen erst noch die Auslosung für den Marathon verfolgen.«
Vivian nickt mitfühlend und ihre Augen verdunkeln sich. »Du solltest draußen noch vorsichtiger als sonst sein, Liebes. Diese Bestien haben letzte Woche bei den Färöern die Hölle losgelassen.« Sie schüttelt den Kopf.
Ich verziehe das Gesicht. »Ich habe es gesehen. Das war ein schrecklicher Angriff.«
Ein Schatten huscht über Vivians Gesicht. »Ich verstehe einfach nicht, wie sie es wagen können, unseren Siedlungen so nahe zu kommen.« Sie schaudert und schlingt die Arme um ihren Oberkörper. »Manchmal scheint es, als gäbe es gar keine Hoffnung mehr für uns. Wir sind für so ein Leben nicht gemacht. Wir sind für Tag und Nacht gemacht. Nicht für ewige Dunkelheit. Wen wundert es da«, sie senkt die Stimme, »dass so viele an der Seekrankheit leiden? Diese Hoffnungslosigkeit … Es gibt kein Heilmittel dagegen. Und mittlerweile vermehren sich diese Horrorgestalten immer weiter und weiter, wie die Mondfische.«
Ich schiebe mir die Haare aus dem Gesicht und sehe mich um, ob Tabby außer Hörweite ist. »Viv, bitte. Was ist, wenn Tabby das hört? Sie ist immer noch nicht ganz gesund.«
Vivian beißt sich auf die Lippen und wirft einen unschlüssigen Blick in Richtung Wohnraum.
»Wir können dieses Übel überleben«, fahre ich fort. »Das Leben hier unten hat mehr zu bieten als Anthropoiden. Wir haben eine riesige Veränderung auf der Erde durchgestanden. Und na ja, ich weiß, dass es natürlich kein bisschen so ist, wie das Leben oben war, aber … wir sind immer noch am Leben. Ich meine, das ist doch die Hauptsache, Viv: die Tatsache, dass wir noch immer da sind – und nicht, wo wir sind.«
Vivian sieht mich zweifelnd an. »Oh, Schätzchen, du bist jung und noch so naiv, Hoffnung zu haben, obwohl die Fakten so entmutigend sind. Aber du musst dir keine Sorgen um Tabitha machen – Theo und ich tun alles, um sie bei Laune zu halten. Nimm diese Last nicht auch noch auf dich, Liebes, du hast selbst genug zu tragen. Und ich würde meine Befürchtungen niemals vor ihr aussprechen.« Sie stößt einen langen Seufzer aus und lässt die Schultern hängen. »Mir ist sehr wohl bewusst, dass die Seekrankheit jederzeit zurückkehren und sie erneut zu einem Schatten ihrer selbst werden könnte wie …«
»Leyla!«, schreit Tabby und winkt mich aus dem offenen Wohnraum zu sich.
Vivian und ich wenden uns um und sehen, wie Tabby und Müller ziemlich eng miteinander tanzen.
»Tabitha!«, mahnt Vivian, lässt den Haushälter mit einer Handbewegung verschwinden und wir müssen beide lachen – genau, was wir jetzt gebraucht haben.
»Oh, bevor ich es vergesse! Bitte schön, Liebes.« Die Mutter der Zwillinge zieht ein kleines Fläschchen aus ihrer Tasche. Sie beugt sich zu mir, öffnet die Flasche und hält sie mir unter die Nase. »Ah, riech einmal daran. Echte Erde aus der Alten Welt! Nicht dieser nachgemachte Mist, den sie einem auf den Märkten andrehen wollen. Fröhliche Weihnachten, mein Schatz.«
Auch ich überreiche Vivian ein Geschenk. Vor ein paar Monaten habe ich auf dem Markt einen Gartenzwerg aus der Zeit der Jahrhundertwende gefunden. Der Millennium-Barock ist ihre Lieblingsepoche der Alten Welt – vor Kurzem wurde sie sogar zum Ehrenmitglied des Millennium-Barock-Ausschusses ernannt. Obwohl er mit Rissen übersät und an vielen Stellen geklebt ist, hat der Zwerg immer noch ein kleines Vermögen gekostet – zum Glück durfte ich ihn in Raten bezahlen. Ich bin mir sicher gewesen, dass er ihr gefallen würde.
»Weißt du, manchmal gelingt es mir«, sagt sie und umarmt mit wehmütigem Blick den Gartenzwerg, »das ganze Wasser einfach wegzudenken, und dann fühlt es sich irgendwie an, als wäre ich ein Teil der Alten Welt.« Ihr Armband blinkt. »Lass uns später weiterreden, Liebes. Es ist so schön, dass du hier bei uns bist.« Sie drückt mir einen Kuss auf die Stirn und nimmt den Anruf entgegen.
Ich gehe zu den Zwillingen in den Wohnraum. Das gesamte Haus der Campbells ist elegant und mit Hochglanzmöbeln eingerichtet. Der offene Wohnbereich wird von raumhohen Fenstern eingerahmt und ist allein schon so groß, dass unsere Wohnung daneben wie ein Schuhkarton wirkt. Alle Villen hier in der Gegend sind ganz individuell gestaltet.
Eine perlmuttartig schimmernde Kugel, der Putz-Roboter, schwebt an mir vorbei und beginnt, ein Schränkchen abzustauben, in dem Tabbys unzählige Kampfkunst-Trophäen und -Auszeichnungen ausgestellt sind. Mein Herz macht einen Hüpfer. Tabby hat mein Geschenk genau in die Mitte des Regals platziert. Es ist ein detailgetreues Origami-Modell von der 12-jährigen Tabby, wie sie mit ihrem Vater tanzt. Das gehört zu ihren schönsten Erinnerungen an ihn.
Mir stockt jedes Mal der Atem, wenn ich daran denke, dass die Zwillinge ihren Vater nie wiedersehen werden. Ich kann mir nicht einmal vorstellen, wie sich das anfühlen muss. Ein unerträglicher Gedanke.
Theos Miene erhellt sich auf einmal. »Dein Geschenk. Ich habe es dir noch gar nicht gegeben!«
»Noch eins? Ich habe doch schon was von dir bekommen! Die holografische Szene für mich zusammenzuschneiden, muss ewig gedauert haben.«
Er runzelt die Stirn. »Ist ja richtig toll gelaufen mit der Familien-Szene. Verdammtes Pech, dass der Strom genau in dem Moment ausgefallen ist.«
Ich drücke seinen Arm. »Ich musste gar nicht alles sehen, um es großartig zu finden. Bestes Geschenk aller Zeiten.«
Theo rennt hinaus und ist blitzschnell wieder zurück. »Ta-da!« Er hält mir ein langes, dünnes Päckchen hin.
Ich packe es vorsichtig aus, um das schöne Papier nicht zu zerreißen, es wäre perfekt für ein Origami-Modell. »Ein Regenschirm! Wahnsinn, danke, er ist toll!« Der Schirm ist aus lilafarbenem Stoff, der Stock bronzefarben. »Ich habe schon einmal einen in der Hand gehabt, als die Königliche Konservierungsgesellschaft einen Tag der offenen Tür hatte. Der war total verrostet und kaputt, aber dieser hier ist wunderschön!«
»Na gut, es ist kein richtiger Regenschirm«, sagt Theo und zwinkert mir zu. »Es ist …«
»… eine verdammt echte Waffe«, verkündet Tabby strahlend.
Mir fällt der Kiefer herunter. Ich habe noch nie eine Waffe besessen. Ich starre die beiden an, unschlüssig auf meinem Stuhl herumrutschend. Eine Geheimwaffe. Sie soll wie ein harmloser Regenschirm aussehen. Irgendwie ist es toll.
»Du kannst nicht allein leben, ohne eine Möglichkeit, dich zu verteidigen, Leyla«, meint Theo. »Ich habe neulich gesehen, wie Miss Petrov aus dem Finanzamt ins Bürgerhaus kam und einen Sonnenschirm in der Hand hatte, da bin ich auf die Idee gekommen: Ich könnte eine Waffe für dich entwerfen, die aussieht wie ein Accessoire. Und ich weiß ja, wie gern du es magst, dir Regen vorzustellen. Ach ja, und in der durchsichtigen Spitze ist eine Lampe.« Er legt mir beruhigend eine Hand auf die Schulter. »Der Schirm ist vollkommen ungefährlich, wenn er nicht aktiviert ist, keine Angst. Aber entweder du nimmst ihn oder du ziehst bei uns ein. Also, ich zeig dir am besten, wie er funktioniert.«
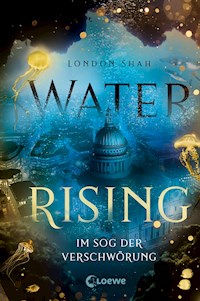













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)














