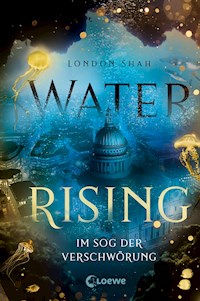
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Loewe Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Water Rising
- Sprache: Deutsch
Die Welt verändert sich – warum nicht wir? Leyla gilt ab sofort als Großbritanniens Staatsfeind Nummer eins. Gemeinsam mit dem Anthropoiden Ari stellt sie sich in ihrem U-Boot gegen die Regierung. Doch als Leyla beim Kampf unter Wasser ein Geheimnis ihrer verstorbenen Mutter aufdeckt, schwebt sie sogar noch in viel größerer Gefahr. Ari und Leyla müssen das britische Volk unbedingt über die dunklen Machenschaften des Premierministers aufklären, sonst werden die Anthropoiden und sie selbst niemals Ruhe finden. Im Abschluss ihrer Climate-Fiction-Dilogie zeigt London Shah, wie wichtig es ist, gut mit dem Planeten, anderen Lebewesen und unseren Mitmenschen umzugehen. Das topaktuelle Thema Klimawandel spannend verpackt in einem actionreichen Jugendbuch!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 670
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALT
Anmerkung der Autorin
Wohin ging die Reise nun …
An den Premierminister
Protokoll der Pressekonferenz mit Premierminister Gladstone
Tous les changements, …
Kapitel 1 – Eysturoy, Färöer-Inseln, Europäisches Nordmeer
Kapitel 2 – Wir sind schnell, …
Kapitel 3 – Ben und Ruby …
Kapitel 4 – Aris Zimmer ist …
Kapitel 5 – Wieder türmen sich …
Kapitel 6 – »Okay, Oscar, das …
Kapitel 7 – »Um Gottes willen, …
Kapitel 8 – »Damit werden sie …
Kapitel 9 – Schnell werfe ich …
Kapitel 10 – Ich danke dir, …
Kapitel 11 – Es ist fast …
Kapitel 12 – Das Sichtfenster glänzt …
Kapitel 13 – Es ist Vormittag, …
Kapitel 14 – Ari war allein …
Kapitel 15 – Beim Aufwachen erwartet …
Nichts ist so schmerzhaft …
Kapitel 16 – Ich treibe ziellos …
Kapitel 17 – Doch, da ist …
Kapitel 18 – Ich übergebe mich. …
Kapitel 19 – Für eine Sekunde …
Kapitel 20 – Mein Vater bewegt …
Kapitel 21 – Es ist früher …
Kapitel 22 – Ich kann mein …
Kapitel 23 – Bergen ist ein …
Kapitel 24 – Es ist später …
Kapitel 25 – Die Zentrale des …
Kapitel 26 – »Was?« Tabby schießt …
Kapitel 27 – Wir haben uns …
Kapitel 28 – Am frühen Morgen …
Kapitel 29 – »Mann, was soll …
Kapitel 30 – Wir sitzen wieder …
Kapitel 31 – Am frühen Abend …
Kapitel 32 – Einige Meter tiefer …
Kapitel 33 – Das Meer ergießt …
Kapitel 34 – Schmerz. Ein scharfer …
Kapitel 35 – Es ist, als …
Kapitel 36 – Ari steht vor …
Kapitel 37 – Entgeistert starren wir …
Silvester, neun Monate später
Es wird die Zeit kommen, …
Danksagung
ANMERKUNG DER AUTORIN
Hallo und willkommen zurück in meiner Unterwasserzukunftswelt! Bevor du dich mitten hineinstürzt, möchte ich noch schnell etwas loswerden …
Seit meiner Kindheit fantasiere ich über ein Leben in den Tiefen der Meere. Unsere Welt, wie wir sie hier und heute kennen, am Grunde des Ozeans – dieser Gedanke fasziniert mich extrem. Die Vorstellung einer Landschaft, die gezeichnet ist von der Lebensweise unserer Zeit, aber von den Fluten überspült wurde, hat mich in all ihrer gespenstischen Unwirklichkeit schon immer gereizt.
Du hast dich entschieden, die Water-Rising-Dilogie zu lesen (die aus den Bänden Flucht in die Tiefe und Im Sog der Verschwörung besteht), und dein Interesse bedeutet mir unglaublich viel. Es sind die ersten Science-Fiction-Romane mit einer britisch-muslimischen Hauptfigur und ebenso die ersten westlichen Romane aus dem Bereich der Fantastik mit einer Paschtunin als Protagonistin. Als britische Muslima paschtunischer Herkunft ist mir diese Geschichte nicht zuletzt deswegen so wichtig.
Die Water-Rising-Dilogie handelt vom richtigen Umgang mit Veränderung. Davon, Unterschiede wertzuschätzen, anstatt sie zu fürchten. Davon, die Vergangenheit mit klarem Blick zu sehen und die Gegenwart mit offenem Herzen. Sie handelt von der unermüdlichen Suche nach der Wahrheit, mag diese noch so schmerzhaft sein. Vor allem aber handelt sie davon, niemals die Hoffnung aufzugeben.
Es rührt mich sehr, dass du dich erneut in die versunkene Welt meiner geliebten Leyla begeben willst, um sie auf ihrer Suche nach Antworten zu begleiten und mit ihr in – buchstäblich – immer größere Tiefen vorzustoßen. Ich danke dir aufrichtig. Möget ihr in allem, was ihr tut, immer das Licht finden.
London Shah
Wohin ging die Reise nun
DOWNING STREET NR. 10
VEREINIGTES KÖNIGREICH
AN DEN PREMIERMINISTER
21.
September 2035
Dieses Schreiben enthält Staatsgeheimnisse und unterliegt der strengsten Geheimhaltung. Es ist ausschließlich für den Premierminister des Vereinigten Königreichs bestimmt.
Hochverehrter Premierminister,
zunächst möchte ich Ihnen, dem neuen Oberhaupt unserer großen Nation, bereits im Voraus zu Ihrer Wahl gratulieren. Zweifellos sehen Sie es wie ich – es gibt keine höhere Ehre, als das Vereinigte Königreich lenken zu dürfen. Aber dieses Amt bringt auch ungeahnte Aufgaben mit sich. Ich wende mich in diesem Brief an Sie, um Sie auf eine höchst sensible Angelegenheit aufmerksam zu machen, die mich mit tiefstem Bedauern erfüllt. Ich bitte Sie, Ihr Herz nicht zu verschließen und mit Güte auf das Handeln der Beteiligten zu blicken. Wir leben in ungewissen und herausfordernden Zeiten.
Der Asteroid 2030 FM31 befindet sich weiterhin auf Kollisionskurs mit der Erde und wird uns bald dazu zwingen, unter der Meeresoberfläche zu leben. Damit stehen wir am Rande einer Katastrophe, wie sie die Menschheit noch nie zu bewältigen hatte. Dies hat uns zuweilen dazu genötigt, Mittel und Wege in Betracht zu ziehen, gegen die man zuvor größte ethische Vorbehalte hatte. So erdachten gewisse Kräfte innerhalb der Operation Arche und des Auferstehungsrats das Projekt Amphibios. Es sollten 200 künstlich geschaffene Menschen vom Typ Homo amphibius entwickelt werden – mit dem alleinigen Zweck, den Überlebenden des Untergangs als Arbeitskräfte zu dienen, da die neuen Umweltbedingungen ihnen keinerlei Schwierigkeiten bereiten würden. Aus wissenschaftlicher Sicht hat sich das Programm als voller Erfolg erwiesen. Die sogenannten Amphis können unter Wasser atmen und ertragen den Druck problemlos. Dank einer geringfügigen Steigerung der normalen Körperkraft sollten sie darüber hinaus in der Lage sein, alle ihnen gestellten Aufgaben zu bewältigen.
In der Rückschau verstieß das Projekt jedoch gegen jede Moral. Deshalb sind jene, die davon Kenntnis haben, zu einer einstimmigen Entscheidung gelangt: Wir können nicht guten Gewissens mit dem Programm fortfahren. Bei den Amphis handelt es sich um menschliche Wesen. Von uns anderen unterscheiden sie sich praktisch nur in ihrer Fähigkeit, unter Wasser zu atmen. Ihnen muss ein Leben in Freiheit ermöglicht werden, anstatt dass sie ihre Tage als Arbeitssklaven fristen, nur um uns das unsere zu erleichtern. Ich habe daher ein gründliches Sterilisationsprogramm aufstellen lassen. Nachdem sie dieses durchlaufen haben, sollen die verbleibenden Amphis ein gleichberechtigter Teil unserer Gesellschaft werden. Und damit, mein hochverehrter Freund, kommen wir zum Kern dieser Botschaft: Um ihrer selbst willen, aber auch im Interesse der Stabilität unserer Nation, dürfen die wahren Identitäten und Fähigkeiten der Amphis niemals öffentlich werden.
Ich bitte Sie inständig: Helfen Sie mit, unseren Fehler zu korrigieren. Stellen Sie sicher, dass dieses Schreiben von Premierminister zu Premierminister weitergegeben wird, bis keine Amphis mehr existieren.
Hochachtungsvoll
Stephen John
Premierminister des Vereinigten Königreichs
PROTOKOLL DER PRESSEKONFERENZ MIT PREMIERMINISTER GLADSTONE
KABINETTSRAUM, DOWNING STREET NR. 10, GROSSBRITANNIEN
20. JANUAR 2087
PM GLADSTONE
[Räuspern]
Guten Abend, meine lieben britischen Landsleute.
[Pause]
Während des Wahlkampfs habe ich geschworen, stets offen und ehrlich zu Ihnen zu sein, den Bürgern unserer einst so großartigen Nation. Ihrer aller Sicherheit hat für mich höchste Priorität, so ist es und so war es schon immer. Nach langem Abwägen habe ich deshalb schweren Herzens beschlossen, mit Ihnen über eine sehr ernste Angelegenheit zu sprechen. Damit verstoße ich zwar gegen meinen Amtseid – doch ich bin zuversichtlich, dass Sie verstehen werden, warum mir keine andere Wahl blieb. In meiner Vision für die Führung dieser Nation war nie Platz für Lug und Trug. Zum Abschluss können Fragen gestellt werden – vielen Dank.[
tiefes Seufzen]
Ja, wo soll ich anfangen? Tatsache ist: Wir sind nicht allein. Unter uns lebt eine … eine unnatürliche Spezies. Künstlich geschaffene Menschen.
[unverständliches Murmeln]
Das Ergebnis eines
fatalen
Unterfangens der Wissenschaft der Alten Welt. Diese Spezies befindet sich bereits ebenso lange in den Tiefen der Meere wie wir selbst und sie –
REPORTER
Sir! Premierminister Gladstone, was meinen Sie mit »künstlich geschaffene Menschen«? Könnten Sie genauer –
PM GLADSTONE
Wenn Sie mich bitte aussprechen lassen würden? Es sind in der Tat nichts anderes als künstlich geschaffene Menschen, hervorgegangen aus der fehlgeleiteten Hoffnung, diese Kreaturen könnten uns nach unserer Verbannung in die Finsternis hilfreich zur Seite stehen. Es war ein unerträglich leichtsinniges Unternehmen – ein besonders erschreckender Missgriff unter den unzähligen Fehlern, die von den Wissenschaftlern dieser Zeit begangen wurden. Äußerlich gleichen uns diese Wesen voll und ganz, wovon man sich aber nicht täuschen lassen darf. Sie sind
nicht wie wir
. Sie –
[unverständliches Murmeln]
REPORTER
Sir, soll das heißen, dass dort draußen gefährliche menschenähnliche Wesen unterwegs sind, die –
PM GLADSTONE
Ich bitte Sie, bewahren Sie Ruhe, bis ich fertig bin. Ich muss darauf bestehen. Ihre Fragen werden beantwortet – am Schluss. Was ich sagen wollte: Diese Wesen sind längst
hier
, sie bewegen sich unerkannt unter uns. Diese … diese künstlichen Kreaturen sind unsere Freunde, Nachbarn und Kollegen. Sie haben Kontakt zu unseren Kindern.
[unverständliches Raunen]
Und manche ihrer Eigenschaften kann man nur als abnormal –
REPORTER
Was sind das für Eigenschaften, Sir?
PM GLADSTONE
Übermenschliche Kräfte. Doch das Entscheidende ist: Man sieht es ihnen nicht an. Wir müssen deshalb –
VERSCHIEDENE REPORTER
-
Sir! Wie können sie identifiziert werden?
-
Wie konnte es so weit kommen?
-
Sind wir in akuter Gefahr?
-
Hat das Auswirkungen auf Ihre Pläne für die Rückkehr an die Oberfläche?
-
Warum die lange Geheimhaltung? Warum erfahren wir erst jetzt davon?
-
Können Sie uns einen Beweis für die Existenz dieser –
PM GLADSTONE
Ruhe!Schon besser. Gut. Ich bedaure das sehr, aber falls es zu weiteren Störungen kommt, wird die betreffende Person den Saal verlassen müssen. Was ich Ihnen zu berichten habe, ist genauso erschütternd wie verwirrend, dessen bin ich mir bewusst. Trotzdem muss ich Sie dringend bitten, sich in Geduld zu üben und mit Ihren Fragen bis zum Schluss zu warten.
[Seufzen]
Also: Sollten diese Kreaturen böse Absichten gegen uns hegen – und es gibt keinen Beweis des Gegenteils –, sehen wir uns von einem Feind herausgefordert, der den Schrecken des Abgrunds in nichts nachsteht. Und doch ist nicht alles verloren. Das Fundament meines Wahlerfolgs, daran darf ich Sie kurz erinnern, war meine Oberflächen-Politik. Sie haben Ihre Hoffnungen in mich gesetzt und ich werde Sie nicht enttäuschen. Der Finsternis zu entkommen und wieder oberhalb des Wassers zu leben, das ist es, was unsere Nation will. Was wir brauchen. Und es ist unser gutes Recht. Der gegenwärtige Zustand verstößt gegen unsere Natur und wir werden uns nicht so bereitwillig in diese traurige Existenz fügen wie die Bewohner der Alten Welt. Was die neue Bedrohung durch unsere vermeintlichen Mitmenschen anbetrifft: Derzeit entwickeln wir einen absolut zuverlässigen Test zur Identifikation dieser … dieser Anthropoiden, um sie rasch enttarnen und unschädlich machen zu können. Und just in diesem Moment arbeitet mein Kabinett mit Hochdruck daran, in jeder größeren Siedlung eine Zweigstelle des AÜW einzurichten, des Anthropoiden-Überwachungsrats. Im Anschluss an die heutige Übertragung sollten Sie alle eine persönliche Informationsbroschüre zum AÜW in Ihrem Postfach finden. Es ist von größter Wichtigkeit, dass Sie jedes Wort davon verinnerlichen. Ihr Leben und das Leben Ihrer Liebsten könnte davon abhängen. Gerne würde ich Ihnen versichern, dass niemand in akuter Gefahr schwebt, doch das wäre schlicht unverantwortlich. Bleiben Sie wachsam, achten Sie stets auf Ihre Sicherheit. Wir haben es mit einem verschlagenen Gegner zu tun, dessen Fähigkeiten wir zum Teil nur erahnen können. Nach allem, was wir wissen, haben die Anthropoiden die Kontrolle über die Labore übernommen, in denen sie untergebracht waren, und alle an jenem Tag anwesenden Wissenschaftler und Techniker abgeschlachtet. Doch der Feind unterschätzt unsere Willenskraft. Wir sind Briten. Wir beugen vor niemandem das Haupt. Wir haben die Meere
beherrscht
Tous les changements, même les plus souhaités ont leur mélancolie, car ce que nous quittons, c’est une partie de nous-mêmes; il faut mourir à une vie pour entrer dans une autre.
1
Eysturoy, Färöer-Inseln, Europäisches Nordmeer
Februar 2100
Es ist früh am Morgen. Das abgeschaltete Tauchboot schwankt in der Strömung des Nordatlantiks, während ich mit klopfendem Herzen in die Fluten spähe. Doch von unserem Schlupfwinkel zwischen ein paar riesigen Felsblöcken kann ich nichts als Finsternis erkennen.
Mein Vater sitzt schweigend neben mir, den Blick ins dunkle Grau gerichtet. Schließlich holt er Luft und sagt etwas: »Ich hätte mir ein anderes Leben für dich gewünscht, Leyla.«
Er verstummt und kneift die Augen zusammen und auch ich spüre eine Veränderung. Wir schauen uns in alle Richtungen um, spähen aus unserem Zweisitzer in die undurchschaubare Umgebung.
So dunkel es auch ist – der verräterische Schatten, der nun über uns hinwegzieht, ist nicht zu übersehen. Obwohl das andere Boot bloß mit minimaler Beleuchtung unterwegs ist. Nur wer unerkannt bleiben will, wagt sich ohne Scheinwerferlicht in diese Gewässer. Doch hier unten zwischen den Felsen sollten wir in Sicherheit sein. Jetzt hängt unser Schicksal davon ab, wie viel Zeit die dort oben auf die Suche in diesem Gebiet verwenden und ob sie doch noch auf maximale Beleuchtung schalten. Sollten sie das tun, werden sie uns finden.
Oscar hat uns auf die Sicherheitspatrouille aufmerksam gemacht. Wenn ich im Tauchboot zu meinen Touren aufbreche, lasse ich die Kabul immer im Tarnmodus zurück; so wurde sie bis jetzt nicht aufgespürt und zudem habe ich den Navigator angewiesen, ihre Position ein wenig zu verändern. Solange mein U-Boot nicht gesichtet wird, kann ihm in den schroffen Bergen hoch über uns nichts passieren.
»Die sind gleich wieder weg, Papa.« Ich lasse den bedrohlichen Schatten nicht aus den Augen, doch der scheint es nicht eilig zu haben.
Ich hätte mir ein anderes Leben für dich gewünscht. Ich wickle einige Haarsträhnen fest um meine Finger. Papa ist enttäuscht von mir oder zumindest mache ich ihm Sorgen.
»Ich hätte mir auch was anderes gewünscht. Aber wir haben keine Wahl, oder?«
Das Tauchboot erzittert und ich hoffe und bete, dass der Fels unter uns nicht plötzlich wegbricht. Wie sich in den letzten Wochen gezeigt hat, halten die Gebirgszüge dieser Gegend hervorragende Schlupfwinkel bereit, bringen allerdings ihre eigenen Gefahren mit sich. Wenn das Wasser hier doch nur ein wenig klarer wäre … Doch die Tiefen sind noch trüber als das dunkle Graublau der Höhe, in der die Kabul wartet.
»Ach, Gürkchen. Mir will immer noch nicht einleuchten, dass diese Exkursionen die beste Möglichkeit sein sollen, nach seiner Siedlung zu suchen.« Mein Vater stößt ein tiefes Seufzen aus und streicht Jojo über ihr weißes Fell. Wir waren kaum im Tauchboot aufgebrochen, da ist mein Hundemädchen, ein Malteser-Welpe, auch schon auf Papas Schoß eingenickt, faul wie immer.
»Ich finde es auch nicht ideal, aber wie sollen wir Aris Leute sonst finden? Und du willst ja immer mitkommen, dabei müsste das gar nicht sein. Jojo und du, ihr solltet gemütlich auf der Kabul sitzen und warten. Wir könnten die ganze Zeit in Kontakt bleiben – und ich brauche doch nie mehr als ein paar Stunden.« Ich müsste mir so viel weniger Sorgen machen, wenn mein Vater an Bord des U-Boots bleiben würde, anstatt mich auf meinen Suchaktionen zu begleiten.
Im Schlaf befinde ich mich manchmal wieder in unserer Londoner Wohnung. Papa ist gerade zur Arbeit gegangen und unser Haushälter Jeeves überbringt mir eine Botschaft: Ihr Vater wurde erneut von der Blackwatch festgenommen. In anderen Albträumen ist Papa draußen in einem Tauchboot, das auf einmal von einem Netz eingeschnürt wird. Es ist, als wären die schlimmsten Erlebnisse der vergangenen Wochen miteinander verschmolzen. Und jeder Traum wirkt so verdammt echt, dass ich jedes Mal vor Erleichterung zittere, wenn ich endlich die Augen öffne. Sie dürfen ihn auf keinen Fall noch mal in die Finger kriegen.
»Nicht schon wieder, Gürkchen. Wenn diese Ausflüge wirklich sein müssen, dann begleite ich dich.«
Aus der undurchdringlichen Finsternis löst sich ein Schemen. Ich zucke zusammen – von der Seite her nähert sich etwas Rundes, so groß wie unser Tauchboot. Es kommt geradewegs auf uns zu und umkreist uns gemächlich. Als es wieder vor uns auftaucht, halte ich den Atem an. Es ist ein sonderbarer Anblick, eine Art Riesenfisch, dem die hintere Hälfte seines Körpers abhandengekommen ist.
»Was für ein gewaltiger Mondfisch«, sagt mein Vater staunend.
Das Tier ist mindestens drei Meter hoch, aber ganz schmal, und hat ein kleines, kreisrund geöffnetes Maul. Ich wedele mit dem Arm, um es zu verscheuchen – als könnte es mich tatsächlich verstehen. Aber es darf die Patrouille nicht auf unser Versteck aufmerksam machen! Endlich zieht der Fisch weiter.
Ich drehe mich zu Papa, der aus dem Seitenfenster schaut, und schiebe meine Hand in seine. Er drückt sie fest.
Er hat es nie laut gesagt, doch seit seiner Rückkehr fühlt er sich unwohl, sobald er allein ist. Die ganze Nacht ist aus seinem Zimmer leise Musik zu hören und früher hat er nie neben einer leuchtenden Lumi-Kugel geschlafen.
Ich hasse die Behörden so sehr. Was sie ihm im Broadmoor-Gefängnis angetan haben … Über drei Monate musste er in diesem Höllenloch verbringen! Wochenlang hatten sie – erfolglos – versucht, die Namen anderer Amphi-Sympathisanten aus ihm herauszuholen, dann ließen sie ihn einfach in einer eiskalten Zelle verrotten. Er wurde krank, litt lange unter Fieber, konnte sich bald nur noch mit Mühe bewegen, sein Zustand verschlimmerte sich zusehends. Als wir ihn fanden, war er kaum noch am Leben. Verschiedene Viren und Bakterien hatten sich in seinem Körper eingenistet und seine Temperatur stieg in derart schwindelerregende Höhen, dass er tagelang mit Wahnvorstellungen zu kämpfen hatte. Fast am meisten schmerzte es mich, wie dünn er war – lebensbedrohlich unterernährt. Inzwischen hat er zum Glück keine Ähnlichkeit mehr mit dem Menschen, den wir aus Broadmoor herausgeholt haben. Und trotzdem, wann immer ich ihn anschaue, sehe ich in erster Linie eine Seele und einen Körper, die in der Hölle waren.
Jetzt fährt er sich über sein viel zu kurzes dunkelbraunes Haar. Es ist immer noch nicht so lang nachgewachsen, dass es sich locken würde wie früher. Ich musste ihm den Kopf rasieren, er war vollkommen verlaust. Aber Papa ist hier bei mir und manchmal kann ich das immer noch nicht glauben.
Seit der Rettungsaktion ist etwas mehr als ein Monat vergangen. Vor einem Monat hat Captain Sebastian, die rechte Hand des Premierministers, ein stattliches Kopfgeld auf meinen Vater und mich ausgesetzt und uns zu Terroristen erklärt. Zu den Staatsfeinden Nummer eins.
Vor einem Monat wurde Ari uns entrissen.
Eine schleimige Kreatur schiebt sich in unser Sichtfeld. Sie interessiert sich offenbar für die Rundung unseres Cockpits, gleitet ausgiebig darüber hinweg, hin und her. Man könnte meinen, die Färöer würden das seltsamste Getier der Welt anziehen. Sekunden werden zu Minuten und noch immer kreist das Sicherheitsboot über uns. Doch wohin ich auch schaue, überall sehe ich nur Aris Gesicht. Schwer vorstellbar, dass dieser Ort seine Heimat sein soll. Kaum zu glauben, dass er einmal hier draußen geschwommen ist. Es macht mir richtiggehend Angst, ihn gedanklich in diese Umgebung zu versetzen. Ari ist zu hell, zu strahlend für diese Finsternis. Seine leuchtenden Augen, so schön, ihr Ausdruck, so zärtlich. Immer wieder taucht er in meinem Geist auf und lässt sich nicht wieder vertreiben, selbst wenn ich mich auf etwas anderes konzentrieren will. Besonders zu den Mahlzeiten lockt mich sein Blick, dann sehe ich ihn vor mir wie früher, wenn wir am Sichtfenster beim Essen saßen, sehe das kleine, verstohlene Lächeln, das er so oft auf den Lippen hatte. In solchen Momenten muss ich mich sehr beherrschen. Er fehlt mir so.
Und der Gedanke daran, dass ihm jemand wehtun könnte, zerfetzt mein Inneres.
Immer und immer wieder spielt es sich vor meinem geistigen Auge ab – wie sein gerade noch so warmer und liebevoller Ausdruck in Hass umschlug, als das Netz auf ihn herabfiel. Wie sie ihn durch die Fluten nach oben zogen, als wäre er ein Tier. Wie sich sein Gesicht zunächst vor Fassungslosigkeit verzerrte, dann vor unbändigem Zorn.
Und wie immer, wenn ich an ihn denke, wird mir schwer ums Herz. Am Anfang steht jedes Mal das Staunen über seine innere und äußere Schönheit, am Ende eine grenzenlose Leere.
Mein Vater seufzt und rutscht auf seinem Sitz herum. »Das ist ihre Normalität, Gürkchen, jeden Tag. Ein Leben im Verborgenen. So etwas kann man wirklich niemandem zumuten.«
Ja, niemandem … Nicht einmal den Anthropoiden, hätte ich noch vor einiger Zeit gesagt. Aber tatsächlich ist es falsch, Ari und seine Leute als Anthropoiden zu bezeichnen. Dieser Name wurde ihnen bloß von der Regierung verpasst, um sie als eine Art Tiere hinzustellen. Doch sie sind Menschen! Homo amphibius, um genau zu sein. Erschaffen von Wissenschaftlern, die genau wussten, dass die gesamte Struktur der Amphis, ihre DNA, absolut menschlich ist, mit nur einem echten Unterschied zwischen ihnen und uns: Sie können im Wasser atmen. Ich wünschte, ich hätte das schon früher gewusst. Lange habe auch ich sie abschätzig Anthropoiden genannt … Der Gedanke daran erfüllt mich mit Scham.
Da es zu gefährlich gewesen wäre, mir die Wahrheit über die sogenannte »Bedrohung durch die Anthropoiden« zu enthüllen, hat mein Vater mich zu meinem eigenen Schutz unwissend gelassen. Und bevor er mich einweihen konnte, wurde er verhaftet.
Die Minuten ziehen sich endlos in die Länge, während wir angespannt im Tauchboot sitzen. Mein Magen verkrampft sich. Es ist schon das dritte Mal, dass wir in so eine Situation geraten sind, und ich halte es immer noch kaum aus. Doch es gibt keine Alternative. »Mir machen diese Touren auch keinen Spaß, Papa«, sage ich sanft. »Aber ich kann jetzt nicht damit aufhören. Irgendwann werden uns Aris Leute schon entdecken. Es muss einfach klappen.«
»Trotzdem, dieses Risiko …«
Seine größte Sorge ist, dass ich auf einem meiner Tauchgänge von den Behörden gefasst werden könnte – was mich jedes Mal an seine eigene Verhaftung denken lässt. Insbesondere daran, dass ich nach wie vor keine Ahnung habe, warum genau er festgenommen und ins Gefängnis geworfen wurde. Leider ist er immer noch nicht bereit, darüber zu sprechen. Aber er hat so viel durchgemacht – wenn er so weit ist, wird er es mir schon erklären.
»Falls wir entdeckt werden, steuere ich sofort zwischen die Felsspitzen da hinten. Verglichen mit ihrem Boot ist unseres winzig klein, deswegen haben wir hier in den Bergen einen klaren Vorteil, Papa. Wir könnten in den Felsformationen Katz und Maus spielen, bis ihnen irgendwann die Energie ausgeht.«
»Das kommt gar nicht infrage.« Mein Vater schüttelt den Kopf. Dann schaut er gedankenverloren ins Wasser. »Du bist deiner Mama so ähnlich.« Wie immer, wenn er sie erwähnt, nimmt seine Stimme einen wehmütigen Klang an. »Ich muss auf deine Sicherheit a-«
»Papa –«
»Lass mich ausreden, Gürkchen. Du kannst argumentieren, wie du willst – es ist meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass dir nichts passiert. Denn du bist mein Kind. Das soll nicht heißen, dass du nicht auf dich selbst aufpassen könntest. Sondern nur, dass ich ebenfalls auf dich aufpassen muss. Sieh mich an, Leyla.«
Unsere Blicke begegnen sich und auf seinem Gesicht blitzt ein kleines, liebevolles Lächeln auf. Oh, wie habe ich sein schiefes Grinsen vermisst in all den Monaten, die er verschwunden war.
»Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich will, dass du mir glaubst: Ich bin so stolz auf dich. Und deine Mama … Es hätte keinen stolzeren Menschen gegeben als Soraya. Was du in den letzten Monaten ertragen musstest, hätten selbst die meisten Erwachsenen nicht ausgehalten. Dass du ein U-Boot bestiegen und London hinter dir gelassen hast … Es kommt mir vor, als wäre dies die Geschichte eines anderen Menschen, nicht die meiner Leyla. Wie unwohl dir immer war, wenn ich auch nur von einem Leben jenseits der Stadtgrenzen gesprochen habe. Und dann … dann musstest du so viel Schlimmes mitmachen. Was habe ich meinem Gürkchen nur aufgebürdet?« Ihm versagt die Stimme, er muss schlucken.
»Du hast mir überhaupt nichts aufgebürdet, Papa. Es war nicht deine Schuld – es war die der anderen. Und nach dir zu suchen war meine eigene Entscheidung. Mir ist inzwischen klar, dass ich oft gründlicher hätte überlegen sollen, bevor ich handle. Aber du bist wieder bei mir und das ist doch die Hauptsache, oder?« Ich streiche ihm über den Arm. »Und jetzt … jetzt müssen wir Ari finden.«
Papa berührt meine Hand und wendet den Blick ab. »Ich stehe in seiner Schuld. Wenn ich wieder einmal zu viel darüber nachdenke, was du alles durchmachen musstest, dann tröstet es mich, dass du dabei zumindest nicht alleine warst.«
»Ohne ihn wären wir nicht gemeinsam hier«, flüstere ich.
Als seit der letzten Sichtung des Sicherheitsboots endlich volle zehn Minuten vergangen sind, hebe ich mein Armband. Mit der anderen Hand schirme ich sein Licht ab, man weiß ja nie.
»Oscar? Nur Sprachkommunikation.«
Selbst das leichte Schimmern rund um mein Handgelenk macht mich nervös. Ich lasse meine Haare schützend darum fallen.
»Meine Liebe?« Wie immer entfaltet der schelmische Tonfall des Navigators sofort eine beruhigende Wirkung.
»Oscar, wir können sie nirgendwo mehr entdecken. Könntest du noch einmal die Umgebung absuchen?«
Es dauert nur ein paar Sekunden. »Meine Liebe, das feindliche Schiff hat Fahrt aufgenommen, es befindet sich ungefähr zwei Seemeilen westlich von Ihrer derzeitigen Position und bewegt sich in entgegengesetzter Richtung zu unserem Kurs. Anweisungen?«
Mein Vater murmelt ein Dankgebet.
»Alles klar, Oscar, du kannst dich jetzt zeigen«, sage ich erleichtert und wische seine Projektion in Richtung Cockpit, damit wir ihn sehen, während ich das Tauchboot wieder starte.
Ich drehe mich zu meinem Vater. »Es geht weiter, okay?«
Er nickt, seine Aufmerksamkeit richtet sich jedoch auf Oscar. »Wie ist die Lage auf der Kabul?«
Für einen Moment ruht der wohlwollende Blick des Navigators auf uns beiden, dann neigt er mit einem vergnügten Lächeln den Kopf. »Wir haben keinerlei Grund zur Klage, Sir.« Er führt eine tiefrote Tulpe an seine Nase und atmet ihren Duft ein.
»Tarnung trotzdem aufrechterhalten«, sage ich mit einem Blick auf das Armaturenbrett. »Und lass das Anti-Tracking-Gerät nicht aus den Augen.« Als ich mich das letzte Mal entspannt habe, ist aus dem Nichts ein Netz herabgefallen, hat sich um Ari zusammengezogen und ihn mir weggenommen.
Ein Schwarm gestreifter Makrelen flieht vor den aufflammenden Scheinwerfern des Tauchboots.
»Verstanden, meine Liebe.« Oscar legt den Kopf schief. »Auf die Kabul und ihre Vorliebe dafür, sich bedeckt zu halten, ist stets Verlass. Wenn es gilt, sich in Diskretion zu üben, ist sie in ihrem Element. Wie es sich für eine Dame, die etwas auf sich hält, gehört!«
Papa und ich müssen grinsen. Unser Tauchboot steigt über die Felsblöcke und mein Blick fällt auf ein Panorama aus gespenstischen Silhouetten, auf die endlosen zerklüfteten Gipfel der einstigen Insel Eysturoy.
Der Navigator räuspert sich. »Wenn ich für die nächste Gelegenheit eine Prise Feuerkraft vorschlagen dürfte, meine Liebe?« Ein Leuchten erscheint in seinen Augen. »Das letzte Mal hat sie wahre Wunder gewirkt.«
»Immer mit der Ruhe, Oscar. An diesem einen Abend musste es sein. Aber wie gesagt, wir schießen nur, um uns zu verteidigen. Abgesehen davon, dass wir unsere Kräfte nicht vergeuden sollten. Vielleicht werden wir schon bald auf die ganze Macht der Kabul angewiesen sein.«
»Aber natürlich.« Oscar rückt seine Seidenkrawatte zurecht und nickt. »Äußerst umsichtig, meine Liebe.«
Ich entlasse den Navigator und wir fahren weiter, wobei Jojo aufwacht, von der Bewegung und der plötzlichen Helligkeit. Sie rekelt sich auf Papas Schoß. Ohne Jojo wäre er bestimmt nicht so schnell wieder auf die Beine gekommen.
Während ich so vorsichtig wie möglich durch das unbekannte Terrain steuere, halte ich Ausschau nach Hinweisen auf eine Siedlung. Mein Vater späht ebenfalls aufmerksam in die Fluten.
Wir passieren Berge, die turmhohen Wassergeistern gleichen. Wellen brechen sich am Fels und entfesseln ein Strudeln und Brodeln, das einen förmlich in den Wahnsinn treiben kann. Als ich einen pechschwarzen Gebirgskamm umrunde, bleibt mein Blick an einer Bewegung direkt vor uns hängen. Ich bremse ab. Wow!
Papa beugt sich vor. »Warum hast du – oh. Mashallah.« Er nimmt den faszinierenden Anblick in sich auf und sein Gesicht erhellt sich.
Dort vorne haben sich mehrere gigantische Feuerwalzen miteinander verwoben – es ist unglaublich. Bald schwimmt das hauchzarte, leuchtende Gespinst ganz in unserer Nähe, wir können zusehen, wie die durchscheinenden Kreaturen in der Strömung schwingen. Kaum zu glauben, dass diese feingliedrigen Tiere in einer so stürmischen Umwelt überleben können. Ihr Inneres ist gesprenkelt von orangefarbenen Lichtpunkten. Sie treiben weiter und verschwinden aus unserem Sichtfeld.
Und als ich erkenne, was sich hinter ihnen verbirgt, stockt mir der Atem.
Nur wenige Meter vor unserem Boot, eben noch im Schatten der zarten Wesen, schwebt eine Gruppe von Amphis im Wasser. Menschen, die tief im Meer atmen können.
Jojo schnellt auf Papas Schoß in die Höhe und stellt die Ohren auf.
»Alhamdulillah!«, ruft mein Vater, um Gott zu danken. »Vergiss nicht, Gürkchen: Wir haben nichts zu befürchten.« Er grüßt die Amphis mit einem Winken.
Sie schwimmen Seite an Seite, jeweils mit einer Laserwaffe ausgerüstet, die sie jedoch nicht auf uns richten. Um ihre Gesichter wallen ihre Haare in der Strömung, während das Wasser ungehindert in ihre Münder und wieder hinaus fließt. Sie starren uns genauso an wie wir sie. In meinem Magen rumort es, dabei weiß ich es doch eigentlich besser. Und da ist auch Erleichterung, ja, eine ganze Welle davon schwappt über mich hinweg. Es ist so weit.
In Zeichensprache wendet Papa sich an die Amphis – so kommunizieren sie mit allen, die sich nicht im Wasser befinden. »Ich bin Hashem McQueen«, sagt er. »Der Sohn von Gideon Abraham und das ist meine Tochter Leyla. Es könnte sein, dass Gideon Ihnen bereits von uns berichtet hat? Wir konnten nicht riskieren, mit ihm oder irgendjemand anderem Kontakt zu halten. Wir sind auf der Suche nach der Familie von Ari Sterling. Er war bei uns, als sie ihn geholt haben.« Außerdem informiert er die Amphis über das Sicherheitsboot, das vorhin in der Gegend unterwegs war, woraufhin sie nicken, als hätten sie schon davon gewusst.
Die Amphis besprechen sich und bewegen dabei die Lippen, als würden sie nicht in einer Welt aus Wasser schweben. Ich kann den Blick nicht von ihnen abwenden, so unglaublich finde ich das alles. Dass sie sich dort draußen hören können …
Eine von ihnen kommt näher und gibt den anderen nach einem kurzen Blick ein Zeichen.
»Folgt uns«, sagt sie und wendet sich ab. Sie schwimmen davon.
Obwohl mir immer noch ein wenig mulmig zumute ist, richte ich mich entschlossen auf. Auf diesen Moment habe ich gewartet. Wochenlang habe ich nach ihnen gesucht.
Ari. Ich stecke die Hand in meine Pullitasche und meine Finger schließen sich um den glatt polierten Stein. Ich habe Vertrauen in dich, Leyla. Das hat Ari gesagt, als er mir das uralte Werkzeug aus Feuerstein gegeben hat. Vielleicht sind wir ihm endlich einen kleinen Schritt näher gekommen.
Ich schiebe den Gashebel nach vorne, um den Amphis auf den Fersen zu bleiben.
2
Wir sind schnell, hat Ari einmal zu mir gesagt, doch Amphis in Aktion zu sehen ist immer wieder unglaublich. Im ersten Moment ist niemand mehr zu erkennen, dann schießt urplötzlich einer von ihnen auf unser Tauchboot zu und vergewissert sich, dass wir ihnen noch folgen. Ihre Zeichensprache unterscheidet sich leicht von der, die ich von Jeeves gelernt habe, ich verstehe sie aber dennoch einigermaßen. Auf einer Lichtung zwischen schroffen Felsen angekommen, tauchen die Amphis jäh ab. Ich packe den Steuerknüppel und drücke ihn nach vorne, um es ihnen gleichzutun.
Felswände ziehen an uns vorbei, während wir weiter und weiter absinken, in die gespenstische Dunkelheit hinein. Wie kann auch nur ein einziger Mensch in diesen Tiefen überleben, geschweige denn eine ganze Gruppe davon? Das Wasser verdichtet sich, wird zu einer undurchdringlichen Mauer.
Was würden Theo und Tabby sagen, wenn sie uns jetzt sehen könnten? Wenn sie wüssten, dass wir bald bei einer Amphi-Gemeinschaft eintreffen werden? Seit unserem Chat in Cambridge vor sechs Wochen habe ich von den Zwillingen nichts mehr gehört oder gesehen. Was würde ich dafür geben, mit meinen Freunden reden, in ihre Gesichter schauen zu können! Oder in Opas Gesicht. Was er sagen würde, weiß ich genau. Er macht sich immer so viele Sorgen. Ich spüre ein altbekanntes Ziehen im Herzen.
Die Amphis tauchen nicht mehr weiter ab, sondern geben uns ein Zeichen und verschwinden hinter einer Felswand. Als wir sie eingeholt haben, finden wir uns zwischen zwei mächtigen Bergrücken wieder. Erneut ein Signal: Folgt uns! Ich werfe sämtliche Suchscheinwerfer an, kann im ersten Moment aber nicht einmal erkennen, wo es weitergehen soll.
»Wenn sie leicht zu finden wären«, sagt Papa leise, »wäre keiner von ihnen mehr am Leben.«
Er hat recht – je weiter die Amphis schwimmen, desto schwieriger wird es, auf ihrer Spur zu bleiben. Ich schüttele den Kopf. Niemals, nicht in tausend Jahren, hätte ich diesen Ort auf meinen täglichen Tauchgängen aufgespürt. Der Meeresgrund kommt in Sicht. Hier liegen nicht so viele Trümmer herum wie zu Hause in London und doch sind es noch mehr als genug. Autos, Frachtkisten, das Heck eines Flugzeugs, riesige blaue Tonnen, all das ist unter uns zu erkennen, sogar einzelne Möbelstücke. Ein Durcheinander wahllos verstreuter Dinge, überzogen von Rost, Schwämmen und Korallen.
»Nicht mehr weit«, teilen uns die Amphis mit.
Wir nähern uns der Siedlung und mir geht auf, dass sie sich in einem Punkt von sämtlichen Städten Großbritanniens unterscheidet: Es gibt keine Straßenbeleuchtung. Unglaublich – wie kann man sich hier unten ganz ohne Laternen oder Solarkugeln bewegen? Wir gleiten durch einen höhlenartigen Durchgang und gelangen wieder in offenes Wasser, wo sich die Amphis umdrehen und uns zu verstehen geben, dass wir am Ziel sind.
Nach vorne gelehnt tauschen mein Vater und ich einen Blick. Für einen Moment schauen wir uns an, dann bestaunen wir nur noch das Panorama, das in der Dunkelheit gerade so zu erahnen ist. Ringsum ragen riesenhafte Felswände empor, ohne eine einzige Lücke, als befänden wir uns im Schlund eines Vulkans. Dann bemerken wir die Lichter.
Hier und da wölben sich große Vorsprünge aus dem schroffen Stein und oh Gott, auf jedem davon schimmert eine erleuchtete Behausung.
Das ist die Siedlung.
Seit über einem Monat haben wir niemanden mehr gesehen, mit niemandem mehr gesprochen, deshalb wird mir beim Anblick von so viel Zivilisation beinahe schwindelig. Papa und ich schauen uns an und lächeln. Nach der langen Reise durch die Dunkelheit ist es unglaublich erleichternd, die Lichter der Amphi-Behausungen zu sehen. Ich merke, wie in mir eine plötzliche Sehnsucht aufsteigt, ein Schmerz, und unvermittelt taucht Aris Gesicht vor meinem geistigen Auge auf. Er ist nicht hier, natürlich nicht, und trotzdem habe ich mich ihm seit seinem Verschwinden nicht mehr so nahe gefühlt.
Das Tauchboot schwankt. Selbst zwischen diesen hohen Felswänden herrscht eine ungemütliche Strömung, Wellen krachen gegen Riffs und senkrecht aufragendes Gestein.
»Wo sie nicht wie hier von Bergen abgeschirmt werden, haben ihre Siedlungen stets mehrere Ebenen«, erklärt Papa mir. »Im Fall eines Angriffs besteht so die Hoffnung, dass nur die oberste vernichtet wird, während sich die Bewohner in den Ebenen darunter verstecken können. Mit etwas Glück gehen die Sicherheitskräfte davon aus, dass sie alles und jeden erwischt hätten, und ziehen weiter. Das ist einfacher, als immer wieder von vorne anzufangen. Oft errichten die Amphis auch eine aufwendige Fassade, um die eigentliche Siedlung zu schützen. Doch obwohl sie sich von Geburt an darin üben, im Verborgenen zu bleiben«, nun ist ihm der Kummer anzuhören, »werden immer noch viel zu viele Gemeinschaften enttarnt und …«
Er kann es nicht aussprechen, das ist aber auch nicht nötig. Ari hat mir erzählt, wie rücksichtslos die Amphis von den Behörden abgeschlachtet werden. Unschuldige Menschen, sogar Kinder, nur weil sie anders sind.
Mit einem Winken macht eine Frau auf sich aufmerksam, ihrer Anweisung folgend steuere ich einen Lichtkegel an, der vermutlich zu einem Moonpool führt. Fische stieben auseinander, als wir in den hellen Bereich fahren.
»Aber ich verstehe nicht, wie sie überhaupt noch aufgespürt werden können, Papa. Ich meine, ich war noch nie in einer so rauen Gegend. Man sieht kaum, dass hier jemand lebt. Woher wissen die Sicherheitskräfte so genau, wo sie suchen müssen? Sie können ihre Schiffe doch nicht in jeden Winkel des Landes schicken. Haben sie eine Überwachungstechnik, von der wir keine Ahnung haben?« Unser Tauchboot steigt auf.
Mein Vater schüttelt den Kopf. »Das bezweifle ich, Gürkchen. Um all das kümmert sich unsere Truppe in Cambridge und die macht ihre Sache gut. Nein, so ist die Blackwatch nun einmal – stets bereit, immer auf der Lauer. Sobald ein Bewohner irgendeiner Siedlung unvorsichtig wird und ihren Standort verrät, schlagen sie zu.«
Schaukelnd durchbricht unser Tauchboot die Oberfläche eines Wasserbeckens. Wir befinden uns in einem grell ausgeleuchteten Raum, ein krasser Kontrast zur umliegenden Dunkelheit. Ich trage die Fahrt ins Logbuch ein – wir haben Wochen mit der Suche nach diesem Ort verbracht, die nicht vergeudet sein sollen. Dann vergrabe ich die Information tief im System, weil man nie ausschließen kann, dass unser Boot zwielichtigen Personen in die Hände fällt.
Die Amphis, die uns hierhergeführt haben, schießen neben uns durchs Wasser. Sie klettern aus dem Becken hinaus und verschwinden in einer Reihe kleiner Kabinen an der gegenüberliegenden Wand.
Unser Boot treibt hinüber zum Beckenrand. Papa und ich steigen aus und betreten die Druckausgleichskammer. Als der Vorgang abgeschlossen ist, öffnet sich die nächste versiegelte Tür und wir können weiter. Vor uns stehen unsere Begleiter von vorhin, gerade noch tropfnass, jetzt schon trocken und umgezogen.
»Die machen das nicht zum ersten Mal«, sagt Papa und grinst, als er mich staunen sieht.
Dass sie sich nicht eine Sekunde lang an die neue Umgebung gewöhnen müssen – das werde ich wohl nie ganz begreifen. Ich strecke die Arme nach Jojo aus, mein Vater setzt sie hinein, sein Blick geht jedoch an mir vorbei und mit einem Mal verschwindet sein Grinsen. Ich fahre herum und entdecke hinter mir mehrere Amphis. Sie bedrohen uns mit Waffen.
»Alles gut«, wendet Papa sich an die Frau, die uns am nächsten steht. »Glauben Sie mir, wir sind Freunde. Bitte kontaktieren Sie Gideon Abraham.« Er sieht mich an. »Keine Sorge, Gürkchen. Sie haben gute Gründe, niemandem zu trauen.«
»Die Hände da, wo ich sie sehen kann«, befiehlt die Frau mit fester Stimme und wachsamem Blick.
Jojo winselt und ich beruhige sie.
Wir werden abgetastet. Danach zieht sich ein kleinerer Typ in eine Ecke zurück und spricht hektisch in sein Armband.
»Hier entlang.« Die Frau zeigt mit ihrer Waffe zur Tür. Zwei andere gesellen sich dazu und flankiert von drei Wachen marschieren wir los. Wohin auch immer. Wenn mein Herz doch nur nicht so klopfen würde. Wir passieren die Luke in den Innenbereich.
»Aus ihrer Sicht ist es nur vernünftig, Vorsicht walten zu lassen«, flüstert Papa zu mir gebeugt. »Sie werden schon einsehen, dass wir ihnen nichts Böses wollen. Dein Opa arbeitet eng mit den Siedlungen hier im Norden zusammen, irgendjemand muss also von ihm gehört haben.«
Seltsamerweise glaube ich gar nicht, dass es allein die Angst ist, die meinen Puls beschleunigt. Ja, eigentlich habe ich kein schlechtes Gefühl. Ich glaube eher, mein Herz macht Bumm-Bumm-Bumm wegen Ari, Ari, Ari. Wir haben seine Heimat gefunden, wir sind bei seinen Leuten.
Hinter der großen Luke liegt ein Gang. Das Armband der Anführerin unserer Eskorte piept, sie entfernt sich ein paar Schritte und flüstert etwas hinein. Einen Moment später kehrt sie zurück und nickt den anderen knapp zu. Daraufhin lassen ihre Gefährten die Waffen sinken und verschwinden, wobei sie den letzten Rest meiner inneren Anspannung mitnehmen.
»Mir nach«, sagt die Frau. »Ben ist schon auf dem Weg zu euch.«
Mein Vater nickt mir aufmunternd zu und wir folgen ihr.
Am Ende des Korridors durchqueren wir eine wasserdichte Tür und betreten einen hell erleuchteten Bereich. Wow. Wie riesig hier alles ist. Es duftet wie in einer Bäckerei – nach frischem Brot. Eine überraschende Wärme empfängt uns, sowohl im Hinblick auf die Temperatur als auch auf die rustikale, liebevolle Einrichtung. Überall Holz, gedämpfte Farben, kuschelige Stoffe, Porträts und Bücherregale, wohin man auch blickt – einfach gemütlich. Nie und nimmer hätte ich gedacht, dass sich tief in der Dunkelheit, im Herzen dieser feindseligen Landschaft ein solcher Ort verbirgt. Oder dass die Amphis so leben.
In London wäre ich überhaupt nicht auf die Idee gekommen, mir ihr Zuhause auszumalen. Kaum zu glauben, wie wenig ich damals begriffen hatte, wie wenig Ahnung ich von diesen Menschen hatte. Mir waren nur die paar Unterschiede zwischen ihnen und uns bewusst gewesen, nicht die vielen Gemeinsamkeiten. Und ich hatte nicht den leisesten Schimmer, wie wir mit ihnen umgehen. Mir fallen Aris Worte ein und das Blut schießt mir ins Gesicht.
Ihr Leute … Hauptsache glücklich in eurem eigenen Leben, ganz egal, was mit anderen geschieht – solange es euch nur gut geht. Und immer schön alles glauben, was euch erzählt wird.
Als wir an einer offen stehenden Tür vorbeikommen, wird der köstliche Duft intensiver. In der Mitte der großen Küche steht ein imposanter Herd, ähnlich wie der, den die Zwillinge haben, seine leuchtenden Holo-Ringe sind gut zu erkennen. Darüber köcheln verschiedene Töpfe vor sich hin und von seinen Seiten strahlt Wärme ab, selbst bis hierher. Wir gehen weiter und gelangen schließlich in einen weitläufigen Raum mit mindestens einem Dutzend Menschen darin. Bei unserem Eintreffen kehrt augenblicklich Stille ein.
»Bitte wartet hier«, sagt die Frau und deutet auf ein paar breite Sessel.
Ich schaue mich in dem warmen, hellen Zimmer um, mustere jedes der Gesichter, die uns beobachten. Was machen diese ganzen Menschen hier? Leben sie alle an diesem Ort? Ein paar grüßen uns mit einem Nicken, andere beäugen uns argwöhnisch und unterhalten sich flüsternd mit ihren Nebenleuten.
Vor gar nicht mal so langer Zeit bin ich vor Angst erstarrt, sobald in den Nachrichten auch nur ein einziger »Anthropoid« gezeigt wurde. Jetzt bin ich umzingelt von Amphis, von Menschen jeder Hautfarbe, Herkunft und Gestalt, jedes Alters. Sogar Kinder sind dabei. Schwer vorstellbar, dass diese Leute uns einfach so aus dem Wasser heraus attackieren würden. Sie wurden uns immer als Wilde, als Barbaren geschildert. Doch nichts, gar nichts deutet darauf hin. Während mein Blick umherhuscht, wirbeln in meinem Kopf all die Lügen herum, all die manipulierten Filmaufnahmen aus den Nachrichten. Jahrelang wurde mir eingeschärft, die Amphis seien die gewalttätigste Spezies aller Zeiten; in Wirklichkeit sind sie Menschen, die brutal verfolgt werden, deren Familien und Gemeinschaften auseinandergerissen werden von denjenigen, die eigentlich die Pflicht hätten, für unser aller Sicherheit zu sorgen.
Seit er sich erholt hat, erzählt mein Vater mir immer wieder etwas Neues über Ari, über die anderen, die dieselben Fähigkeiten haben wie er, und über das Versagen der Regierung, und jedes Mal macht es mich sprachlos. Auch dass Papa und viele andere im ganzen Land seit Langem alles daransetzen, die Wahrheit über die Amphis ans Licht und unter die Leute zu bringen, und ihr Bestes geben, sie zu beschützen. Dass sie schon immer mit den Amphis befreundet sind, sie heimlich besuchen.
Die ursprünglichen Zweihundert, habe ich von Ari erfahren, hätten sterilisiert werden sollen, doch die Katastrophe brach früher als erwartet über die Erde herein. Sie entkamen der Gefangenschaft und entschieden sich für ein unauffälliges Dasein am Rand der Gesellschaft, wo sie lange Zeit unbemerkt blieben. Bis die jetzige Regierung einen Vorwand brauchte, um ihr einziges Ziel, die Rückkehr an die Oberfläche, um jeden Preis weiterzuverfolgen. Auf einmal lebten wir hier unten inmitten der furchtbarsten Monster, waren wir der größten Gefahr ausgesetzt und plötzlich war überall dieses eine Wort, wie eine Springflut aus dem Nichts: Anthropoid, Anthropoid, Anthropoid …
In meinem Geist erklingen Aris Worte, damals, als ich nicht glauben wollte, dass er einer von ihnen ist, und er mich anflehte, ihn zu verstehen: Wir sind Menschen, Leyla. Wir sind wie du. Uns fehlt nichts – im Gegenteil, wir haben nur etwas mehr. Kaum etwas davon ist bei mir angekommen. Ich war innerlich erstarrt – von Beginn an war ich mit einer Kreatur unterwegs gewesen, die nach allem, was mir eingebläut worden war, mein größter Feind sein sollte.
Ein Mann und eine Frau, beide ungefähr in Papas Alter, treten ein und eilen uns entgegen.
»Ben Sterling«, sagt der Mann zur Begrüßung. »Ich bin Aris Vater. Das hier ist unser Zuhause.«
Ich schnappe nach Luft. Ich bin bei Ari zu Hause – unglaublich! So viele Gefühle steigen in mir auf, doch ich muss mich schnell wieder konzentrieren.
Aris Vater ist groß, hat helle Haut und lockiges blondes Haar, und seine warmen braunen Augen sind fest auf uns gerichtet, ein Blick, als hätte er in seinem Leben schon zu viel gesehen. Aris Mutter Ruby ist ebenfalls blond und hellhäutig. Ist Ari vielleicht adoptiert worden?
Ruby will uns unbedingt etwas zu essen servieren, wir entscheiden uns jedoch nur für warme Getränke.
Der Raum leert sich, Ben winkt uns hinüber zu einer Sofalandschaft in der Ecke. Ruby nimmt neben ihrem Mann Platz, auch ein paar andere kommen dazu.
»Bitte«, sagt Ben und nimmt die Hand seiner Frau. Sein Blick huscht fieberhaft zwischen Papa und mir hin und her. »Erzählt uns alles. Wo ist unser Sohn?«
3
Ben und Ruby lauschen gebannt, während ich ihnen in allen Details berichte, wie Ari verschleppt wurde. Die Erinnerung wird lebendig und wieder und wieder blitzt Aris entsetztes Gesicht vor meinem geistigen Auge auf.
Als ich fertig bin, erhebt Ben sich und marschiert auf und ab, sein Blick grimmig, aber entschlossen. Ruby sitzt mit düsterer Miene auf dem Sofa, ihre Augen verschattet, als müsste sie die neuen Informationen erst verarbeiten. Es bricht mir das Herz, Aris Eltern so zu sehen. Wenn ich doch nur irgendetwas für sie tun könnte.
»Gut«, sagt Ruby schließlich. Ihr Gesicht spannt sich an, ihr Unterkiefer schiebt sich nach vorne. »Wie gehen wir vor?«
»Unser Bursche ist ein Kämpfer«, entgegnet Ben und dreht sich räuspernd zu Papa. »Egal, wohin sie ihn gebracht haben, er wird sich durchbeißen. Und so wie ich ihn kenne, macht er ihnen das Leben zur Hölle.« Ein Anflug von Stolz huscht über seine Züge und Ruby nickt gedankenverloren.
»Mein Vater hat mir erzählt, wie viele von Ihnen schon verschwunden sind«, sage ich an Aris Mutter gewandt.
Ruby muss schlucken, ehe sie antwortet. »Wir sehen nur sehr selten einen von ihnen wieder. Doch Ari wird zu uns zurückkehren, Liebes. Ich bin mir sicher.«
»Jetzt wissen wir zumindest etwas mehr«, Ben krempelt seine Ärmel hoch, »und können unsere Maßnahmen entsprechend anpassen. Wir haben keine Zeit zu verlieren.«
Aris Familie und einige Nachbarn diskutieren, wie die Suchaktion am sinnvollsten zu organisieren wäre. Ben bindet uns ein, allerdings habe ich nicht viel beizutragen, deswegen höre ich meist nur zu und gebe Jojo nebenbei eine Kleinigkeit zu fressen. Mein Vater hingegen kann von etlichen eigenen Erfahrungen berichten – zum ersten Mal überhaupt erlebe ich ihn von dieser Seite. Er weiß eine Menge über die Sicherheitskräfte und ihre hinterhältigen Taktiken.
»Ich wünschte, wir hätten uns unter anderen Umständen kennengelernt, Hashem«, meint Ben nach einer Weile. »Ich habe viel von dir und deinen Verdiensten um unsere Leute im Süden gehört. Es war mir eine Ehre, als Gideon sich erkundigte, ob Ari über deine Tochter wachen könnte.« Wann immer er Ari erwähnt, fällt sein Gesicht in sich zusammen. »Und bitte entschuldigt den ›herzlichen‹ Empfang. Neuankömmlinge können wir leider erst richtig willkommen heißen, nachdem wir uns davon überzeugt haben, dass ihnen zu trauen ist. Dabei haben wir ebenfalls nach euch Ausschau gehalten, seit wir nichts mehr von Ari gehört haben. Er hatte uns noch über die Befreiungsaktion informiert, doch kurz darauf seid ihr vom Radar verschwunden.«
»Da war uns klar, dass irgendetwas faul sein muss«, fügt Ruby hinzu, ihr Blick leer. »Ari hätte uns nie so lange warten lassen, ohne sich zu melden.«
Ben reibt sich das Gesicht. Ich bemerke seine tiefen Augenringe.
»Und trotzdem mussten wir ein Gleichgewicht finden zwischen der Suche nach euch und der Sicherheit unserer Gemeinschaft, die wir nicht aufs Spiel setzen durften. Dadurch kamen wir nur sehr langsam voran.« Er atmet kontrolliert ein und aus, seine Augen verengen sich. »Apropos Sicherheit … Wir waren gerade mitten in einer Besprechung. Hashem, hast du schon von der kleinen Siedlung in Tórshavn gehört?«
Papa schüttelt den Kopf.
»Es ist zwei Tage her«, fährt Aris Vater fort. »Ein halbes Dutzend Tote, die anderen sind gerade so mit dem Leben davongekommen. Und es gibt keine Hinweise auf bewaffnete Angreifer. Sie wurden im Schlaf überrascht.«
Stille kehrt ein.
Wie konnte ich früher in London nur so ahnungslos vor mich hin leben? Was stimmt eigentlich nicht mit uns, verdammt noch mal? Ich werde die Bilder nicht los, die jetzt vor meinem inneren Auge Gestalt annehmen, davon, was in Tórshavn passiert sein könnte. Von den Menschen, die bis vor Kurzem dort lebten und die nun einfach nicht mehr sind. Ich weiß nicht, wohin ich schauen soll, und ich komme nicht an gegen die Emotionen, die über mich hereinbrechen: Abscheu, Frustration und Wut. Scham und Entsetzen über die Verbrechen, die in unserem Namen begangen werden. Doch solange ich nicht aktiv werde, nichts dagegen tue, sind meine Gefühle bedeutungslos.
Ben vergräbt die Finger in seinen Locken. »Was diejenigen angeht, die verschleppt werden … Wir haben keine Ahnung, was aus ihnen wird.«
Es war so schlimm gewesen, nicht zu wissen, wo Papa war und warum er überhaupt verhaftet wurde – das Schweigen der Behörden kaum zu ertragen. Ich fühle mit Ben und Ruby und allen anderen, die verzweifelt auf Nachrichten von ihren Liebsten warten.
»Ich habe viel verpasst«, sagt mein Vater ernst. »Sobald wir das Bord-Kommunikationssystem abgesichert haben, werde ich mich an meine Kontakte im Süden wenden und nachfragen, was sie über diesen jüngsten Angriff wissen.«
Ben wedelt mit der Hand, als wäre ihm gerade etwas eingefallen. »Ach stimmt, ihr wart von der Außenwelt abgeschnitten. Wenn ihr wollt, ruft ruhig von hier aus bei Gideon und allen anderen an, die ihr sprechen wollt. Unsere Systeme sind sicher.«
Schon sind mein Vater und ich auf den Beinen.
»Oh ja, bitte!«, sage ich zu Ben, bevor ich mich an Papa wende. »Ich muss unbedingt mit Opa reden und mit Theo und Tabby.«
»Dann kommt mit.« Ben führt uns aus dem Raum hinaus.
Wir gehen durch einen engen, mit gerahmten Bildern geschmückten Gang. Auf einem Foto entdecke ich Ari und mir stockt der Atem. Ich halte inne, starre es an. Die Aufnahme stammt offenbar von einer Feier hier bei ihm zu Hause und das kleine Mädchen neben ihm kann nur seine Schwester Freya sein. Wie entspannt und glücklich die ganze Familie aussieht. Aris Augen leuchten und funkeln wie immer, sein schwarzes Haar fällt ihm in Wellen über die Schultern und oh je, ich muss das Bild einfach kurz anfassen …
»Gürkchen?« Weiter vorne ist Papa stehen geblieben und beobachtet mich mit zusammengezogenen Augenbrauen. Ich eile rasch weiter, meine Wangen sind bestimmt feuerrot.
Der Kommunikationsraum ist nicht groß, aber deshalb nicht minder beeindruckend. Alle möglichen Apparaturen und Anti-Tracking-Geräte tun ihren Dienst – ich weiß genau, wie viel Spaß Theo daran hätte, sich einen Tag lang mit jedem Einzelnen vertraut zu machen. Ben zeigt uns, was zu tun ist, und lässt uns allein.
Als Erstes kontaktieren wir meinen Großvater. Er nimmt das Gespräch sofort an, und als er tatsächlich auf dem Bildschirm erscheint, macht mein Herz einen Hüpfer.
Kaum hat er meinen Vater und mich erblickt, leuchten seine blassgrünen Augen auf. »Ah, Queenie! Shalom! Und Hashem … endlich hat das Warten ein Ende.«
»Salaam, Opa!« Ach, wie habe ich ihn vermisst. Das Wiedersehen lässt auch Papas Augen feucht werden.
Mein Großvater sitzt in seinem Arbeitszimmer und blinzelt in die Kamera, als könnte er es ebenfalls kaum glauben. Dann streicht er sein wirres weißes Haar glatt und wir bringen uns schnell gegenseitig auf den neuesten Stand. Seit wir uns an Silvester in den Mayfair-Hangars voneinander verabschiedet haben, ganz zu Beginn meiner langen U-Boot-Fahrt auf der Suche nach meinem Vater, habe ich nicht mehr mit Opa gesprochen. Wir erzählen ihm zunächst, was in den letzten Stunden passiert ist.
Danach antwortet Papa kurz und knapp auf Opas Fragen über seine Zeit in Broadmoor und ich sehe die Tränen in Opas Augen glitzern.
»Isolationshaft?«, fragt er fassungslos. »Schlimm genug, dass die Leute ohne Gerichtsverfahren ins Gefängnis gesteckt werden. Aber dass sie mit keiner Menschenseele Kontakt haben dürfen … das ist Folter.«
Ich fasse schnell zusammen, was wir seit der Befreiung meines Vaters gemacht haben.
Mein Großvater schüttelt immer wieder staunend den Kopf. Er erzählt Papa, was in London los ist. Und er berichtet ihm, dass ihr Labor von den Behörden geschlossen wurde.
Papa und Opa sind Astronomen, bis zu Papas Verhaftung waren sie beide im Bloomsbury-Labor tätig. Die Erforschung unseres Universums ist ihr eigentlicher Lebensinhalt.
Außerdem informiert Opa meinen Vater darüber, was sich zuletzt bei Bia und der Cambridge-Truppe getan hat.
»Bei denen will ich mich als Nächstes melden«, sagt Papa. »Du siehst müde aus, Gideon. Leg dich hin, wir sprechen uns bald wieder.«
Nachdem wir uns von Opa verabschiedet haben, inspiziert mein Vater erst einmal die technischen Gerätschaften und ich kontaktiere die Zwillinge. Sekunden später wird der Bildschirm von Theos Gesicht ausgefüllt.
Er reißt die Augen auf. »Was zum Teufel! Bin ich froh, dich zu sehen!«
Bei seinem Anblick strömt Wärme in meinen Bauch. Jojo kläfft freudig.
Theo mustert mich genau. »Wie geht’s dir? Und wo bist du bitte? Was ist eigentlich los?«
Wir fallen uns ständig ins Wort, bis wir uns endlich daran gewöhnt haben, dass wir plötzlich wieder miteinander sprechen und uns erzählen können, was es Neues gibt.
»Und dann hat Bia deinen Opa informiert, dass ihr deinen Vater aus dem Gefängnis geholt habt – um Neptuns willen, ich kann immer noch nicht glauben, dass du das wirklich durchgezogen hast!«, ruft Theo. »Und Gideon hat dann uns verklickert, was passiert ist. Wir helfen ihm, wo es geht. Dein Opa ist ein verdammter Geheimagent, Experte für verdeckte Operationen und so weiter!« Seine Augen leuchten. »Über ihn bin ich mit Cambridge in Kontakt gekommen und seitdem erledige ich einiges für Charlie. Der Typ ist der Hammer – er tut echt alles, um Amphi-Siedlungen zu beschützen. Und er steht auch total auf Games!« Theo kriegt das Strahlen nicht aus dem Gesicht. Kein Wunder, er ist schließlich der ehrgeizigste Zocker, den ich kenne.
»Großartig, dass ihr Opa unterstützt! Und stimmt, Charlie ist wirklich super. Bis zu Papas Verhaftung haben sie sich gemeinsam um die Siedlungen im Süden gekümmert, auf sie aufgepasst. Charlie hat vielen das Leben gerettet.«
Theo nickt. »Unsere Mum ist wie unter Schock, seit wir das alles erfahren haben. Und seit der hinterhältige Scheißkerl Captain Sebastian diese dreiste Nummer abgezogen hat, das mit dem Kopfgeld, meine ich, hat sie richtig Angst um dich. Sie kommt einfach nicht drüber hinweg, was du durchmachen musst. Und dass dein Dad auch noch in Broadmoor eingesperrt war und … Hey, MrMcQueen, da sind Sie ja! Bin ich froh! Ihnen geht’s gut, Sie sind in Sicherheit. Wie –«
Da quetscht Tabby sich zu ihrem Bruder vor den Bildschirm. »Leyla! Ah, MrMcQueen – so toll, dass Sie wieder da sind! Bei Neptun, Sie sehen aber gar nicht gut aus!« Theos Zwillingsschwester runzelt die Stirn. »Wo sind denn Ihre Haare hin? Was ist überhaupt bei euch los? Ihr müsst euch doch ab und zu melden! Ach, das mit Ari tut mir unglaublich leid, hoffentlich ist er okay. Ich kann immer noch nicht glauben, dass er ein Anthro- … ein Amphi ist, meine ich natürlich. Was für ein Schock! Er war ja an Bord des U-Boots, als wir uns verabschiedet haben. Er ist einer von ihnen und er war so dicht an mir dran. Und außerdem –«
»Tabs!« Theo funkelt seine Schwester an, sie verdreht zur Antwort die Augen.
Ich schüttele den Kopf. »Tabby. Sie sind nicht –«
»Das ist mir doch klar! Aber es ist nun mal ein ziemlicher Schock!« Ihre Miene verdüstert sich. »Wir wissen jetzt übrigens, warum damals der Tunnel zusammengebrochen und unser Dad umgekommen ist. Das hätte überhaupt nicht sein müssen, wenn die Regierung einfach nur ihre Arbeit gemacht hätte – aber stattdessen hat sie die Finanzierung gestoppt und viele Leute sterben lassen. Ich hasse sie alle. Sie sollten für ihre Verbrechen büßen. Vor allem dieser Sebastian, der dich einfach so zum Staatsfeind erklärt hat und … Wenn ich dem Scheißkerl doch nur sein widerliches Grinsen aus der Fresse prügeln könnte.«
Theo schüttelt den Kopf, seine Miene hart. »Sebastian gehört hinter Gitter. Er und niemand anderes sollte in Broadmoor sitzen.«
Ich verabscheue unsere Behörden aus vielen Gründen, doch dass sie durch ihre Unfähigkeit den Tod von Theos und Tabbys Vater verschuldet haben, ist ganz vorne mit dabei.
Wir reden weiter, wollen in der kurzen Zeit, die uns bleibt, so viel wie möglich unterbringen. Für mich ist es immer noch unglaublich, dass ich endlich wieder mit meinen besten Freunden sprechen kann. Mir wird warm ums Herz. Es war zu lange her, dass ich ihre Stimmen gehört habe. Ich wünschte, ich könnte sie berühren, sie umarmen.
»Wie hast du die Grenze ins Ausland überquert?« Theo verschränkt die Arme. »Hattest du die nötigen Papiere?«
Ich kaue auf der Unterlippe. »Es wäre zu riskant gewesen, eine Erlaubnis zu beantragen. Ich wollte am liebsten gar keine Spuren hinterlassen. Und ich konnte mich nicht bei dir melden und dich um Hilfe bitten, das wäre auch zu gefährlich gewesen. Also habe ich auf der Karte nachgesehen, wo die Grenze am schlechtesten überwacht wird, bin ganz weit aufgestiegen und einfach drübergerast.«
Theos Augen sind immer größer geworden. »Und wenn du in eine Kontrolle gerätst? Aber egal. Ein Kumpel von mir ist auf Reisepapiere spezialisiert. Wirklich erstklassiges Zeug, nicht vom Original zu unterscheiden.«
Ich komme mit dem Nicken gar nicht hinterher. Wenn wir da draußen unterwegs sind, muss ich ständig daran denken, dass wir uns hier ohne offizielle Erlaubnis herumtreiben.
»Die Färöer-Inseln …« Theo streicht sich über das Kinn. »Das müssten dänische Gewässer sein. Ich kümmere mich gleich nachher darum und schicke dir die Dokumente so schnell wie möglich rüber. Und sag Bescheid, wenn du Papiere für irgendwelche anderen Gebiete brauchst, klar? Ist echt besser, welche zu haben.«
»Das ist eine Riesenerleichterung. Danke, Theo.«
Mein Vater stellt sich neben mich. »Theo, Tabby. Schön, euch zu sehen. Wie geht es Vivian? Ihr müsst mir alles erzählen.«
Die Zwillinge berichten ihm, wie es bei ihrer Mutter aussieht und was sonst in der britischen Hauptstadt läuft. Zum Beispiel, dass inzwischen einige Leute die Frage stellen, was eigentlich aus mir geworden ist.
»Sie haben dich alle beim London Marathon gesehen, Leyla«, sagt Tabby. »Erst die Interviews mit dir, dann was bei der Preisverleihung passiert ist … Es geht ihnen ziemlich gegen den Strich, dass der Premierminister dir den Ultimativen Preis verwehrt und deinen Papa einfach im Gefängnis gelassen hat. Und als der Ausschuss auch noch dein U-Boot zurückhaben wollte, haben sie sich noch mehr aufgeregt. Das mit dem Kopfgeld auf dich verstehen sie nicht. Die Leute wissen, dass du nicht mal einem Krill etwas zuleide tun könntest.« Sie schleudert ihren kurzen platinblonden Bob herum. »Ganz im Gegensatz zu mir.«
»Wo wir schon beim Thema U-Boot sind …«, schaltet Theo sich lächelnd ein. »Ab jetzt können wir in Kontakt bleiben! Du benutzt doch noch das Armband, das ich dir gegeben habe?« Als ich zustimme, nickt er eifrig. »Du musst dir keine Gedanken mehr machen, dass sie unsere Kommunikation zurückverfolgen. Ich habe ein Programm entwickelt, das sämtliche von der Kabul ausgehenden Signale abschirmt und genauso alles hier bei uns. Bisher konnte ich es dir nicht ohne Risiko zukommen lassen, aber es geht in diesem Moment an Bens Nummer … Übertrag es sofort auf dein Armband und gib es später an Oscar weiter, ja? Der soll es ins Kommunikationssystem des U-Boots hochladen. Auf die Art kannst du jeden anfunken, solange du überzeugt bist, dass sein Anschluss nicht überwacht wird. Die Ausrüstung von deinem Opa habe ich schon überprüft, die ist in Ordnung. Also wenn du mal wieder Lust hast, ruf einfach durch!«
»Was? Das ist ja … Bist du dir sicher?« Ich kann es nicht fassen – endlich wieder regelmäßig mit Opa und den Zwillingen reden! Wir sind nicht mehr allein. Wir haben Aris Leute gefunden und wir können mit allen anderen in Kontakt bleiben.
»Hundertprozentig sicher.« Theo strahlt. »Apropos Oscar, läuft er einigermaßen rund? Und was ist mit der Codierung, die ich dir nach Cambridge geschickt habe, hat sie funktioniert?«
»Ach, Oscar ist ein Traum, ich bin dir so dankbar für ihn. Die Codierung …« Ich schneide eine Grimasse. »Wir sind an die Infos rangekommen, aber die Aktion hat Spuren hinterlassen – davor hattest du mich ja gewarnt. Bia ist uns auf die Schliche gekommen.«
»Was!?« Tabby beugt sich vor. »Davon hat dein Opa kein Wort gesagt! Wie hat sie reagiert?«
Bia und ihre Truppe setzen sich im sogenannten Bau
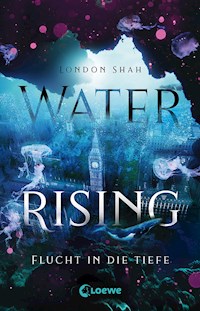













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)














