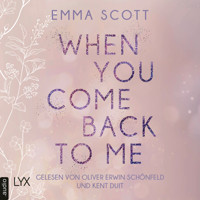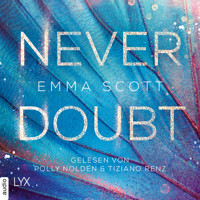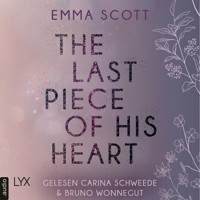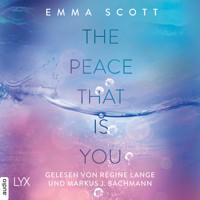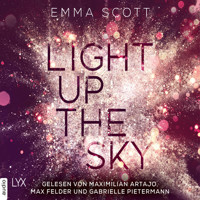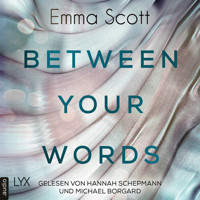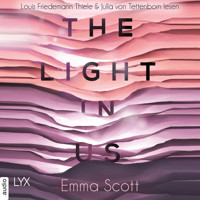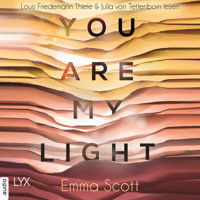11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Angels and Demons
- Sprache: Deutsch
EINE LIEBE, DIE WEDER DER TOD NOCH DIE ZEIT ZERSTÖREN KANN ...
Seit dem Tod ihres Vaters hat sich die introvertierte Lucy in ihr Schneckenhaus zurückgezogen. Als eines Tages ein scheinbar toter, äußerst attraktiver Mann vor ihrer Tür liegt, wird ihre Welt aus den Fugen gehoben. Casziel ist ein mächtiger Dämon, der nach Erlösung sucht, aber nicht mehr wirklich daran glaubt - zu viel Leid hat er einst über die Menschen gebracht. Er möchte Lucy dabei helfen, ihr Glück zu finden, und dann seine eigene Existenz beenden. Bald schon wird klar, dass die beiden etwas verbindet, was über irdische Anziehungskraft hinausgeht. Zum ersten Mal in ihrem Leben fühlt Lucy nicht mehr diese schmerzliche Leere in sich. Doch um Casziel zu erlösen, muss sich Lucy den finstersten Mächten der Unterwelt stellen ...
»Die ultimative Geschichte über Seelenverwandtschaft und immerwährende Liebe. Wunderschön und unvergesslich.« DIRTY GIRL ROMANCE
Die erste Fantasy-Reihe der SPIEGEL-Bestseller-Autorin
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 429
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
INHALT
Titel
Zu diesem Buch
Leser:innenhinweis
Playlist
Vorbemerkung der Autorin
Glossar
Widmung
Teil I
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Teil II
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Siebzehn
Achtzehn
Teil III
Neunzehn
Zwanzig
Einundzwanzig
Zweiundzwanzig
Dreiundzwanzig
Vierundzwanzig
Fünfundzwanzig
Epilog
Anmerkung der Autorin
Danksagung
Die Autorin
Die Romane von Emma Scott bei LYX
Leseprobe
Impressum
Emma Scott
We Conquer the Dark
Roman
Ins Deutsche übertragen von Inka Marter
ZU DIESEM BUCH
Die junge, introvertierte Lucy fühlt sich verloren. Nachdem ihr Vater gestorben ist, verkriecht sie sich außerhalb ihres Jobs in die heile Welt von Liebesromanen und träumt heimlich von ihrem Arbeitskollegen Guy. Als eines Tages ein scheinbar toter, äußerst attraktiver Mann mit schwarzen Flügeln vor ihrer Haustür liegt, verändert sich alles. Casziel ist ein Dämon, der einst ein Krieger im alten Sumer war. Er sucht nach Erlösung, glaubt aber nicht mehr wirklich daran, diese zu erlangen, hat er doch zu viel Leid über die Menschen gebracht. Er möchte Lucy dabei helfen, ihr Glück zu finden, und dann seine eigene Existenz beenden. Aber bald schon wird klar, dass die beiden etwas verbindet, das über reine irdische Anziehungskraft hinausgeht. Casziel nimmt mit jedem Tag mehr Raum in Lucys Gedanken ein, und sie wird zunehmend von Träumen und Visionen heimgesucht, die sich fast wie Erinnerungen anfühlen. Zum ersten Mal in ihrem Leben spürt die junge Frau nicht mehr die schmerzliche Leere in sich, die sie ihr ganzes Leben lang begleitet hat. Doch um Casziel zu erlösen, muss sich Lucy den finstersten Mächten der Unterwelt stellen …
Triggerwarnung
Liebe Leser:innen,
dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte.
Deshalb findet ihr hier eine Triggerwarnung.
PLAYLIST
Godsmack: Voodoo (Vorspann)
The Weeknd: Scared to Live
INXS: Devil Inside
Chris de Burgh: Lady in Red
Imagine Dragons: Follow You
No Doubt (feat. Lady Saw): Underneath It All
The Rolling Stones: Sympathy for the Devil
Taylor Swift (feat. Bon Iver): exile
Billie Eilish: all the good girls go to hell
Mumford & Sons: Thistles & Weeds
Ed Sheeran: Thinking Out Loud (Abspann)
VORBEMERKUNG DER AUTORIN
Die Vorstellungen von Leben, Tod und dem dazwischen, wie sie in diesem Roman beschrieben werden, entstammen allein meiner Fantasie und sind keinesfalls dazu gedacht, einer existierenden Religion recht zu geben oder sie zu widerlegen. Dazu fehlt mir ohnehin die Kompetenz; die Geheimnisse des Universums werden Geheimnisse bleiben, bis wir selbst ins Unbekannte treten. Dieser Roman ist meine Art, diese Geheimnisse zu betrachten, um bestimmte Ereignisse in meinem Leben besser zu verstehen, aber es war auch das reine Vergnügen, meiner Fantasie freien Lauf zu lassen. Außerdem ist das Buch eine tief empfundene Ode an den Liebesroman und an die Träumer:innen und Romantiker:innen (Romance-Leser:innen), die den Wert und die Macht von Liebesgeschichten verstehen.
GLOSSAR
(fiktional und nicht-fiktional)
Andere Seite:Sphäre, in die eine Seele vor dem nächsten Leben nach dem Tod zurückkehrt. Die Sphäre der Engel und Dämonen. Der menschliche Verstand kann die Andere Seite nicht vollkommen verstehen, und etwas darüber zu wissen oder sich daran zu erinnern würde dem Zweck des Lebens zuwiderlaufen. (Siehe: VERGESSEN)
Anikorpus: Die tierische Gestalt, die ein Dämon annimmt, um sich auf Dieser Seite frei bewegen zu können. Nicht mit einer/einem Vertrauten zu verwechseln.
Auslöschung: Ganz aufhören zu existieren. Ultimative und dauerhafte Nichtexistenz. »Der Tod für die Toten.« Nur sehr mächtige Dämonen können andere Dämonen auslöschen, und das auch nur, wenn die- oder derjenige gerade ihre/seine menschliche Gestalt angenommen hat.
Babylonisches Reich: Reich in Mesopotamien zwischen dem 19. und 15. Jahrhundert v. u. Z., dann erneut vom 7. bis zum 6. Jahrhundert v. u. Z.
Bruderschaft: Zwölf hochrangige Dämonen, die direkt dem Großherzog Casziel unterstellt sind und seine Legionen befehligen.
Dämon: Seele, die sich als böse Energie offenbart.
Diener: Jeder Dämon, der einem mächtigeren Dämon dient. Hochrangige Dämonen haben ganze Armeen von Dienern.
Diese Seite: Das irdische Leben.
Dschinn: Dämon, der für eine gewisse Zeit oder bis zur Erfüllung bestimmter Bedingungen als dienstbarer Geist an einen bestimmten Ort, einen Menschen oder einen anderen Dämon gebunden ist.
Engel: Seele, die sich als wohlwollende Energie offenbart.
Großherzog der Hölle: Ranghoher Dämon.
Geringere Diener: Die niedrigsten, untersten Dämonen, die nach menschlichem Schmerz gieren. Sie dienen in den Armeen mächtigerer Dämonen als Fußsoldaten und ähneln hungrigen streunenden Hunden oder haarlosen Ratten. Auch als Teufelchen bekannt.
Gott: Das unbekannte Gute.
Grimoire: Buch mit Zaubersprüchen und Formeln zum Beschwören von Geistern oder Dämonen.
Hammurapi: König der ersten Dynastie von Babylonien, der von ca. 1792 v. u. Z. bis ca. 1750 v. u. Z. regierte.
Himmel: Kollektivbezeichnung für die Engel auf der Anderen Seite. Kein konkreter Ort.
Hölle: Kollektivbezeichnung für die Dämonen auf der Anderen Seite. Kein konkreter Ort.
Innana: Sumerische Göttin des Krieges.
Larsa: Sumerischer Stadtstaat, der 1763 v. u. Z. vom babylonischen König Hammurapi erobert wurde.
Mesopotamien: Das Gebiet zwischen den Flüssen Euphrat und Tigris. Heimat alter Zivilisationen wie die der Sumerer oder Babylonier. Heutiger Irak.
Rim-SinI: König von Larsa, herrschte etwa von 1822–1763 v. u. Z.
Schleier, der: Eine stark vereinfachte Erklärung der Grenze zwischen Dieser Seite und der Anderen Seite.
Sumer: Alte Zivilisation in Mesopotamien, auf dem heutigen Gebiet des Irak.
Übergang: Übergang zwischen Dieser Seite und der Anderen Seite, normalerweise wenn man stirbt. Nur mächtige Dämonen können sich aus eigenem Willen in beide Richtungen bewegen, während andere Dämonen dazu lediglich in der Lage sind, wenn sie angerufen oder beschworen werden.
Unsere Zeitrechnung (u. Z.): Jahr 0 bis in die Gegenwart.
Utu: Sumerischer Gott des Lichts.
Vergessen:Das Löschen sämtlicher Erinnerungen an die Andere Seite und alle früheren Leben, bevor man einen neuen Zyklus auf Dieser Seite (Leben) beginnt, um besser lernen zu können. Beim Übergang (im Tod) wird die Erinnerung wiederhergestellt.
Vertraute/Vertrauter: Tierische Begleiter oder Begleiterinnen der Dämonen, z. B. Fliegen, Schlangen, Ziegen. Nicht jeder Dämon hat eine:n Vertraute:n.
Vor unserer Zeitrechnung (v. u. Z.): Aufgezeichnete Geschichte bis zum Jahr 0.
Zikkurat: Mesopotamischer Tempel, architektonisch der Vorläufer der Pyramiden.
Zu: Der »Sturmvogel«. Ein Dämon aus der sumerischen Überlieferung.
Für Dad, den ich mir gern einfach im Nebenzimmer vorstelle.
Und für Izzy, mein mutiges Mädchen, die als Erste in das Unbekannte getreten ist.
Euch beiden all meine Liebe.
TEIL I
EINS
Ich hätte niemals geglaubt, dass der Tag noch schlimmer werden könnte, aber dann fand ich die Leiche.
Auf der Arbeit war es grauenvoll gewesen für einen Freitag. Die Bahn kam zu spät, weshalb ich zu spät kam, was meinen ganzen Tag durcheinanderbrachte. Beim Morgen-Meeting verwechselte Guy Baker mich mit der Praktikantin, die den Kaffee holt, obwohl wir seit fast zwei Jahren zusammenarbeiteten. Er wusste also immer noch nicht, dass ich existierte. Auf dem Nachhauseweg war die Bahn überfüllt, und alle standen dicht gedrängt. Ein junges Pärchen, ein Stück von mir entfernt, nutzte das aus. Sie schmiegte sich an ihn, er umarmte sie, und sie sahen sich an, als gäbe es niemanden sonst auf der Welt. Es war schön, dass sie so glücklich waren, aber meine Einsamkeit war noch schmerzhafter durch den Kontrast.
Und zu allem Überfluss lag im leeren Hof hinter meiner Wohnung dann diese Leiche.
Eigentlich war der Hinterhof eher mein Vorgarten. Das Haus in Hell’s Kitchen, in dem ich wohnte, war in den 1970er-Jahren zerstückelt worden, um so viel wie möglich am New Yorker Immobilienboom zu verdienen. Das kleine Apartment war kaum eine richtige Wohnung, eher eine Art Anhängsel. Es lag im ersten Stock auf der Rückseite, und um dorthin zu kommen, musste ich um das Gebäude herumgehen, dann über den zugemüllten Hinterhof und schließlich eine klapprige Außentreppe hinauf. Von innen war es nicht viel mehr als ein Schuhkarton, aber es hatte ein großes Fenster. Auch wenn man dadurch vor allem das Nachbargebäude sah, war das Licht am Morgen schön.
Und es war meine Wohnung. In Manhattan.
Jedes Mal, wenn ich nachts die drei Riegel vorschob und die drei Ketten vorlegte, rief ich mir ins Gedächtnis, dass ich keine Mitbewohner hatte, die mich wach hielten oder mir das Essen wegaßen oder ewig in dem kleinen Bad brauchten … wobei ich auch nicht mit ihnen morgens beim Kaffee plaudern konnte oder es mir mit ihnen auf der kleinen Couch gemütlich machen und Netflix gucken oder über meine Hoffnungen und Träume reden konnte. Zum Beispiel die Hoffnung, dass Guy Baker mich endlich bemerken und mit mir auf seiner Fünfzehn-Meter-Yacht um die Welt segeln würde, während wir weiter für Ocean Alliance arbeiteten, die gemeinnützige Organisation, bei der wir beide angestellt waren. Wir würden uns wahnsinnig ineinander verlieben – und es wäre die Art von Liebe, von der die Romane handelten, die ich jeden Abend las. Die Art von Liebe, die mir wie ein nie erfülltes Versprechen vorkam.
Was irgendwie dramatisch klang, schon klar. Ich war erst dreiundzwanzig; ich hatte noch mein ganzes Leben, um mich zu verlieben. Aber die Einsamkeit, die mich niederdrückte, fühlte sich viel älter an als dreiundzwanzig.
Als ich an diesem Aprilabend von der Bahn nach Hause ging, versuchte ich, den miesen Tag mithilfe meines Lieblingstagtraums aus meinem Gedächtnis zu löschen. Mit dem Traum, in dem Guy und ich durch die Straße von Gibraltar segeln oder entlang der Küste bei Kapstadt … der genaue Ort ist nicht wichtig. Wir sind auf einer Mission für Ocean Alliance und arbeiten beide leidenschaftlich und unermüdlich. In dieser konkreten Fantasie kehren Guy und ich auf sein Boot zurück, nachdem wir den ganzen Tag auf den Trawlern und Müllsammelkähnen geschuftet und Tonnen von Plastikscheiß aus dem Wasser geholt haben. Wir stehen müde, aber glücklich in der kleinen Kabine, er sieht mich an, und wir fallen uns in die Arme. Er küsst mich leidenschaftlich, dann nimmt er mein Gesicht in die großen rauen Hände. Seine hellblauen Augen sind auf mich gerichtet, als wäre es ihm unmöglich, den Blick abzuwenden.
»Lucy«, sagt er schroff. »Ich will das nie wieder ohne dich tun.«
Ich schlucke, meine Kehle ist wie zugeschnürt von all den Emotionen. »Das musst du auch nicht.«
Mein Lieblingsdialog. Tausend Mal haben wir ihn in meinen lächerlichen Fantasien geführt. Die Sätze könnte ich aus einem der Hunderten von Liebesromanen geklaut haben, die in meiner Wohnung herumstanden. Das Regal, in dem sie standen, nahm fast eine ganze Wand ein, obwohl ich eigentlich nicht genug Platz hatte, um ihn von überhaupt etwas einnehmen zu lassen.
Ich ging um das Gebäude herum, um zu meiner Wohnung zu kommen. Vor meinem geistigen Auge fielen Guy und ich auf das Bett, das gerade groß genug war für zwei, und die See wiegte uns sanft, als ich abrupt innehielt und mir ein Schrei in der Kehle stecken blieb.
Der ist tot.
Die Worte ploppten in meinem Kopf auf, bevor meine Augen überhaupt registrierten, was ich sah: lange, schlanke und muskulöse Männerbeine. Völlig nackt und so weiß wie Alabaster. Wie Porzellan oder Marmor. Als wäre Michelangelos David im Hinterhof umgekippt.
Ich sah mich um im dämmrigen Licht des frühen Abends. Bis auf Mrs Rodriguez im zweiten Stock, die mit offenem Fenster Telemundo guckte, war alles ruhig.
Ich ging einen Schritt vorwärts. Dann noch einen. Ich hatte das Telefon in der Hand und war kurz davor, den Notruf zu wählen. Aber meine Finger gehorchten mir nicht, mein Blick war auf diese Beine gerichtet, die zu perfekt waren, um real zu sein. Irgendwie surreal.
Vielleicht ist es eine Schaufensterpuppe. Ruf bloß nicht die Polizei, nur weil ein Kaufhaus in deinem Hinterhof seinen Müll abgeladen hat.
Wenn das bei mir auf der Arbeit herauskäme, würde ich es ewig zu hören kriegen. Lucy, Dummerchen, würde Abby Taylor kopfschüttelnd sagen und mit der Videofunktion ihres Telefons alles aufzeichnen. Aber es würde nicht herauskommen. Ich redete kaum mit jemandem bei Ocean Alliance, höchstens in den Meetings, und dann nur, um Vorschlägen zuzustimmen, denen alle anderen schon zugestimmt hatten. Auch wenn ich sie gar nicht so gut fand. Auch wenn ich eigene Ideen hatte.
Jetzt war ich nah genug dran, um zu sehen, dass es definitiv keine Schaufensterpuppe war, sondern ein Mann, dessen Körper so perfekt war wie seine Beine. Makellos. Ohne Narben, ohne Sommersprossen, ohne auch nur ein einziges Härchen bis auf die dichten schwarzen Locken auf seinem Kopf. So schwarz, wie seine Haut weiß war. Er lag auf dem Bauch (ich wandte den Blick ab von der perfekten festen Rundung seines Pos), hatte die Augen geschlossen und den Kopf auf einem muskulösen Unterarm abgelegt. Der andere Arm – der rechte – war auf dem Boden ausgestreckt, als hätte er nach etwas gegriffen, als er …
Gefallen war?
Ich machte einen Schritt über einen seiner Flügel hinweg – oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott – und ging so nah heran, wie ich es wagte. Sein Gesicht war berückend. Wie eine Renaissancestatue mit vollen Lippen, hohen Wangenknochen und Augenbrauen so schwarz wie Tinte. Er hatte eine griechische Nase und eine so gerade und perfekte Kieferpartie, dass er fast nicht menschlich wirkte.
»Fast nicht menschlich«? Und was ist mit den Flügeln, Dummerchen?
Ich zwang mich, zu akzeptieren, was ich sah.
Dieser Mann war in keine Decke gehüllt.
Es gab keine Schatten, die meine Augen hätten täuschen können.
Zwei riesige Flügel mit langen, glänzend schwarzen Federn waren zwischen den perfekten Schulterblättern angewachsen. Beide waren etwa so lang wie sein Körper – beim Gehen berührten die Spitzen wahrscheinlich seine Knöchel. Damit musste seine Flügelspannweite über dreieinhalb Meter betragen.
Er hat eine Flügelspannweite.
Mir entfuhr ein kleiner Schrei, als die vollen Lippen des Mannes sich plötzlich öffneten und er so angestrengt nach Luft rang, als hätte er richtig lange den Atem angehalten. Er atmete stöhnend aus – ein Laut, bei dem mir ein Schauder die Wirbelsäule hinunterkroch, zu gleichen Teilen vor Angst und einer merkwürdigen Erregung.
Was auch immer er war, er lebte. Ich sah wieder auf mein Handy.
Wenn willst du anrufen? 911 oder die Tierrettung?
Mir wollte gerade ein irres Lachen entfahren, als der Mann die Augen öffnete. Das Lachen verwandelte sich in einen erstickten Schrei, und mir fiel das Telefon aus der Hand.
Seine Augen waren völlig schwarz. Kein Weiß, keine Iris. Die Pupillen – wenn er überhaupt welche hatte – verloren sich in der tintigen Schwärze. In diesen wenigen Sekunden, die sich wie eine Ewigkeit anfühlten, hatte ich die fieberhafte Ahnung, dass seine Augen gar nicht schwarz waren. Das war keine Farbe, sondern eine Abwesenheit von Farbe. Eine Abwesenheit von Licht. Hitze. Wärme.
Von allem Guten auf der Welt …
Es war unmöglich zu sagen, ob er mich ansah, aber ich spürte, dass er es tat. Er sah mich. Sein schwarzer Blick durchbohrte mich wie eine kalte Klinge. Mir schauderte, und ich wankte, fühlte mich in diese endlose Schwärze hineingezogen. In einen Abgrund, aus dem es kein Zurück gab.
Der Mann hob den Arm vom Boden, streckte die Hand nach mir aus. Ein raues Flüstern kam aus seinem Mund. »Hilf mir …«
Taumelnd ging ich rückwärts. Dann stieß ich mir an irgendwas den Hinterkopf, und die Schwärze verschlang mich.
ZWEI
Die Fackel brennt ungleichmäßig, Schatten tanzen an den Wänden. Den blutigen Wänden. Die Steine sind glitschig vor Blut, auch der Boden. Und es ist so dunkel. Schreie hallen durch einen schmalen Gang. Seine Schreie, die aus dem Inneren des Tempels kommen.
Der Gang weitet sich zu einer Kammer. Leichen – vier an der Zahl – liegen auf dem Boden. Unter ihnen sammelt sich das Blut und verklebt ihr schwarzes Haar. Eine fünfte Person, eine Frau, lebt noch. Sie ist gefesselt und geknebelt, kniet gegenüber von dem Mann, der geschrien hat. Er ist auch gefesselt, sein harter, muskulöser Körper ist mit Wunden übersät, man hat ihn schlimm zugerichtet.
Ihre Blicke treffen sich über den blutgetränkten Steinen, Tod liegt in der Luft. Er schüttelt den Kopf, Schmerz leuchtet hell in seinen dunklen Augen. Eine Klinge glänzt im Licht der Fackeln, jemand hält sie ihr an die Kehle. Er schreit wieder, rau und stockend, reißt an seinen Fesseln wie ein Besessener. Dann eine schnelle Bewegung, und ein Schwall von Blut ergieß sich aus ihr. Die Frau sinkt auf die Steine, die wie Schatten sind. Sie fällt hinein, hindurch, und die Schreie des Mannes, jetzt voller Zorn, jagen ihr nach.
Die Schreie werden zum Ruf eines Raben mit ausgebreiteten Flügeln …
Dann folgt eine gramerfüllte Bitte.
»Vergib mir …«
Keuchend öffnete ich die Augen. Setzte mich ruckartig an der Hauswand auf. Die Sonne ging schon unter, und es war dunkler geworden. Ich hatte mindestens eine Stunde verloren durch …
Einen Traum. Es war alles nur ein Traum …
Was auch immer es gewesen war, es verblasste – ich konnte es nicht festhalten. Ein Tempel? Und so viel Blut …
»Wurde auch Zeit«, murmelte müde eine tiefe Stimme. »Ich wollte schon aufgeben und mir jemand anderen suchen.«
Wieder entfuhr mir ein Schrei, und ich drückte mich an die Wand. Der Mann war noch da. Er hatte sich gegen eine alte Holzpalette gelehnt und die Beine angezogen, um seine Blöße zu verbergen.
Jedenfalls dachte ich, dass es derselbe war.
Er war nicht mehr ganz so groß, aber kräftiger gebaut und sehr muskulös. Die Flügel waren verschwunden, und die komplett schwarzen Augen waren jetzt tief bernsteinfarben und sahen mich durchdringend an. Seine Haut war nicht mehr so blutleer und weiß, sondern olivfarben und gesund … bis auf die Narben, die seinen Körper bedeckten. So viele Narben. Alte Schnittwunden am Oberkörper. Eine am Bizeps. Noch eine am Hals. Und ein Kreis von der Größe eines Silberdollars direkt auf der linken Seite seiner Brust. Über dem Herzen.
Ich rappelte mich auf. »Was ist hier los?«
»Es ist der Anfang.« Der Mann blickte mit zusammengekniffenen Augen in die untergehende Sonne. »Und ein Ende.«
»Ich verstehe nicht. Wie lange war ich …?«
»Bewusstlos? Etwa eine Stunde.«
Mir schauderte bei dem Gedanken, so lange ohnmächtig gewesen zu sein, während ein nackter Mann mir gegenübergesessen hatte. Er schien meine Gedanken zu lesen und legte die Hand auf diese schreckliche Narbe auf seiner Brust.
»Gek pro’ma-ra-kuungd-eh. Das ist ein heiliger Schwur. Ich werde dir nichts tun. Weder in diesem Leben noch in einem anderen.«
Ich hatte keine Ahnung, was er gesagt hatte – oder auch nur, in welcher Sprache –, aber die Überzeugung in seiner Stimme beruhigte mich ein bisschen.
Ich atmete aus. »Wie heißt du?«
»Ich bin Casziel.«
Wie Ca-si-ell, mit einem Zischen in der Mitte. Bei dem Klang liefen mir halb beängstigende, halb erregende Schauder über den Rücken. Ich wollte es aussprechen. Ich wollte es auf meiner Zunge spüren …
»Was ist das für ein … Name?«
»Ein alter«, sagte er. »Und wie nennt man dich?«
»Lucy.«
»Das kommt aus dem Lateinischen und bedeutet ›aus Licht geboren‹.« Casziel verzog den Mund. »Wie außerordentlich passend.«
Er sah aus wie etwa fünfundzwanzig, aber er redete, als wäre er älter. Ein zynischer, sarkastischer Klang färbte seine Worte, und er hatte einen leichten Akzent, den ich nicht zuordnen konnte.
»Wie bist du hier gelandet?«, fragte ich. »Hat man dich beklaut?«
Ich hoffte, dass es nur das war und nicht, wonach es aussah – dass man ihn brutal überfallen, ihm sämtliche Kleider weggenommen und ihn tot geglaubt liegen gelassen hatte.
Casziel neigte den Kopf. »Du sorgst dich jetzt schon um mein Wohl? Das verheißt Gutes. Aber spar dir dein Mitleid; man hat mir nicht wehgetan. Der Übergang ist immer schwierig.«
Ich nickte, als würde das irgendeinen Sinn ergeben, und rückte ganz langsam zu der Holztreppe, die in meine Wohnung führte. »Na dann, okay … Ich ruf am besten die Polizei …«
»Keine Polizei.«
»Aber du wurdest ausgeraubt … oder?«
»Ich wurde beraubt, ja. Aber was mir genommen wurde, gehört mir nicht mehr.«
»Äh, okay.« Er sprach in Rätseln, aber der Schmerz in seiner Stimme war echt. »Kann ich sonst jemanden für dich anrufen? Familie …?«
»Du hast keine Angst vor mir?«
Ich schluckte. »Sollte ich denn?«
»Die meisten Menschen haben Angst.«
»Okaaaay.« Ich trat einen Schritt zurück. »Ich sollte vielleicht doch jemanden anrufen.«
Die Polizei oder den sozialpsychiatrischen Dienst.
Casziel fixierte mich mit seinen bernsteinfarbenen Augen. »Glaubst du an zweite Chancen, Lucy Dennings? Selbst für die schlimmsten Sünder? Die unvorstellbare Verbrechen begangen haben?«
Die schreckliche Trauer und die blutigen gewaltsamen Tode in meiner Vision oder dem Traum, oder was immer es war, legten sich auf mich wie ein Schatten. Mir wurde am ganzen Körper kalt, und fast wäre mir entgangen, dass er meinen vollen Namen kannte.
»Ich … ich hab dir nie gesagt …«
Casziel murmelte etwas in einer Sprache, die ich nicht erkannte – sie klang exotisch und alt.
»Vergib mir, Lucy Dennings. Es war nicht meine Absicht, dich zu ängstigen, obwohl ich weiß, dass man nichts dagegen tun kann. Aber wenn du wirklich darauf bestehst, die Behörden zu verständigen, hast du vielleicht etwas, womit ich meine Blöße bedecken kann?«
»Du brauchst was zum Anziehen«, sagte ich schwerfällig. »Klar. Okay. Ich … bin gleich zurück.«
Ich ging die klapprige Treppe zu meiner Wohnung hoch und schloss mit zitternden Fingern die Tür auf, wobei ich zweimal fast die Schlüssel fallen ließ. Sobald ich drinnen war, machte ich die Tür hinter mir zu und schob die Riegel vor.
Alles sah aus wie heute Morgen, als ich zur Arbeit gegangen war. Der Kaffeebecher stand noch auf der Arbeitsfläche. Mein Bett war ordentlich gemacht. Meine Zimmerpflanze – Edgar – stand auf der Fensterbank. Die merkwürdige Situation unten mit diesem Casziel wirkte noch unwirklicher vor dem Hintergrund der gewöhnlichen Wirklichkeit meiner Wohnung.
Im Hinterhof stand ein nackter Mann. Das war alles.
Und die Flügel? Die schwarzen Augen? Die blutleere weiße Haut?
»Es muss für das alles eine plausible Erklärung geben«, murmelte ich und atmete bewusst ruhig ein. »Ich hab mir einfach schlimmer den Kopf gestoßen, als ich dachte.«
Nur hatte ich Casziel entdeckt, bevor ich mir den Kopf gestoßen hatte. Hatte eine Version von ihm Flügel?
Denk das nicht einmal.
Ich nahm das Telefon, wollte die 911 wählen. Die Polizei würde kommen, und dieser Mann würde aus meinem Leben verschwinden. Alles wäre wieder normal. Ich könnte ein heißes Bad nehmen, mir ein paar Instant-Nudeln zubereiten und es mir im Bett mit einem Buch gemütlich machen, bis das Wochenende um war und ich wieder irgendwo hinmusste.
Genau wie letztes Wochenende. Und nächstes Wochenende.
Wäre es so schlimm, Casziel vorher was zum Anziehen runterzubringen?
Ja. Wäre es.
Ich wählte die 9 und hielt inne.
Die Heldinnen meiner liebsten romantischen Fantasien gerieten immer in Gefahr. Sie sahen ihr mutig ins Auge und erfuhren dann, dass sie besondere Fähigkeiten hatten, oder wurden Königinnen in Fantasieländern. Einem nackten Mann – einem schönen nackten Mann – mit Narben und fremdartigen Augen etwas zum Anziehen zu bringen war nicht dasselbe, wie ein Königreich zu retten oder Narnia zu besuchen, aber es war wenigstens etwas.
Lächerlich, schnaubte die höhnische Stimme, die sich immer zu melden schien, wenn ich für mich selbst einstehen oder etwas Neues ausprobieren wollte. Das hier ist kein Buch, es ist die Realität, und du bist nichts Besonderes. Du bist nur das Dummerchen Lucy, das sein dummes kleines Leben lebt.
Ich schob das Kinn vor. »Heute nicht.«
Meine Nerven verwandelten sich durch diese Erklärung nicht wie von Zauberhand in Drahtseile, aber Mut, hatte ich gelesen, bedeutete nicht, dass man etwas tat, weil man keine Angst hatte. Es bedeutete, Angst zu haben, und es trotzdem zu tun.
Dann suchte ich zwischen den schlichten Blusen, Pullis und Kleidern in meinem Schrank nach etwas, was Casziel passen könnte. Ich war eins fünfundsechzig. Er sicher eins achtzig und mit breiten Schultern …
Mit oder ohne Flügel?
»Hör auf.«
Ich schob die Bügel zur Seite, dann traf mich schnell und hart die Trauer, und alles andere wurde ausgeblendet.
Dads Trenchcoat.
Er hatte immer gesagt, dass der Mantel zwar ein bisschen altmodisch sei, aber dass er sich darin fühlen würde wie Humphrey Bogart in Casablanca. Er hatte ihn immer angezogen, wenn er früher sonntags in Milford in eine Klassiker-Matinee in dem alten Kino gegangen war.
Ich drückte den Ärmel an meine Wange und atmete ein. Er war vor sechs Monaten gestorben, aber sein Duft – Old Spice und Pfeifenrauch – war immer noch intensiv.
Der würde Casziel passen.
Der Gedanke war befriedigend und zugleich schrecklich.
»Niemals«, sagte ich durch zusammengebissene Zähne. »Auf keinen Fall.«
Ich bildete mir ein, Dads Stimme in meinem Kopf zu hören.
Ich brauche ihn nicht mehr, Mäuschen. Und du auch nicht. Ich werde immer bei dir sein.
»Ich werde immer bei dir sein« war eines der letzten Dinge, die Dad zu mir gesagt hatte, bevor der Krebs ihn geholt hatte.
Ich hatte seinem letzten Willen gehorcht und fast alle seine Sachen und auch das Haus in Connecticut verkauft, was mir ein kleines finanzielles Notpolster verschafft hatte. Ich hatte an der New York University einen Bachelor in Bioingenieurwissenschaft gemacht, aber statt in einem Labor anzufangen oder im Rahmen eines Projekts zu erforschen, wie man Plastikpartikel aus dem Ozean entfernen konnte, hatte ich einen Einstiegsjob in einer gemeinnützigen Organisation angenommen, wo niemand viel von dem schüchternen Mädchen in der Ecke erwartete, das gut in Excel war.
»Ich kann nicht, Daddy«, murmelte ich. »Ich kann deinen Trenchcoat nicht irgendeinem Fremden geben.«
Aber ich tat es schon wieder. Ich ging auf Nummer sicher und tat, was von mir erwartet wurde: nichts.
Ich nahm den Mantel vom Bügel, vergrub ein letztes Mal mein Gesicht darin und ging wieder nach draußen.
Casziel saß genau da, wo ich ihn zurückgelassen hatte, und sah schwach und hilflos aus.
Er ist weder schwach noch hilflos … und das weißt du.
Nur wusste ich das eben nicht, und ich wollte auch auf keinen Fall länger darüber nachdenken. Langsam atmete ich ein, bereit, Zeter und Mordio zu schreien, falls Casziel … Anstalten machte, mich ermorden zu wollen.
»Das sollte gehen«, sagte er und beäugte den Mantel in meiner Hand.
Er stand steif und ruckartig auf. Ich wandte den Blick ab, gab ihm den Mantel meines Vaters und trat schnell zurück. Casziel drehte sich um, und ich entdeckte noch mehr Narben auf seinem Rücken. Er zog den Mantel an, der ein bisschen an den Schultern spannte, aber einigermaßen seine Blöße bedeckte.
»Okay, äh … das war’s dann wohl. Viel Glück …«
»Lucy, warte …«
Casziel taumelte, streckte die Hand aus, griff in die Luft. Instinktiv – und ein bisschen verrückt – eilte ich auf ihn zu statt von ihm weg. Ich reichte ihm den Arm, um ihn zu stützen, und brach fast zusammen unter dem Gewicht. Ein Hauch von Rauch und heißem Metall stieg mir in die Nase, dazu ein merkwürdiger Geruch, den ich nicht einordnen konnte.
Ich sah Casziel an, und er erwiderte den Blick. Seine Augen waren, als würde ein Feuer in ihnen brennen. Zahllose Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge, die sich über Jahrtausende ereignet hatten. Ich fiel immer tiefer in sie hinein, bis ich Schreie hörte …
»Was passiert hier?«, flüsterte ich.
»Meine Zeit läuft ab, Lucy Dennings«, sagte Casziel, und seine Stimme war wie Rauch. »Ich brauche deine Hilfe. In elf Tagen ist alles vorbei, egal ob es gut oder schlecht ausgeht. Und so unwahrscheinlich es auch scheinen mag, ich strebe nach dem Guten.«
»Dem Guten?«
»Es ist vielleicht zu spät; meine Sünden sind so viele. Unzählige. Aber ich will es versuchen. Und du musst mir zeigen, wie.«
Mein Herz schlug, als wollte es aus meiner Brust ausbrechen, und ich hätte weglaufen sollen, aber ich tat es nicht. »Was soll ich dir zeigen?«
»Wie ich zurück ins Licht finde.«
Weil er ein Ausgestoßener ist.
Mir schauderte, als sich der unmöglich Verdacht, wer – oder was – Casziel war, zu einer Realität erhärtete.
»Nein. Ich … ich kann das nicht.« Ich ließ ihn los und trat von ihm zurück. »Ich kann das nicht, was auch immer das hier soll.«
»Lucy …«
»Nein. Ich bin nicht wie diese Frauen in den Geschichten. Ich will ja, aber ich bin einfach nicht so. Ich kann dir nicht helfen. Es tut mir leid …«
Ich war die ersten drei Stufen zu meiner Wohnung hochgelaufen, als Casziels tiefe Stimme mich aufhielt.
»Dieser Mantel hat deinem Vater gehört.«
Ich drehte mich um. Mein Herz schlug langsam und laut. »Was hast du gesagt?«
»Es war seiner. Du hast ihn behalten und alles andere weggegeben.« Casziel runzelte verwirrt die Stirn. »Was ist ein Ham-fri Bo-gaad?«
Alles Blut wich mir aus dem Gesicht. »Wer hat dir gesagt …?«
»Er.«
»Du redest mit meinem Vater? Jetzt?«
»Er sagt, du sollst es mich erklären lassen.« Er runzelte wieder die Stirn und lauschte. »Ich weiß nicht, was das mit Mäusen zu tun hat …«
»Du lügst«, sagte ich mit zitternden Lippen, während ich verzweifelt den Hinterhof nach meinem Dad absuchte. »Du bist ein Lügner und grausam noch dazu, und …«
»Das bin ich beides.« Casziel verzog den Mund. »Aber nicht heute.«
Ich atmete schwer, drohte zu ersticken, weil mir die Tränen die Kehle zuschnürten. »Ich weiß nicht, wer du bist und woher du von uns weißt, aber es ist falsch, einfach mit meiner Trauer zu spielen. Und Furcht einflößend.«
»Da muss ich widersprechen«, herrschte Casziel mich an. »Furcht einflößend ist, das Schicksal deiner ewigen Seele in den Händen einer menschlichen Frau zu wissen, die eindeutig nicht die Courage dafür hat.«
Ich schüttelte den Kopf. »Es geht dir nicht gut. Du brauchst Hilfe.«
»Sage ich das nicht schon die ganze Zeit?« Casziel fuhr sich mit der Hand durch die dunklen Locken. »Gott, Frau, ich habe keine Zeit …«
»Es ist mir egal«, rief ich, ging rückwärts und schlug mit der Hüfte gegen das Treppengeländer. Es tat weh, weckte mich aber nicht aus diesem Irrsinn. »Du hast den Mantel von meinem Dad. Das ist schon zu viel, mehr kriegst du nicht von mir. Und jetzt lass mich in Ruhe, sonst ruf ich wirklich die Polizei.«
Casziel murmelte einen Fluch, dann sagte er lauter: »Ich soll dir sagen, dass er immer bei dir sein wird.«
Ich erstarrte, drehte mich um.
»Er sagt, dass es dir vielleicht verrückt erscheint, aber ich brauche deine Hilfe. Und du hast nie jemandem, der …«
»… der Hilfe braucht, den Rücken zugekehrt«, beendete ich den Satz. »Mein Gott.« Ich drehte mich erneut zu ihm um, ging die Stufen wieder runter und sah Casziel in die Augen. »Ist das real?«
»Ist es.«
»Warum ich?«
»Du, aus Licht geborene Lucy, kannst mir helfen, etwas anderes zu sein als das … was ich bin.«
Schwarze Flügel und schwarze Augen und Todesvisionen umschwirrten mich. »Was du bist …«
»In die Dunkelheit geboren.«
In diesen kurzen Augenblicken krümmte sich die Realität. Ich ging endlich durch den Schrank, und es gab kein Zurück mehr. Und ich wollte auch nicht zurück. Eine merkwürdige Energie ging von Casziel aus, die tief in mir etwas weckte. Einen Mut, von dem ich nicht wusste, dass ich ihn besaß. Sobald ich ihn abwies, würde er wieder einschlafen.
Ich habe viel zu viel von meinem eigenen Leben verschlafen.
»Mein Vater ist hier? Bei mir?«
»Immer.«
»Er ist ein Engel?«
»Sozusagen.«
»Aber du nicht.«
Das war keine Frage.
»Nein«, sagte Casziel. »Ich nicht.«
»Wie nennt man jemanden wie dich?«
Seine bernsteinfarbenen Augen schienen sich in meine zu ergießen. »Kannst du es nicht erraten, Lucy Dennings?«
»Sag es.«
Ich muss es hören.
»Wir haben viele Namen«, sagte Casziel. »Hyang. Frawaschi. Kami. Dschinn. Yaksha. Sylphe. Kakodaimon. Daimon …«
Die Sonne war hinter den Hochhäusern versunken und hüllte die Stadt in lange Schatten. Casziel sah mich erwartungsvoll an.
Ich atmete ein, sagte beim Ausatmen das Wort.
»Dämon.«
DREI
Es war Nacht geworden, und an meiner Kücheninsel saß ein Dämon und aß Frühstücksflocken.
Ich saß am Fenster an meinem kleinen Schreibtisch und war voller Zweifel. Ich hatte meine Ellbogen umfasst, rührte mich nicht und wagte nicht, den Blick von Casziel abzuwenden. Der saß vornübergebeugt an der Kücheninsel, die mir als Esstisch diente, und schaufelte Cornflakes in sich rein. Schon eine leichte Brise könnte ihn umpusten, aber früher oder später würde er seine ganze Kraft zurückgewinnen. Seine Kräfte, wie auch immer die aussahen.
Sei mutig. Das ist deine Wohnung.
Ich stand von meinem Stuhl auf und zwang mich, in den Küchenbereich zu gehen, um mir ein Glas Wasser zu holen. Ich lehnte mich gegenüber von meinem Gast an die Arbeitsplatte. Selbst während er ungehemmt Cornflakes löffelte, war er unmenschlich schön.
Betonung auf unmenschlich.
»Wann hast du das letzte Mal etwas gegessen?«, fragte ich und sah zu, wie er Cornflakes auf seinen Löffel häufte und Milch auf Papas Mantel spritzte.
»Fünfzig Jahre«, sagte er. »Plus/minus zehn Minuten.«
»Was soll das heißen?«
Keine Antwort. Ich räusperte mich.
»Du musst hungrig sein, wenn es fünfzig Jahre her ist.«
»Ich muss nicht essen.« Casziel schnaubte, als wäre allein die Vorstellung unter seiner Würde. »Ich muss nicht trinken. Ich muss nicht schlafen. Es gibt nichts auf Dieser Seite, was ich brauche.« Er sah mich an. »Nur dich.«
Ein Schauder huschte mir die Wirbelsäule hinunter, und er war nicht unangenehm. Bisher hatte mich noch nie jemand gebraucht. Und auf keinen Fall ein Mann, der aussah wie Casziel …
Ein paar Augenblicke vergingen, in denen der Dämon geräuschvoll die Schale Cornflakes verputzte und sich noch eine einfüllte; die dritte.
»Ich kann fühlen, dass du mich ansiehst, Lucy Dennings«, sagte er, ohne aufzublicken.
»Hey, ich hab nur etwa eine Million Fragen.«
Zum Beispiel, wo ich hier reingeraten war oder ob ich gerade total hinters Licht geführt wurde.
Natürlich wirst du das, meldete sich die höhnische Stimme. Lucy, Dummerchen, du glaubst doch nicht etwa, du bist was Besonderes? Du glaubst doch nicht etwa, dieser Unbekannte, den du in deine Wohnung gelassen hast, ist wirklich ein reuiger Dämon, der seine Seele retten will?
Casziel hob den Kopf und kniff die Augen zusammen. »Sei still, Deb.«
»Deb?«
»Einer deiner Dämonen«, sagte Casziel und konzentrierte sich wieder aufs Essen. »Ein ziemliches Ekel.«
Gänsehaut breitete sich auf meinen Armen und meinem Rücken aus. »Einer meiner Dämonen? Wie viele hab ich?«
»Nur zwei.«
»Nur?«
»Zwei ist gar nichts. Wenn es mehr wären, hätte ich dich vielleicht nicht gefunden.«
Er hat mich gefunden.
Irgendwie machte mir der Gedanke weniger Angst, als er vielleicht sollte. Weniger, als zwei Dämonen zu haben.
»Sein Name ist Deb?«
»Ihr Name, es ist eine Sie. Die andere heißt K«, sagte Casziel. »Wir belassen es besser dabei. Dämonen lieben es, ihre wahren Namen von Menschen ausgesprochen zu hören, und kommen oft, wenn man sie ruft.«
»Gott.« Mir schauderte. »Was machen die mit mir? Ich meine … Warum sind es meine?«
»Es sind nicht allein deine«, sagte Casziel. »Sie sind zwei der Mächtigsten in unseren Rängen. Deb ist Pestilenz. Wie eine ansteckende Krankheit. Sie vergiftet Menschen und hindert sie, ihr wahres Potenzial zu erreichen. K, die Zermalmerin, macht ihnen Angst, wenn sie es trotzdem versuchen.«
»Das ist … schrecklich.«
Casziel zuckte die Achseln. »Es ist ihr Job. Sünde. Laster. Unmoral. Trägheit. Was ihr Todsünden nennt, sind unsere Fachgebiete.«
»Und was genau ist deins?«, fragte ich, unsicher, ob ich die Antwort hören wollte.
»Zorn.«
Er sagte es ausdruckslos, ohne Stolz oder Arroganz, aber auch ohne schlechtes Gewissen.
Mein Blick fiel auf die Narben, die aus dem Kragen des Trenchcoats hervorlugten. Der Traum von den blutigen Steinen und den Schreien meldete sich noch einmal leise, dann verblasste er wieder.
»Hast du … schon mal jemanden umgebracht?«
»Im Leben, ja«, sagte Casziel. »Ich war ein Krieger.«
»Du warst ein Mensch? Wegen der Flügel dachte ich, du wärst vielleicht … ein gefallener Engel.«
Laut ausgesprochen, klang es genauso verrückt wie in meinen Gedanken.
Er schüttelte den Kopf, seine Augen verdunkelten sich. »Nein, ich hatte einmal ein Leben. Vor langer Zeit. Ich habe Armeen befehligt. Jetzt schwingen meine Armeen keine Schwerter mehr. Wir stacheln die Menschen zum Kampf an, schüren die Wut in den Herzen der Männer. Den Zorn.«
»Du klingst nicht besonders traurig deswegen.«
»Ich bin hier, oder?«, sagte er und aß weiter, während ich mich verstohlen nach »Deb« oder »K« umsah.
Wie oft hatte ich ihre Stimmen gehört? Die mir einflüsterten, meine Idee, wie man mehr Plastik aus den Meeren holen könnte, lieber für mich zu behalten, weil sich bestimmt schon jemand Klügeres darum kümmerte. Oder lieber abzulehnen, wenn Jana Gill mich fragte, ob ich nach der Arbeit mit ihr und den anderen noch etwas trinken gehen wolle, aus Angst, mich zu blamieren. Die jedes Mal, wenn ich gerade meinen Mut zusammengenommen hatte, um Guy Baker anzusprechen, flüsterten, dass Lucy, das Dummerchen, sowieso nichts sagen könnte, was ihn interessieren würde.
»Das machen Dämonen?«, fragte ich nach einer Minute, die Stimme angespannt vor Wut. »Sie halten Menschen klein? Schicken uns in den Krieg oder geben uns das Gefühl, scheiße zu sein?«
»Dämonen können nichts machen«, sagte Casziel. »Wir deuten an. Beeinflussen. Verleiten. Wir schüren eure Trägheit, euren Zorn, eure Eifersucht und nähren uns davon. Ob ihr unseren Andeutungen folgt oder nicht, ist allein eure Entscheidung, auch wenn ihr das meistens nicht glaubt. Unser größter Sieg war es, die Menschen davon zu überzeugen, dass sie ihre Reaktion auf Ungemach nicht kontrollieren können.« Er legte einen Finger ans Kinn. »Ich glaube, Asmodäus ist dafür befördert worden.«
Das ist ein Traum. Ich werde aufwachen. Jede Sekunde …
Ich trank einen großen Schluck kaltes Wasser. »Gibt es viele Dämonen auf Dieser Seite?«
»Es sind nur ein paar Tausend.«
»Tausend?«
»Wir sind Legion«, sagte er. »Und deine Cornflakes sind alle.«
»Ich schreib’s auf meine Einkaufsliste«, murmelte ich, als Casziel sich mit dem Ärmel des Trenchcoats den Mund abwischte, vom Hocker rutschte und in meinen Wohnbereich ging.
Er tippte mit langen Fingern ans Fenster. »Geht das auf?«
»Ja, aber …«
Er drückte es auf.
»Ich lass es nur im Sommer einen Spalt auf«, sagte ich und wollte es wieder schließen. »Es ist zu unsicher …«
»Niemand wird es wagen, dir zu schaden. Nicht, solange ich hier bin.«
Die beiläufige Drohung in seiner Stimme ließ erneut ein Kribbeln über meinen Rücken wandern. Noch nie hatte ein Mann – oder eine halbwegs annehmbare Kopie davon – auf diese Art geschworen, mich zu beschützen. Als wäre meine Sicherheit unter seiner Aufsicht eine ausgemachte Sache.
Es fühlte sich gut an.
Casziel führte die Inspektion meiner Einzimmerwohnung im Schlafbereich fort und beugte sich vor, um das Foto auf meinem Nachttisch zu betrachten. Dad und ich in Coney Island, als ich zehn war.
»Ah, er kann also lächeln«, murmelte Casziel. »Ich hab mich schon gefragt, ob er immer nur missbilligend guckt.«
»Dad ist jetzt hier?«
»Ja und nein. Hier ist ein relativer Begriff.«
»Du hast doch gesagt …«
Casziel winkte ungeduldig ab, als er mein vollgestopftes Bücherregal unter die Lupe nahm. »Er ist immer hier und gleichzeitig auch irgendwo anders. Überall und nirgends.« Er neigte den Kopf, lauschte und schnaubte. »Ich muss widersprechen.«
»Er redet jetzt mit dir?«
»Er behauptet, ich würde mich absichtlich unklar ausdrücken. Als wäre es so leicht, einem kümmerlichen menschlichen Gehirn, für das ›Wahrheit‹ nur ist, was die Sinne wahrnehmen, die Natur des Kosmos zu erklären.«
»Das ist ein bisschen hart«, sagte ich. »Viele Menschen glauben.«
Casziel schnaubte. »An der Oberfläche. Einmal die Woche auf den Knien, wenn überhaupt.«
»Du bist nicht sehr begeistert von der Menschheit.« Ich verschränkte die Arme. »Es ist wohl kaum fair, Menschen zu Krieg und Hass anzutreiben, uns einzuflüstern, dass wir nicht gut genug sind, oder uns in Versuchung zu führen und uns dann für dasselbe zu kritisieren.«
Casziel zuckte die Achseln. »Ich bin ein Dämon. Ich habe nie behauptet, fair zu sein.«
Ich verdrehte die Augen und nahm das Bild von meinem Vater und mir in die Hand. Wir lächelten beide. Wir waren beide sorglos und fröhlich. Ohne Dämonen.
»Er ist jetzt ein Engel«, murmelte ich und berührte sein Gesicht.
»Glaubst du, er sitzt auf einer weißen Wolke und spielt Harfe?«, sinnierte Casziel. Er strich mit dem Finger über eine Reihe von Liebesromanen auf dem Regal. »Himmelspforte oder Höllenfeuer. Göttlich oder teuflisch. Engel oder Dämon. Für euch Menschen ist alles schwarz-weiß, obwohl es tausend Schattierungen von Grau gibt.« Er zog ein Buch aus dem Regal und zog eine Augenbraue hoch. »Deutlich mehr als fünfzig.«
»Okay. Und wie ist es dann?«
»Die Andere Seite?« Er zuckte die Achseln, ließ das Buch einfach fallen und inspizierte weiter meine Wohnung. »Du kannst es nicht verstehen, und ich will dich lieber nicht mit einem Erklärungsversuch in den Wahnsinn treiben.«
»Toll, danke«, murmelte ich und stellte das Buch wieder an seinen Platz, als Casziel den Kopf in mein winziges Bad steckte.
»Ich kannte Mönche, die hatten mehr weltliche Besitztümern als du, Lucy Dennings.«
Ich zuckte mit der Schulter. »Es ist alles, was ich brauche.«
Er deutete auf meine Regale. »Du brauchst diese Bücher? Vor allem Liebesromane, wie mir aufgefallen ist.«
»Und Gedichte. Ich liebe Gedichte und Liebesromane.« Ich lächelte verlegen. »Ich hab eben eine Schwäche für schöne Worte.«
Casziel rümpfte die Nase. »Deine schönen Worte sind nur Ersatz für das echte Leben.«
»Ich … Das stimmt nicht.«
»Ach nein?« Er streckte seinen langen Körper auf meiner zu kleinen Couch aus. »Ein Hocker in der Küche. Ein Stuhl vor dem Schreibtisch. Ich bin schockiert, dass dein Bett groß genug ist für zwei.«
Ich zupfte am Ausschnitt meines Pullis, mein Gesicht wurde heiß. »In dieser Wohnung ist nicht genug Platz für mehr Möbel. Und nicht, dass es dich etwas angehen würde, aber ich habe nicht so oft Besuch.«
Wohl eher nie, Lucy, Dummerchen.
Casziel zuckte die Achseln, schnappte sich die Fernbedienung vom Couchtisch und zappte durch die Programme. »Können wir Pizza bestellen?«
Ich nahm ihm die Fernbedienung aus der Hand und schaltete den Fernseher aus.
»Sicher, klar, wir können gern Pizza bestellen. Sobald du mir sagst, was du eigentlich von mir willst. Ich soll dir helfen, kein Dämon zu sein?«
Er fixierte mich. »Meine Erlösung liegt in deiner Hand, Lucy Dennings. Du bist die Expertin darin, für andere zu leben und dich, zu deinem eigenen Nachteil, ständig zu verbiegen.«
»Das mache ich gar nicht«, sagte ich leise.
»Du würdest sogar dein sprichwörtliches letztes Hemd hergeben, auch wenn es wirklich dein letztes wäre.«
»Das … ist nicht wahr.«
»Wir sind da wohl verschiedener Meinung.«
Ich versank tiefer in meinem Pulli. Ein hässliches, nervöses Gefühl nistete sich wie eine Schlange in meinen Eingeweiden ein. Es war einfach zu ungeheuerlich, was ich tun und glauben sollte. Dämonen oder nicht, die Stimmen in meinem Kopf hatten recht – ich war leichtgläubig und dumm und immer bereit, das Beste in den Menschen zu sehen, auch wenn sie offensichtlich mit mir spielten.
»Dieses Gespräch macht mich krank«, sagte ich. »Es war verrückt, dich reinzulassen. So wie ich das sehe, ist das alles gelogen, und du … willst mir irgendetwas antun.«
Casziels träges Lächeln verschwand. »Ich habe doch gesagt, dass ich dir nichts tun werde.«
»Ja, schon, aber was kann das Wort eines Dämons schon wert sein? Und wie soll ich dir überhaupt helfen? Du hast Gott weiß wie viele Gräueltaten begangen …«
»Gott weiß«, sagte Casziel mit leiser Stimme. »Bis zum letzten Tropfen vergossenen Blutes, Gott weiß.«
Ich erschauderte. »Das hier war ein Fehler. Ich denke, du solltest gehen.«
Der Dämon setzte sich gerade hin, senkte den Kopf, ließ die Hände über die Knie hängen. »Vergib mir, Lucy, aus Licht geboren. Es ist fast viertausend Jahre her, dass ich mich zuletzt der Großzügigkeit eines Menschen ausgeliefert habe.« Er sah zu mir hoch, und seine Miene wurde merkwürdig sanft. »Ich habe geschworen, nie …«
»Was?«
Er sah weg. »Nichts.«
Schmerz hing über ihm, drückte ihn nieder wie ein zweiter Mantel. Oder eine Rüstung, die zu schwer geworden war. Gegen meinen Willen ließ mein Herz sich für ihn erweichen, aber er hatte recht. Ich verbog mich, riss mir für andere ein Bein aus, und manchmal – meistens, wenn ich ehrlich war – hatte ich hinterher das schale Gefühl, ausgenutzt worden zu sein.
Ich verschränkte die Arme. »Wie kann ich dir vertrauen?«
»Dein eigener Vater hat dir versichert, dass du das kannst.«
»Und wenn das auch eine Lüge ist?«
»Du hast vorher gefragt, ob er hier ist, und meine Antwort war … unangemessen.« Casziel verzog ärgerlich das Gesicht. »Na gut. Sie war unhöflich und respektlos. Besser?«
Trotz allem musste ich lächeln. Fast sah ich vor mir, wie Dad, die Hände in die Hüfte gestemmt, mit Casziel schimpfte. Fast. Sosehr ich es auch glauben wollte, es war niemand da.
»Das Schlimmste daran, jemanden zu verlieren, ist der Gedanke, dass sie für immer fort sind«, sagte ich. »Im Herzen weißt du, dass es nicht stimmt, aber die leisen Stimmen des Zweifels flüstern und wenn doch?«
Casziel nickte, dann neigte er den Kopf und lauschte. Als er sprach, war sein Tonfall viel sanfter.
»Er sagt, du sollst dich an deine Jugend erinnern. Wie du deine Hausaufgaben am Esstisch gemacht hast, während er in der Küche in eurem Haus in Milford Essen gekocht hat.«
»Milford.« Tränen stiegen mir in die Augen. »Ich erinnere mich.«
Ich sah es, als wäre es erst gestern gewesen: Dad werkelte in der Küche unseres gemütlichen Hauses herum, und der Duft von Schmorbraten oder Spaghettisoße lag in der Luft. Ich, damals mit Zöpfchen, saß am Tisch und hatte meine Schulsachen überall, aber ordentlich darauf ausgebreitet. Ich war eine gute Schülerin, wollte immer mein Bestes geben. Um Dad stolz zu machen, auch wenn er nie mehr von mir verlangte, als ich schaffte.
»Wenn du Hilfe bei einer Gleichung brauchtest oder eine Frage hattest«, sagte Casziel, »ist er aus der Küche gekommen, um dir zu helfen, und wenn du keine Hilfe mehr brauchtest, ist er wieder gegangen.«
Ich nickte, meine Stimme war ein Flüstern. »Ja. Das hat er gemacht.«
»Und so ist es auch jetzt. Er ist immer da, Lucy. Er ist einfach im Nebenzimmer. Und wenn du ihn brauchst, kommt er.«
Die Tränen flossen jetzt über. Ich lächelte durch sie hindurch, fühlte mich, als wäre eine Last leichter geworden. Sie war nicht fort; sie würde nie ganz weggehen, aber zum ersten Mal seit sechs Monaten hatte ich das Gefühl, wieder atmen zu können.
»Danke, Casziel.«
Ich hatte seinen Namen vorher nicht ausgesprochen. Wahrscheinlich bildete ich mir das nur ein, aber es fühlte sich an, als hätte sich die Luft zwischen uns verändert. Da war ein Schimmern zwischen uns, wie die wabernde Luft über einem Feuer, und verschwand dann.
»Und ich helfe dir«, sagte ich. »Ich weiß nicht, wie oder wo ich anfangen soll. Aber ich versuche es.«
Casziels Augen weiteten sich, als er mich ansah. »Ich habe zu danken, Lucy Dennings«, sagte er sanft. Dann war seine mürrische Miene wieder da, als hätte er sich erinnert, sie wieder aufzusetzen. »Können wir jetzt endlich Pizza bestellen?«
Ich bestellte Pizza für meinen Dämon und legte mich aufs Bett, während er auf der Couch saß und fernsah. Irgendwann wurden meine Lider schwer; die Ereignisse des Tages und die starken Emotionen hatten mich ausgelaugt. Ich döste ein bei Casziels ständigem Hintergrundkommentar zu was auch immer er sich ansah – er lachte höhnisch oder murmelte etwas in dieser merkwürdigen Sprache. Einer Sprache, die klang, als stamme sie aus einem geöffneten Grab, staubig und kehlig und seit Jahrhunderten nicht von lebenden Wesen gehört.
Ich schlief ein und träumte von einer Frau …
… die auf einem Feld steht. Ihr schwarzes Haar ist zu einem dicken, bis zur Taille reichenden Zopf geflochten. Sie trägt ein formloses Wollkleid, das über der Hüfte gegürtet ist. Ihre Haut ist gebräunt, silberne Armreifen mit blauen Steinen gleiten über ihren Arm, als sie die Hand hebt, um die Augen vor der untergehenden Sonne zu schützen. In der Ferne steht am Ufer eines Flusses eine Stadt mit niedrigen Lehmziegelbauten.
Ich folge ihrem Blick und kann gerade noch einen Zug von Soldaten erkennen, der in die Stadt marschiert. Leise höre ich die jubelnde Menge und den Klang triumphierender Hörner.
Die Frau stößt einen Freudenschrei aus, und auch mein Herz hüpft vor Glück. Sie rafft das Kleid und läuft los …
VIER
Ein Dämon in Gestalt eines menschlichen Türstehers lehnt neben dem Eingang des Idle Hands. In der Kneipe, die in einer dunklen Gasse liegt, ist einiges los, dem lauten Gelächter, den Flüchen und den üblen Gerüchen nach zu urteilen, die nach draußen dringen. Der Türsteher sieht mich mit ausdruckslosen Augen näher kommen. »Aus der Höhe schoss ich her …«
»Im Stern- und Feuerscheine«, vervollständige ich.
Er nickt. »Tritt ein.«
Ich blicke mich in der Gasse um. Sie ist leer, aber um uns herum atmet elektrisiert und lebendig New York. Selbst in der tiefsten Nacht ist die Stadt voller Leben. Voller Licht.
Da es keine neugierigen Augen gibt, verwandle ich mich, nehme meine Dämonengestalt an, und seufze fast vor Erleichterung, als ich fühle, wie ihre Kraft mich umhüllt, als würde ich eine Rüstung anlegen. Ich bin nicht länger geschwächt vom Übergang; die schwarze Kleidung und das Großschwert, das ich auf der Anderen Seite trage, begleiten mich.
Der Türsteher tritt zurück und wendet den Blick ab. »Casziel, Herr, ich hatte keine Ahnung. Vergib mir.«
Vor nicht allzu langer Zeit hätte ich die Todesangst genossen, die meine Gegenwart hervorruft. Jetzt erinnert sie mich an alles, was ich getan habe, um sie zu verdienen.
»Aus dem Weg«, fauche ich.
Er gehorcht mit einer weiteren Verbeugung, und ich betrete das Idle Hands. In der dunklen, fensterlosen Kneipe stinkt es bestialisch – von den etwa zwanzig Dämonen und Dämoninnen, die sich hier versammelt haben, gehen üble Gerüche aus. Alle sind in ihrer Dämonengestalt. Das Idle Hands ist ein Rückzugsort, unsichtbar für menschliche Augen.
Nur wenige bemerken meine Ankunft, aber Eistibus starrt mich von hinter dem Tresen an. Der Dschinn scheint erfreut, aber nicht überrascht, mich zu sehen.
»Casziel, mein Herr.« Eistibus ergreift meinen Arm. »Wie lange ist es her?«
»Fünfzig Jahre nach menschlicher Rechnung.«
»Viel zu lange, und doch kommt es mir wie gestern vor.« Der Dschinn blickt auf eine Tür hinter dem Gastraum. »Astaroth wartet …«
»Ich weiß.«
Lass ihn warten.
»Wenn du meinst«, sagt Eistibus langsam. »Was willst du trinken?«
Auf einigen der Flaschen in den Regalen sind Schädel mit gekreuzten Knochen, aber ich weiß, was ich will. »Rotwein, bitte.«
Eistibus stellt ein Glas Wein von der Farbe alten Blutes vor mich hin. Von der Taille aufwärts erscheint der Dschinn als ein rundlicher, prächtig gekleideter Mensch mit schweren Goldketten um den dicken Hals und an den Fingern funkelnden Edelsteinen. Unterhalb der Schärpe aus Goldbrokat, die er sich um die Taille gewickelt hat, ist nur Nebel. Dieser kettet ihn an eine Lampe, die irgendwo in den Fundamenten der Taverne vergraben ist. Angeblich hat er eine Wette gegen Aclahayr verloren.
»Wie lange wirst du auf Dieser Seite sein?«
»Nicht lange«, antworte ich und nippe an meinem Wein. »Ein paar Tage.«
Und dann wird es enden, so oder so.
»Und du?«, frage ich. »Wie läuft das Geschäft?«
»Es ist einiges los dieser Tage. Was komisch ist. Meistens bin ich allein mit dem wurmigen Bastard.«
Langsam deutet er mit dem Doppelkinn auf den Dämon am anderen Ende des Tresens, dessen Kopf auf dem polierten Mahagoni ruht und der den dürren Arm um einen Ring leerer Shotgläser gelegt hat.
Eistibus haut mit der Faust auf die Theke. »Hey! Ba-Maguje! Nimm deine dreckige Fresse von meiner Theke.«
»Lass mich in Ruhe«, lallt Ba-Maguje. »Ich arbeite.«
Eistibus lacht leise, hörte aber schnell wieder auf. Ein Blick seiner goldenen Augen huscht flackernd zur Hintertür, dann wieder zu mir. »Ich will dich nicht drängen, aber Astaroth hat darauf bestanden, dass du gleich zu ihm gehst.«
»Willst du mich schon wieder loswerden?« Ich lächle. »Ich dachte, wir wären Freunde.«
»Wir sind Freunde«, sagt Eistibus. »Deshalb die Warnung. Und du wärst mir ein besserer Freund, wenn du schnell gehst. Sonst schneiden sie mir nämlich die Eier ab, weil ich die Botschaft nicht überbracht habe.«
»Du hast keine Eier, Eistibus«, sage ich grinsend, dann winke ich ab. »Ich geh ja schon.«
Ich kippe den Wein runter, und jetzt blicken mir ein paar Dutzend Augen nach – oder was als Augen dient –, als ich den Raum durchquere. Ich steige über Schwänze und umgehe eklige Pfützen. An der Tür nehme ich die Schultern zurück und klopfe.
»Herein.«