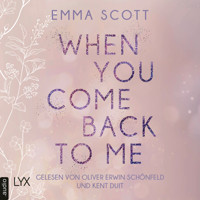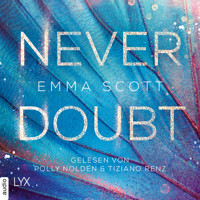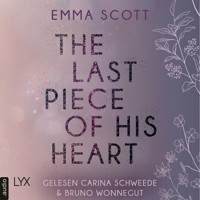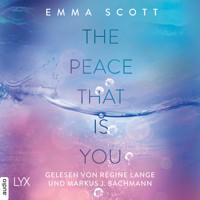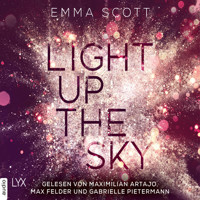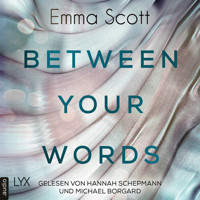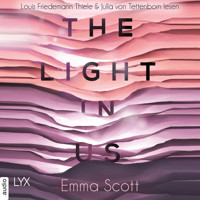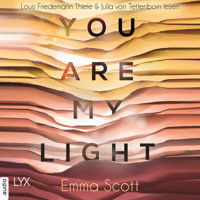11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Angels and Demons
- Sprache: Deutsch
Wahrhaft Böses kann nur von wahrhaftiger Liebe besiegt werden
Der sensible Künstler Cole hat die Hoffnung auf Erfolg schon fast aufgegeben, als die mitternächtliche Begegnung mit einem Wesen der Nacht alles verändert. Er ahnt nicht, dass seine Seele in Gefahr ist. Denn der Dämon Ambri entfacht in ihm ein kreatives Feuer, dass er so nie kannte - und noch viel mehr. Auch Ambri bleibt nicht unberührt von Cole. Obwohl er den Auftrag hat, Cole zu korrumpieren, kann er sich den Gefühlen nicht entziehen, die der junge Maler in ihm weckt. Aber den Mächten der Finsternis wurde eine reine Seele versprochen, und sie kommen, um diese einzufordern ...
»Diese betörende Geschichte zweier gequälter Seelen, die miteinander Heilung und Frieden finden, eine Geschichte, die all die komplizierten und wundervollen Emotionen auslöst, die ich beim Lesen fühlen möchte.« SUNNY SHELLY READS
Abschlussband der ANGELS & DEMONS-Dilogie
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 469
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
INHALT
Titel
Zu diesem Buch
Leser:innenhinweis
Playlist
Anmerkung der Autorin
Glossar
Widmung
Teil I
Prolog
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Siebzehn
Achtzehn
Neunzehn
Zwanzig
Einundzwanzig
Zweiundzwanzig
Dreiundzwanzig
Vierundzwanzig
Teil II
Fünfundzwanzig
Sechsundzwanzig
Siebenundzwanzig
Achtundzwanzig
Neunundzwanzig
Dreißig
Einunddreißig
Zweiunddreißig
Dreiunddreißig
Vierunddreißig
Epilog
Anmerkung der Autorin II
Danksagung
Die Autorin
Die Romane von Emma Scott bei LYX
Impressum
Emma Scott
We Reach for the Light
Roman
Ins Deutsche übertragen von Inka Marter
ZU DIESEM BUCH
Der sensible Künstler Cole hat die Hoffnung auf Erfolg schon fast aufgegeben und wird von düsteren und hoffnungslosen Gedanken gequält. Aber die mitternächtliche Begegnung mit einem Wesen der Nacht verändert alles und rettet sein Leben. Der Dämon Ambri entfacht in ihm ein kreatives Feuer, das er so nie kannte. Ambri wird zu seiner Muse, dem Gegenstand seiner genialsten Werke. Und zugleich erweckt er in Cole Gefühle, die er nicht für möglich gehalten hätte. Was er allerdings nicht weiß: Ambri hat den Auftrag, eine Seele zu korrumpieren und den Mächten der Hölle zu opfern. Doch Cole löst etwas in dem abgebrühten Dämon aus, womit er niemals gerechnet hätte, und erinnert ihn an seine eigene Menschlichkeit, die er lang verloren glaubte. Schon bald kann er seine Gefühle für den jungen Maler nicht mehr leugnen. Aber den Mächten der Finsternis wurde eine Seele versprochen, und sie kommen, um diese einzufordern. Um ihre Liebe zu retten, um Cole zu retten und um sich selbst der Dunkelheit zu entziehen, bräuchte es ein Wunder, und Ambri weiß nicht, ob er es wagen kann, wieder an die Macht des Lichts zu glauben …
Triggerwarnung
Liebe Leser:innen,
dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte.
Deshalb findet ihr hier eine Triggerwarnung.
PLAYLIST
Squirrel Nut Zippers: Hell (Vorspann)
Filter: Hey Man, Nice Shot
Ewan McGregor, Jose Feliciano, Jacek Koman: El Tango de Roxanne (aus: Moulin Rouge)
Years & Years: American Boy
Billie Eilish: everything i wanted
twenty øne piløts: Heathens
Jimmy Eat World: Pain
Fink: Walkin’ in the Sun
INXS: Devil Inside (Abspann)
ANMERKUNG DER AUTORIN
Dieses Buch kann als Stand-alone gelesen werden; es kommen darin aber Ereignisse aus We Conquer the Dark vor. Da ich (für diejenigen, die We Conquer the Dark nicht lesen möchten) nicht zu viel darüber schreiben will und (für diejenigen, die es schon gelesen haben) nicht zu viel wiederholen will, empfehle ich, das Glossar als eine kurze Zusammenfassung der Ereignisse in We Conquer the Dark zu lesen, und auch, um sich mit der Welt der Engel und Dämonen vertraut zu machen. Wenn Begriffe oder Namen vor ihrer eigenen Erklärung in den Definitionen genannt werden, sind sie fett gedruckt.
GLOSSAR
Ambri: Ambrosius Edward Meade-Finch (1762–1786), Dämon der Lust, der Eitelkeit und der Exzesse. Ehemaliger Diener des Dämons Casziel. Wurde von Astaroth erschaffen.
Andere Seite:Die Sphäre, in die eine Seele vor dem nächsten Leben nach dem Tod zurückkehrt. Die Sphäre der Engel und Dämonen. Der menschliche Verstand kann die Andere Seite nicht ganz verstehen, und etwas darüber zu wissen oder sich daran zu erinnern, würde dem Sinn und Zweck des Lebens zuwiderlaufen. (Siehe: Vergessen)
Anikorpus: Die tierische Gestalt, die ein Dämon annimmt, um sich auf Dieser Seite frei bewegen zu können. Das können Raben, Käfer, Schlangen oder Fliegen sein.
Asmodäus:Großherzog der Hölle, Vater des Zorns, Seelenfresser.
Astaroth: Dämon der Unterwerfung, Großherzog der Hölle, Prinz der Ankläger. Astaroth war Casziels und Ambris Herr, er hat beide in die Sphäre der Dämonen geholt.
Auslöschung: Ganz aufhören zu existieren. Ultimative und dauerhafte Nichtexistenz einer Seele. Der »Tod für die Toten«.
Beschwörung: Ritual, mit dem ein Mensch einen Dämon von der Anderen Seite herbeiruft.
Casziel Abisare: Früher bekannt als König des Südens, Prinz der Dämonen, Nachtbringer. Ein menschlicher Krieger, der im alten Sumer lebte und nach der Ermordung seiner Frau Li’ili als Dämon in den Dienst Astaroths trat. In der heutigen Zeit ist er wieder zu einem Menschen geworden und erneut mit seiner Frau (jetzt Lucy Dennings) vereint.
Dämon: Seele, die sich als böse Energie offenbart.
Diener: Jeder Dämon, der einem mächtigeren Dämon dient. Hochrangige Dämonen haben ganze Armeen von Dienern.
Diese Seite: Das Leben auf der Erde. Die menschliche Existenz.
Eisheth: Ein Sukkubus, Asmodäus’ stellvertretende Kommandantin.
Engel: Seele, die sich als wohlwollende Energie offenbart.
Gott: Das unbekannte Gute.
Grimoire: Buch mit Zaubersprüchen, in dem oft auch Formeln zur Beschwörung von Geistern oder Dämonen vorkommen.
Großherzog der Hölle: Ranghoher Dämon.
Himmel: Kollektivbezeichnung für alle Engel auf der Anderen Seite. Kein konkreter Ort.
Hölle: Kollektivbezeichnung für alle Dämonen auf der Anderen Seite. Kein konkreter Ort.
Inkubus: Ein männlicher Dämon, der mit schlafenden Menschen Sex hat.
Leben: Menschlicher Zyklus von Leben, Tod und Wiedergeburt. Manche Menschen leben hundertmal und kehren immer wieder auf Diese Seite zurück. Andere bleiben als Dämonen oder Engel auf der Anderen Seite. Menschen haben für die Dauer ihres Lebens keine Erinnerung an ihren Aufenthalt auf der Anderen Seite, weil sie vergessen.
Schleier: Eine stark vereinfachte Erklärung der Grenze zwischen Dieser und der Anderen Seite.
Sukkubus: Ein weiblicher Dämon, der mit schlafenden Menschen Sex hat.
Übergang: Übergang zwischen Dieser und der Anderen Seite. Menschen können nur übergehen, wenn sie sterben. Mächtige Dämonen können sich aus eigenem Willen in beide Richtungen bewegen, während andere Dämonen das nur können, wenn sie beschworen werden.
Vergessen: Bevor man ein neues Leben auf Dieser Seite beginnt, werden die Erinnerungen an die Andere Seite und alle früheren Leben gelöscht, damit man besser lernen und sich weiterentwickeln kann. Bei jedem Übergang auf die Andere Seite wird die Erinnerung wiederhergestellt und dann wieder gelöscht, wenn ein neues Leben beginnt.
Zwillinge: Deber und Keeb, dämonische Zwillingsschwestern. Deber vergiftet Menschen mit negativen und selbstverachtenden Gedanken. Keeb quält sie mit der Angst vor dem Versagen, wenn sie versuchen, Debers Geflüster zu überwinden. Von allen Dämonen sind die Zwillinge besonders erfolgreich dabei, die Menschen daran zu hindern, ihr volles Potenzial zu entfalten.
Für jede:n Künstler:in, Schöpfer:in oder Geschichtenerzähler:in, der oder die jemals an sich gezweifelt hat: Bitte hört nicht auf, eure Gaben mit der Welt zu teilen. Diese ist für euch.
TEIL I
Dieses Stück handelt von der Liebe.
Moulin Rouge
PROLOG
Ambri
Paris, 1786
Auf dem Weg zur Bastille lief mir der Schweiß unter der Perücke hervor, und ich zerrte an meinem Rüschenkragen. Es war untypisch warm für einen Mainachmittag, und im Gefängnis würde es noch schlimmer sein.
Am Eingang rückte ich meinen feinen roten Rock zurecht und teilte dem Kerkermeister mit, dass ich zu Monsieur Armand Rétaux de Villette wollte. Man führte mich durch steinerne Gänge zu einer mit Stroh ausgestreuten Zelle, die nach Pisse und Scheiße roch. Armand packte seine wenigen Habseligkeiten in einen Rucksack. Er roch nicht weniger übel, aber das würde ein parfümiertes Bad in meiner Wohnung schnell richten.
»Un moment, s’il vous plaît«, sagte ich zu den Wachen.
Sie betrachteten meine Aufmachung, die der eines Adligen entsprach, dann zogen sie sich ein paar Schritte in den Gang zurück. Hinter den Gitterstäben ließ Armand sich auf die einzige Bank in der Zelle sinken, den Rücken mir zugekehrt.
»Was willst du, Ambri?«, fragte er müde.
Ich runzelte die makellosen Augenbrauen angesichts dieser dummen Frage. Ich wollte nur eines: ihn.
»Ich weiß, das Urteil ist hart«, fing ich an. »Vor allem da deine Rolle in der Angelegenheit so unerheblich war …«
»Unerheblich? Ich habe Briefe in der Handschrift der Königin gefälscht. Das würde ich kaum unerheblich nennen.«
»Natürlich nicht«, verbesserte ich mich schnell. »Du hast ein außergewöhnliches Talent. Ich wollte nur damit sagen, dass du nichts verbrochen hast! Ein paar Briefe … na und? Aber betrachte deine Verbannung als ein Geschenk. Als Möglichkeit zu einem Neuanfang. Du und ich, wir können uns zusammen ein neues Leben aufbauen …«
»Leben?« Armand drehte sich zu mir um, seine blauen Augen funkelten ungläubig. »Was für ein Leben? Meine Liebste soll gefoltert und ins Gefängnis geworfen werden, und ich bin gezwungen, Paris zu verlassen.«
Ich wand mich bei meine Liebste. Er liebte mich, nicht diese Hure und Gaunerin Jeanne de la Motte, die Drahtzieherin des kleinen Schwindels, der dazu geführt hatte, dass wir alle gefangen genommen und wegen Fälschung, Hochverrats und Verschwörung zwecks Betrug an ihrer Majestät der Königin Marie Antoinette verurteilt worden waren.
Mit Ausnahme von mir natürlich.
Nur Jeannes wegen wurde Armand in die Verbannung geschickt; sah er das nicht? Die letzten paar Monate in Gefangenschaft mussten ihm mehr zugesetzt haben, als ich angenommen hatte.
»Ich komme mit dir«, sagte ich und hörte die Verzweiflung in meiner Stimme. »Ich habe alles Geld der Welt. Dir wird es an nichts fehlen.«
Er schnaubte, anscheinend hatte er nicht zugehört. »Sie hätten mich auch gleich zum Tode verurteilen können, so viel haben sie mir genommen. Ich habe nichts. Nichts.«
»Du hast nicht nichts.« Ich schluckte. »Du hast mich.«
Armand starrte mich einen harten Moment lang an, dann fing er an zu lachen. Ein raues, schneidendes Lachen, das sich wie ein Messer in mich bohrte. Er drückte sein schmutziges Gesicht zwischen die schmutzigen Gitterstäbe.
»Und was bist du, Ambri? Ein Flittchen. Ein Spielzeug. Wir hatten unseren Spaß, aber sei bitte nicht albern.«
Ich schob das Kinn vor, auch wenn die Worte mir einen Stich versetzten. »Es war mehr als das. Was wir haben …«
»Sex, Ambri. Mehr hast du mir nie bedeutet. Eine nette Nummer. Eine der besten, wenn dich das irgendwie tröstet.«
Ich starrte ihn an, ausnahmsweise sprachlos.
Mehr hast du mir nie bedeutet.
Armand grinste schief und sah mich von oben bis unten an. »Jetzt guck nicht so bestürzt. Verzweiflung steht dir nicht.«
Er winkte den Wachen. Sie schoben mich zur Seite, nahmen ihn in die Mitte und begleiteten ihn durch den Gang. Mir lagen tausend Worte auf der Zunge, um ihn aufzuhalten – zu betteln und zu flehen –, aber es war zwecklos. Das Urteil war gefallen. Ich war der Strafverfolgung entgangen bei unserem großartigen Plan, wurde aber trotzdem bestraft. Getrennt von meiner Liebe. Ich sah, wie er mit dem Rücken zu mir und mit verschlossenem Herzen wegging.
Nein, nicht schon wieder! Nicht schon wieder!
In den ganzen vierundzwanzig Jahren meines Lebens hatte man mich wie eine Nebensache behandelt. Als wäre ich bedeutungslos. Ein Spielzeug, das man benutzen und liegen lassen konnte … genau wie mich auch mein Onkel behandelt hatte, als ich noch ein Kind war.
Ich kniff die Augen zusammen, als die Erinnerungen mich in einer Flut aus Scham und Angst bestürmten. Mein Onkel hatte das Unsägliche verbrochen, und doch hatten meine Eltern mich verstoßen. Derselbe Schmerz hallte im Klang von Armands Schritten, die sich von mir entfernten. Auch er hatte mich benutzt und dann weggeworfen wie einen alten Lumpen.
Ich rückte meinen Kragen zurecht und marschierte mit erhobenem Kopf aus der Bastille, während ich innerlich zusammenbrach. Wieder war ich verlassen worden. Doch wenigstens war Jeanne de la Motte zu öffentlicher Auspeitschung und lebenslangem Gefängnis verurteilt worden. Ich erwog, der Auspeitschung beizuwohnen, um mich aufzuheitern, entschied jedoch stattdessen, mich zu betrinken.
Die Nacht brach herein, während ich meinen Liebeskummer in einer Flasche Wein ertränkte und besoffen durch die gefährlichen Straßen von Paris wankte. Vormittägliche Proteste hatten sich zu einem richtiggehenden Aufstand ausgewachsen. Die Nachricht von den Urteilen hatte sich verbreitet; die Schmähschriften waren schon gedruckt und zirkulierten. L’affaire du collier de la reine – Die Halsbandaffäre. Angeblich hatte Marie Antoinette, obwohl das Volk hungerte, ein kostbares Diamantencollier in Auftrag gegeben und, sobald ihre Machenschaften aufgedeckt worden waren, eine Unschuldige bezichtigt: Jeanne. Dass Marie Antoinette überhaupt nichts mit Jeannes Verschwörung zu tun und das Collier sogar zwei Mal abgelehnt hatte, interessierte niemanden mehr.
Ein dreckiger Bauernmob, dachte ich, war nicht gerade dafür bekannt, sich eine nette kleine Ausschreitung von unbedeutenden Fakten verderben zu lassen.
Ich fluchte und drängte mich durch Reihen von ungehobelten Bastarden, die nach Nachttopf stanken, weniger Steuern zahlen und Essen für ihre Kinder wollten und lauthals verlangten, dass die Köpfe des Königs und der Königin rollen sollten. Ein Haufen Schreihälse … und ich in ihrer Mitte.
Mit glasigem Blick suchte ich nach einem Straßenschild, sah jedoch nur wütende Gesichter. Ich wünschte, ich wäre in meine Wohnung zurückgekehrt, bevor ich meine Sorgen ertränkt hatte. An einem Pfahl hing eine Puppe, die die Königin darstellen sollte. Sie brannte lichterloh in der dunklen Nacht und warf tanzende Schatten, die das Chaos noch schlimmer machten. Man schubste mich. Ich war eine Forelle, die gegen den Strom schwamm, die Menge drängte mich zurück und besudelte meinen schönen roten Rock mit ihrem Dreck.
Dann fingen mich ein paar Männer in ihrem Netz.
»Wir haben einen adligen Herrn unter uns«, sagte einer von ihnen zu seinen Gefährten, die nach saurem Schweiß stanken und mich umzingelten. »Bist du ein Mann der Königin?«
»Verpiss dich«, lallte ich und versuchte, an ihnen vorbeizukommen.
»Das ist einer vom Hof, bien sûr«, sagte ein anderer, und der Ring um mich zog sich enger zusammen. »Stimmt’s etwa nicht, Monsieur Schönling?«
Er wagte es, mich mit seinen dreckigen Fingern anzufassen, und schubste mich. Zu betrunken, um das Gleichgewicht zu halten, stolperte ich rückwärts. Raue Hände fingen mich auf und schubsten mich vorwärts. Ein paar beängstigende Minuten lang warfen sie mich hin und her wie eine Lumpenpuppe. Dann nahmen sie mir die Weinflasche weg, rissen mir den Rüschenkragen vom Hals und die Perücke vom Kopf.
»Ah, ein Goldjunge«, rief ein Mann, griff in mein blondes Haar und zog daran, dass es wehtat. »Ein kleines Engelchen.«
»Verdammt sollt ihr alle sein!«, rief ich. Die Angst ließ den Alkohol verdunsten und hinterließ eine Panik, die sich wie ein Feuer in mir ausbreitete. »Nehmt eure dreckigen Hände weg. Wisst ihr, wer ich bin?«
Der Mann zog mein Gesicht dicht an seins.
»Wir wissen genau, wer du bist«, zischte er. »Du bist einer von denen.«
Mit einem fleischigen Finger zeigte er auf die brennende Puppe, die jetzt wild hin und her schwang. Gerade als ich hinsah, berührte sie das Dach einer Destillerie. Überraschte Schreie wurden laut, als das Feuer sich schnell über das Strohdach und das trockene Holz ausbreitete.
»Lasst es brennen!«, rief jemand, und der Ruf wurde aufgenommen. »Lasst es brennen! Lasst es brennen!«
Der Raufbold, der mich festhielt, wandte sich mir zu, die Augen so groß, dass man das Weiße sah. »Oui, lasst es brennen. Und ihn gleich mit!«
»Was? Nein!«
Der Mann zerrte mich zum Eingang der Destillerie, andere brachen die Tür mit ihren Schultern auf. Das ganze Gebäude brannte jetzt, der Rauch füllte die Straßen.
»Nein! Ich gehöre nicht zum Hof. Ich bin nicht einmal Franzose!«, schrie ich, und meine Fersen schleiften über das Kopfsteinpflaster, als sie mich dichter an das brennende Gebäude zerrten. »Ich bin Mitglied des britischen Adels, ihr Tiere!«
Was, im Nachhinein betrachtet, keine sehr geglückte Wortwahl war.
Die Augen des Mannes weiteten sich, er verzog die Lippen, und ein weiteres Urteil wurde an Ort und Stelle gefällt: Tod. Er schubste mich in die brennende Destillerie und knallte die Tür hinter mir zu.
Hustend und mit tränenden Augen legte ich mir den Arm vor den Mund und warf mich gegen die Tür. Es war zwecklos. Sie hatten sie von außen verbarrikadiert. Das Dach der Destillerie wurde von rotorangen Flammen verzehrt, Glut fiel herab und zündete Heubüschel an, auf denen Schnapsflaschen gelagert wurden. Ich stolperte an Kisten voller Alkohol vorbei und suchte nach einem zweiten Ausgang. Ich kam an eine Ecke, die sich als Sackgasse erwies, und drehte mich wieder um, als ein lodernder Balken herunterkrachte und mir den Weg versperrte.
»Nein«, wimmerte ich und sank mit dem Rücken zur Wand auf den Boden. »Nicht so. Das verdiene ich nicht. Ich habe nichts verbrochen!«
»Das hast du in der Tat nicht«, drang eine Stimme durch das Chaos. Weiches, kultiviertes Englisch. Wie kühles Wasser.
Ich stierte blinzelnd in den dichten Rauch und entdeckte einen Mann, der lässig auf einer Kiste saß. Er trug einen merkwürdigen weißen Anzug, der makellos war, völlig ohne Rußflecke. Sein dunkles Haar fiel unter einem weißen Samthut auf seine Schultern herab, und auf der Nase trug er eine merkwürdige Brille.
»Es ist so unfair, wie diese Bauern dich behandelt haben«, sagte er. »Dich, den Sohn eines britischen Lords.«
»Wer sind Sie?«
»Ich bin Astaroth«, sagte der Mann, auch wenn ich sogar in diesem mit Rauch erfüllten Raum, in dem der Tod von allen Seiten an mir leckte, wusste, dass er nicht wirklich ein Mann war.
Er war … etwas anderes.
»Diese dreckigen Schweine hätten dich niemals anrühren dürfen!«, fauchte Astaroth. »Sie haben dich einfach gepackt und dem Tod übergeben. Dich, der du ihnen unendlich überlegen bist.«
»J-ja. Helfen Sie mir bitte!«, rief ich. Der Rauch nahm mir gnadenlos die Luft zum Atmen.
»Wie konnten Sie es wagen?«, rief dieses Mann-Ding Astaroth. Sein Gesicht war plötzlich – wie konnte das sein? – nur Zentimeter von meinem entfernt, und er stank so entsetzlich, dass es den Rauch durchdrang und ich würgen musste.
Tod. Er ist aus Tod gemacht.
»Ich beobachte dich schon eine ganze Weile, Ambrosius Edward Meade-Finch.«
»Du beobachtest mich …?«
»Deine Freunde sind allesamt Verbrecher und Schwindler. Aber wir wollen dich.«
Trotz der Hitze lief mir bei diesen Worten ein Schauder über den Rücken. »Wir?«
»Deine Fleischeslust ist köstlich. Du bist mächtig. Du bist großartig. Wir sehen es, auch wenn andere sich entschieden haben, es nicht zu tun. Deine Eltern, die dich anstelle deines bösen Onkels fortgeschickt haben. Diese Vagabunden, die es gewagt haben, dich anzufassen.« Er lächelte und zeigte seine fauligen Zähne. »Dieser grausame Armand, der dir das Herz gebrochen hat.«
Die Kehle wurde mir eng, und es war nicht der Rauch, der mir die Tränen in die Augen trieb. »Wie konnten sie mir das antun?«
»In der Tat«, stimmte Astaroth zu. »Sag ein Wort, und ich werde dich von allem erlösen. Ich kann dafür sorgen, dass all das verschwindet.«
»Dann tu es!«, rief ich und zog die Beine an, als die Flammen näher kamen. »Hilf mir!«
»Ich werde dir eine neue Existenz schenken«, fuhr Astaroth gemächlich fort. »Eine Existenz ohne Reue. Niemand wird dich je wieder verlassen. Du wirst die Kontrolle haben. Menschen werden wie Puppen an deinen Fäden tanzen. Du wirst für immer jung und schön sein, und der Tod wird dich niemals berühren.«
Ich nickte, Tränen liefen mir über die Wangen. »Ich will nie wieder jemanden begehren, der mich nicht will.«
»Nie wieder«, stimmte er zu. »Sie werden dich begehren. Du wirst dich von ihrem Verlangen nach dir nähren. Man wird dich unmöglich abweisen können, niemand wird dich mehr vergessen wie die, die dich eigentlich hätten lieben sollen.«
Zorn wütete in mir. Diese Ungerechtigkeit. Meine Eltern, die mich aus meinem Zuhause verbannt hatten und so taten, als würde ich nicht länger existieren, weil das leichter war, als die Schande der Taten meines Onkels zu ertragen. Es hing nicht einmal ein Porträt von mir in der Familiengalerie. Es war nie gemalt worden. Als würde ich nicht existieren.
Ich war zu einem Leben auf der Suche nach Zugehörigkeit und Liebe in den Betten Hunderter Fremder verdammt und hatte beides nicht gefunden. Wie viel leichter wäre es, die anderen stattdessen zu hassen?
»Wirst du dich unterwerfen, Ambri?« Astaroths Worte trieften vor Gier. »Wirst du dich mir unterwerfen?«
Ich konnte ihn kaum sehen in dem Rauch und den Flammen. Aber seine Hand, die mit Ringen geschmückt war und mich zu ihm winkte, war wie ein rettendes Seil. Ich musste es nur sagen. Eine leise Stimme riet mir, mich nicht zu unterwerfen, weil ich dann meine Seele hergäbe in einem unheiligen Handel mit einem aus der Hölle.
Weil er ein Dämon ist. Und ich …
Ich würde wie er sein. Mächtig. Unantastbar. Unsterblich.
»Ich unterwerfe mich«, flüsterte ich. »Ich bin dein.«
»Hervorragend.«
Er lächelte triumphierend, dann zog er sich in den Rauch zurück, und ich griff nach ihm.
»Warte! Geh nicht! Du hast gesagt, du würdest mich retten!«
»Das werde ich auch«, sagte er. »Aber zuerst, lieber Junge, musst du brennen.«
Ich keuchte und krümmte mich, als die Todesqualen kamen. Meine Füße brannten in meinen Schuhen. Die Flammen fanden meine Strümpfe, bissen sich mit heißen Zähnen durch Seide und Haut. Das Feuer kletterte immer höher; der Gestank meines eigenen verbrannten Fleisches stieg mir in die Nase. Ich hob die Hände und sah sie schwarz werden und verschrumpeln. Der Schmerz war so grausam und allumfassend, dass er sich von mir löste. Irgendwie hatte ich noch eine Stimme, um zu schreien, als das Feuer mich verzehrte …
… dann trieb ich auseinander wie Asche im Wind. Ich flog in Fragmenten, verwirrt durch das Gefühl, auseinanderzubrechen und doch gleichzeitig ganz zu sein. Schwarze Käfer, fast handtellergroß, glatt und glänzend, umschwärmten mich.
Aber das stimmte nicht.
Die Käfer umgaben mich nicht, sie waren … ich.
Ich war der Schwarm. Ich bestand aus Hunderten umherfliegenden Insekten.
Barmherziger Jesus!
Aber ich hatte den barmherzigen und heiligen Dingen den Rücken gekehrt. Dessen war ich mir sicher.
Die Käfer verschmolzen miteinander und wurden ein Körper. Mein neuer Körper. Große gefiederte Flügel sprossen aus meinem Rücken, und eine überirdische Macht, die ich nur zu erahnen begann, durchflutete mich. Mir war gleichzeitig übel und froh zumute.
Was habe ich getan?
In einem Wimpernschlag war ich nicht länger in dem brennenden Gebäude, ich war … woanders, heil und unberührt, und sah den Rest meines menschlichen Körpers zerfallen. Mein schönes Gesicht verkohlte bis auf die Knochen. Astaroth stand neben mir, lächelte, und da war kein Schmerz mehr. Nicht hier, auf der Anderen Seite des Schleiers. Nicht der Schmerz des Feuers und auch nicht mehr der Hunger nach einer Liebe, die ich nie gekannt hatte.
Ich fiel vor dem Dämon auf die Knie, erfüllt von unerschütterlicher Hingabe. Astaroth hatte mich vor den Qualen des Lebens gerettet und schenkte mir stattdessen die süßeste Rache.
Ich fühlte, wie er meinen Kopf streichelte. Mich beruhigte.
»Mein lieber, lieber Ambri«, murmelte er, als mein Körper zu Asche verbrannte. »Willkommen in der Hölle.«
EINS
Cole
London, heute
»Und dann sagt dieser Typ, er will die Serie NächteinCornwall komplett kaufen, und ich muss ihm sagen, dass sie schon verkauft ist. Und dann sagt er: ›Scheiße, mal mir ’ne beschissene Blume auf ’ne Serviette, sonst bringt meine Frau mich um.‹«
Vaughn Ritter, mein ehemaliger Mitbewohner an der Royal Academy of Arts, schüttelte leise lachend den Kopf. Ich lächelte schwach in mein Pint im vollen Mulligan’s, wo ich jobbte und für heute fertig war.
»Mann, Vaughn, das klingt, als hättest du es echt geschafft«, sagte ich, und der Neid zwickte mich im Magen. Es fühlte sich wie Hunger an. Vielleicht war es Hunger; ich war noch nicht bezahlt worden, und außer ein bisschen Salatgarnierung hatte ich nichts zu Mittag gehabt.
Vaughn winkte ab. »Gott, man darf mir echt nicht zuhören. Ich klinge wie ein arrogantes Arschloch und rede nur von meinem Scheiß. Erzähl du, Cole. Wie behandelt dich das Leben nach dem Studium?«
Ich senkte den Blick. »Könnte besser laufen.«
»Ach Quatsch, du hast nur gerade eine schwierige Phase.«
Vaughn schlug die Beine übereinander und streckte den Arm auf dem zerschlissenen Rückenpolster der Sitzbank aus. Er wirkte locker, entspannt und absolut zuversichtlich in einem Wollblazer und Jeans. Sein dunkles Haar war elegant geschnitten und zurückgegelt. Gepflegt. Im Gegensatz dazu fiel mir mein hellbraunes Haar wirr in die Augen, als ich mich in alten Jeans und Jackett über mein Glas beugte. Durch den Stress war jeder Muskel in meinem Körper so angespannt, dass ich mich kaum bewegen konnte.
»Die schwierige Phase dauert schon seit dem Examen«, sagte ich, und mir war bewusst, dass ich kurz davor war zu jammern. »Ich weiß, dass ein Abschluss von der Academy kein Ticket zu sofortigem Ruhm und Erfolg ist, aber ich dachte, ich …«
Würde nicht total untergehen.
»… würde wenigstens einen Fuß auf den Boden kriegen«, beendete ich den Satz.
Vaughn zeigte, breit lächelnd, seine weißen Zähne. »Kopf hoch, Kumpel! Du siehst aus, als würdest du gleich von der Tower Bridge springen. Ist es wirklich so schlimm?«
»Es war nicht leicht.« Ich trank einen großen Schluck von meinem Ale. »Letzte Woche ist meine Großmutter gestorben. Ich bin gerade von ihrer Beerdigung in den Staaten zurück.«
»Oh verdammt, ein Unglück kommt selten allein, oder?« Vaughn beugte sich vor und nahm meine Hand. »Tut mir leid, Kumpel. Habt ihr euch nahegestanden?«
Ich nickte. »Sie war praktisch alles, was ich noch an Familie hatte. Aber als sie dement wurde, konnte ich nicht …« Ich räusperte mich, dankbar, dass meine schwarz gerahmte quadratische Brille die Tränen verbarg. »Ich konnte mich nicht um sie kümmern. Aber am Ende war ich bei ihr.«
»Das ist hart. Aber du weißt ja, was wir Künstler tun. Wir kanalisieren es.« Vaughn machte eine Tauchbewegung mit der Hand. »Schmerz, Kummer, Triumphe und Freude – alles fließt direkt in die Arbeit.«
Ich nickte wieder und fragte mich, welchen Schmerz oder Kummer Vaughn Ritter in seine Gemälde fließen ließ. Für ihn war der Abschluss an der Academy wirklich ein Ticket zu Ruhm und Erfolg gewesen. Eine wichtige Agentin – Jane Oxley – hatte sich ihn unter den Nagel gerissen, noch bevor er sein Diplom hatte rahmen können, und allein im letzten Jahr hatte er zwei Ausstellungen gehabt. Ich freute mich für ihn, aber ich wollte wenigstens ein bisschen von dem, was er hatte. Wenn schon nicht den Erfolg, dann wenigstens eine Pause von den Sorgen und Selbstzweifeln.
Ein Verkauf könnte auch nicht schaden.
»Ist da noch mehr?«, fragte Vaughn und las in meinem Gesicht. »Du kannst es mir sagen.«
»Nee, schon okay.«
»Cole Matheson«, schimpfte er und zog eine Augenbraue hoch. »Wir haben an der Uni einen Pakt geschlossen. Du und ich, weißt du noch? Der Yankee und der Brite. Die zwei Musketiere: einer für alle und so.« Er beugte sich vor. »Brauchst du Geld? Ich …«
»Nein, nein«, sagte ich und winkte schnell ab. »Ich brauche kein Geld. Ich …«
Ich brauchte jemanden, der meine Arbeit sah und daran glaubte. Ich brauchte eine andere Perspektive, musste einfach malen und nicht in dem Chor der Stimmen untergehen, die flüsterten, dass ich nicht gut genug war, dass nie etwas aus mir werden würde. Ich brauchte einen kleinen Hoffnungsschimmer, dass sich der Kampf des Künstlerdaseins lohnen würde.
Ich zwang mich zu einem Lächeln.
»Ich musste endlich mal wieder mit dir was trinken. War viel zu lange her.«
Vaughn runzelte die Stirn, als er sich im vollen Pub über den Tisch beugte. Auf einem Fernseher oben in einer Ecke lief ein Fußballspiel – AFC Richmond gegen Man City. Wenn man nach den Jungs ging, die in Rot oder Blau an der Bar saßen – und etwa gleich viel jubelten und fluchten –, war noch nichts entschieden.
»Ich weiß, ich hatte in letzter Zeit wegen der Ausstellungen viel zu tun«, sagte Vaughn. »Und Jane will, dass ich nächste Woche nach Paris fliege, aber ich hab dich nicht vergessen, Kumpel.«
»Du schuldest mir nichts, Vaughn. Ich tu mir einfach nur selbst leid und …«
»Nichts da.« Er schlug mit der Faust auf den Tisch. »Wir sitzen im selben Boot. Und du, mein Freund, hast Talent. Echtes Talent.«
»Danke, Mann. Manchmal frag ich mich das.«
»Lass es. Ich versteh ja, dass es nicht leicht ist. Aber ich lass dich nicht hängen, Cole. Es gibt da eine kleine Galerie in Chelsea, die frisches Blut braucht. Ich rede mit Jane, vielleicht kann sie ein paar Fäden ziehen. Sie ist mit dem Besitzer befreundet.«
»Ehrlich, Vaughn? Ich weiß nicht, was ich sagen soll.«
»Du musst gar nichts sagen, Kumpel.« Vaughn stieß mit mir an. »Wir sind zusammen bis hier gekommen. Wir erobern zusammen die Welt.«
»Okay.«
Ein kleiner Schirm der Hoffnung spannte sich über mir auf, um mich vor dem sintflutartigen Regen der Zweifel zu schützen, und hielt gerade mal zwanzig Minuten – exakt die Zeit, die ich brauchte, um in meiner schäbigen Wohnung in Plaistow anzukommen, die ich mir mit drei Mitbewohnern teilte.
Sie saßen alle im Wohnzimmer und guckten gut gelaunt Graham Norton. Bierflaschen standen auf dem Couchtisch.
»Cole!«, sagte Stuart, als er mich entdeckte. »Setz dich zu uns.«
»Sieht aus, als gäb’s was zu feiern«, sagte ich und setzte mich neben Malcolm auf die Couch.
»Gibt’s auch. Wir feiern unsere Befreiung«, sagte Caleb. Er warf mir einen Umschlag zu. Darin lagen dreihundert Pfund in neuen Scheinen.
»Wofür ist das?«, fragte ich. Hoffnung erfüllte mich und floss etwa in dem Tempo, in dem Malcolm redete, wieder ab.
»Abfindung von Mr Porter. Er wirft uns raus und will eine richtige Wohnung aus dem Loch hier machen.«
»Für Mieter, die richtige Verträge unterschreiben«, sagte Caleb grinsend.
Stuart nickte. »Porter hatte keinen Bock mehr auf die ständig wechselnden Mieter, also bezahlt er uns dafür, dass wir ausziehen. Ein Monat mietfrei plus dreihundert Tacken obendrauf.«
Er stieß mit den anderen an, während ich mich auf der abgewetzten alten Couch zurücklehnte. Meine Mitbewohner schienen die drohende Räumung für etwas Gutes zu halten, während mein Magen sich anfühlte wie eine Bleikugel.
»Und ihr habt einfach zugestimmt?«, fragte ich. »Ohne mich zu fragen?«
»Es mussten alle zustimmen«, sagte Stuart und runzelte die Stirn, als er mich ansah. »Hey, das ist gut, oder? Umziehen ist nervig, aber diese Wohnung ist eine Bruchbude.«
Er hatte recht, aber es war eine erschwingliche Bruchbude. Ohne Ersparnisse waren die dreihundert Pfund alles, was ich besaß. Und das würde niemals reichen, um die Kaution für eine andere Wohnung zu zahlen.
Und was jetzt? Was jetzt, verdammt?
In meiner billigen Jacke klingelte das Handy.
»Anruf aus den Staaten«, murmelte ich und stand auf. »Ich muss da rangehen …«
Ich hatte absolut keine Lust, jetzt mit meiner besten Freundin zu reden, weil sie sich nur Sorgen machen würde, aber Lucy Dennings und ich kannten uns seit dem Bachelorstudium an der New York University. Ich setzte ein Lächeln auf und ging ran.
»Hey, Luce. Wie geht’s?«
»Ich wollte nur mal hören. Wie geht’s dir?«
Lucy war auf der Beerdigung meiner Großmutter gewesen und wusste, dass es mir schwer zu schaffen machte. Ich verschwieg ihr nichts, doch ich war froh, dass wir nicht wie sonst über FaceTime redeten; sie hätte sonst sofort gesehen, wie die Verzweiflung ihre Tentakel um mich schlang.
»Es geht mir gut«, sagte ich. »Und du? Wie geht’s Cas?«
»Super«, sagte sie, und ich hörte das Lächeln in ihrer Stimme. »Ja, er ist …«
»Ein wahr gewordener Traum?«, neckte ich sie.
»So was in der Richtung.«
Meine beste Freundin war so single und einsam gewesen wie ich, als der mysteriöse Cas Abisare in ihrem Leben aufgetaucht war. Ich kannte nicht die ganze Geschichte – sie war merkwürdig kryptisch, was gewisse Details anging –, aber Luce schien wahnsinnig glücklich zu sein mit ihm. Es war, als wäre ein fehlender Teil von ihr wiederhergestellt.
»Was ist mit dir?«, fragte sie leichthin. »Irgendein potenzieller neuer Lover am Horizont?«
»Nope. Ich habe Männern abgeschworen, schon vergessen?«
»Aber es ist drei Jahre her. Er muss dich wirklich sehr verletzt haben.«
Der er, den Lucy meinte, war Scott Laudner, mein erster Freund, als ich aus New York nach London gekommen war. Ich hatte mich schnell und komplett in ihn verliebt wie ein Idiot, obwohl er mir explizit gesagt hatte, dass er nicht an das »heteronormative Konstrukt der Monogamie« glaubte. Ich hatte versucht, Kompromisse zu machen, aber als er einen Dreier mit einem anderen Typen wollte, den er auch datete, hatte ich das einfach nicht gekonnt.
»Ich war selbst schuld«, sagte ich zu Lucy und setzte mich auf die Kante des schmalen Betts in meinem bald ehemaligen Zimmer. »Scott hat von Anfang an gesagt, was er geben konnte. Es war dumm von mir, mehr zu wollen. Wahrscheinlich bin ich irgendwie altmodisch.«
»Das ist nicht altmodisch«, sagte Lucy. »Du willst eben nur einen einzigen Lieblingsmenschen. Da ist nichts falsch dran.«
»Ja, kann sein, ich hab gerade größere Probleme als mein Liebesleben«, sagte ich.
Zum Beispiel drohende Obdachlosigkeit.
Doch bevor Lucy fragen und sich noch mehr Sorgen machen konnte, unterbrach ich sie. »Aber mein Freund Vaughn will mich mit seiner Agentin in Kontakt bringen. Es gibt eine neue Galerie in Chelsea. Vielleicht entwickelt sich da was.«
Ich sah die Gemälde an, die an der Wand meines kleinen Zimmers lehnten, alle aus meiner Zeit an der Academy. Ich malte Porträts und versuchte jedes Mal, ein intimes Abbild meines Modells zu erschaffen. In jedem Gesicht sah man eine Geschichte, und ich wollte derjenige sein, der sie erzählte. Aber es war schwierig, an Aufträge zu kommen. Ich hatte den Job im Mulligan’s angenommen, um Zeit zum Malen zu haben und auch für das anstrengende Networking, das ich hasste – und in dem Vaughn Ritter so gut war. Ich musste meine Arbeiten bekannter machen, was in etwa so war, wie im Meer eine einzelne Angel auszuwerfen.
Bis jetzt hatte keiner angebissen.
Ich rieb mir die Brust, die sich eng anfühlte, während Lucy mir ins Ohr quietschte.
»Cole, das ist fantastisch! Du musst mir Bescheid sagen, wann deine Ausstellung ist, und dann komme ich.«
»Ich weiß nicht, ob es überhaupt dazu kommt …«
»Das wird es ganz bestimmt. Du bist großartig. Aber Ausstellung oder nicht, ich dachte daran, dich zu besuchen. Mit Cas. Oder auch allein, wenn es dir lieber ist. Ich will dich wirklich sehen. Ich vermisse dich.«
»Ich vermisse dich auch, aber im Moment passt es gerade nicht so gut. Ich werde umziehen. Ein neuer Anfang«, sagte ich und wünschte, ich hätte etwas von dem Optimismus, der eigentlich zu dem Satz gehörte.
»Aha. Ist alles in Ordnung, Cole? Sag mir die Wahrheit. Kannst du schlafen?«
Ich verfluchte und liebte es zugleich, wie gut meine Freundin mich kannte.
»Nicht so gut«, gab ich zu. »Im Moment ist einfach viel los. Aber sobald ich was Neues hab, freu ich mich wirklich, dich und Cas hier zu haben. Ich muss diesen geheimnisvollen Fremden endlich kennenlernen. Wie soll ich sonst beurteilen, ob er auch gut genug für dich ist.«
»Ich will auch, dass du ihn kennenlernst.«
Lucys Stimme war warm und voller Liebe für diesen Mann, der in ihr Leben gerauscht und sie vor einer Einsamkeit gerettet hatte, derentwegen ich langsam besorgt gewesen war. Ich starrte aus dem Fenster in den bewölkten Londoner Nachmittag. Der Herbst wich dem Winter mit großen Schritten. Eine Metapher, dachte ich. Mein Leben war sommerlich grün und sonnig gewesen und verwandelte sich in Windeseile in graue, kalte Ödnis.
Du hast echt einen Lauf, trauriger Junge.
»Ich muss auflegen, Luce. Hab einiges zu tun.«
»Okay«, sagte sie, und die Sorge kroch wieder in ihre Stimme. »Aber ruf mich jederzeit an. Und das meine ich so!«
»Das mach ich. Hab dich lieb.«
»Ich dich auch, Cole. Wirklich. Und wenn du etwas brauchst …«
»Ja, danke. Bye, Luce«, sagte ich und legte auf.
Ich warf das Telefon aufs Bett. Die Stille war erdrückend, und plötzlich fühlte ich mich völlig losgelöst von allem und jedem. Ich hatte meinen Dad nicht gekannt, und meine Mutter war abgehauen, als ich dreizehn war. Meine Großmutter, Margaret-Anne, war meine einzige Familie gewesen, und jetzt war sie tot. Selbst Lucy, die in New York lebte, hätte ebenso gut eine Million Kilometer weit entfernt sein können.
Ich blickte nach draußen in das kalte, graue Licht. Die Gebäude des Viertels umringten mich, engten mich ein. Kein Geld. Keine Wohnung. Keine Familie. Die Gemälde, die an der Wand lehnten, waren alles, was ich nach der Ausbildung an der Royal Academy of Arts hatte. Nicht genug.
Ich bin nicht gut genug.
Gedanken der Resignation und Selbstzweifel kreisten schneller und immer schneller in meinem Kopf, bis mir das Herz wie ein Hammer in der Brust pochte. Innerhalb von Sekunden beschleunigte sich mein Puls so sehr, dass man die einzelnen Schläge nicht mehr auseinanderhalten konnte. Ich packte mein schweißnasses T-Shirt.
»Scheiße, nicht jetzt.«
Ich legte mich aufs Bett und konzentrierte mich auf die Risse in der Decke. Langsam beruhigte sich mein rasender Puls, ich machte einen Atemzug nach dem anderen. Ich würde eine neue Wohnung finden und einen neuen Job. Einen besseren Job. Und Vaughn würde sich für mich einsetzen. Er hatte recht – ich hatte nur gerade eine schwierige Phase. Das war alles.
Nach gefühlten Stunden ebbte die Panikattacke ab und ließ mich leer und erschöpft zurück. Es war erst sechs Uhr abends, aber ich deckte mich zu und versuchte, in den Schlaf zu finden, der mir seit Monaten versagt blieb.
Morgen wird es besser. Bestimmt.
Ich hielt mich an dem Gedanken fest, während ich davondriftete, klammerte mich an ihn, während ein anderer höhnisch zu grinsen schien.
Bist du dir sicher?
ZWEI
Ambri
»Knie nieder, Junge!«
Ich tue, wie mir befohlen wird, und ziehe eine Grimasse. Der mit Blut bespritzte Steinboden ist unnachgiebig unter meinem nackten menschlichen Fleisch. Aber solange ich mit ein paar blauen Flecken hier rauskomme, kann ich mich glücklich schätzen.
Asmodäus, Großherzog der Hölle, sitzt auf einem Thron aus Knochen, überall und nirgends brennen gleichzeitig Feuer. Er ist fürchterlich anzusehen. Noch schlimmer ist es, von ihm angesehen zu werden.
Die Augenpaare in seinen drei Köpfen – Widder, Mensch und Stier – sind auf mich gerichtet, und in allen lodert kaum zurückgehaltener Zorn.
Echt witziger Typ.
»Du weißt, warum du hier bist«, sagt Asmodäus’ mittlerer, menschlicher Kopf.
Er spioniert in meinen Gedanken herum; ich muss aufpassen.
»Ich kann es mir denken, Herr.«
»Astaroth – dein Schöpfer – ist tot. Er wurde in die Auslöschung geschickt.«
»Wirklich traurig. Er war wie ein Vater für mich.«
Ein Vater aus Schlangen, dessen Atem Kleintiere umbringen konnte, aber wer konnte schon wählerisch sein?
»Casziel, der Nachtbringer, dem du direkt unterstellt warst, ist uns entkommen.« Asmodäus spießt mich mit seinem Blick auf. »Du standest ihm nahe.«
Das ist keine Frage.
»Ja, ich habe Casziel über zweihundert Menschenjahre lang gedient«, sage ich vorsichtig. »In dieser Zeit habe ich eine gewisse … Zuneigung zu ihm entwickelt.«
Der Stierkopf, links auf dem massigen Hals, stößt schnaubend Rauch aus.
»Casziel lebt als Mensch mit der Frau Lucy Dennings zusammen und wurde von seinen Pflichten uns gegenüber befreit. Astaroth existiert nicht mehr. Das sind folgenreiche Verluste für unsere Reihen, und du bist der einzige Zeuge der Ereignisse.« Asmodäus beugt sich vor, alle drei Augenpaare fixieren mich, seine Klauenhände umfassen die aus Schädeln gemachten Armlehnen. »Du hast doch nichts getan, was unseren Zielen schadet? Denk sorgfältig über deine Antwort nach, Ambri.«
Ich schlucke und wünschte, man hätte mir gestattet, meine Dämonengestalt zu behalten. Ich bin schwach und dünn in meinem menschlichen Körper … und genau aus diesem Grund hat Asmodäus es so befohlen. Er kann mich mit einem Faustschlag in die Auslöschung schicken.
Aber ich bin nicht völlig wehrlos. Ich habe sozusagen mein eigenes Waffenarsenal. Eine gute Lüge muss man mit Fakten würzen, damit sie glaubwürdig wird. Solche kleinen Bruchstücke der Wahrheit machen sie schmackhafter, damit sie besser runtergeht.
Und ich bin ein hervorragender Koch.
Rasch denke ich nach und rühre ein größtenteils wahres Süppchen zusammen, bei dem nur die ungenießbaren Zutaten fehlen, die mich wahrscheinlich umbringen würden.
»Casziel war der Unsterblichkeit müde geworden und strebte nach Auslöschung. Ein furchtbarer Verlust. Aber er liebte Lucy Dennings. Ich nahm an, dass Casziel bleiben würde, wenn sie eine von uns würde, also habe ich Lucy die Mittel besorgt, um Astaroth zu beschwören, damit er sie für unsere dunkle Sache gewinnen konnte. Niemals hätte ich die Einmischung eines Engels vorhersehen können. Der heilige Spuk hat Astaroth vernichtet und Casziel aus unseren Rängen befreit. Ich habe mir Mühe gegeben, beide zu retten.« Ich setze mein gewinnendstes Lächeln auf. »So betrachtet bin ich ein Held!«
Widder-, Stier- und Menschenkopf sehen mich aus schwarzen Augen an, und ich muss mich zusammenreißen, um das Kinn zu heben und die Blicke unverwandt zu erwidern. Die Sekunden gehen vorüber, gezählt von meinem hämmernden Puls, während ich warte, ob der Dämonenherrscher meine Geschichte schluckt oder wieder ausspuckt.
»Ich habe gehört, dass du schlau bist«, sagt Asmodäus schließlich. »Listig wie eine Kakerlake. Fähig, sich in Ärger einzumischen und einfach wieder zu verschwinden. Zu überleben, während alles andere vergeht.«
Die Unterstellung macht mich nervös. »Sehr freundlich von dir, aber ich bin eher Käfer als …«
»Astaroth war nachlässig. Er hat Casziel seine Schwärmerei zu lange nachgesehen und dich nicht genügend überwacht. Als dein neuer Herr werde ich nicht denselben Fehler machen.«
Oh, super.
Asmodäus lehnt sich auf seinem Thron zurück. »Ich sehe die Lügen auf deiner schlauen Zunge, Ambri. Ich sollte sie dir rausreißen und dir dann das Maul damit stopfen. Ich sollte dich auspeitschen lassen, bis dir die menschliche Haut in Fetzen vom Leib hängt.« Nachdenklich legt er die Köpfe schief. »Oder ich sollte sie vielleicht abbrennen, Zentimeter für Zentimeter. Wie in alten Zeiten.«
»Ich schwöre Herr, ich habe nichts getan …«
»Ja, du hast nichts getan. Du hast versagt. Und vielleicht hast du uns, was schlimmer ist, sogar betrogen. Du bist die Kakerlake, die auch dein Anikorpus ist, ein Ungeziefer unter meinem Stiefel.«
»Käfer«, murmele ich leise.
»Wenn du dich vor einem Jahrtausend voller Schmerz bewahren willst, Ambri, musst du der Dunkelheit deine Loyalität beweisen.«
»Was auch immer du wünschst, Herr. Sag es, und ich …«
»Ich will einen Menschen«, sagt er. »Frisch. Rein. Einen Menschen, dessen Licht hell durch den Schleier scheint.«
»Betrachte es als erledigt«, sage ich erleichtert. »Menschen zu verderben ist meine Lieblingsbeschäftigung. Das kann ich im Schlaf. Ist mir sogar lieber so. Dann muss ich nicht aus dem Bett aufstehen …«
»Ich bin nicht interessiert an deinen fleischlichen Untaten, Ambri. Du wirst einen Menschen herbringen. Zu mir.«
Ich runzle die Stirn. »Wir können nicht töten, Asmodäus, Herr.«
»Hältst du mich für einen Narren?«, donnert er dreistimmig, und der Äther selbst zittert unter seinem Zorn. »Du wirst der Verursacher seines Übergangs sein. Flüstere. Verleite. Verführe. Das ist doch deine Stärke, oder nicht?«
»Ich verführe sie zu den Sünden der Lust, Herr. Nicht dazu … zu sterben.« Mein Stirnrunzeln wird tiefer. »Darf ich Mammon vorschlagen? Er ist sehr viel geeigneter für solch eine Aufgabe. Oder vielleicht Kali? Die blutrünstige kleine Schlange hat mal einen Mann überredet, seinen eigenen Schwanz zu essen …«
»Schweig!«
Ich weiche zurück, als Asmodäus plötzlich so groß wird wie ein Berg und sein Thron winzig wirkt. Der Himmel hinter ihm ist bewegt, voller schwarzer Wolken und purpurner Blitze. Feuer strömt wie Erbrochenes aus seinen drei Mündern, und ich höre seine Worte, die vom Boden und vom Himmel und sogar von meinem eigenen Kopf ausgehen, der auseinanderzubrechen droht.
»Beweise dich mir, Ambri. Beweise, dass du ein loyaler Diener der Hölle bist. Treib einen Menschen in die größte Verzweiflung. Überrede ihn, sein elendes Leben zu beenden, und dann führe ihn zu mir. Solltest du versagen, wirst du ewige Qualen leiden.«
Ich falle auf die Knie, als Schmerz sich wie eine Schraubzwinge um meinen Kopf legt. Tränen laufen mir die Wangen herunter und tropfen dunkel vor mir auf den Stein.
Keine Tränen, Blut.
Blut rinnt mir aus Augen, Nase und Ohren. Ich halte mir den Kopf, als könnte ich so verhindern, dass er explodiert. Ich kneife die Augen zusammen, damit sie mir nicht aus dem Schädel springen. Der Schmerz lässt nicht nach, bis mein Körper von Asmodäus’ unsichtbarer Kraft flach auf die blutigen Steine gepresst wird. Als ob eine Hand mich zu Boden drückt.
»Herr …«, stoße ich hervor. »B-bitte …«
Erst, als meine Knochen fast brechen, lässt der Druck nach. Luft strömt zurück in meine Lungen, und mein Magen entspannt sich. Langsam erhebe ich mich, zitternd, nackt und würdelos.
»D-danke, Herr«, sage ich. Als ich mir über das Gesicht wische, färbt sich mein Handrücken rot. »Ich werde dich nicht enttäuschen.«
»Astaroth war zu lasch«, sagt Asmodäus und nimmt in einem Wimpernschlag wieder seine normale Größe an. »Casziel war ein liebeskranker Narr. Ich bin keins von beidem.«
»Natürlich nicht, Herr«, sage ich und verbeuge mich. »Du bist Asmodäus, Vater des Zorns. Asmodäus, der Seelenfresser.« Ich schlucke schwer. »Asmodäus, der Barmherzige …«
»Barmherzig.« Der Stierkopf schnaubt. »Enttäusch mich, Ambri, und du wirst vergessen, dass du je gewusst hast, was das Wort bedeutet.«
Ich gehe rückwärts aus Asmodäus’ bröckelnder Festung aus Blut und Knochen und vollziehe sofort den Übergang. Innerhalb einer menschlichen Sekunde befinde ich mich in meiner Luxuswohnung in New York City. Die mitternächtliche Stadt erhebt sich um mich herum, Wolkenkratzer glitzern jenseits meiner Fenster.
Ich schleppe mich ins Bad und betrachte mein Spiegelbild.
»Verfluchte Dämonen.«
Ich dusche den Dreck und das Blut der Anderen Seite ab, hülle mich in eine Seidenrobe und werfe mich mit noch feuchten goldenen Locken auf mein breites Bett. Dämonen schlafen nicht, aber ich muss warten, bis die Erschöpfung des Übergangs vergeht. Ich mache ihn oft genug, dass es nicht allzu lange dauert, und die Nacht ist noch jung.
Ich stehe auf und suche in meinem Schrank nach Designerklamotten und teuren Düften für die Vergnügungen dieser Nacht. Vielleicht finde ich die arme Seele, die ich zum Selbstmord verführen soll, in einem Sex-Club oder einer der geheimen Bars, die ich für meine nächtlichen Eroberungen frequentiere. Bezüglich der Deadline war Asmodäus ja nicht sehr deutlich. Warum also sollte ich mir nicht vorher ein bisschen Spaß mit meinem Opfer gönnen?
Mein Opfer …
Der Gedanke, einen Menschen in den Selbstmord zu treiben, hinterlässt einen schlechten Geschmack in meinem Mund. Selbstverständlich verachte ich Menschen. Das Pack hat mir nur Schmerzen bereitet, als ich noch einer von ihnen war. Jetzt übe ich Rache, indem ich ihnen Lust abringe, bis sie völlig erschöpft sind, aber trotzdem nach mehr betteln. Mehr von mir. Von meiner Aufmerksamkeit, meinen Berührungen, meiner Zunge auf ihrer Haut. Ich herrsche über ihre Körper, kontrolliere, verführe, verlocke sie. Ich bringe sie an den Rand des Höhepunkts, erlaube ihnen jedoch erst zu kommen, wenn ich es wünsche.
Köstlich.
Mehr hast du mir nie bedeutet …
Die Erinnerung trifft mich; eine offene Wunde, die Armand mir am Ende meines menschlichen Lebens zugefügt hat.
Ich ignoriere sie, schlüpfe in einen nachtschwarzen Anzug und betrachte mich im Spiegel. Wenn man stirbt und als Unsterblicher wiedergeboren wird, ist fünfundzwanzig das ideale Alter. Ich bin über einen Meter achtzig groß (sechs Fuß bei den Yankees), schlank und muskulös. Meine Haare sind goldblond. Meine menschlichen Augen sind blaugrün und von langen dunklen Wimpern umrahmt. Ich habe volle Lippen, eine gerade Nase, eine verführerische Kieferpartie …
Ich bin wirklich ein gut aussehender Teufel.
Ich trete hinaus in die New Yorker Nacht. In der Luft liegt die Kühle des Novembers. Aber statt mich zu einem meiner Lieblingsorte auf den Weg zu machen, spüre ich, wie ich mich mit zitternden Flügeln in hundert Einzelteile auflöse. Ich erhebe mich als Käferschwarm in die Luft und fliege, wie von unsichtbaren Fäden gezogen, nach Hell’s Kitchen.
Sei verflucht, Casziel.
Ich fliege zwischen den Gebäuden umher, bis ich die kleine Wohnung finde, die hinter einer anderen liegt. Die man über eine klapprige Treppe erreicht, von einem verlassenen Hinterhof aus. Das Pentagramm, das Lucy Dennings im Hof auf den Boden gezeichnet hat, ist nicht mehr da. Die schwarze Kerze, die ich ihr gegeben habe, längst fort. Genau wie mein Schöpfer, Astaroth, der von ihr beschworen und dann von ihrem Engel zerstört wurde. In die Auslöschung geschickt.
Um ihn trauere ich nicht, aber um Casziel …
Ich schwärme hinauf zum warmen gelben Licht des Fensters im ersten Stock – wie die sprichwörtliche Motte zum Licht – und sehe mit hundert Augenpaaren hinein. Casziel und seine geliebte Lucy sitzen aneinander gekuschelt auf der Couch und sehen fern. Ab und zu wandert sein Blick zu ihr, ohne dass sie es merkt. Seine Liebe zu ihr ist wahrnehmbar wie ein Duft, den ich im Wind spüre, obwohl ich verdammt bin.
Es fühlt sich in meinen hundert kleinen Körpern an, als würde mir das Herz stocken.
Das Telefon, das neben Lucy auf dem Tisch liegt, vibriert. Sie küsst Casziel auf die Wange, geht hinaus und setzt sich auf die Treppe.
Schnell fliege ich außer Sicht und lande auf der Seite des Gebäudes. Lucy redet mit Cole Matheson, ihrem amerikanischen Freund, der in London wohnt. Ich habe früher schon gesehen, wie sie mit ihm sprach. Damals hat mir die FaceTime-Funktion einen jungen Mann mit hellbraunem Haar und kantigen Zügen gezeigt. Gut aussehend, aber nicht zu sehr. Einzigartig. Tiefe Stimme, tiefgründige braune Augen hinter einer schwarz gerahmten Brille.
Lucys Sorge und der monotonen, elenden Stimme nach zu urteilen, die von Coles Ende kommt, ist er nicht glücklich und versucht, es zu verbergen.
Ein möglicher Kandidat für Asmodäus’ Aufgabe?
Er wohnt in London, dem Schauplatz der Verbrechen meines lieben Onkels …
Ich hatte geschworen, nur nach England zurückzukehren, wenn es unvermeidlich war, aber ich hatte ein paar Millionen Pfund auf einer Londoner Bank und eine schöne Wohnung in Chelsea, die ich seit zehn Jahren nicht betreten hatte.
Und ich bin nicht länger der ängstliche Junge in der Kutsche meines Onkels. Wenn er mich jetzt sehen könnte …
Ich löse mich von der Hauswand, fliege hoch und gönne mir einen letzten Blick auf Casziel. Er ist auf der Couch eingeschlafen, sein schönes Gesicht im Profil, die Augen geschlossen, ein leichtes Lächeln auf den Lippen.
Schlaf, spotte ich. So was brauche ich nicht. Aber mich auf der Couch an jemanden anzulehnen … Umarmt zu werden …
Die Flügel meiner hundert Käfer zucken bei der Vorstellung. Es ist Schwäche. Seine Schwäche. Casziel war ein Großherzog der Hölle und ist freiwillig einer menschlichen Frau zum Opfer gefallen. Noch dazu einer, die so wenig bemerkenswert ist. Ich werde niemals so dumm sein. Ich werde nie zulassen, dass mich jemand in die Finger kriegt, wenn es nicht meinen eigenen Wünschen dient. Ich bin jetzt mächtig und werde das für nichts auf der Welt aufgeben.
Auf der Straße verwandle ich mich wieder in einen Menschen, gehe ein Stück und denke nach. Ich werde nach London zurückkehren, Cole Matheson finden und …
»Ihn vernichten?«
Meine Worte scheinen erstarrt in der kalten New Yorker Nacht zu hängen.
Es wird Casziel und Lucy Schmerzen bereiten, wenn ich Cole auf die Andere Seite treibe. Asmodäus wäre hochentzückt, dass ich nicht nur seinem Befehl gehorche, sondern darüber hinaus den Dämon bestrafe, der ihm entkommen ist, und seine menschliche Geliebte noch dazu. Ein rundum zufriedenstellendes Ergebnis.
Vor allem für mich.
Und doch …
Was zögerst du? Menschen haben dich brutal ermordet. Casziel hat dich vergessen. Sie alle verdienen eine Kostprobe der Schmerzen, mit denen man dich dein Leben lang zwangsernährt hat.
Ich fege die letzten Zweifel hinweg.
»Cole Matheson soll es sein.«
DREI
Cole
»Kein Lärm nach acht Uhr abends, keine Partys, keine Mädchen.«
Ich grinste schief hinter dem Rücken der Frau, die mir die kleine Kellerwohnung in Whitechapel zeigte. »Was ist mit Jungs?«
Velma Thomas, vielleicht meine neue Vermieterin, drehte sich um und betrachtete mich aus zusammengekniffenen, von Falten umrahmten Augen. Sie trug ein altes Hauskleid und Pantoffeln, und ihre missmutige Miene wirkte wie in ihre Wangen geätzt.
»Wie bitte?«
»Nichts.«
»Hmpf. Miete ist am Monatsersten fällig, keinen Tag später. Und außerdem ist Rauchen verboten, und Haustiere und laute Musik …«
Während sie aufzählte, was ich alles nicht durfte, sah ich mich um. Dunkel, zugig, verstaubt. Kaum mehr als ein Schuhkarton mit schwarz gestrichenen Wänden, als würde Ms Thomas hier Open-Mic-Abende abhalten oder Improvisationstheater unterrichten. Hinter einem Fenster sah man ein schmales Rechteck von der Straße. Die weiteren Annehmlichkeiten umfassten eine elektrische Kochplatte, einen Minikühlschrank und ein Badezimmer, vor dem anstelle einer Tür ein Vorhang hing. Aber die Wohnung hatte einen eigenen Eingang unten an einer haarsträubenden Treppe, und ich würde das winzige Bad mit niemandem teilen müssen. Es war ein Schuhkarton, aber wenn ich all mein Zeug – was nicht viel war – auf eine Seite räumte, hätte ich genug Platz zum Malen.
Wobei ich nicht genug Licht zum Malen hätte, aber darum würde ich mich kümmern, wenn es so weit war.
»Also?«
»Ich nehme es.«
Als hätte ich eine Wahl.
Ms Thomas ließ mich allein, damit ich auspacken konnte – was nach fünf Minuten erledigt war –, und ich setzte mich mit hängenden Schultern aufs Bett. Staub stieg rund um mich herum auf, der Wind pfiff ums Fenster, und kalte Luft schob sich durch die Ritzen.
Es würde ein sehr langer Winter werden.
Später am selben Nachmittag half mir ein Kumpel aus dem Pub, mit meinen Bildern umzuziehen. Wir wickelten die Porträts einzeln in Decken und schleppten sie die schmale Treppe runter in meine neue Wohnung. Mein Telefon hatte seit Tagen nicht geklingelt – keine Nachricht von Vaughn. Ich überlegte, ihn anzurufen oder ihm vielleicht ein beiläufiges Hi, wie geht’s? zu schicken.
»Sei bitte nicht so armselig«, murmelte ich in meiner winzigen Wohnung, aber verzweifelt traf es eher – Vaughn konnte jetzt jeden Tag nach Paris abreisen.
Er hatte versprochen, den Galeriebesitzer über seine Agentin zu kontaktieren, aber das hieß nicht, dass ich nicht selbst auch Arbeit vor mir hatte. Ich konnte mich nicht darauf verlassen, dass andere Leute meine Zukunft in die Hand nahmen. Ich zog die Jacke aus und stellte eine leere Leinwand auf die Staffelei. Ich hatte nicht mehr viel Farbe, aber für ein neues Bild würde es noch reichen. An der Uni hatten meine Profs immer gesagt, dass ich die Fähigkeit hätte, in meine Modelle hineinzublicken und wirklich ihr inneres Wesen zu sehen. Nur ein kurzer Blick auf die Person würde mir genügen, dann sei sie in mein Gedächtnis eingebrannt, und ich könnte aus der Erinnerung malen, wenn sie mir nicht Modell sitzen konnte.
Es kam mir vor, als wäre das eine Million Jahre her.
Ich setzte den Bleistift auf die Leinwand und erstarrte. Ich hatte kein Modell im Kopf. Keine Idee für ein Bild. Meine Gedanken bestanden nur noch aus Sorgen, Stress und Selbstzweifeln. Die Professorinnen und Professoren mussten jemand anderen gelobt haben. Jemand anders musste die Kunstzeitschrift der Uni herausgegeben haben, jemand, der sehr viel mehr Selbstvertrauen hatte als ich. Eine Version von mir hatte an der Academy angefangen, eine andere den Abschluss gemacht. Und die erkannte ich nicht wieder.
Ich ließ die Hand sinken. »Scheiße.«
Okay, heute war also kein Maltag. Ich konnte immer noch versuchen, irgendwas an Land zu ziehen. Eine Ausstellung irgendwo. Egal was.
Ich zog die Jacke wieder an und ging hinaus.
»Knallen Sie gefälligst nicht mit der Tür!«, kreischte Ms Thomas über mir aus dem Fenster.
»Ja, Ma’am«, murmelte ich.
Ich nahm den Bus zum Hyde Park. Obwohl es fast vier war und Regen drohte, standen Künstler hinter Leinwänden und malten den Wellington Arch, die Stadt oder die zahlenden Kunden, die vor ihnen saßen. Und es gab ausreichend Platz. Ich könnte mich auch morgen mit meiner Staffelei hier hinstellen.
So weit ist es schon gekommen?
Es war ehrliche Arbeit, aber die letzten Zuckungen meines Egos brachten mich dazu, Vaughn anzurufen. Ich hielt mir das Telefon ans Ohr und zitterte in meinem abgetragenen Mantel.
Mailbox.
Hallo, guten Tag. Dies ist die Mailbox von Vaughn Ritter. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Geschäftliche Fragen richten Sie bitte an meine Agentin Jane Oxley unter …
Ich legte auf.
»Mist.«
Ich schob mir die kalten Hände in die Taschen und wollte gerade über die Straße gehen, als ich an der Ecke einen Mann sah – einen unerhört schönen Mann, der mich aufmerksam beobachtete. Er trug einen schwarzen Mantel mit hochgestelltem Kragen. Sein volles blondes Haar wehte im eisigen Wind, und er sah mir unverwandt in die Augen. Ein träges Grinsen lag auf seinen Lippen, als würde er darauf warten, dass ich ihn erkannte. Oder seine Schönheit anerkannte; ihm war ganz klar bewusst, wie unglaublich großartig er aussah. Er trug es wie seinen Mantel.
Aber selbst wenn ich Männern nicht für die absehbare Zukunft abgeschworen hätte, war ich nicht in der Position, mich so jemandem zu nähern. Alles an ihm schrie Geld und Selbstvertrauen – zwei Dinge, die bei mir gerade Mangelware waren.
Ich riss den Blick von ihm los und gönnte mir ein Taxi nach Shoreditch, einem kleinen Künstlerviertel. Eine Stunde lang ging ich an winzigen Galerien, Clubs und Läden vorbei, die sich in den Straßen aneinanderreihten. Bis auf die Bars war alles geschlossen. Ich suchte die Galeriefenster ab – manchmal klebten Aufrufe an Künstler an den Scheiben. Niente. Nada. Nichts. Es wäre klüger, zu Hause online zu suchen, dachte ich. Die schnell einsetzende Dunkelheit brachte winterliche Kälte mit sich.
Ich nahm den Bus – keine Taxis mehr – zurück in mein Viertel und kaufte ein Paket Instant-Nudeln und eine Banane in einem kleinen Eckladen.
»Das Abendessen der Champions.«
In meiner Kellerwohnung machte ich mir die Nudeln heiß und aß sie langsam, damit sie länger hielten. Mein Magen knurrte noch, als ich mein Laptop hochfuhr. Ich suchte nach Galerien mit offenen Ausschreibungen. Keine innerhalb der Stadtgrenzen. Akquise machte einen fertig, aber so war das eben. Dummerweise hatte ich irgendwie gedacht, es würde leichter gehen.
Mein Gehirn drohte, seine nächtliche Kreisfahrt zu beginnen, und die negativen Gedanken nahmen Fahrt auf. Ich klappte das Laptop zu und sank aufs Bett, hoffte, ich würde genauso schnell in den Schlaf sinken.