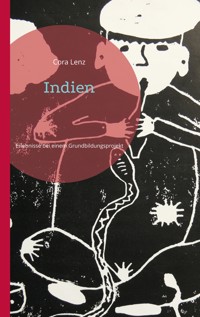Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In locker zusammengestellten autobiografischen Geschichten erzählt die Autorin von ihrem Leben als Flüchtlingskind und ihrer Erkenntnis als junges Mädchen, dass das gesellschaftlich Übliche für sie nicht das Beste sein muss. Sie beschreibt die Suche nach ihrem eigenen Weg, ihre Erlebnisse von Fremdsein, enttäuschten Hoffnungen, unerwartetem Glücklichsein und ihrem "Ankommen". Selbstkritisch setzt sie sich mit den Haltungen ihrer Jugend und ihres Arbeitslebens auseinander und fragt, wie es anders hätte sein können. Einen besonderen Teil widmet sie der Auseinandersetzung mit der Persönlichkeit ihrer Eltern und ihrer Beziehung zu ihnen und anderen ihr wichtigen Menschen. Dadurch gelingt es ihr, sich mit ihnen zu versöhnen. Ein eindringliches, mutiges Buch!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 332
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Befreiung
Schatten der Erinnerung
Gebannt auf Papier.
Stürme der Vergangenheit
Schwarz auf weiß.
Im Schutz dieses Gitters
Kann ich sie freundlich betrachten.
Die Schrecken weicher
Die Freuden sanfter.
Beide für immer
Verbunden mit mir.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Prägung - Die Kindheit
Ferienparadies mit dunklen Flecken
Schulstraße
Das Puppenkleidchen
Borkum
Die rote Schleife
Die Vulkan-Werft
Suche - Jugend und Freunde
Tanz des Lebens
Starklofstraße
Kerstin
Wangerooge
Lena oder Die Chemiearbeit
Gegensätze
Die Antwort
Rodrigo
Das erste Mal
Möckel
Sehnsucht - Liebesgedichte aus Botswana
Botswana
Allein Sein
Wahrheit
Frage nicht
Der Wanderer
Hoffnung
Jenny
Treibsand
Dunkel der Nacht
Schnee
Bindung - Die eigene Familie
Erster Eindruck
Die erste gemeinsame Wohnung
Die Hochzeit
Da ist sie - Anna
Das Geschenk des Himmels
Robert
Schatten der Trauer
Weihnachten
Wurzeln - Die Herkunftsfamilie
Uralt-Lavendel
Suchbild Vater
Brief an Pantita
Das Vermächtnis
Der Ring oder Suchbild Mutter
Marianne
Ideale - Der Beruf
Die Expertin
Die Bettwäsche
Ein Traum ging zu Ende
Maria oder Eine schwere Entscheidung
Bangladesch
Das Kleinod
Das Sorgentelefon
Ankommen
Die Namensgeschichte
Galapagos
Heimat
Glücklich Sein
Angekommen?
Nach 47 Jahren
Epilog
Wie Abdrücke in feuchtem Sand
Danksagung
Wie Abdrücke in feuchtem Sand
Vorwort
Als ich vor sechs Jahren begann, hoffte ich, einen roten Faden zu finden, der sich durch mein Leben zieht, den ich bislang nicht gesehen hatte, der sich mir endlich durch das Schreiben offenbaren würde. Doch er zeigte sich mir nicht. Die Ereignisse, die ich geschildert hatte, erschienen mir eher wie ein Flickenteppich ohne Muster oder ein Mosaik ohne Rahmen. Jetzt in diesem Sommer endlich erschienen mir meine Erinnerungen wie Abdrücke im Sand meiner Vergangenheit, die sich verändern oder ganz verschwinden werden je nach meiner Sichtweise oder vor dem Hintergrund neuer Geschehnisse.
Ich möchte sie festhalten, wie sie sich mir heute darstellen. Ich habe sie geschrieben besonders für meine Kinder; sie sollen mehr über mein Leben erfahren als ihnen bislang bekannt ist und das sonst verloren gehen könnte. Sie sind ein Kompromiss zwischen Ehrlichkeit und Verletzlichkeit.
Diese Sammlung enthält Geschichten aus meiner Kindheit und von meiner Familie, Beschreibungen meiner Jugendfreunde, Gedichte aus meiner „wilden Zeit“ in Botswana, eine Auseinandersetzung mit dem Wesen meiner Eltern und was sie mir bedeuteten, einige Episoden aus meinem Berufsleben und Betrachtungen zum Ankommen am Ziel meiner Wünsche. Sie sind in großen zeitlichen Abschnitten zusammengestellt, ohne strenge Chronologie oder aufeinander bezogen zu sein - eine Sammlung voneinander unabhängiger Geschichten.
Sie enthalten meine Wahrheit, meine subjektiv gefärbten Erinnerungen, vielleicht geschönt oder dramatisiert, vieles vergessen oder verdrängt. Wenn ich wissentlich die Fakten verlassen habe, ist dies kursiv kenntlich gemacht.
Die Namen lebender Personen sind verändert.
Gewidmet ist das Buch meinem Mann. Das Schreiben hat mir bewusst gemacht, wie nahe und wie wichtig er mir ist.
Cora Lenz, Nordsee, 5.8.2016
Prägung
-
Die Kindheit
Ferienparadies mit dunklen Flecken
Der Bauernhof in Ober-Hilbersheim in Rheinhessen war das Zuhause meiner Mutter. Dort verbrachten wir beide in der Nachkriegszeit die Sommer, auch um uns richtig satt essen zu können. Hier war sie geboren und hatte bis zu ihrem 14ten Lebensjahr gelebt. Sie kannte sich aus und alles war ihr vertraut. Deshalb war der Hof irgendwie auch mein Zuhause. Doch waren wir nur zu Gast bei meiner Tante Hanna, Mutters Schwester, und blieben immer nur für ein paar Wochen. Der Hof gehörte jetzt Hanna, die als Ältere der beiden früh verwaisten Schwestern den Bauernhof geerbt und meine Mutter später ausgezahlt hatte. Ihr Mann war nicht aus dem Krieg zurückkehrt und hatte Hanna mit ihren drei Kindern und dem Hof allein gelassen.
Der Gegensatz zu unserer engen Zweizimmer- Wohnung in Bremen, in der meine Eltern und ich bei Frau Schlumbohm einquartiert waren, machte die Zeit in Ober-Hilbersheim noch schöner und wertvoller. Auf jeden Fall liebte ich die Aufenthalte dort, das Spielen mit meinem acht Jahre älteren Vetter Philip, den ich damals noch Gerhard nannte. Erst später nachdem er Gerda, die Tochter eines wohlhabenden Geschäftsmannes aus Hamburg, geheiratet hatte, legte er den alten „Bauern-Namen“ Gerhard ab und verwandte seinen Zweitnamen Philip. Gerhard foppte mich gerne und immer wieder, wenn er sang: „Cora von Mora hat Bobbestrümpf an“. Ich wusste nicht, was „Bobbestrümpf“ sind. Das hinderte mich aber nicht daran, mich fürchterlich darüber zu ärgern, hinter ihm her zu laufen und lauthals mit ihm zu schimpfen. Er war natürlich schneller und rannte weg, das Sprüchlein ständig wiederholend. Und band mich damit umso mehr an sich. Trotz des großen Altersunterschiedes durfte ich ihn begleiten. Ich liebte ihn sehr. Meine Kusine Gisela, sechs Monate älter als ich, mochte ich weniger. Gisela war der Liebling von Tante Hanna, zart und verwöhnt. Ich hielt mich lieber an Gerhard, der mich neckte und sich mehr mit mir als mit Gisela beschäftigte. Meine älteste Kusine Marianne war mir zehn Jahre voraus und oft außer Haus. Mit ihr hatte ich nicht viel zu tun.
Auf jeden Fall war es schön in Ober-Hilbersheim: ein richtiger Bauernhof mit großem, lichten Innenhof. Die Hühner spazierten frei in der Nähe des riesigen Misthaufens herum, aber ließen genügend Platz für uns Kinder, um ungestört im kopfsteingepflasterten Eck, das von der Küche und dem Wohntrakt gebildet wurde, in der Sonne spielen zu können. Auf der anderen Seite ging es in die offene Scheune mit dem kleinen Schweinekoben daneben. Seit Tante Hannas Mann als Arbeitskraft fehlte, hatte meine Tante die Viehhaltung auf drei Schweine für den Eigenbedarf reduzieren müssen.
Bei einem Besuch hatte ich Glück. Ich konnte endlich das miterleben, was ich mir schon lange gewünscht hatte. Meine Mutter war weniger begeistert, denn sie hatte diese blutrünstigen Angelegenheiten immer gemieden. Das Schwein, das in diesem Jahr alt genug geworden war, sollte nicht wie in den andern Jahren im Oktober, sondern schon im August geschlachtet werden. Da waren wir noch da.
Alle Türen, die zum Hof führten, wurden abgesperrt, damit das Schwein keine Zuflucht finden konnte. Von dem zweiteiligen Holzgatter durften Gisela und ich vom Flur aus in den Hof schauen. Der obere Teil war zur Seite geschwenkt und gab die Sicht frei. Aber ich war noch so klein, dass ich nicht einmal auf Zehenspitzen etwas sah. Meine Mutter holte einen Schemel aus der Küche. Jetzt reichte ich mit der Nasenspitze über den unteren Teil des Gatters. Das Schwein rannte quiekend über den Hof, von einer Ecke zur anderen, über den Misthaufen und zurück. Es spürte, dass nichts Gutes zu erwarten war. Aber da war kein Schlupfloch.
Endlich packten der Schlachter und sein Geselle zu und schleppten das Schwein mit festem Griff unter das Dach vor die Küche, wo der Eimer schon bereit stand. Ein fachmännischer Stich. Das Blut schoss in einer Fontäne hoch und floss in hohem Bogen in den Eimer. So viel Blut hatte ich noch nie gesehen. Die Frauen durften das Blut rühren. Ich auch. Ich rührte eifrig. Von der Blutwurst später mochte ich allerdings nicht essen.
Solche aufregenden Erlebnisse gab es nur hier.
Viele Stellen auf dem Hof konnte man erkunden oder sich darin verstecken, wie den verlassenen Kuhstall oder die Scheune Dort fand uns so leicht niemand. An der Rückseite der Scheune war eine solide Holzleiter mit zehn Stufen. Über sie gelangte man in den kleinen hochgelegten Gemüsegarten. Sich hier zu verkriechen war ein besonderes Abenteuer: es gab wenig Platz und man sollte das Gemüse nicht zertreten. Aber wenn der Sucher die Treppe hoch kam, knarrte sie, und ich konnte mich schnell noch kleiner machen.
Über dem Misthaufen war ein Dachboden, der ebenfalls nur über eine Leiter zu erreichen war. Er war richtig aufregend, denn hier wurde alles abgelegt, was nicht mehr gebraucht wurde, und es wurde nie aufgeräumt. Dieser Boden zog mich immer wieder an, sicher könnte ich etwas Interessantes aufspüren. Vielleicht hatten hier Räuber eine Prinzessin versteckt gehabt und sie hatte ihren Ring fallen gelassen. Den wollte ich finden. Ich verbrachte viele Stunden auf dem geheimnisvollen Dachboden, entdeckte aber nie etwas Außergewöhnliches, wie Tante Hanna mir vorhergesagt hatte. Nur wollte ich nicht zu früh aufgeben.
Der Hof in Bubenheim war der andere Teil des Ferien-Paradieses für mich. Aber da waren Einschränkungen! Eigentlich war ich gerne dort, weil die Köhlers so nett waren. Heinrich Köhler, Onkel Schorsch, mein Großonkel mütterlicherseits, hatte in Bubenheim den elterlichen Hof übernommen und als Köhlersches Familienoberhaupt nach dem Tod seiner Schwester ihre beiden Kinder, als sie 1927 zu Vollwaisen wurden, zu sich geholt: Gretel, meine Mutter und Hanna, meine Tante. Das war lange vor der Zeit dieser Erzählung, doch es ist die Erklärung, warum ich in Bubenheim mit zur Familie gehörte.
Die Köhlers waren eine große Familie: Da war zunächst einmal meine Großtante - liebevoll „Käthsche“ genannt, ein Kosename für Katharina - die Frau von Schorsch, die schon meine Mutter mit aufgezogen hatte. Sie war rundlich, unglaublich gutmütig und konnte in ihrem hohen Alter schlecht laufen. Trotzdem machte sie jede von mir begehrte Menge Apfelpfannkuchen mit Weinschaumsoße - man sagt, dass es einmal sogar 15 bei einer Mahlzeit waren! - und hat sich damit bei mir unvergesslich gemacht. An Onkel Schorsch, der aus dem Krieg mit nur einer Hand auf den Bauernhof zurückkam und mit einer Lederbandage um den Stumpf gewickelt herum lief, kann ich mich nur vage erinnern. Er starb, als ich ungefähr zwei Jahre alt war. Großonkel Jean, Bruder von Schorsch und meiner Großmutter Susanna, war ledig geblieben und lebte, wie damals üblich, auch auf dem Familienhof. Ein netter, auch schon recht betagter Mann, der mir besonders wegen seines eleganten Gehstocks in Erinnerung ist. Der zweite Sohn von Schorsch und Käthsche, mein Onkel Willi, hatte „nach auswärts“, nach Elsheim geheiratet und eine „gute Partie“ gemacht, so hieß es. Anfangs kam er noch oft, später nur selten. Das jüngste Kind, die Tochter Hanna, war eine Nachzüglerin. Nur zehn Jahre älter als ich, war sie für mich weder Tante - ich nannte sie auch nie so - noch passende Spielgefährtin. Sie muss da gewesen sein, aber eigentlich existierte sie für mich damals gar nicht. Erst heute habe ich Kontakt zu ihr: Wir verstehen uns gut. Sie ist meine einzige noch lebende Verwandte mütterlicherseits.
Wirklich existierten dagegen die vielen Hühner, die in dem engen Hof, der zum größten Teil überdacht und düster war, frei herum liefen. Und entsprechenden Dreck auf dem Boden machten! Nirgends konnte man unbedacht hintreten, bei jedem Schritt musste man aufpassen! Das war kein Paradies!
Doch war da mein Onkel Hans, der älteste Sohn. Eine drahtige Gestalt, biegsam und wendig. Auch sein Gesicht mochte ich, schmal mit markanten Zügen, die man beinahe scharf hätte nennen können, wenn da nicht die wachen Augen gewesen wären, die sich unvermutet mit Fältchen umkräuseln konnten, wenn er wieder einmal einen seiner klugen Scherze machte. Er war so intelligent und gut aussehend, dass ich nicht verstehen konnte, dass er ausgerechnet Margret geheiratet hatte. Die redete selten, war von Anfang an recht rund und wurde es immer mehr! Ich beachtete Margret kaum, wenn sie im Haus herumschlurfte und versuchte, zu mir freundlich zu sein. Dafür war aber Onkel Hans umso wichtiger für mich. Ich durfte ihn überall hin begleiten, beim Heu machen, zur Weinlese und bei den Arbeiten im Hof. Das war paradiesisch! Nur später, als er zum Bürgermeister von Bubenheim gewählt wurde, worüber ich wohl stolzer war als er selbst, konnte ich nicht mehr mitkommen.
Aber beim Ausmisten im Hof durfte ich helfen. Diese Arbeit war nicht meine Lieblingsbeschäftigung, doch ich tat es für Onkel Hans.
Ich beschwerte mich immer wieder über die Hühner bei Onkel Hans, auch an diesem Tag. „Geh doch mal zur Tante Käthsche und hol schnell ein paar Korken“, bat er mich. Ich lief in die Küche und fragte Tante Käthsche nach Korken. Die suchte in der Schublade und drückte mir dann einige in die Hand. Ich rannte zurück und rief schon in der Haustür: „Onkel Hans hier sind die Korken!“ Onkel Hans drehte sich um, sah mich mit der ausgestreckten Hand und den Korken und brach in schallendes Gelächter aus. Ich verstand erst nicht warum. Bis er sagte: „Na, dann verstopf mal die Hühner!“
So gefoppt zu werden tat meiner Liebe keinen Abbruch. Im Gegenteil, ich verehrte Onkel Hans umso mehr!
Beide Orte waren für mich gleichermaßen paradiesisch: In Ober-Hilbersheim gab es den großen schönen Hof mit Kindern zum Spielen, und ich wurde aufgepäppelt mit Fleisch vom selbstgeschlachteten Schwein und Gemüse aus dem eigenen Garten. In Bubenheim gab es die Köhlers und das Gefühl, wirklich willkommen zu sein.
Besonders schön waren die Feldwege von Ober-Hilbersheim nach Bubenheim. In der Sommerwärme flirrte die blaue Luft, auf den Feldern wogte das gelbe Korn. Ich war sehr stolz darauf, den Unterschied zwischen der Gerste mit den langen Grannen, dem Roggen mit den kürzeren und dem Grannen losen Weizen zu kennen. Den hatte meine Mutter mir sehr früh beigebracht. Es war wunderbar über die flachen Hügel dieser rheinhessischen Landschaft zu laufen und sich allmählich den Weinbergen von Bubenheim und dem kleinen Weingut der Köhlers zu nähern. Kurz nach dem Wäldchen, in dem es auch Wildschweine geben sollte - ich und Mama liefen dort immer etwas schneller - kam die schönste Stelle: der Hohlweg, der auf beiden Seiten von Brombeerranken gesäumt war. Auf der von der Sonne beschienenen Seite waren die Brombeeren besonders groß und saftig. Dies war mein Lieblingsort, denn die Brombeeren schmeckten dort so gut wie sie später nirgendwo anders schmecken sollten!
An diesem Tag, der sich in meine Erinnerung gegraben hat, wollte meine Mutter wieder einmal nach Bubenheim gehen, und ich musste in Ober-Hilbersheim auf dem Hof von Tante Hanna bleiben. Meine Kusinen und Gerhard waren irgendwo unterwegs. Tante Hanna sollte auf mich aufpassen. Denn ich durfte nicht laufen. Die fünf Kilometer, die ich sonst mühelos bewältigte, waren an diesem Tag zu viel: Ich hatte ein Furunkel in der Nähe der linken Leiste. Es war in den letzten Tagen immer größer geworden und ganz dick mit Eiter gefüllt, kurz vor dem Aufplatzen. Ich sollte mich schonen, nur liegen. Das Furunkel sollte ausreifen. Ich versuchte, Mama zu überzeugen, dass ich nicht alleine bleiben wollte, auch nicht bei Tante Hanna. Aber es ging nicht. Mama tröstete mich, sie würde sich sehr beeilen und mir ganz viele Brombeeren mitbringen. Ich war ein braves Mädchen und fügte mich endlich. Ich blieb allein zurück und dachte an die Brombeeren, während ich mich im Innenhof auf einer Liege im Sonnenschein wärmte. Die Hühner stolzierten friedlich gackernd um mich herum. Tante Hanna war irgendwo im Haus und hatte zu tun. Ich traute mich nicht aufzustehen oder mich zu rühren. Und dann geschah das, was ich doch hatte vermeiden sollen: Das Furunkel brach auf! Ich richtete mich auf: Der Eiter floss heraus. Es sah eklig aus und verschmutzte meine Hose. Ich rief nach Tante Hanna. Tante Hanna kam nicht! Ich rief wieder und wieder, wagte nicht aufzustehen. Ich wusste mir nicht zu helfen, hatte das Gefühl, Tante Hanna wäre es egal, wenn ich mich quälte, ich war ja nicht Gisela. Oder wollte sie mich zappeln lassen und dafür bestrafen, dass Mama mich ihr zum Versorgen da gelassen hatte, wo sie doch so viel zu tun hatte? Nach einer Ewigkeit, wie mir schien, kam sie dann doch. Aber da war auch schon Mama wieder zurück.
Die Brombeeren, die sie mir entgegenstreckte, beachtete ich gar nicht. Nur meine Mutter, die endlich wieder da war und mich erlöste.
Es war ein großes Furunkel gewesen. Es hinterließ eine Narbe, die bis heute sichtbar ist. Seither erinnert sie mich daran, dass jeder Zeit etwas Unvorhersehbares geschehen mag, das ich nicht verstehen oder beeinflussen kann. Für das es keinen wirklichen Trost gibt. Diese Narbe, dieses Gefühl des Verlassen Seins und der Ohnmacht, brach viele Jahre später wieder auf.
- Licht und Schatten - Beides gehört eng zusammen in meiner ersten Erinnerung. Der strahlende Sonnenschein und das Gefühl des Verlassen Seins.
Schulstraße
Schulstraße in Bremen-Aumund. Dort war unser Zuhause von 1945 - 1954, einquartiert im Einfamilienhaus von Vater und Tochter Schlumbohm, der unverheirateten, kinderlosen Volksschullehrerin. Die Kinder in der Schule reichten ihr, als Mann hatte sie ihren betagten Vater, um den sie sich kümmern musste. Sie mochte mich nicht und meine Eltern ebenso wenig. Sie hatte uns nicht eingeladen, bei ihr zu wohnen. Uns war der erste Stock - möbliert - zugewiesen worden: Wohnzimmer, Schlafzimmer und eine schmale Kammer mit Dachschräge als Küche und Waschzimmer. Bad konnte man das nicht nennen.
Mein Lieblingszimmer war das Wohnzimmer. Es schien mir groß mit zwei Fenstern, von denen man die schmale Anliegerstraße mit Kopfsteinpflaster, die hohen Bäume und die gegenüberliegenden Häuser betrachten konnte. An der linken Wand stand ein zweisitziges Sofa, altrosa Samt mit geschwungenen, schwarz lackierten Armlehnen. Sie fühlten sich kühl und glatt an und glänzten. Dazu passte der schwere, massive Büffetschrank an der gegenüberliegenden Wand: gedrechselte schwarze Säulen an den Seiten und auf der Türoberfläche kunstvoll geschnitzte Ornamente. Diesen Schrank durfte ich immer putzen, den Staub aus jeder Nische holen, die Wölbungen der Säulen polieren. Danach war ich stolz: der Schrank war wunderschön und glänzte. Es war „mein“ Schrank. Mein Lieblingsplatz war die Höhle unter dem ovalen Esstisch, der ebenfalls schwarz lackiert war und ein schweres Standbein in der Mitte hatte, das sich unten in vier gedrechselte schräg stehende Füße verzweigte. Wenn man die große Häkeldecke von Frau Schlumbohm, deren Ecken bis auf den Boden reichten, etwas nach vorne zog und den Tisch weiter an das Sofa rückte - da musste meine Mutter helfen -, hing die Decke vorne mit der ganzen Seitenkante auf den Boden und der Rücken der Höhle war durch das Sofa geschützt. Dies war die Welt, in der ich mit Marina, meiner besten Freundin, und unseren Puppen herrschte.
Der zweitschönste Ort war das Doppelbett meiner Eltern am Sonntag. Morgens, wenn Mama schon in der Küche war und Papa mir Geschichten erzählte, immer wieder andere, selbst ausgedachte. Oder wenn ich ihm meine Stärke zeigen durfte: würde ich es schaffen die Finger seiner geballten Faust aufzubrechen? Ich hatte damals wohl enorme Kräfte!. Papa strahlte, wenn ich seine Hand bezwungen hatte, und ich wegen seiner Bewunderung!
Auf der ganzen Etage gab es nur eine Möglichkeit zu heizen: der gusseiserne Brikettofen im Wohnzimmer. Im Winter kniete meine Mutter jeden Morgen davor, blies hinein, um das Feuer wieder zu entfachen und legte dann Briketts nach. Die wurden aus dem Keller geholt. Es gab kein fließendes Wasser für uns, unser Wasser kam von draußen, von einer öffentlichen Pumpe 200 Meter vom Haus entfernt. Meine Mutter holte mit zwei Eimern alles Trink- und Waschwasser für uns drei von dort und trug es die Treppen hoch. Das ist wohl der Grund, warum ich Einzelkind geblieben bin: Meine Mutter hatte in der Zeit zwei Fehlgeburten, wie sie mir später einmal erzählte, als ich sie auf meinen Geschwisterwunsch ansprach.
Von der Küche erinnere ich nur wenig: ein paar Bretter auf denen zwei elektrische Kochplatten standen, die Eimer und die ovale Zinkwaschwanne. Einmal in der Woche machte meine Mutter heißes Wasser für mich und füllte die Wanne halb voll. Es roch nach Seifenwasser und Besonderheit. Ich bewegte mich ganz vorsichtig, damit der Boden nicht nass würde. Danach begann die neue Woche.
Auf der Etage gab es noch eine Kammer, aber die hatte Frau Schlumbohm für sich als Abstellkammer behalten. Erst später, als ich in die Schule kam, musste sie auch die an uns abtreten: Sie wurde mein Kinderzimmer. Es war klein und ungemütlich mit dem großen einsamen Bett nur für mich ganz allein. Eigentlich hielt ich mich dort nur zum Schlafen auf.
Es gab auch eine Toilette. Wenn das Töpfchen nicht benutzt werden sollte für das anstehende große Geschäft, mussten wir die Treppe hinunter, zum schmalen Wohnungseingang an der Seite des Hauses hinaus und nach hinten um die Ecke. Dort war das Plumpsklo.
Bis dahin durfte ich alleine gehen. Weiter in den Garten durfte ich nur zusammen mit meiner Mutter. So war der Gang zum Komposthaufen, auf den ich Mama begleiten durfte, für mich ein Ereignis: der knirschende Kiesweg, eingesäumt von harten, grauen Kantsteinen, die mir bedeuteten, sie nicht zu übertreten, der scheue Blick auf die Pflanzen links und rechts vom Weg, wo Frau Schlumbohm etwas Gemüse und Blumen angebaut hatte. Einmal durfte ich auch hinter die andere Seite des Hauses schauen. Wir waren sicher, dass Frau Schlumbohm und ihr Vater nicht zu Hause waren. Trotzdem hielt Mama sicherheitshalber Wache in der Nähe der Toilette, wo sie den Zugang zur Straße im Blick hatte. Auf dieser vom Hauseingang abgewandten Seite wuchs ein Fliederbusch. Ein süßer Duft, summende Bienen, Wärme von der Sonne. Ein Ort voller Frieden und Leuchten. Er kam mir vor wie das verborgene Herz des Hauses, ein verwunschener Ort. Ich kann mich nur an das eine Mal erinnern, dort gewesen zu sein.
Vom Wohnzimmer aus konnte ich auf die Reihenhaussiedlung mit Etagenwohnungen gegenüber schauen. Im Eckhaus uns direkt gegenüber wohnte Martin im ersten Stock. Er war ein Jahr jünger als ich. Aber er hatte mir etwas voraus: sein Vater arbeitete in der Vulkanwerft und sie waren reguläre Mieter in einer Wohnung, die der Werft gehörte - nicht einquartiert wie wir.
Etwa hundert Meter weiter rechts die Straße hinunter kamen die besseren Häuser von der Vulkanwerft, direkt vor den großen Toreinfahrten. Es waren Doppelhaus-Hälften, die von den höheren Angestellten gemietet werden konnten. In einer davon wohnte meine Klassenkameradin Ursel, in einer anderen Annemarie. In jedem dieser Häuser lebte nur eine Familie, ein für mich unglaublicher, beneidenswerter Luxus. Die breiten Hauseingänge schauten auf eine große Grünfläche, deren Rasen mir zu gepflegt zum Spielen erschien. Wir waren eigentlich ein Trio in der Schule. Doch hatte ich immer das Gefühl, dass sie aus derselben Siedlung stammten und ich woanders her. Und ihr Weg zu uns war viel weiter als der Weg für die beiden zueinander.
Einen kurzen Weg hatte ich zu Marina. Sie wohnte direkt um die Ecke. Einquartiert wie wir, mit einer jüngeren Schwester, Mutter und Oma. Der Vater war nicht aus dem Krieg zurückgekommen. Bei ihnen war es noch enger als bei uns: Der schmale Flur war gleichzeitig Küche und Waschraum. Dann gab es noch ein Wohnzimmer, in dem die Oma und Mutter von Marina schliefen und dahinter eine kleine Kammer ohne Tageslicht als Schlaf- und Spielraum für Marina und ihre kleine Schwester. Es war immer ein bisschen unordentlich, aber gemütlich. Mama meinte, es sei auch schmuddelig. Ich fand es erleichternd, dass man bei Marina nicht alles so genau nahm. Marina war leider nicht in meiner Klasse, sondern in einer darunter. Bei ihr war ich immer willkommen. Wir waren viel zusammen in ihrer Kammer. Dort tuschelten wir über unsere Geheimnisse und machten Modenschau für die Puppen. Dort waren wir geborgen.
Foto Seite →: Cora in der zweiten Reihe, zweite von links
Das Puppenkleidchen
Marina hatte viele kleine Puppen. Ich hatte drei: eine große Käthe Kruse Puppe, eine mittelgroße und eine kleine. Die kleine war genauso groß wie Marinas größte.
Damals kaufte man keine Puppenkleider. Sie wurden von den Müttern für ihre Kinder aus Stoffresten oder abgelegten Kleidern mit der Hand genäht. So jedenfalls machten das Mama und Marinas Oma.
Für meine zwei großen Puppen hatte ich viele Kleider. Aber für meine Kleine hatte ich leider nur zwei verschiedene Garnituren, etwas wenig, um wirklich Modenschau zu machen. Marina hatte für ihre größte Puppe ganz viele Kleidchen. Eines davon war besonders hübsch: zartrosa Seide mit kleinen Puff-Ärmelchen bis kurz über die Schulter. Der Ausschnitt und der Saum waren mit einer schmalen Spitze verziert, knapp ein Zentimeter breit, eigentlich weiß, aber schon ein wenig vergilbt und ganz zart und luftig wie selbst gestickt. Manchmal bekam meine kleine Puppe dieses Kleid ausgeliehen. Sie sah traumhaft darin aus, wie eine kostbare Prinzessin. Wenn ich ihr vorsichtig über das Festkleid strich und sie streichelte, stellte ich mir vor, selbst eine Prinzessin zu sein, in Prachtkleidern und strahlend schön.
Ich kam von Marina nach Hause. Mama sagte: „Warum hast du denn die Hand auf dem Rücken? Was hast du da?“ Ich nahm meine Hand zögernd nach vorne und musste sie öffnen: Das Kleidchen. „Das geht aber nicht! Das musst du sofort zurückgeben!“. Sie zog sich an, nahm mich an der Hand, sodass es kein Entrinnen gab, und ließ mich nicht los, bis wir bei Marina und ihrer Oma ankamen. „Cora will das Kleidchen zurückbringen!“ Weder Marina, noch die Oma hatten den Verlust bislang bemerkt. Ich musste meine Hand ausstrecken und das Kleidchen dahin geben, wo es hin gehörte.
Es war nicht nur der Abschied von dem Kleidchen, der mir wehtat!
Borkum
Dass ich überlebte, verdanke ich dem Zufall. Meine Mutter irrte mit ihrer knapp zweijährigen kleinen Tochter, mir, auf den Straßen von Hude umher auf der Suche nach einem Arzt, der mich, hoch fiebernd, hustend und apathisch, behandeln würde. In der Flüchtlingsunterkunft hatte man ihr niemanden nennen können. Sie trug mich auf dem Arm, zum Laufen war ich zu schlapp. Ich war schwer.
Sie kam an einer Kaserne der britischen Besatzungsmacht vorbei. Sie fragte den Soldaten an der Wache, ob er einen Arzt wüsste. Er sah mein rotes Gesichtchen, hörte mein quälendes Husten und erkannte, dass meine Mutter nicht mehr lange durchhalten würde mit der schweren Last in den Armen. Er ließ sie durch und schickte sie ins Lazarett. Es war die erste Lungen-Entzündung, die ich hatte. Sie war lebensbedrohlich. Man behielt mich dort und pflegte mich bis ich auskuriert war und wieder zu meiner Mama in die Flüchtlingsunterkunft zurückkonnte. Danach kam die Lungenentzündung mindestens einmal im Jahr wieder, jedes Mal sehr schwer. Das änderte sich erst, als Anfang der 50er Jahre Penicillin auch in Deutschland allmählich zugänglich wurde und ich damit behandelt werden konnte.
Bis zu dem Zeitpunkt waren es jedoch nach der Erzählung meiner Mutter zehn Jahre, in denen sie und mein Vater jedes Mal um mich bangten und sich fragten, was sie zur Stabilisierung meiner Gesundheit tun könnten. Luftveränderung, meinten die Ärzte. Entweder die raue Nordseeluft zum Abhärten oder die klare Bergluft der Alpen war die Empfehlung. Die Nordsee war näher von Bremen-Aumund aus. Es war kurz vor meinem fünften Geburtstag, als das Gesundheitsamt eine vierwöchige Kur für mich in einem Kinderheim in Borkum genehmigte. In der kalten Jahreszeit November/Dezember sollte das besonders gut sein für die Bronchien und die Lunge. Fünfzig Kinder wurden von ihren Eltern getrennt, in einem Bus in Bremen eingesammelt, ans Meer gefahren, auf einen Dampfer gesetzt und dann in das Kinderheim gebracht. Ich erinnere mich nicht an die Fahrt, nur an die vielen fremden Kinder, das Fehlen meiner Mama und das erste Abendessen in dem riesigen Speisesaal. Wir saßen eng nebeneinander auf den Holzbänken, wie Hühner nebeneinander gepfercht, sollten uns benehmen und essen. Wie ging das? Die Nonnen waren streng, laut sprechen war untersagt, keines der Kinder hatte Lust dazu. Ich wollte nach Hause. Das Essen schmeckte auch nach vielen Tagen noch nicht. Vielleicht lag es auch an der Läusehaube, die ich nach einer Woche tragen musste. Nicht nur ich, alle Kinder. Irgendjemand hatte Läuse mitgebracht. Ich wusste, dass ich vorher keine gehabt hatte. Die Haube bedeckte meinen ganzen Kopf, alle Haare wurden darunter verstaut, nachdem sie mit einer dicken weißen Paste eingeschmiert worden waren. Wir durften die Maske nicht abnehmen, sie musste Tag und Nacht auf dem Kopf bleiben, auch beim Schlafen. Nicht einmal zum Kratzen war das Abnehmen erlaubt. Es juckte fürchterlich. Ich beobachtete die anderen Kinder, wie sie heimlich im Waschraum die Haube abnahmen, sich heftig kratzten und dann schnell das dicke Ding wieder aufstülpten, wenn sie eine Nonne kommen hörten. Ich tat das nie, ich wollte brav sein und keinen Ärger machen.
Nach zwei Wochen musste die Haube wieder ab und die Paste ausgewaschen werden. Jetzt machte ich Ärger, auf jeden Fall einen Höllenlärm, es war nicht zu verhindern. Ich schrie wie am Spieß, als die Nonne versuchte die Haube zu lösen. Meine Kopfhaut war daran festgeklebt und ging mit ab. Das Bravsein hatte sich für mich nicht gelohnt. Ich weinte noch Stunden lang.
Bald wäre es vorbei, nur noch ein paar Tage, dann dürfte ich wieder nach Hause - ein schwacher Versuch mich zu trösten. Das Essen schmeckte immer weniger. Ich wurde krank und isoliert von den anderen Kindern. Jetzt war ich ganz allein in einem Zimmer und wollte gar nichts mehr essen. Aber das ging nicht. „Das Kind muss wenigstens ein paar Bissen zu sich nehmen! Jetzt iss doch etwas!“ Ich tat es - und übergab mich. Ein dickes Kopfkissen im Rücken, damit ich mich etwas aufrichten konnte. Weißes Leintuch und Bettbezug. Aber vor mir direkt vor meinem Gesicht graugrüner, brockiger Brei. Er besudelte das grelle Weiß der Bettdecke. Ich konnte nichts tun. Es war so eklig und ich so hilflos.
Eine Nonne kam. Ihre weiße Haube ließ das lange knochige Gesicht noch strenger wirken. Sie hieß Elisabeth und hatte noch nie gelächelt. Doch jetzt wurde ihr Gesicht richtig finster. Ein Blick reichte. „Du hast ja noch nicht einmal das Bisschen auf deinem Teller gegessen. Und dann hast du auch noch alles ausgespuckt! Du isst das jetzt auf der Stelle auf, was da auf der Bettdecke ist. Ich will das nicht mehr sehen.“ Sie blieb neben mir stehen. Drohend wartete sie auf den Vollzug ihres Befehls. Ich fing an damit. Wie es weiter ging, weiß ich nicht mehr. Ob ich alles wieder aufaß, ob die Nonne doch noch Erbarmen zeigte oder ob mein Kopf vor Ermattung wegkippte und mich mit Vergessen einhüllte, ist mir entfallen. Ich weiß nur, dass ich tatsächlich meinen Löffel in die Hand nahm und zumindest einen Mund voll wieder in mich hineinzwang.
Jetzt waren es nur noch zwei Tage bis zur Heimreise. Ich überstand sie irgendwie, ohne weitere Erinnerung. Sie setzt erst wieder ein in Bremen.
Der Bus entlud die fünfzig Kinder. Da standen meine Eltern, aufgeregt, nahmen mich in den Arm und drückten mich. „Hast du dich gut erholt? Du hast doch sicher ganz viel erlebt. Mit all den Kindern muss es doch richtig schön gewesen sein! Und die gute Luft!“ Ich konnte nur kuscheln und kaum etwas sagen. „Jetzt gehen wir auf den Freimarkt, den Bremer Weihnachtsmarkt, wenn wir schon einmal hier sind. So viele bunte Lichter hast du noch nie gesehen. Und ganz viele Karussells. Du kannst dir aussuchen, in welchem du fahren möchtest.“ Langsam fiel ihnen auf, dass ich mich nicht zu freuen schien, dass ich nicht redete. Dass ich einen roten Kopf hatte und meine Stirn ganz heiß war. „Es macht dir ja gar keinen Spaß! Was ist denn los?“, fragte meine Mama. „Ich will nach Hause!“, war alles, was ich sagen konnte.
Am nächsten Morgen diagnostizierte der herbeigerufene Arzt eine schwere Lungenentzündung.
Die rote Schleife
Musste das sein? Eine sechs Zentimeter breite, rote Taftschleife, die meinen etwa fünfundzwanzig Zentimeter langen Pferdeschwanz zusammen hielt? Meine Haare waren voll und locker, mittel- bis goldbraun. Und zu feierlichen Anlässen - wie dem Termin in einem Foto-Atelier - hatte meine Mutter sie mir vorher mit einigen dicken Lockenwicklern für eine halbe Stunde eingerollt, damit sie lockig fielen. Meine Haare und meinen Pferdeschwanz mochte ich - kräftig und pflegeleicht, was sie auch mein ganzes weiteres Leben blieben, durch alle verschiedenen Haarschnitte hindurch.
Nur einmal hatte meine Mutter den Versuch mit Dauerwelle gewagt - damit die dicken Lockenwickler entfallen könnten. Der Versuch war misslungen: Anstatt einer leichten, lockeren Welle hatte die zu stark dosierte Dauerwelle meine dicken Haare in eine unförmige Krause verwandelt, die wie die später beliebten Afro-Mähnen ungebändigt von meinem Kopf abstand. Afro war damals noch nicht in Mode und so wurde die Mähne mit einem dünnen Haarreif aus Horn mühsam zusammen gehalten und bei nächster Gelegenheit in eine Kurzhaarfrisur verwandelt.
Das nette Fotografenfoto von mir, etwa sieben Jahre alt, mit meiner Mutter, für das mein Vater noch lange Zeit nach ihrem Tode einen Ehrenplatz bewahrte, ist vor der Dauerwelle entstanden, als der Pferdeschwanz noch voll und natürlich war. Aber natürlich fühlte ich mich nicht. Da war nämlich die Taftschleife. Und das brave karierte Kleid mit dem weißen Bubikragen, das auf dem Porträt-Foto deutlich zu sehen ist. Das glatte, kindliche Gesicht einer Siebenjährigen, wohl gerundet, freie Stirn. Das schmelzende, liebliche Lächeln einer behütet erzogenen Tochter. Sie weiß, was man von ihr erwartet, wie sie wohlgeraten wirkt. Sie lächelt auch für ihre Mutter, für die die Taftschleife dazugehört. Auch der Gehorsam gehörte dazu.
Es schaudert mich noch heute, wenn ich an die aufdringliche Breite der leuchtend roten glänzenden Schleife in meinem schönen schlicht glatten Haar denke.
Die Vulkan-Werft
1948 im Spätsommer in Bremen-Aumund. Ich sehnte meinen fünften Geburtstag herbei. Vielleicht würde ich dann endlich mehr erleben und mehr Freunde haben.
„Du kannst ruhig mal mitkommen auf den Vulkan-Berg, wir sind ja nicht so.“ Zum ersten Mal war ich mit ein paar Kindern aus der Nachbarschaft unterwegs, mit denen ich sonst noch nicht gespielt hatte, lauter Vulkan- Kinder, die gegenüber wohnten. Auf den Vulkan-Berg gehen hatte meine Mutter mir erlaubt.
Der Vulkan-Berg war ein Hügel hinter den Schrebergärten der Werksangehörigen, der auf der anderen Seite direkt an die Weser grenzte. Flach und unwirtlich, kaum bewachsen, nur ein paar spärliche Gräser. Aber dafür viele Kuhlen, Kuhlen in denen man sich verstecken konnte. Und zum Verstecken spielen waren wir hier her gekommen. Aber dann war etwas anderes daraus geworden. Die drei Jungen hatten die tiefste und größte Kuhle ausgesucht und mich und das andere Mädchen mit hineingezogen. Wir hockten ganz unten zwischen ein paar vereinzelten Steinen. Es war geheimnisvoll, keiner sollte uns sehen, und keiner konnte es von oben aus der Ferne, denn wir hatten uns ganz tief geduckt. Es kam ohnehin kaum jemand auf diesen Hügel, der mir eigenartig und zu nichts nutze schien. Und dann begann ein ganz besonderes Spiel, eines, das ich noch nicht kannte. Ein Junge öffnete seine Hose und holte etwas heraus, was ich auch noch nie richtig gesehen hatte, höchstens mal aus der Ferne. Jetzt war es ganz nah und konnte betrachtet werden. Was machen die da? Warum nehmen die dieses dünne Stöckchen? Das tut doch weh, wenn man damit piekst! Anfassen durfte man nicht, nur mit dem Stöckchen berühren, ob sich etwas veränderte. „So wie es der Doktor macht“, sagte einer. Ich wollte gar nicht hinsehen, das war doch irgendwie nicht richtig. Dann war das Nachbarmädchen an der Reihe. „Zieh mal dein Höschen runter, mal sehen wie du aussiehst!“ Ich zuckte zusammen - sie tat es wirklich. Ich spürte förmlich wie es schmerzen würde, wenn ich dran käme. Aber die Wissbegier meiner vier Begleiter war ganz sachlich, es war egal, ob es weh tat oder nicht. Tatsächlich: Mädchen sahen ganz anders aus als Jungen. „Ich muss nach Hause“ - ich war an der Reihe. Ich sprang auf und rannte davon, hörte noch, wie sie „Feigling“ und „Heulsuse“ hinter mir herriefen.
„Mit denen will ich nicht mehr spielen“, verkündete ich meiner Mama. Sie meinte verständnisvoll, dass da ja noch viele andere Kinder seien, die meisten von den Leuten der Vulkan-Werft. Mein Papa arbeitete nicht dort. Ich konnte nie entscheiden, ob das gut oder schlecht war: Er war ja wohl ganz zufrieden, dass er jeden Morgen mit dem Bus eine dreiviertel Stunde in das mir unendlich weit entfernt scheinende Ingenieur-Büro Agatz in Bremen-Farge fahren musste, mit dem er Ende des Krieges von Berlin hierher umgezogen war. Er saß da an einem Schreibtisch mit großen Plänen vor sich, dachte viel nach und änderte dann etwas in den Plänen. Er schien stolz darauf, aber mir wäre lieber gewesen, er hätte auch in der Vulkan-Werft gearbeitet. Dann hätte ich dort dazu gehört, hätte vielleicht auch gegenüber in einer Werkswohnung gewohnt und nicht auf dieser Seite der Straße, wo Flüchtlinge oder Vertriebene wie wir einquartiert waren.
Mir blieben die Flüchtlingskinder und andere Vulkan- Kinder. Ich verlegte mich auf Streifzüge mit ihnen in den großen verwilderten Garten direkt vor dem Haupteingang der Werft. Er war mit einem hohen Zaun umgeben, aber das Eingangstor war halb heruntergerissen und wir konnten hineinschlüpfen. Hier war das Gras so hoch, das man sich auch verstecken konnte. Es war viel schöner als auf dem Berg, verwunschener mit den vielen wilden Blumen, den weißen Margeriten und den lila rankenden Wicken. Hier fühlte es sich nach Unbekanntem und Abenteuer an. Ich liebte es, mir dort den Weg durch die Pflanzen zu bahnen und Neues zu entdecken, obwohl es gefährlich sein sollte. Das hatte mir meine Mutter eingeschärft: „Geh nie dort hin. Wer weiß, was dir da passieren kann.“ Deshalb der Zaun und das Schild „Betreten verboten“. Ich hielt mich nicht daran. Es ging immer gut und ich erzählte ihr nie etwas davon. Diese “Gefahr“ war mir lieber als die auf dem Berg.
Dann waren da noch die Kinder, mit denen ich zusammen zu dem großen Ereignis ging, wenn sich die Werkstore öffneten und Zuschauer eingelassen wurden. Wir liefen über die Gleise zwischen den Werkshallen hindurch, mussten immer aufpassen, wo wir hintraten. Es lag so viel herum. Endlich standen wir dann vor dem Bug eines riesigen Schiffes. Er schien schier unendlich in die Höhe zu ragen. Nachher, wenn die Seile gekappt waren, der Dampfer ganz langsam ins Wasser geglitten war und dann auf der Weser mit dem Schlepper davongezogen wurde, wirkte er plötzlich ganz klein. Ich spürte den Stolz der Menschen: „Dieses Schiff ist hier entstanden, in unserem Ort. Dabei haben wir mitgearbeitet. Wir können uns in der Welt sehen lassen.“ Es waren wunderbare Ereignisse. Besonders, weil da immer ein kleines Mädchen war, jedes Mal ein anderes, das aller Augen auf sich zog. Die Tribüne, zwei bis dreimal so hoch wie die umgebende Menschenmenge, war direkt vor dem Bug des Schiffes aufgebaut. Dort standen die wichtigen Leute, vielleicht zehn an der Zahl, Bürgermeister und Ähnliches. Reden wurden gehalten. Und dann wurde das kleine Mädchen in seinem Kleidchen mit dem dicken Petticoat von seinem Papa hoch in die Luft gehoben - mein Nacken wurde ganz steif beim Zuschauen. Er nahm die an einem Seil befestigte Sektflasche dem Nebenstehenden ab, drückte sie seinem Töchterchen in die Hand und sagte „Jetzt wirf ganz kräftig mit Schwung!“ Es klappte, die Sektflasche zerschellte am Bug, und das Schiff war getauft. Das hätte ich auch gerne einmal gemacht. Aber dazu hätte mein Papa Werksangehöriger sein müssen.
Taufe des Fischdampfers „Berlin“ durch den stellvertretenden Oberbürgermeister Berlins Dr. Ferdinand Friedensburg im Jahre 1949 (Wikipedia)
Zu Hause wollte ich wissen „Wo fährt das Schiff jetzt hin?“ Mein Vater erklärte es mir: „Es wird von den Schleppern nach Bremerhaven geschleppt. Dort wird geprüft, ob es auch allein navigieren kann und dann wird es beladen mit Frachtgut aus Deutschland, manchmal Autos, manchmal Maschinen, vielleicht auch Wein oder andere Sachen, die es in Amerika, Afrika oder Asien nicht gibt. Die fährt es dann über das Meer, lädt sie dort im Hafen aus und lädt dafür Dinge ein, die wir hier in Deutschland haben wollen.“ Das klang sooo aufregend. „Da möchte ich auch gerne mal mitfahren.“ Mein Vater konnte das gut verstehen: „Ja, ich am liebsten auch. Im Augenblick geht das aber nicht. Da sind Fracht- und Passagierschifffahrt noch voneinander getrennt. Doch ich habe gehört, dass sie dabei sind Schiffe zu entwerfen, die Fracht befördern und gleichzeitig auch einige Passagiere mitnehmen. Vielleicht können wir das in ein paar Jahren mal machen.“