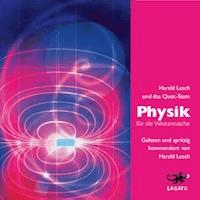Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Patmos Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Was versetzt einen Biologen und einen Astrophysiker gleichermaßen in Staunen? In diesem Fall ist es eine unscheinbare blaue Blume. Von der Faszination durch die Traubenhyazinthe ausgelöst, machen sich die beiden die Gründe für ihr Staunen bewusst – und kommen dabei aus dem Staunen nicht mehr heraus. Mit Witz und Augen fürs Detail erklären die Wissenschaftler die Entwicklung vom Urknall über die kleine Blume bis zum komplexen Gehirn im eindrucksvollen Schnelldurchlauf. Dabei rufen sie sich und uns das Erstaunliche der evolutionären Prozesse ins Bewusstsein und feiern ganz nebenbei das Wunder des Lebens. Ein faszinierendes Buch über das Staunen, das zum Mitstaunen anregt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 219
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
NAVIGATION
Buch lesen
Cover
Haupttitel
Inhalt
Über die Autoren
Über das Buch
Impressum
Hinweise des Verlags
Leseempfehlung
HAUPTTITEL
Harald Lesch / Christian Kummer
Wie das Staunen ins Universum kam
Ein Physiker und ein Biologe über kleine Blumen und große Sterne
Patmos Verlag
Inhalt
Das Staunen ist der Anfang von allem
Was an »Baurabüeble« so besonders ist
Das Staunen eines Biologen
Blaues Wunder Traubenhyazinthe
Die geheime Hochzeit der Pflanzen
Austesten des Möglichen – der weite Weg aufs Land
Evolutionsstrategien
Flaschenkork und Schwärmerzellen– das Bauprinzip Zelle
Am Tellerrand der Biogenese
Blicke über den biologischen Tellerrand hinaus
Cantico Cosmico
Das Staunen eines Physikers
Das Universum ist groß und leer
Der Tag ohne gestern – der Anfang des Universums
Was die Welt im Innersten zusammenhält
Die langweiligsten 400.000 Jahre im Universum
Strahlung und Materie trennen sich – die Gravitation regiert
Die Materie organisiert sich
Sterne und Kerne – die kosmische Elementeküche
Mensch und All
Das Leben eines Sterns
Das Gleichgewicht der Kräfte
Von Explosionen, Sternleichen und dem großen Kreislauf der Elemente
Von den Gesetzen der Natur – wie im Himmel, so auf Erden
Von Gasriesen und Felsbrocken – aus einer Scheibe werden Planeten
So was gibt es doch gar nicht – 4,5 Milliarden Jahre Stabilität
Immer sind es die kleinen Abweichungen – der nicht ganz perfekte Kosmos
Der blaue Diamant
Wasser – der Stoff, der vom Himmel fiel
Vom globalen Regen, den Meeren, der Atmosphäre und der Venus
Von schwimmenden Platten
Vom Schneeball Erde und seinem Auftauen
Von der Entstehung des Lebens auf der Erde
Das Wunderbare, worüber wir staunen, ist nicht das unverstanden Geheimnisvolle, sondern gerade das Erkannte und Verstandene
BUCH LESEN
Das Staunen ist der Anfang von allem
Statt einer Einleitung
Zwei gestandene Wissenschaftler, ein Biologe und ein Astrophysiker, staunen. Sie staunen über eine kleine blaue Traubenhyazinthe. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Es gäbe da noch ganz andere Gewächse, die des Bestaunens mehr als nur würdig wären. Oder wie wäre es mit dem Sternenhimmel über uns, verlangte der nicht nach Bestaunung? Und überhaupt, wieso staunen diese beiden Wissenschaftler überhaupt? Vielleicht, weil sie ihr jeweiliges Interesse an der Naturwissenschaft mit philosophischer Reflexion und Lehrtätigkeit begleiten. Der kontroversen Natur der Philosophie (worüber ist man sich eigentlich einig in der Philosophie?) entstammt nämlich auch ihre Zügellosigkeit. Philosophie darf, ja muss alles infrage stellen dürfen, sie setzt sich keine Grenzen. Es ist ihre eigentliche Aufgabe, nach den Hintergründen zu fragen. So steht dann sogar das Staunen, das nach Aristoteles am Anfang jeder philosophischen Betrachtung steht, unter dem Brennglas einer philosophischen Analyse: Warum staunen wir, was ist Staunen überhaupt und was sind die Bedingungen des Staunens? Da staunen Sie?
Am 18. Februar 1829 schrieb Goethe an Eckermann: »Das Höchste, wozu der Mensch gelangen kann, ist das Erstaunen; und wenn ihn das Urphänomen in Erstaunen versetzt, so sei er zufrieden; ein Höheres kann es ihm nicht gewähren und ein Weiteres soll er nicht dahinter suchen; hier ist die Grenze.«
Das vorliegende Buch ist nicht der Versuch, dem Geheimen Rat aus Weimar zu widersprechen, aber wenigstens die Grenze etwas hinauszuschieben. Die kleine blaue Traubenhyazinthe hat ihm wahrscheinlich ebenfalls gefallen, vielleicht hat er sie gemalt oder sogar ein kleines Gedicht für und über sie geschrieben und dann? Goethe ist offensichtlich nicht auf den Gedanken gekommen, sie derart zu zerpflücken, wie wir das in unserem Buch tun; das Staunen über ihre Existenz war ihm wahrscheinlich genug. Wir aber wollen nicht nur staunen, wir wollen wissen, warum wir staunen. Unsere Erkenntnisse auf diesem Weg haben wir auf zwei verschiedene Arten beschrieben: biologisch und physikalisch.
Zwei Punkte scheinen uns wichtig zu sein.
Erstens: Man staunt nicht grundlos.
Zweitens: Staunen ist dem Menschen so eigen wie Glauben und Wissen.
Was kann ich wissen? Immanuel Kant stellt diese Frage an den Anfang seiner Philosophie. Er stellt kurz und nüchtern fest, dass sich Wissen auf eigene, unausweichliche Einsicht gründet. Dies steht im Gegensatz zum Glauben, dem »Für-wahr-Halten« aufgrund der Mitteilung einer Autorität, der man vertraut. Und Wissen besteht im echten Sinne nicht nur in der Feststellung von irgendetwas, sondern im Erkennen eines tatsächlichen Sachverhalts aus seinen Gründen. Damit ist Wissen auf Vorgegebenes gerichtet. Es bekommt seine Einstellung zum Vergangenen, das schon bereit ist, während Glauben mehr auf das Kommende schaut. Vom Vergangenen kann man im geschichtlichen Sinne wissen, vom Zukünftigen gibt es kein echtes Wissen in diesem Sinn. Kant geht von Bereichen aus, bei denen nach seiner Einschätzung jeder Erfahrung vorangehendes Wissen besteht, Kant nennt das Wissen apriori. Wissen also, das man nicht erst durch Erfahrung erwirbt. Das ganze große Feld der Erkenntnis aus Gründen des wissenschaftlichen Wissens aber gründet sich auf Erfahrung. Alle Naturwissenschaft ist darauf gebaut. Dem um Wissen bemühten Menschen bietet sich die gesamte Natur als Anschauungsmaterial an. Alles, was direkt oder durch Mittel wie Mikroskope, Fernrohre, Beschleuniger etc. den Sinnen zugänglich ist. Hier sind wir im Raum der Erfahrung dessen, was wir nachprüfen können, was sich allen Menschen auferlegt und was Voraussagen, Vorausberechnungen, also auch Blicke in die Zukunft in beträchtlichem Umfang gestattet.
Für Kant hat die Natur ihre eigene Weise, sie ist unauslotbar tief und groß und reich gegliedert. Es ist nicht vorstellbar, dass der Mensch in seiner Erforschung der Natur je zum Abschluss kommen könnte. Naturwissenschaft ist echtes Wissen über die Naturdinge, aber es ist unvollständiges Wissen über die Natur und wird immer unvollständig bleiben. Die Fülle alles dessen, was in einer Naturgegebenheit und in einem Naturgegenstand beisammen ist, kann der Mensch nie ausschöpfen. Ob Zelle oder Elementarteilchen, ob Stern oder Galaxie, die Natur ist immer noch reicher; aber der einzelne Zug aus der Fülle der Zusammenhänge und Phänomene, der vom Forscher im Experiment isoliert gefragt wird, den gibt die Wissenschaft in Treue wieder. Und so wissen wir denn im echten Sinne vieles von der Natur und erfahren immer mehr.
Aber wir erfahren nicht alles, vielleicht staunen wir deshalb, weil wir etwas verstanden haben, was wir aber nicht in Sprache verwandeln können. Staunen wir, weil wir nicht mehr nur glauben wollen, aber doch wissen, dass wir nicht alles wissen können? Komme ich aus dem Staunen nicht mehr heraus, weil es gar nicht anders geht?
Staunen ist eine Sache für sich, es ist nicht rational, es hat auch nichts Fokussierendes. Etwas zu bestaunen heißt, es nicht zu reduzieren, sondern ganz aufzunehmen, es ist eine im besten Sinne des Wortes ganz menschliche Urerfahrung. Staunen ist ein tiefes Gefühl der Überraschung, des Respekts und eben auch der Ehrfurcht vor dem Bestaunten. Vom Staunen ist man ganz ergriffen; es ist allen Menschen eigen, ob alt oder jung, Expertin oder Laie. Staunen ist auch ein Erlebnis von Grenze, anders ausgedrückt: Etwas entzieht sich unserer unmittelbaren Erkenntnis. Staunen erinnert an unsere Grenzen in Raum und Zeit, an die Grenzen unserer Möglichkeiten, an die Grenzen des Geistes. Und genau deshalb ist Staunen von grundlegender Bedeutung für die Wissenschaft, es ist manchmal der erste Fußabdruck des menschlichen Erkenntnisdrangs auf bis dahin noch völlig unbekanntem Terrain. Staunen ist ein erster Schritt, sich mit der Welt auseinanderzusetzen. Aristoteles beginnt seine Metaphysik mit dem Satz: »Denn Staunen veranlasste zuerst wie noch heute die Menschen zum Philosophieren«, und Thomas von Aquin meint: »Das Staunen ist eine Sehnsucht nach Wissen.« Ein berühmter Aphorismus von Einstein lautet: »Der Fortgang der wissenschaftlichen Entwicklung ist im Endeffekt eine ständige Flucht vor dem Staunen. Das schönste Erlebnis ist die Begegnung mit dem Geheimnisvollen. Sie ist der Ursprung jeder wahren Kunst und Wissenschaft. Wer nie diese Erfahrung gemacht hat, wer keiner Begeisterung fähig ist und nicht starr vor Staunen dastehen kann, ist so gut wie tot: Seine Augen sind geschlossen.«
Staunen gilt seit Platon als wesentliches Merkmal für einen an Erkenntnis und Einsicht interessierten Menschen. Über etwas zu staunen heißt, eine Beobachtung, eine Erzählung, eine Erklärung nicht mehr als selbstverständlich anzunehmen, Skepsis gegenüber der eigenen Sinneswahrnehmung zu hegen, Fragen zu stellen, statt bisher gültige Antworten zu übernehmen, gängige Deutungen zu modifizieren oder auch radikal abzulehnen. Das Staunen ist somit verschwistert mit dem Zweifel. Alte Denkwege erscheinen oft nicht mehr gangbar, die daraus entstehende denkerische Not drängt uns dazu, neue Antworten auf alte und bisweilen auch neue Fragen zu suchen und diese Behauptungen zu begründen.
Man kann also nicht einfach so losstaunen. Es muss schon etwas da sein, was zu kritisieren, zu hinterfragen oder zu verstehen ist. Man kann sich eben auch blöd staunen. Wenn man über alles staunt, dann bleibt nichts mehr. Das Staunen vergeht einem bei andauerndem Staunen, es nutzt sich ab. Hintergründiges Staunen verlangt nach Hintergrund. Unser Hintergrund ist die Wissenschaft. Wir sind Wissenschaftler. Uns interessiert die Vernetzung der Welt, das Ineinandergreifen von ganz verschiedenen Kräften, Feldern und Zusammenhängen, von Galaxien, Sternen, Planeten, Lebewesen, Zellen, bis zu den elementarsten Teilchen. Wir möchten wissen, wie es kommen konnte, dass sich aus einem extremen, sehr heißen, sehr energetischen, fast vollständig gleichmäßigen Anfang eine derart komplizierte und komplexe Welt entwickeln konnte. Wie kam es vom Urknall bis zum Gehirn, das über eine Traubenhyazinthe staunt?
Worüber wir am meisten staunen? Wir staunen über das Glück, die scheinbar grundlose Fröhlichkeit, für die es keine Rechtfertigungspflicht gibt, die nicht erzeugt werden kann. Menschen fühlen sich beim Staunen in ihrer Welt gut aufgehoben. Da muss nichts gemacht werden, es ist schon gemacht – und wie! Ganz schlicht ausgedrückt: Wir sind gemachte Leute, gemacht für eine Welt, die von einem dem Leben gegenüber merkwürdig wohl wollenden naturgesetzlichen Fundament durchzogen ist. Dieses Fundament ist geprägt von eng miteinander vernetzten Prozessketten und Kreisläufen, die andauernd neue Möglichkeiten erzeugen und ausprobieren, aber ohne die Welt gleich aus den Angeln zu heben. Winzige Abweichungen von der Normalität probieren sich aus. Bei Erfolg verstärken sie sich. Aus den kleinen Schwankungen werden Wellen, und es treten ab einer bestimmten Stufe ganz neue Erscheinungen in Erscheinung. Die Natur ist ein Geflecht von »Werden-Können«, aber »Noch-nicht-geworden-Sein«, ein andauernder Möglichkeitsdruck, der Neues erzeugen will, aber nicht um jeden Preis. Revolutionen, die alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen, sind sehr selten in der Natur. Es sind vielmehr die Entwicklungen der »kleinen Schritte« oder der »ruhigen Hand«, die sukzessive, peu à peu die vorhandenen Möglichkeiten an den Bedingungen der Umwelt, zunächst nur an wenigen Lebewesen, ausprobiert. Dabei entscheidet immer der unmittelbare Erfolg, aber der Normalfall ist, dass nichts Neues passiert. Manchmal jedoch geschieht es doch, und etwas ganz Neues taucht auf - es emergiert. Aus dem Vorherigen wäre das jetzt Passierende nie ablesbar gewesen. Nicht durch pure Erhöhung der Zahl, nicht durch die Aneinanderreihung von immer mehr Einzelnen erschaffen sich neue Möglichkeiten, vielmehr ereignet sich etwas qualitativ Neues. Das Paradebeispiel dafür ist die Entstehung des Lebens.
Was an »Baurabüeble« so besonders ist
Prolog im Zimmer
»Also, diese kleinen blauen Hyazinthen in unserem Garten, einfach eine Wucht«, kam neulich mein Freund, der Physiker, in mein Büro.
»Ja, klar, Traubenhyazinthe Múscari botryoídes, ein typischer Frühjahrsblüher«, antwortete ich und dachte in meiner abgebrühten Botaniker-Seele, was denn daran so Besonderes sei. Das ließ ich mir aber nicht anmerken, um den Flug der Begeisterung meines Gegenübers nicht allzu jäh abzubremsen. Sollte er ruhig auch einmal über etwas Lebendiges staunen, statt immer nur über seine Sterne. »Darüber sollten wir unbedingt zusammen was machen«, war der Lohn für meine Zurückhaltung.
»Was machen, womöglich ein Buch?«, zögerte ich weiter, »über so etwas Alltägliches?«
»Ja, genau«, kam die Antwort, »ist doch verrückt, dass das Universum in 15 Milliarden Jahren so etwas zuwege bringt.«
»Aber doch nicht nur das, sondern einen ganzen Haufen anderes Zeug auch noch!«
»Und, was macht das für einen Unterschied? Das ganze Universum braucht es, um so etwas wie die Traubenhyazinthe hervorzubringen, genauso, wie für alles andere Leben auch!«
Da war es auf dem Tisch – das anthropische Prinzip in »traubenhyazinthischer« Version sozusagen. Warum eigentlich nicht? Die Idee war geboren. »Lass uns von beiden Seiten beginnen, wie beim Tunnelbau, bei dem ein Berg von zwei Seiten angebohrt wird. Ich als Biologe beginne mit der Traubenhyazinthe und frage zurück nach den Bedingungen, wie sich Leben auf der Erde entwickeln konnte. Du als Astrophysiker beginnst beim Urknall und fragst danach, wie ein Planet entstehen konnte. Vom Urknall zum bewohnbaren Planeten Erde; von der Ursuppe bis zur Traubenhyazinthe.«
Traubenhyazinthe: Die heimliche Hauptdarstellerin – attraktiv nicht nur für Physiker.
Das Staunen eines Biologen
Blaues Wunder Traubenhyazinthe
Es hilft nichts: Man muss hinaus ins Feld, in die noch braunen Vorfrühlingswiesen der Schwäbischen Alb oder des Fränkischen Jura, um die Traubenhyazinthen an ihrem natürlichen Standort zu sehen. Dann stellt sich die Begeisterung schon ein, das alte Staunen über einen unerwarteten Fund, wie in den längst vergangenen Tagen botanischer Sammelleidenschaft. Da sind sie dann und leuchten frisch und blau zwischen den abgestorbenen, noch vom Schnee niedergedrückten Grashalmen hervor. Nicht so auffallend wie ihre nahen Verwandten, die Blausterne oder Scilla, die gleich ganze Orgien in Blau erzeugen. Traubenhyazinthen sind da eher kleinlaut und stehen verlegen in Grüppchen beisammen. Wie auf frischer (Un-)Tat ertappte »Baurabüeble« halt, wie sie im Volksmund der Schwäbischen Alb bis heute heißen. Das hat seinen Grund sicher in den weißen Kronzipfeln, die die blauen Blütenglocken zieren und mit dieser Farbkombination an die Trachtenkittel erinnern, die ehemals von den männlichen Dorfbewohnern auf der Alb spätestens ab dem Tag ihrer Einschulung getragen wurden.
Wenn man dann – moderne Version der Linné’schen Botanisiertrommel – die Kamera zückt und ein Makrofoto von der zierlichen Schönheit probiert, kann man trotz schmerzender Knie tatsächlich ins Schwärmen kommen. Was sich da Knopf an Knopf an kugeligen Knospen in der oberen Hälfte der Blütenähre aneinanderreiht, entpuppt sich stängelabwärts bei Öffnung der sechs weißen Kronzipfel als richtig bauchiger Krug. Solche Höhlungen üben eine magische Anziehungskraft auf Bienen und besonders Hummeln aus, die, auch wenn sie sich anstrengen müssen, den Kopf durch die Öffnung zu zwängen, darin zu Recht ein höchst erfreuliches Nahrungsangebot vermuten. Man muss schon mit dem Lichteinfall spielen, um die Einzelheiten im Blüteninnern in die Kamera zu bekommen. Sechs schwarzblaue Staubbeutel an hellen Stielen zeigen sich dann; dazu in der Mitte ein fahler Griffel auf einem grünlichen Fruchtknoten, der den von den Besuchern so begehrten Nektar absondert. Nun meldet sich aber der Botaniker wieder zu Wort. Eigentlich ist an diesem Bau der Muscari-Blüte nichts weiter Besonderes, und die Sechs- bzw. Dreizahl ihrer Blütenelemente entspricht voll dem Blütendiagramm der »Einkeimblättrigen«, wie wir es schon in der Schule am Beispiel der Tulpe gelernt haben. Folgt man allerdings der »Traube« nach oben, entdeckt man an der Spitze Blüten, die entweder Knospen bleiben oder auch in geöffnetem Zustand steril sind. Ihr Mangel an inneren Organen wird durch eine Attrappenfunktion wettgemacht: Sie dient dazu, den »Kittel« der »Baurabüeble« größer erscheinen zu lassen, als er eigentlich ist. Ganz im Gegensatz zur Mentalität der Schwaben geschieht das nicht in weiser, von Sparsamkeit geleiteter Voraussicht auf ein noch zu erwartendes Hineinwachsen des Trägers, sondern eindeutig in der verschwenderischen Absicht, mehr zu scheinen, als man ist: Man will die Aufmerksamkeit der Blütenbesucher schon von möglichst weit her auf sich lenken.
Sterile und fruchtbare Blüten, verkümmerte und ausgebildete Organe – da sind wir mit einem Mal bei der Metamorphoselehre des Herrn Geheimrats Johann Wolfgang von Goethe. Er schrieb damals vor seinem Weimarer Gartenhaus, dass der »wahre Proteus« der Pflanzengestalt im Blatt verborgen sei, und wenn das auch für Spross und Wurzel übertrieben ist, so trifft es doch für die Blütenorgane hundertprozentig zu. Alle Teile einer Blüte, die wir einst im Biologieunterricht mühsam als Kelch, Krone, Staubfäden und Griffel auseinanderzupften, sind nichts anderes als abgewandelte Blätter. Dass deren Umwandlung ineinander auch tatsächlich vorkommt, hat Goethe durch eine ganze Sammlung von Übergangsformen und Missbildungen aus seinem Garten belegt. Warum es allerdings überhaupt solche Metamorphosen gibt und sie noch dazu so leicht möglich sind, wissen wir erst durch die Molekulargenetik der letzten zwei oder drei Jahrzehnte. Lediglich drei Steuerungsgene sind es, die das bewirken. Sie beeinflussen durch die Zonen ihrer Aktivität im Vegetationskegel, d.h. der Wachstumsregion eines pflanzlichen Sprosses, das Schicksal der dort entstehenden Blattanlagen. Eines dieser drei Gene, nennen wir es der Einfachheit halber C, wirkt an der Spitze des Vegetationskegels, ein zweites, A, an seiner Basis. Durch gegenseitige Hemmung grenzen A und C die Territorien ihrer Wirksamkeit gegeneinander ab. In diesem Grenzbereich kann nun ein drittes Gen, B, aktiviert werden und seine Wirksamkeit mit derjenigen von A bzw. C überlagern. Damit ist das Schicksal der einzelnen Blütenkreise festgelegt. An der Basis der Bildungszone wirkt nur A und lässt grüne Blätter, den Kelch, entstehen. Weiter nach oben wirkt A zusammen mit B und macht aus den Blattanlagen farbige Kronblätter. Wird noch weiter oben die Wirkung von A durch C ersetzt, führt die Überlagerung mit B zu Staubblättern. Und wirkt schließlich an der Spitze nur noch C allein, entstehen Fruchtblätter.
Ein Blick in eine Magnolien-Blüte offenbart etwas von der Blatt- Umwandlung entlang der Blütenachse: Die Staubblätter sehen wie kleine eingerollte Blütenblätter aus, in deren Schutz der Pollen heranreifen kann. Die ausgezogenen Spitzen der darüberstehenden Fruchtblätter haben Narbenfunktion: ihre klebrigen Ränder halten den Blütenstaub fest. Kleine Käfer, denen der Blütenstaub zur Nahrung dient, besorgen ungewollt die Bestäubung. (CK)
Durch den Ausfall eines oder zweier dieser Steuerungsgene sind nun alle möglichen Fälle von Rück- bzw. Umbildungen im Blütenbereich denkbar und an bestimmten Modellorganismen der Molekulargenetiker, der Ackerschmalwand Arabidopsis und dem Löwenmäulchen Antirrhinum, auch experimentell erzeugt worden. Auch für unsere Traubenhyazinthe ist es leicht, das scheinbar so raffinierte Täuschungsmanöver zustande zu bringen: Sie lockt die Insekten mittels Attrappenwirkung auf mechanistisch nachvollziehbare Weise.
Nun sind für die Entwicklung einer Blüte natürlich mehr als nur drei Gene zuständig. Von all dem, was denn die »Blattanlagen« hervorbringt und in sinnvoller Ordnung wachsen lässt, war ja gar nicht die Rede, sondern nur von der Beeinflussung dieses Wachstums in die eine oder andere festgelegte Richtung. Im Ganzen sind für die Entstehung einer Blütenpflanze größenordnungsmäßig sicherlich nicht weniger Gene notwendig als für, sagen wir, eine Maus. Das Genom-Projekt hat uns gelehrt, dass erstaunlicherweise selbst für den menschlichen Organismus 20.000 bis 30.000 Gene ausreichen. So gesehen, können unsere drei »Metamorphose-Gene« als Beispiel dafür stehen, auf welche Weise organische Umformungsprozesse gesteuert werden und der Einsatz von blind wirkenden Faktoren zu gezielten Effekten führen kann. Das hinter der Formenvielfalt des Lebendigen aufzudecken, hat sich die Evolutionstheorie seit Darwin zur Aufgabe gemacht. Es soll uns aber nicht darum gehen, diese Aufgabe bis in alle molekularbiologischen Details für die Traubenhyazinthe durchzuführen. Wir würden dabei sehr schnell an die Grenzen des tatsächlich Gewussten wie des verstandesmäßig Überblickbaren gelangen! Was wir zeigen wollen, ist lediglich, wie sich die stammesgeschichtliche Entwicklung, die zu einem solchen kleinen Blütenwunder wie unserer Traubenhyazinthe führt, konsequent und anhand allgemeiner Prinzipien rekonstruieren lässt, ohne dass darum diese Geschichte und ihr Ergebnis etwas von ihrem Wunderbaren verlieren müssen. Man braucht nicht naiver Kreationist zu sein, um die Wunder der Schöpfung bestaunen zu können. Es bedarf auch nicht der logischen Spitzfindigkeit der Intelligent-Design-Anhänger, die mit ihrem – immer möglichen – Rekurs auf die Lückenhaftigkeit evolutionärer Erklärungen Gott als planende Vernunft hinter allem retten möchten. Es genügt, sich der evolutionären Nacherzählung der Geschichte der Traubenhyazinthe zu überlassen, um in andächtiges Staunen zu kommen über die Menge an Erfindungsgeist, der in dieser Geschichte am Werk ist.
Das Wort »andächtig« ist hierbei bewusst gewählt. Es ist kein Geheimnis, dass wir Verfasser dieses Buches als gläubige Christen schreiben. Dennoch, oder vielleicht besser: gerade deshalb halten wir es für angemessener, vor der Menge an Kreativität in die Knie zu gehen, die dieser evolutionäre Prozess in jedem seiner Produkte offenbart, als vorschnell vor einem »Erfinder«, der das alles in womöglich nur katechetischer Absicht hergestellt hat. Wenn beim Lesen der Eindruck entsteht, dass die Anerkennung der Evolution eine bessere Grundlage für den Glauben an einen Schöpfergott darstellt als ihre Ablehnung (wobei selbstverständlich die Richtigkeit einer naturwissenschaftlichen Theorie nicht von ihrer theologischen Brauchbarkeit abhängt), dann ist das Blühen der Traubenhyazinthe – Angelus Silesius möge die kühne Anleihe verzeihen – doch nicht »ohn’ Warum«.
Die geheime Hochzeit der Pflanzen
Warum gibt es Blüten? Die Frage scheint banal. Jedermann weiß, dass Blüten im Dienst der Fortpflanzung stehen. Die Blüte reift zur Frucht, im Innern der Frucht sitzen die Samen, aus den Samen werden wieder neue Pflanzen – und so weiter von einer Generation zur andern. Nicht ganz so selbstverständlich ist, dass es sich bei diesem Fortpflanzungsvorgang um echte Sexualität handelt, der genauso auf der Verschmelzung von weiblicher Ei- und männlicher Samenzelle beruht wie im Tierreich. Zwar war es schon von alters her üblich, in der Bestäubung, die der Fruchtbildung in der Regel vorausgeht, eine Analogie zum Geschlechtsakt zu sehen, aber das war lange Zeit nicht mehr als eine Allegorie oder Metapher.
So hat der große Carl von Linné bereits als 23-jähriger Student die Grundlagen zu seinem späteren Botanischen System in einer Schrift dargestellt, die er programmatisch als »Einführung in die Hochzeit der Pflanzen« (Praeludia sponsaliorum plantarum) betitelte. Darin werden die auffälligen Teile der Blüte, Kelch und Krone, als bloßes »Brautlager« aufgefasst, wogegen Staubblätter und Fruchtknoten die eigentlichen Wohnsitze der Geschlechter darstellen. Die dafür verwendeten Fachtermini »Frauenhaus« (Gynoeceum) und »Männerhaus« (Androeceum) sind heute noch in Gebrauch. Von diesem Ausgangspunkt konnte Linné die Pflanzenhochzeit dann einteilen je nachdem, ob sie öffentlich geschieht (bei den Blütenpflanzen) oder im Geheimen (bei den Kryptogamen, d.h. bei all denjenigen Pflanzen, bei denen er keine Blüten feststellen konnte). Die Pflanzen mit öffentlicher Hochzeit wurden weiter danach unterschieden, ob Mann und Frau ein gemeinsames Schlafgemach haben oder sich getrennter Schlafzimmer »erfreuen« (ob Linné wohl unglücklich verheiratet war?) – das sind, natürlich, unsere zwei- bzw. eingeschlechtlichen Blüten. Bei ersteren kommt es weiter darauf an, ob die Männer untereinander alle Brüder sind oder nicht, will heißen, ob die Staubblätter miteinander verwachsen oder frei sind, in wie vielen Kreisen sie stehen, ob es zwischen ihnen Unterordnung oder Gleichheit gibt usw. Fachleute können eine Menge Unterscheidungskriterien finden, die noch in heutigen Büchern zur Pflanzenbestimmung eine Rolle spielen. Dies zeigt, wie erfolgreich Linné bei der Auswahl seiner systematischen Merkmale war.
Eine Storchschnabelblüte (Geranium macrorrhizum) als Beispiel für den »üblichen« Blütenaufbau: Die Blütenorgane sind nicht mehr wie bei der Magnolie spiralig, sondern in Kreisen angeordnet. Die aus der Kronröhre herauswachsenden »Staubfäden« mit dem »Griffel« sind so verändert, dass ihre Blatt-Herkunft nur noch im Vergleich erschlossen werden kann. Im Hintergrund die als Knospenschutz dienenden Kelchblätter. (CK)
Ob er sich dabei aber wirklich an der Bedeutung von Staub- und Fruchtblättern für die Fortpflanzung orientierte? Wahrscheinlich war es einfach ein glücklicher Griff oder der sichere, aber nicht weiter reflektierte Instinkt des durch lange Beobachtung geschulten Pflanzenkenners, gerade solche Unterscheidungsmerkmale zu wählen, die zugleich beliebig und konservativ sind, weil sie unter keinem Anpassungsdruck stehen. Es ist eine Notwendigkeit, dass eine Pflanze Fortpflanzungsorgane hat. Wie diese aber in der Blüte angeordnet sind, ob in Dreier- oder Fünferkreisen, ob verwachsen oder nicht, ist gegenüber der Fortpflanzungsfunktion sekundär. Das eine ist so gut wie das andere, und darum bleiben Unterschiede hier dauerhafter erhalten als dort, wo die Selektion eine bestimmte Verbesserungsrichtung prämiert. Um ein modernes Beispiel zu gebrauchen: Die Symbole der Automarken sind beliebig und fahrtechnisch irrelevant, weshalb sie durch die Jahrzehnte gleich bleiben. Dagegen gleichen sich die äußeren Formen der Limousinen durch das Styling im Windkanal immer mehr aneinander an, sodass man die Zugehörigkeit schließlich nur noch am Firmensymbol, aber kaum noch am Bau der Karosserie feststellen kann. Entsprechend repräsentiert auch die traditionelle Anordnung von Staub- und Fruchtblättern in der Blüte die Verwandtschaftszugehörigkeit weit mehr als etwa die Ausbildung der Laubblätter, die viel stärker von der Anpassung an allgemeine Standortbedingungen, wie Licht und Schatten, Trockenheit, Wind und Kälte usw., bestimmt ist.
Ist also die »Pflanzenhochzeit« Linnés ein zwar glückliches, aber eigentlich bloß von der Rokoko-Lyrik bestimmtes Bild, oder ist sie auch Niederschlag eines damals bereits vorhandenen Wissens über die Sexualität der Pflanzen? Unmöglich wäre das nicht, denn immerhin hat sich der Tübinger Mediziner und Botaniker Rudolf Jakob Camerarius schon Ende des 17. Jahrhunderts eingehend Gedanken über die Fortpflanzung im Pflanzenreich gemacht und diese mit den Verhältnissen bei den Tieren verglichen. So wunderte er sich z.B. darüber, dass ein weiblicher Maulbeerbaum Früchte trug, obwohl kein männlicher Baum in der Nähe war, stellte aber zugleich fest, dass diese Früchte keine Samen enthielten und so unbefruchteten »Windeiern« des Huhns glichen. Seine Beobachtungen und Bestäubungsversuche führten ihn schließlich dazu, in den für die Samenbildung so wichtigen Staubbeuteln die »männlichen Geschlechtsteile« zu sehen, worauf dann folgerichtig der »Behälter der Samen mit seiner Narbe oder seinem Griffel«, also der Fruchtknoten oder Stempel, zum weiblichen Geschlechtsorgan avancierte. Von ähnlichen Betrachtungen finden wir bei Linné indessen nicht die Spur. Auch in der Folgezeit blieben die Einsichten Camerarius’ – von Ausnahmen abgesehen – ziemlich wirkungslos, sodass noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Mehrzahl der Botaniker an der Sexualität der Pflanzen zweifelte. Das lag gewiss auch daran, dass Camerarius mit seiner Gleichsetzung von bestimmten Blütenteilen mit den männlichen und weiblichen Sexualorganen auf halbem Weg stehen geblieben war. Er postulierte zwar einen Zeugungsvorgang, konnte aber noch keine direkten Beobachtungsdaten für dessen Ablauf vorbringen. So war man noch um 1800 der Meinung, die Befruchtung bestünde in einer Vermischung eines aus den Pollenkörnern austretenden Saftes mit dem Schleim der Narbe. Es bedurfte besserer Mikroskope, wie sie etwa der italienische Mathematiker und Astronom Giovanni Amici (1786–1863) zu konstruieren wusste, bis man dem Geheimnis der pflanzlichen Sexualität auf die Spur kam. Amici gelang der bahnbrechende Nachweis, dass der »Saft« des Pollenkorns in Wirklichkeit ein Schlauch ist, der aus dem Pollenkorn auskeimt und die Narbe bis zu den Samenanlagen des Fruchtknotens, damals noch »kleine Eier« (Ovula) oder »Keimbläschen« genannt, durchdringt. Nun war es die Spitze dieses Pollenschlauchs, die mit dem pflanzlichen Keim identifiziert wurde, wie der in Jena lehrende Botaniker Matthias Schleiden meinte. Andere blieben der Pollensaft-Theorie treu und sahen den Befruchtungsvorgang im Übertritt von Flüssigkeit aus der Pollenschlauchspitze in das Keimbläschen. Erst durch ausgefeilte mikroskopische Färbetechniken gelang es Eduard Strasburger im Jahr 1884, den eigentlichen Einfluss des Pollenschlauchs aufzuklären. Er konnte im Innern des Pollenschlauchs zwei Zellkerne nachweisen, von denen einer mit dem Eikern eines Keimbläschens verschmilzt. Damit war endlich gezeigt, dass der Befruchtungsvorgang, den Oskar Hertwig schon 1875 beim Seeigel als Verschmelzung der Zellkerne von Spermium und Ei beschrieben hatte, in gleicher Weise auch bei den Pflanzen stattfindet.
Es sollte aber noch eine Reihe von Jahren dauern, bis das Schicksal des zweiten »generativen Kerns« aus dem Pollenschlauch geklärt werden konnte. Er geht keineswegs zugrunde, wie man zunächst annahm, sondern vollzieht zusammen mit zwei weiteren Kernen des Keimbläschens eine zusätzliche Befruchtung. Daraus geht allerdings kein Embryo, sondern das Nährgewebe des Samens hervor. Bei den Samenpflanzen ist also nicht nur die Bildung eines neuen Keims, des Embryos, Ergebnis eines Geschlechtsakts, sondern auch die Bildung des Nährstoffvorrats für die Erstversorgung dieses Embryos. Diese Besonderheit hat der russische Botaniker S. G. Navašin im Jahr 1898 entdeckt.