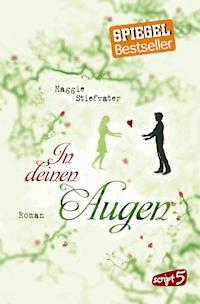12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
In ihrem neuen Fantasy-Roman erzählt Spiegel-Bestseller-Autorin Maggie Stiefvater eine atmosphärisch-düstere Geschichte über Angst und Magie, Liebe und Mut. Jeder träumt von einem Wunder, aber nicht jeder ist bereit dafür. Wem nur noch ein Wunder helfen kann, der findet stets seinen Weg in die Wüste Colorados und zur außergewöhnlichen Familie Soria. Doch die Wunder der Sorias sind unberechenbar und wer sie aus eigener Kraft nicht vollenden kann, zahlt einen hohen Preis. Auch Daniel Soria bewirkt diese Wunder mit der Ernsthaftigkeit und Hingabe, die es braucht. Doch dann bricht er die wichtigste Regel seiner Familie: Er mischt sich in ein Wunder ein. Dadurch entfesselt er eine Magie, die seinen Tod bedeuten könnte. »Eine meisterhafte Geschichtenerzählerin.« USA today
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 384
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Maggie Stiefvater
Wie Eulen in der Nacht
Aus dem amerikanischen Englisch von Katharina Volk
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Jeder träumt von einem Wunder, aber nicht jeder ist bereit dafür.
Wem nur noch ein Wunder helfen kann, der findet stets seinen Weg in die Wüste Colorados und zur außergewöhnlichen Familie Soria. Doch die Wunder der Sorias sind unberechenbar und wer sie aus eigener Kraft nicht vollenden kann, zahlt einen hohen Preis.
Auch Daniel Soria bewirkt diese Wunder mit der Ernsthaftigkeit und Hingabe, die es braucht. Doch dann bricht er die wichtigste Regel seiner Familie: Er mischt sich in ein Wunder ein. Dadurch entfesselt er eine Magie, die seinen Tod bedeuten könnte.
»Eine meisterhafte Geschichtenerzählerin.« USA today
Inhaltsübersicht
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
Epilog
Dank
Colorado 1962
1
Nach Einbruch der Dunkelheit ist ein Wunder sehr weit zu hören.
Da sind Wunder ganz ähnlich wie Radiowellen. Nur wenigen Leuten ist klar, dass die gewöhnliche Funkwelle und das außergewöhnliche Wunder einiges gemeinsam haben. Auf sich allein gestellt, wären Radiowellen nur etwa siebzig, achtzig Kilometer weit zu hören. Sie reisen von ihrem Sender aus in schnurgeraden Linien, und da die Erde rund ist, dauert es nicht lange, bis sie sich von ihrer Oberfläche entfernen und zu den Sternen unterwegs sind. Würden wir das nicht alle tun, wenn wir könnten? Ein Jammer, dass sowohl Wunder als auch Radiowellen unsichtbar sind, denn das wäre mal ein Anblick: Bahnen aus Wundern und Schall, die sich von überall auf der Welt als klare Strahlen ins All strecken.
Doch nicht alle Radiowellen und Wunder entkommen ungehört. Manche prallen von der Decke der Ionosphäre ab, wo hilfreiche freie Elektronen in freudvoller Harmonie mit ihnen herumoszillieren und sie dann in ganz neuen Winkeln zur Erde zurückschießen. So kann ein Signal von Rosarito oder Nogales aus lossausen, sich den Kopf an der Ionosphäre stoßen und in Houston oder Denver herauskommen, stärker als zuvor. Und wenn es nach Sonnenuntergang ausgesandt wird? Vieles läuft in diesem Leben besser, wenn sich die wachsame Sonne nicht einmischen kann, und dieser Prozess gehört dazu. Bei Nacht können Radiowellen und Wunder so lange hin und her hüpfen, dass sie manchmal unvorhersehbarerweise Sendeanlagen und Heilige in Tausenden Kilometern Entfernung erreichen. Auf diese Weise könnte man ein kleines Wunder aus dem winzigen Örtchen Bicho Raro im fernen Philadelphia hören, oder umgekehrt. Ist das Wissenschaft? Oder Religion? Sogar Wissenschaftler und Heilige haben Schwierigkeiten, beides auseinanderzuhalten. Vielleicht spielt es auch keine Rolle. Wer eine unsichtbare Saat heranzieht, kann über die Form seiner unsichtbaren Feldfrüchte keine übereinstimmenden Ansichten erwarten. Da ist es doch klüger, einfach anzuerkennen, dass sie alle gut wachsen.
In der Nacht, in der diese Geschichte beginnt, hörten ein Heiliger und ein Wissenschaftler Wundern zu.
Es war dunkel, so wahrhaft dunkel, wie es eben in der Wüste wird, und die drei Sorias hatten sich im Laderaum eines kleinen Lkw versammelt. Seit etwa einer Stunde schubsten über ihnen die größeren Sterne die kleineren als hübsche Schnuppen von ihrem Platz am Himmel. Darunter war der Himmel tiefschwarz bis hinab ins Tal voller Chamisa und Rabbitbrush.
Es war still, bis auf das Radio und die Wunder.
Der Laster war in einem ausgedehnten Gestrüpp geparkt, mehrere Kilometer vom nächsten Ort entfernt. Er war nichts Besonderes, nur ein Neunzehnachtundfünfziger-Dodge-Umzugswagen in verblichenem Rot mit einem gewissen optimistischen Ausdruck. Ein Rücklicht war zerbrochen. Der rechte Vorderreifen war ein klein wenig platter als der linke. Auf dem Beifahrersitz war ein Fleck, der für immer nach Cherry Coke riechen würde. Ein kleines holzgeschnitztes Alebrije, teils Stinktier und teils Kojote, hing vom Rückspiegel. Der Laster trug Nummernschilder aus Michigan, obwohl hier nicht Michigan war.
Das Radio lief. Nicht das im Fahrerhaus – das hinten im Frachtraum. Es war ein dunkeltürkisgrünes Motorola-Radio, das von Antonia Sorias Küchentheke stammte. Und es spielte den Sender der drei Sorias. Nicht etwa einen Lieblingssender, den sie gern hörten – sondern den Sender, den sie geschaffen hatten. Der Lastwagen war ihr fahrbares Sendestudio.
Sie, ihr. In Wahrheit war das Beatriz Sorias Laster und Beatriz Sorias Radiosender. Dies ist die Geschichte aller Sorias, aber noch mehr die von Beatriz. Die Mittelwellen des Senders übertrugen zwar nicht ihre Stimme, wurden aber von ihrem komplizierten drahtigen Herzen mit Lebensenergie versorgt. Andere Menschen haben ihr Lächeln und ihre Tränen, mit denen sie Gefühle zeigen; die rätselhafte Beatriz Soria hatte einen Lastwagen voll Sendetechnik in der Wüste von Colorado. Wo immer sie auch sein mochte – wenn sie sich in den Finger schnitt, bluteten im Lastwagen die Lautsprecher.
»… wenn ihr den Swing nicht mehr hören könnt«, versprach der DJ, »findet ihr uns immer nach Sonnenuntergang, aber vor Sonnenaufgang.«
Dies war die Stimme des jüngsten der drei Sorias, Beatriz’ Cousin Joaquin. Er war sechzehn Jahre alt, nahm sich selbst sehr ernst, und es war ihm lieb, wenn andere das auch taten. Er war geschniegelt und glatt rasiert und drückte sich beide Muscheln des Kopfhörers an ein Ohr, um sich nicht die Frisur zu ruinieren – eine geölte Schmalztolle von beachtlicher Höhe. Zwei Taschenlampen erleuchteten ihn wie goldene, ein wenig vorschnelle Scheinwerfer und überließen alles andere dem Violett, Blau und Schwarz. Joaquin trug dasselbe Oberteil wie schon seit zwei Monaten: ein kurzärmeliges rotes Hawaiihemd mit hochgeschlagenem Kragen. In dem einzigen Film, in den er es 1961 geschafft hatte, hatte er ein ähnlich getragenes Hemd gesehen und sich geschworen, diesen Look für sich neu zu erschaffen. Ein Garten aus gebrauchten Limoflaschen voll Wasser wuchs zu seinen Füßen. Er hatte panische Angst vor dem Verdursten und bekämpfte diese Phobie, indem er stets genug Wasser bei sich hatte, um tagelang zu überleben.
Nach Anbruch der Dunkelheit war er nicht mehr unter dem Namen Joaquin Soria bekannt. In dem mobilen Sender, der durch die Bergwüste streifte, nannte er sich Diablo Diablo. Dieser DJ-Künstlername hätte seine Mutter wie seine Großmutter zutiefst schockiert, wenn sie davon gewusst hätten, und darum ging es ja. In Wahrheit schockierte er Joaquin selbst ein bisschen. Jedes Mal, wenn er ihn aussprach, genoss er den Kitzel der Gefahr, denn er war der abergläubischen Überzeugung, dass ein drittes Diablo nach diesem Namen den Teufel tatsächlich herbeirufen könnte.
Dies wollte Joaquin Soria: berühmt sein. Und dies fürchtete er: ganz allein im Wüstenstaub nicht weit von Bicho Raro zu sterben.
»… noch etwas zum Tanzen und Träumen«, fuhr Diablo Diablos Stimme fort. »Die heißesten Songs des Jahres, von Del Norte bis Blanca und von Villa Grove bis Antonito – the music that’ll save your soul.«
Die beiden anderen hinten im Lastwagen, seine Cousine Beatriz und sein Cousin Daniel, zogen die Augenbrauen hoch. Die Behauptung, ihr Sender decke das ganze San Luis Valley ab, war glatt gelogen, doch Joaquin interessierte sich eben mehr für Dinge, die toll wären, wenn sie denn wahr wären, als für Dinge, die tatsächlich wahr waren. Nein, der Sender deckte nicht das gesamte Tal ab, aber wenn er das könnte, welch großartige Welt hätten wir dann?
Daniel setzte sich ein wenig anders zurecht. Die drei saßen Knie an Knie im Laderaum, und weil es so eng war, konnte Daniels langer Fuß gar nicht anders, als eine von Joaquins Wasserflaschen anzustoßen. Der metallene Verschluss kullerte zu Boden und hastete aufrecht auf dem Rand dahin, als würde er verfolgt. Die Kabel am Boden wichen schon vor dem Wasser zurück. Unheil flüsterte. Dann fing Joaquin die Flasche ab und hielt sie Daniel mahnend hin.
»Mach den Laster nicht kaputt«, sagte er. »Der ist neu.«
Er war nicht neu, aber ganz neu in seiner Rolle als Radiosender. Ehe er dazu genötigt worden war, hatte die Familie der Schwester von Ana Maria Sorias Schwägerin damit die Alonso-Brüder – Anstreicher – zwischen Maleraufträgen und Bars hin und her transportiert. Der Laster war dieses Elends schließlich müde geworden und liegen geblieben. Und da die Alonso-Brüder lieber anstrichen und tranken, statt den Laster wieder aufzurichten, hatte man ihn dem Unkraut überlassen. Während dieser Zeit hatte er sogar so viel Feuchtigkeit gesammelt, dass sich Timotheegras und Seggen angesiedelt und ihn schnell bis über Dach und Haube überwuchert hatten. Der Laster hatte sich in ein kleines Feuchtgebiet inmitten der Wüste verwandelt. Tiere kamen aus vielen Kilometern Umkreis herbei, um in dieser Oase zu leben: erst ein Biber, dann ein Dutzend Leopardfrösche, deren Rufe wie knarrende Schaukelstühle klangen, und dann dreißig Cutthroat-Forellen, die sich so dringend eine neue Heimat wünschten, dass sie durch das Tal zum Laster liefen. Endgültig genug war es dann, als vier Dutzend Kanadakraniche einzogen – mannsgroß und doppelt so laut. Das Chaos dieses Sumpfs hielt alle wach, zu jeder Stunde jedes Tages.
Beatriz war die Aufgabe übertragen worden, die Tiere zu vertreiben.
Da hatte sie den kleinen Lastwagen darunter entdeckt. Sie restaurierte ihn so langsam, dass die Tiere ganz allmählich ausquartiert wurden und der neue Sumpf kaum mitbekam, dass man ihn gerade hinausbegleitete. Bald erinnerte sich ein Großteil der Familie Soria nicht einmal mehr daran, dass es ihn je gegeben hatte. Sogar der Laster war mehr oder weniger in Vergessenheit geraten. Der Holzboden des Kastenaufbaus wies noch rostrote, kreisförmige Flecken vergangener Farbeimer auf, doch an seine Zeit als Ökosystem erinnerte nur ein Ei, das Beatriz unter dem Gaspedal gefunden hatte. Es war riesig, handgroß, marmoriert wie der Mond und so leicht wie Luft. Sie hatte ihm aus einem Haarnetz eine Hängematte geknüpft und es als Glücksbringer im Laderaum aufgehängt. Da baumelte es nun über Funktechnik aus dem Koreakrieg, Tonbandgeräten aus dritter Hand, kaputten Plattenspielern und von sonst woher zusammengesammelten Radioröhren, Transistoren und Kondensatoren.
Diablo Diablo (Diablo!) verkündete schmachtend: »Und jetzt legen wir für euch eine nette kleine Scheibe von den Drifters auf. Hier kommt ›Save the Last Dance for Me‹ … aber wir hören noch nicht auf zu tanzen, also bleibt dran.«
In Wirklichkeit legte Joaquin keine nette kleine Scheibe von den Drifters auf, obwohl der Song gespielt wurde – von einem der Tonbandgeräte. Die gesamte Sendung war vorher auf Tonband aufgenommen für den Fall, dass sich der Radiosender schnell verziehen musste. Die Funk-Kontrollbehörde FCC war wenig erbaut davon, dass die amerikanische Jugend in ihrer Freizeit unlizensierte Radiosender betrieb, vor allem, da besagte Jugend offenbar einen grässlichen Musikgeschmack sowie revolutionäre Tendenzen aufwies. Gesetzesübertreter erwarteten Geld- und Gefängnisstrafen.
»Glaubst du, dass sie uns vielleicht peilen?«, fragte Joaquin hoffnungsvoll. Er wollte nicht von der Regierung verfolgt werden, aber er wollte gehört werden, und nach Zweiterem sehnte er sich so sehr, dass er es für seine Pflicht hielt, Ersteres als unvermeidlich hinzunehmen.
Beatriz saß am Sendegerät, die Finger vage in der Luft darüber, und war ganz in ihrer Fantasie versunken. Als ihr bewusst wurde, dass ihre Cousins eine Antwort von ihr erwarteten, sagte sie: »Nicht bei der Reichweite.«
Beatriz war die Zweitälteste der drei Sorias, so still und mysteriös, wie Joaquin laut und bunt war. Sie war achtzehn Jahre alt, eine Hippie-Madonna mit Mittelscheitel im dunklen Haar. Ihre Nase war wie ein J geformt, und ihren kleinen enigmatischen Mund hätten Männer wahrscheinlich als Rosenknospe bezeichnet, Beatriz hingegen als »mein Mund«. Sie hatte neun Finger, weil sie sich mit zwölf Jahren versehentlich einen abgeschnitten hatte, doch das machte ihr nicht viel aus – es war nur der kleine Finger, noch dazu der rechte (und sie war Linkshänderin). Zumindest war es eine sehr interessante Erfahrung gewesen, und rückgängig machen konnte sie es sowieso nicht mehr.
Joaquin war um des Ruhmes willen in diesem Lastwagen dabei, doch Beatriz ging es rein um intellektuelle Befriedigung. Die Reparatur des Lasters und die Konstruktion des Senders waren Puzzle gewesen, und sie liebte Rätsel. Sie verstand Rätsel. Im Alter von drei Jahren hatte sie eine geheime Zugbrücke von ihrem Kinderzimmerfenster zur Koppel hinter dem Haus entwickelt, sodass sie mitten in der Nacht barfuß zu den Pferden gelangen konnte, ohne in die Stacheln der Burzeldorne zu treten, mit denen diese Gegend geschlagen war. Mit sieben hatte sie eine Kreuzung aus Mobile und Marionettentheater erfunden, damit sie die Familienpuppen der Sorias vom Bett aus für sich tanzen lassen konnte. Mit neun Jahren hatte sie begonnen, mit ihrem Vater Francisco Soria eine Geheimsprache zu entwickeln, an der sie auch jetzt noch feilten, Jahre später. In Schriftform bestand sie ganz und gar aus Zahlenreihen, und gesprochen – oder vielmehr gesungen – wurde sie in Noten, die der mathematischen Formel dessen entsprachen, was man gerade ausdrücken wollte.
Dies wollte Beatriz: der Frage nachgehen können, inwiefern ein Schmetterling einer Galaxie ähnelte. Und dies fürchtete sie: irgendetwas anderes aufgetragen zu bekommen.
»Meinst du, Mama oder Nana hören uns?«, hakte Joaquin (Diablo Diablo!) nach. Er wollte nicht, dass seine Mutter oder Großmutter seine zweite Identität entdeckten, doch er sehnte sich danach, dass sie Diablo Diablo hörten und einander zuflüsterten, dass dieser Piraten-DJ nach einem gut aussehenden Burschen klang – und wie Joaquin.
»Nicht bei der Reichweite«, wiederholte Beatriz.
Sie hatte sich diese Frage auch schon gestellt. Das Funksignal ihrer ersten Sendung hatte wenige Hundert Meter Reichweite geschafft, trotz der großen Fernsehantenne, mit der sie ihr System ausgebaut hatte. Nun ging sie in Gedanken sämtliche Stellen durch, an denen das Signal entwischen könnte, ehe es die Antenne erreichte.
Joaquin blickte missmutig drein. »Musst du das so sagen?«
Beatriz war nicht betroffen. Sie hatte das nicht irgendwie gesagt. Sie hatte es einfach gesagt. Aber manchmal reichte das nicht. Zu Hause in Bicho Raro wurde sie manchmal la chica sin sentimientos genannt. Beatriz machte sich nichts daraus, als Mädchen ohne Gefühle bezeichnet zu werden. Die Feststellung erschien ihr durchaus richtig. »Außerdem – wie sollten sie? Wir haben das Radio mitgenommen.«
Die drei spähten zu dem Radiogerät hinüber, das sie von Antonia Sorias Küchentheke entwendet hatten.
»Ein Schritt nach dem anderen, Joaquin«, gemahnte Daniel. »Auch eine leise Stimme ist immerhin eine Stimme.«
Daniel war ebenfalls ein Soria-Cousin und der Älteste im Laster. Mit vollem Namen hieß er Daniel Lupe Soria, er war neunzehn Jahre alt, und seine beiden Eltern waren schon länger tot, als er lebte. Auf allen Fingerknöcheln außer den Daumen war ein Auge eintätowiert, sodass er acht Augen hatte wie eine Spinne, und wie eine Spinne war er auch gebaut, mit langen Gliedern, hervortretenden Gelenken und schlankem Leib. Das geschmeidige glatte Haar fiel ihm bis auf die Schultern. Er war der Heilige von Bicho Raro, und er war sehr gut darin. Beatriz und Joaquin hatten ihn sehr lieb und er die beiden auch.
Daniel hatte zwar von Beatriz’ und Joaquins Radioprojekt gewusst, war aber heute zum ersten Mal dabei, weil er normalerweise sehr mit Wunder-Angelegenheiten beschäftigt war. Das stete Kommen und Gehen von Wundern nahm bei ihm als dem Heiligen den Großteil allen Denkens und Handelns ein. Dieser Aufgabe widmete er sich mit großer Freude und noch mehr Verantwortungsbewusstsein. Heute Abend jedoch rang er mit einer persönlichen Angelegenheit und wollte ein wenig Zeit mit Cousin und Cousine verbringen, um sich vor Augen zu führen, weshalb er Vorsicht walten lassen sollte.
Dies wollte Daniel: jemandem helfen, dem er nicht helfen durfte. Und dies fürchtete er: durch sein persönliches Begehren seine ganze Familie ins Unglück zu stürzen.
»Auch eine leise Stimme ist immer noch leise«, erwiderte Joaquin unleidlich.
»Eines Tages, wenn du als Diablo Diablo berühmt geworden bist, werden wir die Pilger sein, die bis nach Los Angeles kommen, um dich zu sehen«, entgegnete Daniel.
»Oder zumindest nach Durango«, schwächte Beatriz ab.
Joaquin stellte sich lieber eine Zukunft in Los Angeles vor als in Durango, doch er protestierte nicht weiter. Dass sie an ihn glaubten, reichte fürs Erste.
In manchen Familien hat »Cousin« keine große Bedeutung, doch auf diese Generation der Sorias traf das nicht zu. Während das Verhältnis der älteren Sorias zueinander eher Sand glich, der Perlen zerreiben konnte, waren diese drei Sorias unzertrennlich. Joaquin war ein wenig überspannt, doch in diesem Laster genossen sie seinen Größenwahn. Beatriz war unnahbar, doch in diesem Laster brauchten ihre Cousins nicht mehr von ihr, als sie leicht und gern gab. Und alle liebten den Heiligen von Bicho Raro, aber in diesem Laster konnte Daniel einfach menschlich sein.
»Also, ich prüfe jetzt mal die Reichweite«, sagte Beatriz. »Gib mir das Radio.«
»Gib’s dir doch selber«, erwiderte Joaquin.
Doch Beatriz blieb einfach still sitzen, bis er ihr das Radio reichte. Es war zwecklos, einen längeren Atem haben zu wollen als Beatriz.
»Ich komme mit«, sagte Daniel rasch.
Zu Hause in Bicho Raro gab es ein Zwillingspärchen Ziegen namens Fea und Moco, die unter bemerkenswerten Umständen zur Welt gekommen waren. Ziegen bekommen oft Zwillinge oder sogar Drillinge, daher waren Fea und Moco in dieser Hinsicht nichts Besonderes. Nein, ungewöhnlich war, dass Moco zuerst zur Welt gekommen war und Feas Mutter dann befunden hatte, dass ihr eine zweite Geburt in derselben Nacht zu anstrengend und nicht wichtig genug sei. Fea wäre es zufrieden gewesen, ein paar Minuten nach ihrem Zwillingsbruder geboren zu werden. Stattdessen war sie noch monatelang im Leib ihrer Mutter verblieben, bis die sich für eine weitere Geburt ausreichend motivieren konnte. Schließlich kam Fea zur Welt. Die zusätzliche Zeit im Mutterleib ohne jeden Sonnenstrahl hatte ihr Fell pechschwarz gefärbt. Dem äußeren Anschein nach konnte man Fea und Moco für gewöhnliche Geschwister oder einfach Gleichaltrige halten, doch die beiden blieben so eng verbunden wie Zwillinge, ließen einander nie ganz aus den Augen und waren am liebsten zusammen.
So war es auch bei Beatriz und Daniel. So nah die drei Soria-Kinder Joaquin, Beatriz und Daniel sich auch standen, Beatriz und Daniel standen sich noch näher. Beide waren still, innen wie außen, und beide hungerten vor Wissbegierde danach, wie die Welt funktionierte.
Und dann war da noch die Nähe, die durch die Wunder entstand. Alle Sorias besaßen die Gabe, Wunder zu wirken, doch in jeder Generation kamen ein paar Sorias zur Welt, die sich für diese Aufgabe besonders eigneten: Sie waren seltsamer oder heiliger als andere Menschen, je nachdem, wen man fragte. Daniel und Beatriz waren aktuell am heiligsten, und da Beatriz auf gar keinen Fall die Heilige sein wollte, während Daniel kaum etwas anderes wollte, war alles im Gleichgewicht.
Draußen reckte sich der kalte Wüstenhimmel hinauf und hinaus und davon, eine Geschichte ohne Ende. Beatriz schauderte; ihre Mutter Antonia sagte stets, Beatriz habe ein Herz wie eine Eidechse – und es stimmte, dass sie klaustrophobische Hitze schätzte wie ein Reptil. Sie hatte eine Taschenlampe in den Saum ihres Rocks geknotet, holte sie jedoch nicht hervor. Wegen der Peilwagen der FCC machte sie sich keinerlei Sorgen, wollte aber trotzdem niemanden auf ihren Standort aufmerksam machen. Sie hatte das starke Gefühl, wie ein Soria es manchmal eben hat, dass Wunder im Gange waren. Und man hatte sie gewarnt, wie alle Sorias gewarnt werden, welche Folgen es haben konnte, wenn man Wundern in die Quere kam.
Also gingen die beiden durch beinahe vollständige Dunkelheit. Das Licht des Halbmonds war gerade hell genug, um die spitzen, starren Blätter von Yuccas zu erkennen, spindelförmige Manzanitas und struppige Kreosotbüsche. Wacholder verströmte einen feuchten, warmen Geruch, und Steppen-Salzkraut zupfte an Beatriz’ Rock. Die fernen Lichter von Alamosa färbten den Horizont braun, und von so weit weg sah das Licht natürlich aus wie ein vorzeitiger Sonnenaufgang. Im Radio sprach Diablo Diablo, he, ihr da draußen, wartet, sagte er, hört her, sagte er, hier kommt eine unglaubliche Single, eine heiße Nummer, die von den großen Sendern viel zu selten gespielt wird.
In Beatriz Sorias Kopf drehten sich geschäftige Gedanken, wie sie es immer taten. Während sie mit Daniel durch die Dunkelheit schritt, dachte sie über die beiläufig hingenommene Genialität des tragbaren Radios nach, das sie bei sich hatten, über früher, als die Leute geglaubt hatten, die Nachtluft sei einfach leer, und über den Ausdruck tote Luft. Und nun dachte sie daran, dass sie sich in Wirklichkeit durch ein atomares Gedränge schob wie durch eine überfüllte Stadt aus unsichtbaren Chemikalien, Mikroorganismen und Wellen, und dass sie Letztere nur wahrnehmen konnte, weil sie dieses magische Kästchen bei sich trug, das in der Lage war, sie aufzufangen und in einer Form wieder von sich zu geben, die für ihre sterblichen Ohren taugte. Sie stemmte sich in diese unsichtbaren Radiowellen wie in starken Wind und fuhr mit einer Hand durch die Luft, als könnte sie sie ertasten. Diesen Impuls hatte sie oft – das Unsichtbare berühren zu wollen. Seit sie als Kind oft genug dafür bestraft worden war, hatte sie gelernt, dem Impuls nur nachzugeben, wenn es niemand sah. (Daniel zählte in dieser Hinsicht nicht als Jemand.)
Doch sie spürte nur das zähe Kriechen eines nahenden Wunders. Das Audiosignal aus dem Radio zerfranste bereits, und ein anderer Sender schluckte hier und da eine Silbe.
»Beatriz?«, begann Daniel. Seine Stimme klang ein wenig hohl, wie ein Becher ohne Wasser, ein Himmel ohne Sterne. »Glaubst du, dass Konsequenzen etwas bedeuten, wenn wir sie nicht mit eigenen Augen gesehen haben?«
Manchmal, wenn sich eine Frage um ein Geheimnis dreht, stellen die Leute eine andere, aber ähnliche Frage in der Hoffnung auf eine Antwort, die beide Fragen beantworten wird. Beatriz erkannte sofort, dass Daniel jetzt genau so fragte. Sie wusste nicht, wie sie damit umgehen sollte, dass er Geheimnisse hatte, doch sie antwortete ihm, so gut sie konnte. »Ich glaube, dass eine noch nicht überprüfte Konsequenz nur hypothetisch ist.«
»Meinst du, ich war bisher ein guter Heiliger?«
Das war noch immer nicht die Frage, die ihn eigentlich beschäftigte, und abgesehen davon hätte niemand, der auch nur eine Minute in Bicho Raro verbracht hatte, jemals Zweifel an Daniel Lupe Sorias Hingabe an diese Aufgabe geäußert. »Du bist ein besserer Heiliger, als ich je sein könnte.«
»Du könntest eine gute Heilige sein.«
»Die Indizien sind anderer Ansicht.«
»Wo bleibt deine Wissenschaft?«, erwiderte Daniel. »Ein einzelnes Indiz ist keine Wissenschaft.« Sein Tonfall war nicht mehr ganz so ernst, doch das beruhigte Beatriz nicht. Er war sonst nie bekümmert, und sie konnte nicht vergessen, wie sich das in seiner Stimme angehört hatte.
Beatriz drehte das Radio ein wenig hin und her, um das Krächzen zu reduzieren. »Manche Experimente brauchen nur ein einziges Resultat als Beweis. Zumindest als Beweis dafür, dass es unverantwortlich wäre, sie ein weiteres Mal durchzuführen.«
Immer lauter breitete sich statisches Rauschen und Knacken zwischen den beiden aus. Schließlich fragte Daniel: »Ist dir schon mal der Gedanke gekommen, dass wir es vielleicht ganz falsch machen? Wir alle?«
Da war endlich eine echte Frage, keine versteckte mehr, obwohl das noch nicht die wahre Frage war. Allerdings war das Rätsel zu groß, um es in einer einzigen Nacht zu lösen.
Ein Beben im Gebüsch vor ihnen unterbrach sie. Es wackelte und bebte erneut, und dann rauschte ein Schatten daraus empor.
Weder Beatriz noch Daniel zuckten mit der Wimper. Das lag daran, dass sie Sorias waren. Wenn man in dieser Familie bei jedem plötzlich auftauchenden Schatten einen Satz machen wollte, müsste man schon für sehr kräftige Waden sorgen.
Das tosende Rauschen löste sich in gewaltige, schwere Flügelschläge auf, der Schatten in einen riesigen auffliegenden Vogel. Er schlug so dicht vor ihnen mit den Flügeln, dass Beatriz’ Haar über ihre Wange geweht wurde: eine Eule.
Beatriz wusste viel über Eulen. Eulen haben riesige, sehr scharfe Augen, doch diese erstaunlichen Augäpfel werden von knöchernen Auswüchsen festgehalten, die man Skleralringe nennt. Deshalb müssen Eulen den Kopf in alle Richtungen drehen, statt nur die Augen hin und her zu bewegen. Mehrere Eulenarten haben asymmetrische Ohren, mit denen sie den Ursprung eines Geräuschs genau orten können. Viele Menschen wissen gar nicht, dass Eulen nicht nur außerordentlich gut sehen und hören können, sondern auch stark von Wundern angezogen werden, wenngleich über den genauen Mechanismus dieser Anziehung noch wenig bekannt ist.
Daniel beugte sich vor und schaltete das Radio aus. Eilig floss die Stille in den Raum um sie herum zurück.
Jenseits des Gebüschs, aus dem die Eule erschienen war, kamen ferne Scheinwerfer in Sicht. An einem solchen Ort konnte man die ganze Nacht draußen verbringen, ohne ein einziges anderes Fahrzeug zu sehen. Deshalb beobachtete Beatriz mit einigem Interesse, wie die winzigen Lichtpunkte hin und her schwebten. Das Fahrzeug war viel zu weit weg, um es hören zu können, doch das Geräusch von Reifen auf der Schotterstraße war ihr so vertraut, dass ihre Ohren dennoch so taten, als nähmen sie es wahr. Sie hob die Hand, spreizte die Finger und probierte aus, ob sie den Klang ertasten könnte.
Daniel schloss die Augen. Seine Lippen bewegten sich. Er betete.
»Scheinwerfer! Seid ihr zwei bescheuert?« Joaquin war das Warten zu lang geworden, und er brüllte ihnen aus dem offenen Lastwagen zu: »Scheinwerfer! Warum habt ihr nicht sofort Bescheid gesagt? Ein Peilwagen – die FCC!«
Beatriz schloss die Finger und ließ die Hand sinken. »Sie kommen nicht hierher«, sagte sie.
»Woher willst du das wissen?«
»Sie wollen nach …«
Vage hob sie die Hand und ließ diese Geste als restlichen Satz gelten.
Joaquin sprang in den Laster, zog hastig Drähte aus der Batterie, sprang wieder heraus und rupfte mit großer, furchtsamer Energie Drähte vom Boden. Doch Beatriz hatte recht, wie so oft. Die fernen Scheinwerfer setzten ihren Weg fort, ohne zu zögern, und erleuchteten dabei reglose Antilopen und unförmige Grasbüschel. Das Fahrzeug hielt unbeirrbar auf Bicho Raro zu. Es war nicht auf der Suche nach einem Funksignal, sondern nach einem Wunder.
Daniel öffnete die Augen und sagte: »Ich muss vor ihnen dort sein.«
Es würde kein Wunder geben ohne einen Heiligen.
2
In dem Fahrzeug, das in jener Nacht auf Bicho Raro zufuhr, saßen Pete Wyatt und Tony DiRisio.
Pete und Tony waren lange Stunden zuvor im westlichen Kansas aufeinandergestoßen. Nicht buchstäblich, aber beinahe. Pete war per Anhalter durch die endlose Prärie unterwegs und sehr langsam vorangekommen. Wieder einmal hatte er sich laut den Stand des letzten Meilensteins vorgezählt, als eine große Eule knapp über ihn hinwegflog, sodass er einen Schritt zur Seite sprang. Eine Sekunde war ein Auto rutschend an der Stelle zum Stehen gekommen, wo Pete eben noch gewesen war. Tony hatte das Fenster heruntergekurbelt, durch die Staubwolke zu Pete hinausgespäht und gefragt: »Wie heiße ich?« Pete hatte zugeben müssen, dass er das nicht wusste, woraufhin sich Tonys Miene aufgehellt hatte. »Dann musst du fahren«, hatte er gesagt und sich abgeschnallt, »weil ich zu high bin.«
Und so fand Pete – der erst seit Kurzem den Führerschein besaß und seither nur ein Dutzend Mal mit dem Wagen seines Vaters gefahren war – sich am Steuer eines entschlossen hässlichen Mercury-Kombi in viel zu gelbem Eigelb-Gelb. Tony DiRisio mochte große Autos. Zum Autohändler in Philadelphia hatte er nur ein Metermaß und sein Scheckbuch mitgenommen. Für sein Gefühl hatte ein Wagen mit über fünf Metern Länge und Holzverkleidung etwas Dauerhaftes.
Tony selbst war so attraktiv wie eine Zigarette. Momentan trug er einen weißen Anzug und dunkle Koteletten. Beide hatten einmal schick gewirkt, doch als Pete ihm begegnete, waren sie zerknautscht. Da fuhr Tony seit fünf Tagen den Mercury, und sich selbst trieb er schon viel länger mit Vollgas voran. Er war erst vierunddreißig, doch er hatte all diese Jahre zweimal gelebt: einmal als Tony DiRisio und einmal als Tony Triumph. Nach einer Kindheit in solcher Langeweile, dass die Schilderung nicht salonfähig wäre, war er Radio-DJ bei einem nicht salonfähig langweiligen Easy-Listening-Sender geworden. In den vergangenen Jahren hatte er sich selbst und den Sender in eine feste Einrichtung in jeder Küche verwandelt, mit der Idee, willkürlich ausgewählte Hausfrauen in den Sender zu holen, die dann jede Stunde einen Song ihrer Wahl auflegen durften. Er wurde zum Gejagten – die Frauen Philadelphias drängten sich im Supermarkt und auf den Gehwegen der Nachbarschaft in der Hoffnung, seine Aufmerksamkeit zu erregen. Die lokale Klatschpresse analysierte, welchen Typ Frau er am häufigsten einlud: was die Frauen angehabt hatten, als sie entdeckt worden waren (meist Schuhe ohne Absätze), wie sie das Haar getragen hatten (oft in Lockenwicklern) und wie alt sie waren (für gewöhnlich über fünfzig). Die Überschrift fragte: »Will Tony Triumph seine Mutter?«
Dies wollte er: nicht mehr von winzigen Vögeln mit sehr langen Beinen träumen, die ihn auslachten. Und dies fürchtete er: dass ihn Leute beim Essen beobachteten.
Außerdem vermisste er seine Mutter.
Pete Wyatt wusste nichts von alledem über Tony. Er war kein Easy-Listening-Hörer und abgesehen davon noch nie östlich des Mississippi gewesen. Er kam fast frisch von der Highschool, ein adretter Bursche mit mattem braunem Haar, blitzenden braunen Augen und einigermaßen sauberen Fingernägeln. Er war zwar zehn Jahre jünger als Tony, aber schon alt zur Welt gekommen – ein Fels, aus dem man gut eine Kirche bauen konnte, schon von dem Augenblick seiner Geburt an.
Er war einer von jenen Menschen, die gar nicht anders konnten, als zu helfen. Im Alter von zwölf Jahren hatte er eine Sammelaktion organisiert und damit den Weltrekord für die meisten Dosen Maisbrei aufgestellt, die je den Armen gespendet worden waren. Mit fünfzehn hatte ihn das stumme Elend eines Kindes so betroffen gemacht, dass er genug Geld gespart hatte, um jedem Erstklässler in seiner alten Schule ein Küken zu schenken. Durch ein Missverständnis mit der Zeitung, die darüber berichtete, hatten drei Geflügelzüchter aus Indiana seine Spende verdoppelt, dann verdreifacht und vervierfacht. Zweitausend Küken waren in Petes Heimatort eingetroffen, eines für jeden Schüler im gesamten Schulbezirk und drei zusätzliche. Diesen dreien hatte er Tricks beigebracht, die sie in Altenheimen vorführten.
Pete hatte nach der Highschool eigentlich zum Militär gehen wollen, weil sein Vater bei der Army gewesen war, doch dann war ein Loch in seinem Herzen entdeckt worden. Also hatte er am Tag nach seinem Schulabschluss seine Scham in eine Reisetasche gepackt und sich per Anhalter auf den Weg von Oklahoma nach Colorado gemacht.
Dies wollte Pete: eine Firma gründen, die ihm ein so gutes Gefühl gab wie zweitausend Küken. Und dies fürchtete er: dass dieses seltsame Gefühl in seinem Herzen – diese spürbar wachsende Leere – ihn eines Tages umbringen würde.
Colorado ist ziemlich weit weg von fast überall. Die Fahrt wäre also in jedem Fall sehr lang geworden, doch sie kam ihm noch länger vor, weil Pete und Tony, wie viele vom Schicksal vorgesehene Freunde, einander nicht ausstehen konnten.
»Sir«, sagte Pete mehrere Stunden nachdem er das Steuer übernommen hatte und kurbelte sein Fenster herunter. »Könnten Sie damit vielleicht mal eine Pause machen?«
Tony rauchte auf dem Beifahrersitz des Mercury, während der staubige Nachmittag dem Wagen folgte. Pete hielt schon die ganze Zeit nach Straßenschildern Ausschau, die ihm sagen könnten, wie weit es noch war, doch es kamen keine.
»Junge«, erwiderte Tony, »könntest du dich verdammt noch mal ein bisschen entspannen?«
»Wenn ich deshalb so lange am Steuer sitzen muss, weil Sie zu bekifft dazu sind, und Sie mich seit zehn Stunden so vollqualmen, dass ich husten muss, dann … na ja, dann verstehe ich den Sinn nicht ganz.«
Manche Leute empfinden die Wirkung von Marihuana als beruhigend. Manche finden es beruhigend, haben aber an sich etwas gegen das Kiffen. Wieder andere haben an sich nichts dagegen, werden aber von Marihuana eher unruhig und nervös. Und dann gibt es Leute, die sowohl etwas dagegen haben als auch nervös werden. Pete gehörte zu letzterer Gruppe.
»Bist du immer so pedantisch? Warum machst du nicht mal das Radio an?«
Es gab keinen Knopf am Radio. »Das kann ich nicht«, sagte Pete. »Der Drehknopf fehlt.«
Befriedigt entgegnete Tony: »Allerdings, denn ich habe ihn in Ohio aus dem Fenster geschmissen. Ich konnte das Gejammer nicht mehr hören, und deins will ich auch nicht mehr hören. Also, wie wär’s, wenn du deinen jämmerlichen Hundeblick wieder auf die Windschutzscheibe richtest und ein Weilchen die Natur anstarrst?«
Das war ein guter Rat und auch wieder nicht. Hätte irgendetwas Pete von der sich wandelnden Landschaft abgelenkt, dann hätte sie ihn wohl nicht so ergriffen. Doch als Tony endlich mit Rauchen fertig und eingenickt war, gab es nur noch Pete und die freie Natur. Die Landschaft lief den ganzen Tag lang neben dem Auto her, ging von Ebene über in Hügel, dann in Berge und noch höhere Berge und dann, ganz plötzlich, in Wüste.
Die Wüste in dieser Ecke von Colorado ist von der harten Sorte. Weiter südwestlich findet man farbenprächtige Felsen und elegante Säulenkakteen und im übrigen Colorado verschwiegene Berge und Täler, in ihren grünen Kiefernpelz gehüllt. Nein, diese Wüste ist karges Gestrüpp in gelbem Staub und bläuliche, scharfzahnige Berge in der Ferne, die man lieber in Ruhe lässt.
Pete war auf der Stelle verliebt.
Dieser befremdlichen kalten Wüste ist es gleich, ob man in ihr lebt oder stirbt, aber er verliebte sich trotzdem in sie. Er hatte nicht geahnt, dass irgendein Ort so rau und so unmittelbar sein konnte, so dicht an der Oberfläche. Sein schwaches Herz spürte die Gefahr sehr wohl, konnte jedoch nicht widerstehen.
Er verliebte sich so heftig, dass selbst diese Wüste es bemerkte. Sie war nur beiläufige Affären mit durchreisenden Fremden gewohnt und stellte seine Zuneigung gleich grausam auf die Probe, indem sie einen Sandsturm aufwirbelte. Staub warf sich gegen den Wagen, kroch durch die Spalten an den Fenstern herein und trieb sich an den Ecken des Armaturenbretts herum. Pete musste anhalten, um Steppenläufer und Zweige aus dem Kühlergrill des Mercury zu entfernen und Sand aus seinen Stiefeln zu schütteln, doch seiner Liebe tat das keinen Abbruch. Die Wüste war noch nicht überzeugt und ließ als Nächstes die volle Macht der Sonne auf Pete und Tony herabbrennen. Die Hitze im Wageninneren stieg und stieg. Das Armaturenbrett knackte in der prallen Sonne, und das Lenkrad in Petes Händen wurde heiß wie geschmolzenes Eisen. Doch während Pete der Schweiß in den Kragen rann und sein Mund verdorrte, war er so verliebt wie zuvor. Der Nachmittag wurde alt, und die zynische Wüste zog jedes bisschen Regen, das sie finden konnte, am Himmel im Norden des Mercury zusammen. Dieser Regen wälzte sich als Sturzflut heran und überzog den Highway mit klebrigem Matsch. Und dann im letzten Abendlicht ließ die Wüste die Temperatur plötzlich unter null Grad fallen. Der Matsch gefror, taute wieder an, überlegte es sich dann anders und gefror erneut. Diese Unentschlossenheit sprengte einen Spalt in den Asphalt, in den der Mercury hineinfiel.
Tony fuhr aus dem Schlaf. »Was ist los?«
»Wetter«, entgegnete Pete.
»Wetter ist mir, wie alle Nachrichten, am liebsten«, bemerkte Tony, »wenn es jemand anderem passiert.«
Pete hatte Schwierigkeiten, die Tür zu öffnen, denn das Auto stand in einem unnatürlichen Winkel zur Straße. »Übernehmen Sie das Lenkrad.«
Er stieg aus, um zu schieben, und Tony zog sich die Schuhe an und rutschte hinüber auf den Fahrersitz. Die Wüste sah zu, wie Pete sich abmühte, den Mercury aus dem Spalt in der Straße zu befreien, indem er sich mit der Schulter gegen die hintere Stoßstange stemmte. Die durchdrehenden Reifen bespritzten seine Beine mit einer kalten Schicht aus feuchtem Gold.
»Schiebst du überhaupt, Junge?«, rief Tony zu ihm hinaus.
»Ja, Sir.«
»Bist du sicher, dass du nicht ziehst?«
»Wir können gern tauschen«, erwiderte Pete.
»Da ist eine riesige Lücke zwischen können und sollten«, entgegnete Tony, »und ich bin nicht scharf darauf, sie zu schließen.«
Endlich sprang der Mercury in die Freiheit. Petes Blick folgte jedoch nicht dem rollenden Fahrzeug, sondern dem vielschichtigen und komplizierten Horizont der Wüste. Die allerletzten Sonnenstrahlen tanzten darüber hinweg, und von jedem Grashalm tropfte honigfarbenes Licht. Sein Rücken schmerzte, und an seinen Armen kribbelte Gänsehaut, aber er genoss den Anblick und jeden tiefen, wacholderduftenden Atemzug, und er war immer noch vernarrt.
Die Wüste, so wenig mitfühlend oder gar sentimental, war gerührt, und zum ersten Mal seit langer Zeit erwiderte sie eines Menschen Liebe.
Erst Stunden später, als es dunkel geworden war, brachte Pete den Mut auf, Tony nach dem Ziel seiner Reise zu fragen. Zuvor war ihm das nicht wichtig erschienen, denn sie hatten sich in jenem Teil von Kansas getroffen, den man nur loswurde, indem man weiter nach Westen fuhr. Also war klar gewesen, dass sie zumindest erst einmal denselben Weg haben würden.
»Colorado«, antwortete Tony.
»Wir sind in Colorado.«
»Bei Alamosa.«
»Wir sind bei Alamosa.«
»Bicho Raro«, sagte Tony.
Pete starrte ihn so erstaunt an, dass der Mercury ebenfalls einen Schlenker machte. »Bicho Raro?«
»Habe ich gestottert oder so?«
»Nein, nur … da will ich auch hin.«
Tony zuckte mit nichts als den dichten schwarzen Brauen und blickte aus dem Fenster auf nichts als die dichte schwarze Nacht.
»Was?«, fragte Pete. »Sie glauben nicht, dass das Zufall ist?«
»Zufall, dass du nicht mitten in der Wüste aussteigen und zu Fuß weitergehen willst? O ja, das reinste Wunder, Junge.«
Weil Pete ein grundehrlicher Mensch war, dauerte es eine ganze Weile, bis er dahinterkam, was Tony gemeint hatte. »Hören Sie, Sir, ich habe den Brief von meiner Tante hier in meiner Brusttasche. Sie können gern nachsehen – ich bin unterwegs nach Bicho Raro.«
Er fischte den Brief aus seiner Hemdtasche, und der Mercury machte wieder einen Schlenker.
Tony warf einen flüchtigen Blick darauf. »Das waren wohl eher deine Mathe-Hausaufgaben.«
Pete stellte fest, dass der tagelange schweißtreibende Marsch am Highway entlang den letzten Brief seiner Tante Josefa völlig verschmiert hatte. Tony mochte es egal sein, aber Pete war die Unterstellung, er sage nicht die Wahrheit, er sei ein Schnorrer, beinahe unerträglich.
»Ich will über den Sommer da arbeiten. Meine Tante war vor ein paar Jahren dort zu Besuch. Jetzt wohnt sie bei Fort Collins, aber damals war sie – also, das brauche ich Ihnen eigentlich nicht zu erzählen, aber sie steckte echt in der Klemme, und sie sagt, die Leute da hätten ihr geholfen. Sie hat mir geschrieben, dass es da einen Lastwagen gibt, den ich haben könnte, und dass ich den Kaufpreis abarbeiten darf.«
Tony blies noch mehr Rauch aus. »Was zum Teufel willst du denn mit einem Lastwagen?«
»Ich werde eine Umzugsfirma gründen.« Während Pete das aussprach, blitzte in seiner Fantasie das Logo auf: WYATTMOVING, mit einem freundlich dreinschauenden blauen Ochsen, der sich in sein Joch stemmte.
»Ihr jungen Leute habt heutzutage schon seltsame Ideen.«
»Das ist eine gute Idee.«
»Eine Umzugsfirma, das ist dein Lebensziel?«
»Es ist eine gute Idee«, wiederholte Pete. Er umklammerte das Lenkrad fester und fuhr ein paar Minuten lang schweigend weiter. Die Straße war pfeilgerade, gesäumt von den immer wieder gleichen Holzpfosten mit Stacheldraht daran, und der Himmel war traumschwarz. Die Wüste konnte er nicht sehen, aber er wusste, dass sie noch da draußen war. Dieses Loch in seinem Herzen spürte er ganz deutlich. »Und warum wollen Sie nach Bicho Raro?«
Dies war die Wahrheit: Jeden Morgen, ehe Tony sich dazu überwand, frisch! freundlich! fabelhaft! zu einer weiteren Sendung ins WZIZ-Studio zu gehen, fuhr er quer durch Philadelphia nach Juniata. Dort parkte er in der Nähe des Parks, wo er umgeben war von Menschen, die mit Gewissheit nicht wussten, wer er war. Viele Leute finden dieses Gefühl unangenehm, aber für Tony, der das Gefühl hatte, unter einem Mikroskop zu leben, war es eine Erleichterung. Ein paar Minuten lang war er Tony DiRisio und nicht Tony Triumph. Dann ließ er den Wagen wieder an und fuhr zur Arbeit.
Eines Morgens vor einigen Wochen hatte eine Frau ans Seitenfenster geklopft. Es regnete, und sie hielt sich eine Einkaufstüte über den Kopf, um ihre Locken zu schützen. Sie war um die fünfzig und die Sorte Frau, die Tony normalerweise in seine Sendung eingeladen hätte, doch diese Dame war keine ruhmgierige Hausfrau. Nein, sie erklärte ihm, ihre Familie habe das besprochen und sei zu dem Schluss gekommen, dass er die Familie Soria aufsuchen müsse. Tony konnte ihre Familie sehen, in einigen Metern Entfernung hinter ihr aufgereiht, während sie als Haushaltsvorstand abgesandt worden war, um ihm diese Mitteilung zu machen. Sie wüssten, wer er sei, und es gefiele ihnen gar nicht, ihn so zu sehen. Die Sorias lebten nicht mehr in Mexiko, also brauchte er nicht einmal die Grenze zu überqueren. Er brauchte nur nach Westen zu fahren und mit dem Herzen nach einem Wunder zu lauschen. Die Sorias würden ihm die Änderung geben, die er brauchte.
Tony hatte der Frau erklärt, es ginge ihm gut. Kopfschüttelnd hatte sie ihm ein Stofftaschentuch gereicht, ihm die Wange getätschelt und sich dann zurückgezogen. Trockenen Auges hatte Tony das Taschentuch umgedreht und auf der Rückseite, mit Filzstift geschrieben, die Worte Bicho Raro, Colorado gefunden.
Was Tony nun Pete fragte: »Bist du abergläubisch, Junge?«
»Ich bin Christ«, entgegnete Pete pflichtbewusst.
Tony lachte. »Ich habe mal einen Kerl gekannt, der alle möglichen haarsträubenden Geschichten hier draußen in dieser Wüste erlebt haben wollte. Hat behauptet, es gäbe lauter seltsame Lichter – von fliegenden Untertassen vielleicht. Und dass sich Mottenmänner und Gestaltwandler und alle möglichen Untiere nachts hier draußen rumtreiben würden. Pterodaktylen.«
»Lastwagen.«
»Du bist echt ein Spielverderber.«
»Nein, da.« Pete deutete in die Nacht. »Sieht das da drüben nicht aus wie ein Lastwagen?«
Pete wusste es zwar nicht, doch er deutete auf ebenjenen Laster, um dessentwillen er den weiten Weg hierhergekommen war. Den Laster, in dem sich gegenwärtig die drei Sorias befanden, darunter die Soria-Cousine, in die er sich verlieben würde. Während er angestrengt ins Dunkel starrte, schloss sich die Ladeklappe des Lasters, und das Licht erlosch. In der daraus resultierenden Finsternis war Pete nicht mehr sicher, ob er überhaupt etwas gesehen hatte.
»Echsenmenschen«, bemerkte Tony. »Höchstwahrscheinlich.«
Doch auch Tony hatte etwas bemerkt. Nicht draußen, sondern in sich drin. Ein seltsames Zupfen. Plötzlich erinnerte er sich daran, was die Frau gesagt hatte – dass er nach Wundern lauschen solle. Nur dass lauschen nicht genau das beschrieb, was er jetzt tat. Er hörte nichts. Er nahm kein Geräusch wahr oder ein Lied. Seine Ohren taten rein gar nichts. Sondern ein geheimnisvoller Teil von ihm, den er vor jener Nacht noch nie benutzt hatte und danach nie wieder benutzen würde.
Tony sagte: »Ich glaube, wir sind fast da.«
3
Bicho Raro war ein Ort seltsamer Wunder.
Als der Mercury auf den Hof knirschte und mit einem letzten Schlingern zum Halten kam, erblühte und erstarb ein Staubwölkchen um die Stoßstange. Der eidottergelbe Kombi stand inmitten einer Ansammlung von Hütten und Zelten, Scheunen und Häusern und windschiefen Schuppen, die sich zu einem Kreis zusammendrängten. Autos schienen in alten Stacheldraht geraten und verstorben zu sein, rostige Gerätschaften versanken im Damm um den kleinen Teich. Im nächtlichen Dunkel verschwamm fast alles bis zur Unkenntlichkeit. Eine einsame Lampe leuchtete an einem Hauseingang. Schatten huschten und flatterten darum herum, die wie Motten oder Vögel aussahen. Es waren weder Motten noch Vögel.
Vor den Sorias war Bicho Raro praktisch gar nichts gewesen, nur der Ellbogen einer riesigen Rinderfarm, die wesentlich mehr Weideland als Rinder besaß. Ehe die Sorias Mexiko verlassen hatten, vor der Revolution, hatte man sie Los Santos de Abejones genannt. Hunderte von Pilgern waren zu ihnen gekommen, um sich Segen oder Heilung zu erbitten. Die Pilger hatten rund um den winzigen Ort Abejones kampiert, kilometerweit, bis zum Fuß der Berge. Fliegende Händler hatten Gebetskärtchen und Glücksbringer an die Wartenden verkauft. Legenden hatten sich aus dem Örtchen hinausgeschlichen, in Satteltaschen oder im Beutel eines Pilgers davongetragen, oder in Balladen hineingeschrieben, die spät nachts in Bars gespielt wurden. Wundersame Wandlungen und schreckliche Taten – offenbar spielte es keine Rolle, ob die Geschichten gut oder schlecht waren. Solange sie interessant waren, zogen sie Menschenmengen an. Und diese leidenschaftlich bewegten Menschen hatten Kinder nach Los Santos getauft und in ihrem Namen Kampftruppen aufgestellt. Die damalige mexikanische Regierung war davon nicht begeistert gewesen und hatte die Sorias vor die Wahl gestellt, entweder mit dem Wunderwirken aufzuhören oder schon mal um ein Wunder zu ihrer eigenen Rettung zu beten. Die Sorias hatten sich Hilfe suchend an die Kirche gewandt, doch die damalige katholische Kirche war von den dunkleren Wundern nicht begeistert gewesen und hatte den Sorias ebenfalls geraten, mit dem Wunderwirken aufzuhören oder schon mal um ein Wunder zu ihrer eigenen Rettung zu beten.
Doch die Sorias waren zu Heiligen geboren.
Im Schutz der Dunkelheit waren sie aus Mexiko hinausmarschiert und weitergegangen, bis sie einen anderen Ort vor hohen Bergen gefunden hatten, an dem es still genug war, um Wunder hören zu können.
Das war die Geschichte von Bicho Raro.
»Da sind wir, mein Junge«, sagte Tony und stieg mit einer Spur seiner gewohnten Großspurigkeit aus dem Mercury. Am Ende einer Fahrt von zweitausend Meilen angekommen zu sein verleiht doch eine gewisse Zuversicht, so ungewiss der nächste Anfang auch sein mag.
Pete blieb mit heruntergekurbeltem Fenster am Steuer sitzen. Es gab zwei Gründe für sein Zögern. Erstens hatte er in Oklahoma die Erfahrung gemacht, dass Orte wie dieser oft von frei laufenden Hunden bevölkert waren, und er hatte zwar nicht direkt Angst vor Hunden, war jedoch als Kind von einem gebissen worden und mied Situationen, in denen große Säugetiere auf ihn zustürmten. Und zweitens hatte er erkannt, dass Bicho Raro gar kein richtiges Städtchen war, wie er geglaubt hatte. Es gab gewiss kein Motel, in dem er übernachten, und kein öffentlich zugängliches Telefon, von dem aus er seine Tante anrufen könnte.
»Du wirst irgendwann aussteigen müssen«, sagte Tony zu ihm. »Ich dachte, du wolltest hierher. Beide dasselbe Ziel, hast du behauptet! Ich schwöre, meine Tante hat mir gesagt, dass ich immer weiterlaufen soll, bis ich einen Mercury finde, hast du gesagt! Und hier sind wir, also!«
In diesem Moment kamen die Hunde angeschossen.
Wenn auf einem Hof Hunde angerannt kommen, erscheint meist bald jemand aus dem Haus und versichert beruhigend, bellende Hunde würden nicht beißen, sie sähen vielleicht wüst aus, seien aber im Grunde Schmusekätzchen. Tun keiner Seele was zuleide. Ganz liebe Familienhunde. Besucher fühlen sich daraufhin wohler in der Gewissheit, dass diese Hunde hauptsächlich als Alarmanlagen gehalten werden und um Raubtiere abzuschrecken.