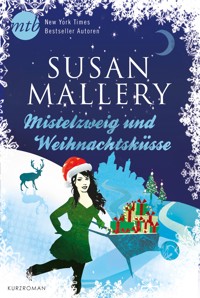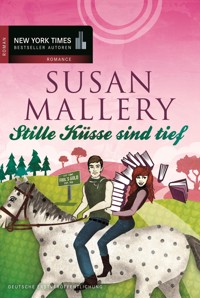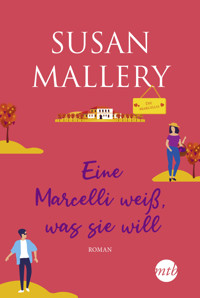8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Blackberry Island
- Sprache: Deutsch
Sie waren die besten Freundinnen, bis ein Verrat sie auseinanderriss. Michelle verließ die idyllische Heimatinsel, Carly blieb - mit dem Mann, den eigentlich Michelle liebte. Nach zehn Jahren führt ein Erbe Michelle zurück. Als sie das in Schwierigkeit steckende Hotel Blackberry Island Inn betritt, das ihr Vater ihr vermacht hat, steht sie unerwartet Carly gegenüber. Nur mit Carlys Hilfe, deren Leben inzwischen eng mit dem Inn verwoben ist, kann Michelle den Familienbetrieb retten. Aber können die beiden Frauen nach all den tiefen Wunden an einem Strang ziehen? "Vielschichtig und bewegend, intensiv und so mitreißend, dass man das Buch nicht aus der Hand legen kann!" Publishers Weekly "Alles über die heilende Kraft einer Freundschaft." Library Journal
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 526
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Susan Mallery
Wie zwei Inseln im Meer
Roman
Aus dem Amerikanischen von Valerie Schneider
HarperCollins®
HarperCollins® Bücher
erscheinen in der HarperCollins Germany GmbH,
Valentinskamp 24, 20354 Hamburg
Geschäftsführer: Thomas Beckmann
Copyright © 2016 by HarperCollinsin der HarperCollins Germany GmbH
Titel der nordamerikanischen Originalausgabe:Barefoot Season
Copyright © 2012 by Susan Macias Redmonderschienen bei: Mira Books, Totonto
Published by arrangement with
Harlequin Enterprises II B.V./S.àr.l.
Konzeption/Reihengestaltung: fredebold&partner GmbH, Köln
Umschlaggestaltung: büropecher, Köln
Redaktion: Mareike Müller
Titelabbildung: Thinkstock / Getty Images, München
ISBN eBook 978-3-95967-963-3
www.harpercollins.de
eBook-Herstellung und Auslieferung:
readbox publishing, Dortmund
www.readbox.net
Alle Rechte, einschließlich das des vollständigen oder auszugsweisen Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten.
Der Preis dieses Bandes versteht sich einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Alle handelnden Personen in dieser Ausgabe sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen wären rein zufällig.
Für alle Frauen, die Militärdienst leisten und ihr Zuhause, Freunde und Familie zurücklassen. Dieses Buch ist für euch, in Dankbarkeit, Liebe und Respekt.
Ein besonderer Dank geht an Sergeant Betty Thurman, die mir bereitwillig von ihren persönlichen Erfahrungen erzählt hat. Jegliche inhaltlichen Fehler in diesem Roman sind meine.
Und an Specialist Jeanette Blanco, die das Buch „auf Herz und Nieren geprüft“ hat. Vielen Dank für deine Anmerkungen und Einsichten. Ein Fool’s-Gold-Cheerleader-High-Five! Du bist die Beste!
1. KAPITEL
„Ich ziehe morgen in den Krieg. Gut möglich, dass ich nie wieder zurückkomme.“
Michelle Sanderson wandte langsam die Aufmerksamkeit von dem fünf Jahre alten Pick-up ab, den sie zu kaufen erwog, und drehte sich zu dem jungen Burschen um, der neben ihr stand.
Er war noch ein Teenager, vielleicht achtzehn oder neunzehn Jahre alt, und hatte rotes Haar und Sommersprossen. Eigentlich war er ganz süß, nur viel zu jung. Seine Gliedmaßen waren jugendlich schlaksig und sein Brustkorb wollte erst ausgefüllt werden. Auch wenn er vermutlich bereits mehr Mann als Junge war, der Wandel war noch nicht völlig vollzogen.
„Entschuldigung“, sagte sie, überzeugt, ihn missverstanden zu haben. „Was hast du gesagt?“
Er grinste breit und zwinkerte ihr zu. „Ich mach’s vielleicht nicht mehr lange. Wenn du den Wagen gekauft hast, könnten wir doch zusammen was trinken gehen oder so, meinen Einstieg in die Army feiern.“
„Es ist zwei Uhr nachmittags.“
„Wir könnten auch einfach zu mir nach Hause gehen.“
Michelle wusste nicht, ob sie laut loslachen oder ihm zu verstehen geben sollte, was für ein Idiot er war, und zwar so, dass er danach heulen würde wie ein kleines Mädchen. Letzteres wäre ein Leichtes für sie. Sie hatte selbst zehn Jahre in der Army gedient, beinahe die Hälfte davon im Irak und in Afghanistan. Dort waren ihr diese notgeilen jungen Typen, die sich für unwiderstehlich hielten, im Überfluss begegnet. Mit der Zeit war sie richtig gut darin geworden, ihnen klarzumachen, dass sie falschlagen.
Loslachen wäre ein wenig schwerer. Hauptsächlich, da ihr ganzer Körper schmerzte. Nicht nur ihre Hüfte, die als Entschuldigung eine Begegnung mit ein paar Kugeln von bewaff-neten Rebellen vorzuweisen hatte, woraufhin ihr eine Teilgelenkprothese eingesetzt werden musste – nein, alles tat ihr weh. Sie dachte lieber nicht darüber nach, wie viel Zeit sie im Krankenhaus zugebracht hatte. Der Körper heilt in seinem eigenen Tempo, hatte ihr Physiotherapeut gesagt. Dennoch hatte sie versucht, schneller wieder auf die Beine zu kommen – was ihr lediglich drei weitere Nächte im Krankenhausbett beschert hatte, bevor sie endlich entlassen wurde.
„Bin ich nicht ein bisschen zu alt für dich?“, fragte sie.
Er zwinkerte ihr zu. „Erfahren nenne ich das.“
Trotz der Schmerzen schaffte sie es, kurz zu lachen. „Verstehe. Du suchst also eine, die dir deine schmutzigen Fantasien erfüllt, ja?“
„Du weißt Bescheid.“
Er ist so erwartungsvoll, dachte sie und fühlte sich sogleich noch ermatteter. Und ganz offensichtlich hatte er den Sehtest bisher nicht absolviert. Ihr war vollkommen bewusst, dass sie nicht in Bestform war. Ihr blasser, allzu dünner Körper verriet, wie lange sie in einem Krankenhausbett gelegen hatte. Sie hatte dunkle Augenringe und ihre Gesichtsfarbe war zu grau, um als normal durchzugehen, und zum Laufen brauchte sie eine Krücke. Was nur mal wieder bewies, wie hormongesteuert junge Männer waren.
Ehe sie dazu kam, sich zu überlegen, wie sie seine Einladung ausschlagen konnte, preschte ein heller Labrador um die Ecke des Hauses. Der Hund jagte auf sie zu und sprang kurz vor ihr in die Höhe. Michelle musste schnell einen Schritt zur Seite tun, damit sie nicht von ihm umgeworfen wurde. Bei der abrupten Bewegung wurde ihre Hüfte belastet und stechender Schmerz schoss durch ihren Körper.
Einen Moment lang drehte sich alles um sie. Ihr wurde schwarz vor Augen und Übelkeit stieg in ihr auf.
Bitte entweder das eine oder das andere, dachte sie, während sie verzweifelt versuchte, bei Bewusstsein zu bleiben. Aber bitte nicht beides auf einmal. Ein überraschend starker Arm legte sich um ihren Körper und hielt sie fest.
„Buster, runter mit dir.“
Sie musste ein paar Mal blinzeln, bis sie an diesem kühlen, feuchten Nachmittag wieder klar sehen konnte. Der brennende Schmerz in ihrer Hüfte ließ so weit nach, dass sie wieder Luft bekam. Der junge Bursche stand nun so nahe bei ihr, dass sie die Sommersprossen auf seiner Nase und eine kleine Narbe auf seiner rechten Wange erkennen konnte.
„Alles in Ordnung?“, fragte er.
Sie nickte.
Er trat zurück und musterte sie. Der Hund blieb auf Abstand, seine Augen waren dunkel vor Beunruhigung, leises Jaulen verriet seine Besorgnis.
Michelle hielt ihm die Hand hin. „Alles okay, Buster. Mir geht’s gut.“
Der Hund kam zu ihr und schnüffelte an ihren Fingern, bevor er sie kurz ableckte.
„Hey, das hatte ich doch vor“, meinte der Junge und lachte unsicher.
Michelle lächelte. „Sorry, er ist mehr mein Typ.“
„Du bist verletzt.“
Sie hob ihre Krücke leicht an. „Hast du das hier für ein modisches Accessoire gehalten?“
„Die habe ich gar nicht richtig bemerkt.“
Das bestätigte ihre Theorie über seine schlechten Augen. „Ist bloß eine Fleischwunde.“ Genau genommen war nicht nur ihre Haut betroffen, sondern auch ein paar Knochen und Sehnen, doch wozu ins Detail gehen?
Sein Blick glitt zu den Army-Seesäcken auf dem Gehsteig, zu ihrer Krücke und schließlich zurück zu ihr. „Warst du drüben?“, fragte er.
„Drüben“, das konnten tausend Orte sein, sie wusste jedoch, was er meinte, und nickte.
„Krass, Mann. Wie war’s, hattest du Angst? Glaubst du …?“ Er schluckte und lief rot an. „Glaubst du, ich kann’s dort schaffen?“
Sie wollte Nein sagen. Dass es so viel leichter für ihn wäre, das College zu besuchen und mit seinen Freunden rumzuhängen. Dass es sicherer wäre. Und bequemer. Aber der einfachste Weg war oft nicht der beste, und einige Leute waren bereit, jeden Preis zu zahlen, um Teil von etwas Sinnvollem zu sein.
Ihre Gründe, der Army beizutreten, waren weit weniger altruistisch gewesen, aber mit der Zeit war auch sie zur Soldatin geformt worden. Das Kunststück würde nun darin bestehen, den Weg zurückzufinden.
„Du kriegst das schon hin“, erwiderte sie und hoffte, dass sie recht hatte.
„Wie ein richtiger Held?“, fragte er grinsend und schlug mit der Hand gegen den Pick-up. „Okay, du hast echt alles getan, um mich zu verwirren – so sexy und dann auch noch eine Kriegsveteranin. Ich lass mich trotzdem nicht aus dem Konzept bringen. Ich will zehntausend, keinen Penny weniger.“
Sexy? Das brachte sie nun wirklich zum Lachen. Zurzeit würde sie wohl nicht mal für einen neunzigjährigen Greis als Trophäe durchgehen. Aber hey, so ein Kompliment war doch immer nett zu hören.
Sie wandte ihre Aufmerksamkeit wieder dem Wagen zu. Er war recht gut in Schuss, hatte ziemlich neue Reifen und nur wenige Beulen. Der Kilometerstand war niedrig genug, dass sie ihn noch ein paar Jahre würde fahren können, bevor sie anfangen müsste, Teile zu ersetzen.
„Zehn sind viel zu viel“, entgegnete sie. „Ich zahle in bar. Und ich dachte eher an achttausend.“
„Acht?“ Er presste in gespielter Dramatik die Hände auf sein Herz. „Du willst mich wohl umbringen. Willst du das einem zukünftigen Helden wirklich antun?“
Leise lachte sie. „Komm schon, Kleiner. Wir unternehmen jetzt eine Spritztour mit deiner Liebsten und fahren bei einem Mechaniker-Freund von mir vorbei. Wenn er sagt, der Pick-up ist in Ordnung, gebe ich dir neun fünf und du hast ein Geschäft gemacht.“
„Deal.“
Zwei Stunden später setzte Michelle den Typen – Brandon hieß er – wieder an seinem Haus ab. Ein Mechaniker auf der Militärbasis, den sie kannte, hatte ihr grünes Licht für den Wagen gegeben und sie hatte Brandon einen sortierten Packen brandneuer Scheine überreicht. Im Gegenzug hatte er ihr die Papiere für das Auto sowie die Schlüssel in die Hand gedrückt.
Als sie nun losfuhr, begutachtete sie den grauen Himmel. Sie war unverkennbar zurück im westlichen Teil von Washington State, wo es so viel regnete, dass ein sonniger Tag die Schlagzeilen der Lokalnachrichten beherrschte. Gepäck unter freiem Himmel zu transportieren war hier riskant, und sie hatte ihre zwei Seesäcke auf die offene Ablage des Pick-ups geschmissen. Doch sie entschied, dass die Wolken eher faul als bedrohlich aussahen. Ihr Gepäck würde während der Fahrt nach Hause einigermaßen in Sicherheit sein.
Nach Hause. Dorthin war es ein weiter Weg von dem Ort aus, an dem sie die letzten zehn Jahre verbracht hatte. Blackberry Island, eine Insel in der Bucht des Puget Sound, die über eine lange Brücke mit dem Festland verbunden war, mochte zwar theoretisch in Pendler-Entfernung von Seattle liegen, dennoch lagen Welten dazwischen. Das einzige Städtchen auf der Insel pries sich selbst als das „Neu-England der Westküste“ an. Ein Verkaufsargument, das sie nie ganz hatte nachvollziehen können.
Die Insel war touristisch und ruhig zugleich, die Uhren gingen dort langsamer. Es gab ein paar hübsche Geschäfte, und alles, was mit den Brombeeren zu tun hatte, die der Insel den Namen gaben, wurde gefeiert. Sie hatte diese Traditionen stets albern gefunden und der Rhythmus der Jahreszeiten kam ihr auf mühsame Weise aus dem Takt geraten vor. Zumindest früher. Doch was sie damals nicht zu schätzen gewusst hatte, erschien ihr nun umso reizvoller.
Sie verlagerte ihr Gewicht auf dem Sitz, der Schmerz in ihrer Hüfte war stärker denn je. Ihr Physiotherapeut hatte geschworen, dass es besser werden würde, dass ihre Wunden schneller heilten als erwartet. Sie war den Genesungsprozess jedoch schon leid – er dauerte ihr viel zu lange. Ihr Körper ließ sich allerdings nicht antreiben.
Sie fand den Weg zur Hauptstraße und dann zum Freeway, dort reihte sie sich in die Kolonne der Fahrzeuge ein, die in Richtung Norden rollte. Sie war überrascht von der Menge der Autos und davon, wie geordnet sie sich fortbewegten. Die letzten Jahre war sie schwere Militärfahrzeuge gewöhnt gewesen, keine SUVs und Sportwagen. Die feuchte, kühle Luft war noch etwas, das sie vergessen hatte. Sie schaltete die Heizung an und wünschte, sie hätte daran gedacht, eine Jacke auszupacken. Dass bereits Mai war, hatte nichts zu bedeuten. Jahreszeiten waren etwas für Weicheier, der Sommer erreichte diesen Teil des Landes erst spät. Glücklicherweise jedoch kamen die Touristen dennoch früh.
Sie wusste, was sie die nächsten vier Monate über erwartete. Vom Memorial Day bis hin zum Labor Day würde die Insel vor Besuchern überlaufen. Sie besuchten das Eiland wegen der Bootsfahrten, der berühmten Puget-Sound-Kraniche und der Brombeeren. Blackberry Island war – was sagt man dazu – die Hauptstadt der, nun ja, der Westküste. Die Urlauber bevölkerten die Restaurants und kauften allen möglichen Schnickschnack und Handgearbeitetes. Und sie aßen Brombeeren.
Sie streuten sie auf ihre Pancakes, in Salate und in und auf jegliche Gerichte, die dem Menschen bekannt sind. Sie kauften Brombeer-Eiscreme von Straßenhändlern und Brombeer-Cookies an Ständen. Sie erwarben Geschirrtücher und Tassen mit Brombeer-Motiven und probierten die fragwürdigen Ergebnisse des jährlichen Brombeer-Chili-Kochwettbewerbs. Und das Beste war, dass sie jedes Zimmer im Umkreis von fünfzig Meilen füllten. Einschließlich der Zimmer des Blackberry Island Inn.
Michelle konnte das fröhliche Klingeln praktisch hören, mit dem sich das Bankkonto für das Hotel füllte. Wie die meisten Unternehmen auf der Insel erwirtschaftete es den Großteil seiner Einnahmen während dieser vier Monate. Die Tage würden lang sein, die Stunden endlos, die Arbeit ermüdend, doch nachdem sie so lange fort gewesen war, konnte sie es kaum erwarten, sich wieder in all das hineinzustürzen. An den einen Ort zurückzukehren, bei dem sie sich darauf verlassen konnte, dass er sich niemals veränderte.
„Ist sie schon da?“
Damaris stand an der Türschwelle zu Carly Williams’ Büro.
Carly blickte von der Willkommenskarte auf, die sie gerade gestaltete. Ein Teil des besonderen Charmes, den das Blackberry Island Inn seinen Gästen bot, war die persönliche Note. Carly sammelte Informationen über ihre Gäste, bevor diese anreisten, und legte dann einen handgefertigten Willkommensgruß in ihr Zimmer. Die Banners – ein älteres Paar –, die herkommen wollten, um Vögel zu beobachten und Weinproben zu besuchen, hatten erwähnt, wie sehr sie das Meer liebten. Carly hatte dafür gesorgt, dass sie ein Zimmer kriegten, das nach Westen hinausging, und bastelte nun eine Karte mit einem Foto von der Blackberry-Bucht bei Sonnenuntergang.
Reste von bunten Bändern und Spitze lagen auf ihrer Schreibunterlage verteilt. Ein Klebestift stand vor ihr, daneben lag ihre ramponierte Pinzette. Sie rieb gedankenverloren an einem winzigen Glitzerpunkt auf ihrem Handrücken herum.
„Sie ist noch nicht hier“, meinte sie zu Damaris. Dann lächelte sie die Köchin an. „Ich hab doch gesagt, ich gebe dir Bescheid, wenn sie eintrifft.“
Damaris seufzte. Ihre Brille war ihr ein Stück die Nase heruntergerutscht, was ihrem Gesicht einen geistesabwesenden Ausdruck verlieh. Neu angestellte Kellner hatten wegen ihres leicht zerstreuten Erscheinungsbilds schon oft darauf geschlossen, dass sie es nicht bemerkte, wenn jemand zu spät zur Arbeit kam oder den Gästen keinen frischen Kaffee nachschenkte, sobald die den ersten Schluck getrunken hatten. Ein Fehler, den sie stets bereuten.
„Ich dachte eigentlich, sie würde um die Zeit bereits da sein“, gestand Damaris. „Ich habe sie so vermisst, sie war so lange nicht hier.“
„Das stimmt“, murmelte Carly, die lieber nicht darüber nachdenken wollte, wie sehr sich ihr Leben verändern würde, wenn Michelle zurückkehrte. Obwohl sie sich in Erinnerung rief, dass sie diejenige war, die man verletzt hatte, änderte das nichts an ihren Magenkrämpfen.
Jetzt ist alles anders, sagte sie sich. Sie war hier zuständig und hatte die letzten drei Monate das Inn selbstständig geführt. Sie war eine wertvolle Bereicherung für das Blackberry Island Inn. Wenn Michelle das nur auch so sehen würde.
Damaris betrat das Büro und setzte sich auf den Stuhl auf der anderen Seite ihres Schreibtisches.
„Ich weiß noch genau, wie sie mich eingestellt hat“, sagte die über fünfzigjährige Köchin seufzend. „Wie alt war sie damals? Sechzehn? Ich hatte bereits Kinder, die älter waren als sie. Sie saß da, wo du jetzt sitzt, und hatte solch einen Bammel. Ich konnte sehen, wie sie zitterte.“ Ihre runzeligen Lippen verzogen sich zu einem Lächeln. „Sie hatte sich ein Anleitungsbuch für Bewerbungsgespräche aus der Bibliothek ausgeliehen. Sie versuchte es unter ein paar Papieren zu verstecken, doch ich habe es gesehen.“
Damaris wurde ernst und kniff leicht die dunklen Augen zusammen. „Eigentlich hätte ihre Mutter sich um diese Dinge kümmern müssen, aber das hat sie nie. Michelle dagegen hat dieses Haus immer geliebt.“
Carly atmete tief durch. Sie und Damaris hatten schon so häufig über Mutter und Tochter gestritten. Carly gab bereitwillig zu, dass Brenda ihre Schwächen hatte, doch sie war auch diejenige gewesen, die sie gerettet hatte, die ihr einen Job und eine Aufgabe gegeben hatte. Carly hatte ihr einiges zu verdanken. Was jedoch Michelle anging …
„Ich hoffe, die Neuerungen werden ihr gefallen“, sagte sie, um das Gespräch in eine andere Richtung zu lenken. Die Anspannung, die ihr die Brust einschnürte, war bereits so groß, dass sie sich immer wieder bewusst entspannen musste, um tief durchatmen zu können. Sie brauchte gerade nicht noch mehr Stress in ihrem Leben. „Du hast ihr doch erzählt, was wir alles gemacht haben, oder?“
„Ich schreibe ihr jeden Monat“, erwiderte Damaris schnaubend. „Nicht, dass ihre eigene Mutter das jemals getan hätte.“
So viel dazu, das Gespräch in eine andere Richtung lenken zu wollen, dachte Carly. Sie gab jedoch nicht auf. „Deine Brombeer-Scones sind so beliebt bei den Gästen. Ich habe überlegt, sie am Sonntagmorgen in Tütchen zum Verkauf anzubieten. Dann könnten unsere Gäste ein paar mit nach Hause nehmen. Was meinst du? Wäre das zu viel Arbeit für dich?“
Damaris entspannte sich sichtlich auf ihrem Stuhl. „Ich könnte schon mehr davon backen. Das wäre kein großer Aufwand.“
„Wir könnten sie in Vierer- und Zehnerpackungen anbieten. Benutz doch die hübsche Plastikfolie, die wir angeschafft haben.“
Damaris hatte genau im Kopf, wie viel die Produktion eines Scones kostete, die Preiskalkulation war also schnell gemacht. Carly hätte gerne auch eine Rezeptkarte beigelegt, doch sie hütete sich, Damaris danach zu fragen. Die Köchin verteidigte ihre Rezepte wie eine Tigermama ihre Jungen – mit Zähnen und Klauen.
„Ich gehe mal nachsehen, ob sie da ist“, sagte Damaris und stand auf.
Carly nickte und folgte ihr widerwillig. Es würde sich einiges im Inn verändern – das war nun nicht länger zu verdrängen, auch wenn sie sich alle Mühe gegeben hatte. Brenda war nicht mehr da und Michelle kam zurück. Das genügte schon, um das Kräfteverhältnis zu ändern, doch es gab weitere Komplikationen. Niemand, der zehn Jahre fort war, ist noch derselbe Mensch. Ihr war daher klar, dass Michelle anders sein würde. Die Frage war nur, wie anders? Nicht alle Menschen machten eine Entwicklung zum Positiven durch.
Sie blieb mitten im Flur stehen. Eine Entwicklung zum Positiven durchmachen? Vielleicht sollte sie mal ein paar Wochen keine Selbsthilfebücher mehr aus der Bibliothek ausleihen, sondern sich stattdessen bei einer netten Liebesgeschichte entspannen.
Sie ging in die Lobby und trat hinter das dunkle, handgeschnitzte Holzpult, das als Rezeption diente. Über seine vertraute, abgenutzte Oberfläche zu streichen entspannte sie. Sie kannte jede Macke, jeden Fleck darauf. Sie wusste, dass die Schublade links unten nicht aufging, wenn es regnete, und dass der Griff der Schublade rechts oben locker war. Sie wusste auch, wo das Putzpersonal zusätzliche Handtücher versteckte und in welchen Zimmern es zu Problemen mit den Rohrleitungen kommen konnte. Sogar mit verbundenen Augen hätte sie jederzeit genau sagen können, in welchem Raum sie sich befand. Sie erkannte ihn an seinem Geruch, daran, wie der Lichtschalter sich anfühlte und wie der Holzboden knarrte, wenn man darüberschritt.
Zehn Jahre lang war dieses Haus ihr Heim und ihr Rückzugsort gewesen. Die Tatsache, dass Michelle ihr das alles im Handumdrehen wegnehmen konnte, war mehr als furchterregend. Dass es außerdem nicht gerecht wäre, schien dabei keine Rolle zu spielen. Carly hatte die Befürchtung, dass sie sich, was ihre moralische Überlegenheit betraf, schon seit Langem auf dünnem Eis bewegte.
„Da!“, rief Damaris und deutete nach draußen.
Carly warf einen flüchtigen Blick durch die frisch geputzten Fensterscheiben und nahm dabei eher das blitzsaubere Glas und den weißen Rahmen wahr als den Pick-up, der sich dem Haus näherte. Dann konzentrierte sie sich auf das grüne Gras und die Farbexplosion der Margeriten.
Diese Blumen waren ihr Hobby, ihre Leidenschaft. Wo andere nicht viel mehr als verschiedene Variationen eines einzelnen Themas sahen, sah sie Robinson-Rosa- und Schwarzrand-Margeriten, Gebirgs-, Haller-, Fett- und Magerwiesen-Margeriten – und natürlich die einzigartige Blackberry-Margerite. Diese Blumen gehörten untrennbar zum Inn. Sie standen in Vasen auf den Restauranttischen und schienen fröhlich über Tapeten zu tanzen, sie brachten Farbe in Wandgemälde und zierten als Prägung das Notizpapier des Inns. Als sie Brenda geholfen hatte, neue Dachziegel auszuwählen, hatte sie die leuchtenden Farben ihres Gartens im Kopf gehabt. Nun bildete das Dunkelgrün der Schindeln, das sich in den Fensterläden und der Eingangstür wiederfand, den perfekten Hintergrund für die Blumen.
Damaris rannte über den Rasen, ihre weiße Schürze flatterte dabei hinter ihr her wie Schmetterlingsflügel. Schließlich breitete sie die Arme aus und umarmte eine Frau, die sehr viel größer und dünner war, als Carly sie in Erinnerung gehabt hatte. Sie sah zu, ohne es zu wollen, und lauschte ihren Worten, ohne etwas hören zu können.
Michelle löste sich aus der Umarmung, lächelte glücklich und umarmte Damaris gleich noch einmal. Sie trug ihr Haar jetzt länger, ein dunkles Gewirr aus welliger Mähne und Quasi-Locken. Ihr Gesicht war kantiger, um ihre Augen lagen dunkle Schatten. Sie sah aus, als wäre sie sehr krank gewesen. Carly war im Bilde darüber, dass sie in der Tat Verletzungen erlitten hatte. Sie wirkte zerbrechlich, doch Carly war sich bewusst, dass sie dem Anschein nicht trauen durfte. Michelle war nicht der Typ, der seiner eigenen Schwäche nachgab. Sie glich eher der furchterregenden und unverwüstlichen Alien-Figur aus den gleichnamigen Filmen.
Sie und Michelle waren praktisch gleich alt, Michelle war lediglich ein paar Monate älter. Früher – bevor alles anders geworden war – hatte sie Michelles Gesicht besser gekannt als ihr eigenes. Zu jeder einzelnen ihrer Narben hätte sie eine Geschichte erzählen können.
In Carlys bisherigem Leben hatte es drei prägende Momente gegeben: der Tag, an dem ihre Mutter sie verlassen hatte; die Nacht, in der sie herausgefunden hatte, dass ihre beste Freundin mit ihrem Verlobten geschlafen hatte; und der Morgen, an dem Brenda sie im Lebensmittelgeschäft aufgelesen hatte – in Tränen aufgelöst, weil sie sich die Milch nicht leisten konnte, die ihre Hebamme ihr jeden Tag zu trinken verordnet hatte.
Für sich betrachtet hatte keiner dieser Momente länger als eine Viertelstunde gedauert. Eine Minute hier, zwei Minuten dort. Jedoch hatte jeder von ihnen ihr Leben verändert, es um hundertachtzig Grad gewendet, es zerschmettert und dabei alles zerbrochen, was ihr lieb und teuer war, und ihr jegliche Luft zum Atmen genommen. Michelle war ein Teil des engmaschi-gen Gewebes gewesen, das ihr Leben darstellte – und hatte es dann vollkommen zerrissen, sodass nur noch Fetzen davon übrig waren.
Carly atmete tief durch und sah der Frau entgegen, die auf das Inn zukam. Wieder einmal hing ihr Lebensglück an einem seidenen Faden. Wieder einmal würde Michelle über ihre Zukunft bestimmen, und es gab rein gar nichts, was sie dagegen tun konnte. Ein beklemmendes Gefühl von Ungerechtigkeit presste ihren Brustkorb zusammen, doch sie entspannte sich bewusst und sagte sich, dass sie schon Schlimmeres überstanden hatte. Sie würde auch das hier überstehen.
Das Telefon klingelte. Carly schritt zurück zur Rezeption, um den Anruf anzunehmen.
„Blackberry Island Inn“, meldete sie sich mit klarer, selbstsicherer Stimme.
„Ich schau gleich mal nach“, fuhr sie fort und tippte auf der Computer-Tastatur herum. „Ja, da hätten wir noch ein Zimmer frei.“
Während sie die Kontaktdaten der zukünftigen Gäste notierte sowie die Ankunftszeit und die Kreditkartennummer bestätigte, war sie sich bewusst, dass Michelle immer näher kam. Die Jägerin war zurück. Was Carly dazu veranlasste, sich zu fragen, ob sie zur Willkommensfeier eingeladen war oder einfach nur deren nächstes Beutetier sein würde.
2. KAPITEL
Etwas theoretisch zu wissen und es mit eigenen Augen zu sehen war nicht das Gleiche. Michelle starrte die Fassade des Inns an und wusste, dass von nun an ein Schlag nach dem anderen sie treffen würde.
„Es ist so schön, dich wieder hierzuhaben“, sagte Damaris und presste sie noch einmal so fest an sich, dass ihr beinahe die Rippen brachen.
Wenigstens etwas, das sich vertraut anfühlte. Ebenso wie der Duft nach Zimt und Vanille, den Damaris verströmte und der von den Backwaren herrührte, die sie jeden Morgen zubereitete. Alles andere dagegen war falsch. Angefangen beim Dach, das in einem abscheulichen Grün leuchtete, bis hin zu den Fensterläden in der gleichen Farbe. Sogar die Form des Gebäudes hatte sich verändert. Die Umrisse des Hauses, in dem sie aufgewachsen war, hatten sich nach außen verschoben und das Hotel so aufgebläht, dass es untersetzt wirkte. Als hätte es sich einen Rettungsring angefressen und müsste dringend die Finger von den Brombeer-Scones lassen und sich einen Zumba-Kurs suchen.
Auf der linken Seite, wo früher das Restaurant gewesen war, ragte ein Anbau heraus, der den seitlichen Rasen zerteilte und somit auch den Abhang, den sie als Kind hinuntergerollt war. An der rechten Seite klebte ein protziges geschwürartiges Gebilde, das in knallbunten Farben gestrichen war und in dessen Fenster der übliche Insel-Schnickschnack hing: Puppen und Leuchttürme, Windspiele und klimpernde, bunt bemalte Glasgebilde.
„Es gibt hier jetzt einen Geschenkeshop?“, fragte sie. Ihre Stimme klang mehr verärgert als fragend.
Damaris rollte mit den Augen. „Ja, das war die Idee deiner Mutter. Vielleicht auch die von Carly. Ich habe nie zugehört, wenn die zwei miteinander geredet haben. Sie sind wie Vögel, machen Lärm und sagen nicht viel.“
Damaris’ kleine, kräftige Finger krallten sich in Michelles Oberarme. „Mach dir keine Gedanken wegen der beiden. Du bist jetzt wieder zu Hause und das ist alles, was zählt.“ Sie kniff besorgt die Lippen zusammen. „Aber du bist viel zu dünn. Sieh dich nur an, nichts als Haut und Knochen.“
„Das kommt davon, wenn man im Krankenhaus herumliegt.“ Es gab wohl keinen effektiveren Appetitzügler als eine schmerzhafte Schusswunde.
Aus den Augenwinkeln nahm sie ein Flügelschlagen wahr. Da waren sie – die allgegenwärtigen Puget-Sound-Kraniche, die über dem grauen Wasser des Sunds ihre Kreise zogen. Die Vögel lockten Touristen und Wissenschaftler gleichermaßen an. Aus irgendeinem Grund fanden die Leute sie hochinteressant. Sie hingegen war nie ein Fan von ihnen gewesen. Als sie acht Jahre alt war, hatten ihr die Kraniche einen ganzen Sommer lang ununterbrochen auf den Kopf geschissen. Sie war sich nicht sicher, ob sie einfach nur Pech gehabt hatte oder ob sich die Vögel gegen sie verschworen hatten. Wie dem auch sei, damals hatte sich ihre einigermaßen neutrale Haltung ihnen gegenüber in regelrechte Abscheu verwandelt. Ihre lange Abwesenheit hatte nichts daran geändert, dass sie sie am liebsten weghaben wollte.
Sie wandte den Blick wieder dem Inn zu und spürte, wie sich ihr Magen vor Enttäuschung zusammenzog. Wie hatte man diesem ehemals schönen Gebäude nur so etwas antun können? Selbst ihre Mutter hätte es besser wissen müssen.
Wahrscheinlich hat sie das auch, sagte Michelle sich. Das war Carlys Werk, da war sie sich sicher.
„Komm rein“, sagte Damaris und ging auf die Veranda zu. „Es wird gleich regnen und ich will dir was zu essen machen.“
Diese zwei zusammenhanglosen Gedanken bewirkten, dass Michelle sich ein bisschen weniger beklommen fühlte. Wenigstens Damaris war noch die Alte – liebevoll und gastfreundlich und stets darauf bedacht, die Menschen um sich herum mit Nahrung zu versorgen. Daran würde sie sich klammern.
Hinkend ging Michelle neben der viel kleineren Frau her. Ihr war klar, dass sie eigentlich ihre Krücke benutzen sollte, doch sie wollte keine Schwäche zeigen. Nicht in einer Situation, die sich so fremd anfühlte. Nicht zu wissen, was einen als Nächstes erwartete, war in ihrer Welt gleichbedeutend mit Gefahr.
Eine der prickelnden Nachwirkungen meiner Stationierungen im Irak und in Afghanistan, dachte sie missmutig, neben Albträumen, allgemeiner Reizbarkeit und dem attraktiven kleinen Tick, der die Haut unter einem ihrer Augen von Zeit zu Zeit zucken ließ.
Sie hatte sich dem idiotischen Irrglauben hingegeben, dass es ihr gut gehen würde, sobald sie das Inn erblickte. Dass es genügen würde, einfach zu Hause zu sein. Eigentlich hatte sie es besser gewusst – dennoch, die Hoffnung war da gewesen. Nun fiel sie in sich zusammen und erstarb schließlich völlig. Zurück blieben der Schmerz in ihrer Hüfte und der verzweifelte Wunsch, wieder zehn Jahre alt zu sein. In die Zeit zurückzukehren, in der es genügt hatte, auf den Schoß ihres Dads zu krabbeln und seine starken Arme um sich zu spüren, sodass alles gut war.
„Michelle?“ Damaris klang besorgt.
„Mir geht’s gut“, log sie und lächelte die ältere Frau an.
„Oder, falls du mir das nicht glaubst, ich arbeite daran, dass es mir wieder gut geht. Kannst du damit leben?“
„Nur, wenn du mir versprichst, gut zu essen.“
„Bis ich platze.“
Damaris’ Haar war ein wenig grau geworden und sie hatte ein paar Falten mehr um die Augen, davon mal abgesehen sah sie immer noch aus wie früher. Das war doch wenigstens etwas. Michelle war nach wie vor auf der Suche nach Teilen ihres Zuhauses, die sie wiedererkannte. Sogar der Garten hat sich verändert, dachte sie und blieb stehen, um die Beete mit den endlosen Reihen von heiteren Margeriten zu betrachten, die sich in der sanften Brise leicht bewegten.
Die bunten Farben bildeten fröhliche Muster, säumten den Rasen und krochen an ihm entlang bis zum Hauptgebäude, wo sie um die Ecke bogen. Sie waren so unterschiedlich, als hätte jemand nur die ausgefallensten und kessesten ausgewählt. Die knallbunten Blüten wirkten wie ein gellender Schrei auf ihre überreizten Sinne, am liebsten hätte sie sich Augen und Ohren zugehalten.
Die Stufen der Veranda lenkten ihre Aufmerksamkeit wieder auf das Inn zurück. Sie bereitete sich gedanklich auf den brennenden Schmerz vor, der sie im nächsten Moment von innen versengen würde, und auf die darauf folgende Übelkeit und die Schweißausbrüche.
Sie setzte den rechten Fuß auf die erste Stufe, dann hob sie den linken an. Auf den Schmerz vorbereitet zu sein machte ihn nicht weniger stechend. Er schoss durch ihren Körper und ließ sie beinahe um Gnade betteln. Wenn sie schon alles hatten verändern müssen, hätten sie nicht gleich auch noch eine Rampe einbauen können?
Als sie schließlich oben ankam, war ihr Körper von kaltem, klebrigem Schweiß bedeckt und ihr zitterten die Knie. Wenn sie heute Morgen etwas gegessen hätte, hätte sie sich in diesem Moment übergeben – eine elegante Art der Heimkehr. Damaris beobachtete sie verstohlen, ihre Miene finster vor Sorge.
„Ist es wegen deiner Mutter?“, fragte sie leise, als wollte sie die Antwort gar nicht hören. „Ich weiß, ihr zwei habt euch nie gut verstanden, aber dennoch, jetzt ist sie tot. Du darfst dir keine Vorwürfe machen, weil du nicht zur Beerdigung kommen konntest.“
„Das tu ich auch nicht“, presste Michelle durch zusammengebissene Zähne hervor. Angeschossen worden zu sein war wohl eine der besten Entschuldigungen, die man haben konnte.
Nach ein paar Atemzügen ließ der Schmerz so weit nach, dass er erträglich war. Es gelang ihr, sich aufzurichten, ohne nach Luft schnappen zu müssen. Was ihr die Gelegenheit gab, festzustellen, dass die Möbel auf der Veranda neu waren, ebenso wie die Brüstung. Ihre Mutter war sichtlich freizügig mit den Einnahmen des Hotels umgegangen, wie hoch auch immer sie gewesen sein mochten.
„Hallo, Michelle. Willkommen zu Hause.“
Sie wandte ruckartig den Blick zur breiten Doppeltür und erblickte Carly auf der Türschwelle.
Auch an ihr waren Veränderungen zu erkennen. Sie trug ihr Haar jetzt kurz statt lang. Ansonsten dasselbe Blond, dieselben dunkelblauen Augen, nur dass sie jetzt durch ein dezentes Make-up betont waren. Weniger „Grufti“, mehr „Lady beim Lunch“.
Die Kombination aus einem schlichten schwarzen Rock, flachen Schuhen und einem pinkfarbenen T-Shirt mit winzigen Rüschen an den Bündchen bildete ein perfektes, professionell wirkendes Outfit für das Inn. Daneben kam sich Michelle in ihrer tief sitzenden Cargo-Hose grobschlächtig vor – doch die bekam sie am einfachsten übergezogen, wenn es gerade mal keine Jogginghose sein sollte. Ihr langärmeliges Shirt war in den Krieg und wieder zurück gereist und sah dementsprechend aus. Sie konnte sich nicht mehr daran erinnern, wann sie das letzte Mal Wimperntusche oder eine Feuchtigkeitscreme aufgetragen hatte. Oder wann sie sich das letzte Mal die Haare von jemandem hatte schneiden lassen, der eine entsprechende Ausbildung hatte.
Im Vergleich dazu sah Carly richtig hübsch aus. Hübscher als sie sie in Erinnerung gehabt hatte. So weiblich.
In ihrer Jugend war sie, Michelle, stets die Schönheit gewesen, mit ihrem langen dunklen Haar und ihren großen grünen Augen. Carly hingegen war die Süße. Ihr Sidekick im Wer-hat-das-schönste-Lächeln-Wettbewerb. Verärgert darüber, eine weitere Veränderung festzustellen, hätte sie sich am liebsten abgewandt und wäre zurück nach …
Das war genau das Problem. Das Inn war alles, was sie hatte, und weggehen war keine Option.
Carly lächelte noch immer, sie wirkte ruhig und kontrolliert.
„Wir freuen uns so sehr, dass du wieder da bist.“ Ihr Lächeln erstarb. „Mein Beileid wegen Brenda. Sie war eine tolle Frau.“
Michelle zog die Augenbrauen hoch. Es gab viele Worte, ihre verstorbene Mutter zu beschreiben. Toll gehörte nicht dazu.
Besorgniserregender war jedoch Carlys Haltung ihr gegenüber. Sie verhielt sich, als hätte sie das Recht, jemanden an diesem Ort willkommen zu heißen. Als würde sie hierhergehören.
„Wir haben uns lange nicht gesehen“, fügte Carly hinzu. „Seit …“ Sie hielt inne. „Nun ja, eben lange nicht“, wiederholte sie noch einmal.
Carlys Worte, ob sie nun spontan waren oder geplant, erinnerten Michelle an ihre letzten Stunden an diesem Ort. Sie nahm an, dass sie verlegen sein sollte oder Schuldgefühle hätte haben sollen, dass Carly eine Entschuldigung erwartete. Doch trotz der Dinge, die sie getan hatte, stellte Michelle fest, dass sie sich eine Entschuldigung von Carly wünschte. Als wäre Carly diejenige, die sich falsch verhalten hatte.
Sie starrten sich eine endlose Minute lang an. Michelle kämpfte gegen ihre Erinnerungen an. Gute Erinnerungen, dachte sie grollend. Sie und Carly hatten unzählige Stunden miteinander verbracht, sie waren zusammen aufgewachsen.
Scheiß drauf, dachte sie und wischte die Bilder weg. Sie ging entschlossen auf die Eingangstür zu. Wie erwartet trat Carly zur Seite, um sie vorbeizulassen.
Das Innere des Hauses hatte sich genauso verändert wie sein Äußeres. Die Vorhänge in fröhlichen Farben waren ebenso neu wie die Kaminverkleidung. Der Holzboden in der Eingangshalle war geschliffen und lackiert worden, die Wände neu gestrichen, und an einer davon, dort, wo es zum Restaurant ging, prangte ein riesiges Wandgemälde mit Margeriten.
Wenigstens das Rezeptionspult war noch das gleiche – und das war es, woran Michelle sich festhielt, wenn auch nicht physisch, so doch geistig. Während der Raum sich um sie zu drehen schien, wurde ihr klar, wie idiotisch es von ihr gewesen war, zu erwarten, dass sich nichts verändert haben würde. Sie hatte angenommen, alles genau so vorzufinden, wie sie es verlassen hatte – abzüglich ihrer Mutter. Dass, wenn sie das Haus beträte, es so sein würde, als wäre sie nie weg gewesen. Als wäre sie nie in den Krieg gezogen.
„Geht’s dir gut?“
Carly streckte eine Hand nach ihr aus, während sie sprach. Im selben Moment fiel das Licht auf das goldene Bettelarmband an ihrem Handgelenk und ließ es aufleuchten.
Michelle kannte es in- und auswendig. Als Kind war sie fasziniert von den glitzernden Goldanhängern gewesen, die stets in Bewegung waren. Als sie größer wurde, hatte sie sich die Herkunft jedes einzelnen Anhängers erzählen lassen und sich eigene Geschichten um den filigranen Seestern oder den winzigen hochhackigen Schuh ausgedacht. Das Armband hatte ihrer Mutter gehört und es verkörperte eine der wenigen guten Erinnerungen, die sie an diese Frau hatte.
Und nun trug Carly es.
Michelle wollte es gar nicht haben, doch ganz sicher wollte sie auch nicht, dass Carly es hatte.
Ärger brodelte in ihr auf wie Wasser in einem Dampfkochtopf. Am liebsten hätte sie Carlys zarten Arm gepackt und ihr die goldenen Kettenglieder heruntergerissen. Sie hatte das Bedürfnis zu zerstören, wegzunehmen und zu verletzen.
Michelle atmete tief durch, wie man es ihr beigebracht hatte. Sie glaubte nicht wirklich an posttraumatische Belastungsstörungen, doch man hatte ihr gesagt, dass sie darunter litt. Also hatte sie sich angehört, was die Ärzte ihr geraten hatten, dass sie Stress vermeiden, sich viel ausruhen und sich gut ernähren sollte. Sie hatte es sich angehört und die Ratschläge herausgepickt, von denen sie dachte, dass sie für sie funktionieren würden.
Sie machte die Atemübung, weil sie sich nicht für eine Reaktion entscheiden konnte und weil ihr gesamter Körper schmerzte. Dann humpelte sie davon. Jeder ihrer Schritte brannte, ihr Fleisch heulte protestierend auf.
Sie ging den kürzeren Flur auf der rechten Seite hinunter, bog um die Ecke und blieb vor einer unbeschrifteten Tür stehen. Noch etwas, das sich nicht verändert hat, dachte sie, und strich über den Türrahmen, auf dem kleine Schnittkerben anzeigten, welche Fortschritte sie als Kind beim Wachsen gemacht hatte. Die Kerben endeten abrupt. Nicht, weil sie irgendwann nicht mehr gewachsen wäre, sondern weil der Mann, der dem Bedeutung zugemessen hatte – der Vater, der sie geliebt hatte – fortgegangen war.
Sie drehte, einem tiefen Bedürfnis folgend, den Türknauf. Dem Bedürfnis, sich zurückzuziehen und ihre Wunden zu lecken.
Die Tür war verschlossen. Sie versuchte es noch einmal, dann hämmerte sie mit der Faust gegen das Holz – laut und entschlossen.
Plötzlich öffnete sich die Tür und ein Teenager starrte sie mit weit aufgerissenen Augen an.
„Ah, hallo“, sagte das Mädchen, wobei sich dessen sommersprossige Nase leicht kräuselte. „Tut mir leid, die Gästezimmer sind alle oben. Hier ist der Privatbereich.“
„Das weiß ich“, sagte Michelle und sprach damit zum ersten Mal, seit sie das Inn betreten hatte.
„Wer ist da, Brittany?“, rief ein jüngeres Mädchen aus dem hinteren Teil der Wohnung.
„Ich weiß es nicht.“ Das Teenager-Mädchen wandte sich wieder ihr zu und blickte sie erwartungsvoll an, als würde es darauf warten, dass sie ging.
Doch Michelle wollte einfach nur in ihr Zimmer, sich auf ihr Bett fallen lassen und schlafen. Schlaf, sofern sie ihn finden konnte, bedeutete Heilung.
Sie drückte sich an der Jugendlichen vorbei und es war, als träte sie wie Alice hinter den Spiegel.
Nichts war so, wie es sein sollte. Weder die Wände noch die Teppiche auf dem Boden noch die Möbel. Das zerfledderte karierte Sofa war verschwunden, stattdessen stand dort eine in Blautönen gehaltene Couch mit Schonbezug. Und alles war voll mit Margeriten – in Vasen, auf Kissen und Bildern. Sogar von den Vorhängen schienen sie höhnisch auf sie herabzuschauen. Und wo keine Margeriten prangten, waren es Brombeeren.
Sie starrte auf die neuen Stühle, den Küchentisch, den sie nicht wiedererkannte, und auf das Spielzeug. In einer Ecke stand ein Puppenhaus. Auf der breiten Fensterbank saßen Stofftiere, daneben stapelten sich verschiedene Brettspiele.
Ein Mädchen, das ungefähr zehn Jahre alt sein mochte, trat vor sie hin. Es hatte große dunkelblaue Augen und einen verängstigten Ausdruck auf dem Gesicht. In der Hand hielt es einen iPod.
„Wer sind Sie?“, fragte es, und plötzlich weiteten sich seine großen Augen noch mehr. „Ich weiß, wer du bist“, hauchte es und trat einen Schritt zurück. Es duckte sich geradezu weg. „Du musst gehen. Sofort!“
„Gabby!“, rief der Teenager schockiert.
Michelle wich eilig zurück und verließ den Raum rückwärtsgehend, wobei sie den heftigen Schmerz ignorierte, der ihre Hüfte umspannte und sie beinahe straucheln ließ. Alles war falsch. Der Schmerz war zu groß und das Zimmer begann sich um sie zu drehen. Sie bekam keine Luft, wusste nicht mehr, wo sie war. Es war, als hätte sie festen Boden unter den Füßen erwartet und würde stattdessen ins Bodenlose fallen.
Sie ging, so schnell sie konnte, und war sich vollkommen bewusst, was sie sich damit antat. Ihr war klar, dass sie später dafür büßen würde, doch das war ihr egal. Sie nahm den Weg zurück, den sie gekommen war. In der Eingangshalle wartete Carly auf sie. Immer noch perfekt aussehend in ihrer mädchenhaften Kleidung und mit Brendas Armband am Handgelenk. Michelle blieb vor ihr stehen.
„Du bist gefeuert“, sagte sie klar und deutlich, trotz des stechenden Schmerzes in ihrer Hüfte.
Carly wurde blass. „Wie bitte? Das kannst du nicht machen!“
„Doch, ich kann. Das Inn gehört mir, schon vergessen? Du bist entlassen. Pack deine Sachen und geh, ich will dich hier nie wieder sehen.“
Sie trat an Damaris vorbei, taumelte mehr die Stufen hinunter, als dass sie ging, und humpelte zurück zu ihrem Pick-up. Als sie ihr linkes Bein auf den Sitz hochziehen wollte, wurde sie beinahe ohnmächtig, schaffte es jedoch. Dann ließ sie den Motor an und fuhr los.
Zwei scharfe Rechtskurven später lenkte sie an den Straßenrand und hielt an. Heftige Schluchzer ließen ihr die Kehle eng werden. Ihre Hände zitterten und eisige Kälte kroch ihr bis in die Knochen.
Es kamen keine Tränen – da waren nur das trockene Weinen und die Erkenntnis, dass allein die Tatsache, dass sie nach Hause gekommen war, nicht bedeutete, dass sie einen Ort hatte, wo sie hinkonnte.
3. KAPITEL
„Unser Tagesgericht heute ist eine Huhn-Marsala-Variation“, sagte Carly und lächelte das ältere Paar an, das an einem Fenstertisch saß. „Rigatoni mit Champignons und frischen Kräutern in Marsala-Sahne-Soße. Eins meiner Lieblingsgerichte.“
Die Frau, die ihr weißes Haar aufgetürmt auf dem Kopf trug, lächelte zurück. „Ich bin mir nicht sicher, ob meine Taille das verkraftet, aber es klingt köstlich.“
Ihr Mann nickte. „Wir haben unseren eigenen Wein mitgebracht. Das ist doch in Ordnung, oder?“
Carly warf einen Blick auf die Flasche. Ein Brombeer-Aufkleber klebte auf der oberen linken Ecke des Etiketts, was bedeutete, dass der Wein in der Stadt gekauft worden war.
„Natürlich“, sagte sie. „Wir berechnen keine Korkengebühr. Soll ich die Flasche schon mal für Sie öffnen, damit der Wein atmen kann?“
Der Mann grinste. „Ich weiß nicht. Das klingt ziemlich vornehm.“
„Sie haben sich da einen hervorragenden Wein ausgesucht. Soll ich ihn nicht für Sie aufmachen? Während Sie sich überlegen, was Sie essen wollen, gehe ich die Weingläser holen, dann können Sie ihn gleich mal probieren.“
„Vielen Dank.“ Die Frau tätschelte die Hand ihres Mannes. „Wir haben eine wunderschöne Zeit hier. Das ist unser dritter Aufenthalt, wir waren allerdings einige Jahre nicht mehr da. Sie haben ein paar schöne Veränderungen vorgenommen.“
„Danke für das Kompliment. Ich hoffe, wir müssen diesmal nicht so lange auf das Vergnügen verzichten, Sie wieder hier begrüßen zu dürfen.“
Sie entschuldigte sich und ging hinüber zur Bar. Mit den Weingläsern und einem Korkenzieher in der Hand kehrte sie zum Tisch zurück, um den Wein zu servieren und die Bestellung aufzunehmen. Als Nächstes sah sie an den anderen drei Tischen nach dem Rechten, dann ging sie in die Küche und holte Salat. Bisher hatte noch niemand bemerkt, dass etwas nicht stimmte. Und falls doch, so hatte keiner was gesagt, was fast genauso gut war. Wenn sie sich beschäftigt hielt, konnte sie nicht nachdenken, sich keine Sorgen machen, nicht in Panik ausbrechen.
Sie betrat die helle Küche voller Dampfschwaden und sah, dass die Salatteller bereitstanden. Sie nahm sie und kehrte zurück in den Speisesaal.
Die Handgriffe waren einfach, wofür sie dankbar war. „Verwirrt“ beschrieb noch nicht mal annähernd, wie sie sich fühlte. „Starr vor Angst“ kam ihrem Zustand schon näher.
Gefeuert. Sie konnte doch nicht einfach entlassen werden! Das hier war ihr Zuhause, sie hatte hier beinahe zehn Jahre lang gelebt. Hatte ihr Herz und ihre Seele in dieses Haus gesteckt. Sie liebte es. Das musste doch etwas wert sein, oder? Recht und Gesetz wurden allerdings zu neun Zehnteln durch Besitzverhältnisse bestimmt. Konnte es da helfen, Klischees aufzuzählen? Aber irgendetwas musste helfen. Michelle durfte nicht hier reinspazieren und sie feuern.
Doch, das durfte sie.
Carly kämpfte gegen Tränen an und verkroch sich hinter der Bar. Die Marmorplatte fühlte sich kühl unter ihren Fingern an, der Marmor, den sie selbst ausgewählt hatte, ebenso wie die Schränke und sogar die Tische und Stühle im ausgebauten Restaurant.
Sie hat es mir versprochen, dachte Carly und drehte ihr Gesicht zur Wand, um die Tränen zu verbergen, die in ihren Augen brannten. Brenda hatte versprochen, dass sie ihr einen Anteil am Inn überschreiben würde. Zwei Prozent jedes Jahr, bis sie es zur Hälfte besitzen würde und sie gleichberechtigte Partnerinnen wären. Von Rechts wegen hätte ihr inzwischen ein Fünftel gehören müssen. Nur, dass Brenda nicht berechtigt gewesen war, das Inn zu verschenken.
Vor vielen Jahren, als Michelle behauptet hatte, ihr Daddy habe ihr das Blackberry Island Inn vermacht, hatte Carly angenommen, ihre Freundin erzählte die üblichen Geschichten, die Kinder eben so erzählten: „Irgendwann gehört das alles mal mir.“ Michelle hatte hier gelebt und gearbeitet. Letzten Endes war Michelle diejenige gewesen, die die Wahrheit gesagt hatte, und Brenda die Lügnerin, und nun hatte sie, Carly, keinen anderen Ort, an den sie gehen konnte.
Sie wischte sich die Tränen ab und setzte ein gezwungenes Lächeln auf, bevor sie zu ihren Gästen zurückkehrte.
Es war fast halb acht, als sie endlich zurück in die Eigentümerwohnung im Inn flüchten konnte – die Räume, die sie und ihre Tochter seit Gabbys Geburt bewohnten. Räume, die sie zu den ihren gemacht hatte, Räume voller Erinnerungen.
Gabby sah fern, schaute jedoch auf und lächelte, als Carly eintrat. Brittany, ihr Babysitter, legte eilig ihr iPhone weg. Gabby krabbelte vom Sofa herunter und kam auf sie zugerannt.
„Mom.“
Mehr sagte sie nicht, sie hielt sie nur fest.
Carly erwiderte ihre Umarmung, in dem Wissen, dass sie –
wie wohl so ziemlich jede andere Mutter auf der Welt – alles für ihr Kind tun würde. Dazu zählte auch, es vor der Wahrheit zu schützen – der Tatsache, dass sie vermutlich kurz davorstanden, aus ihrem Zuhause verjagt zu werden.
„Wie war dein Abend?“, fragte sie, strich Gabby sanft das blonde Haar aus dem Gesicht und sah ihr in die blauen Augen.
„Gut. Ich habe Brittany zweimal beim Glücksrad-Spiel geschlagen.“
Der Teenager grinste. „Siehst du, die Buchstabier-Hausaufgaben haben doch einen Sinn.“
Gabby kräuselte die Nase. „Mathe ist mir lieber.“
„Das Abendessen war super“, sagte Brittany und stand auf. „Danke.“
Carly hatte ihnen um halb sechs etwas von der Huhn-Marsala-Pasta vorbeigebracht. Sie musste zwei Abende in der Woche im Restaurant arbeiten, konnte aber während ihrer Schicht wenigstens etwas zu essen nach Hause bringen.
„Freut mich, dass es euch geschmeckt hat.“
„Ja, das hat es“, sagte Gabby.
Brittany war bereits in ihre Jacke geschlüpft.
„Triffst du dich mit Michael?“, fragte Carly und stand auf, um sie zur Tür zu begleiten.
Der Teenager lächelte. „Ja. Wir gehen mit ein paar Freunden bowlen.“
„Ich werde wahrscheinlich irgendwann in den nächsten zwei Wochen vom Sommerlager hören“, sagte Carly und ignorierte das leise Schnauben ihrer Tochter. Gabby war kein Fan des Sommerlagers, hauptsächlich, weil es bedeutete, dass man viel draußen sein und Dinge machen musste wie wandern oder Kajak fahren. Ihre Tochter zog es vor zu lesen oder Computer-Spiele zu spielen.
„Meine Sommerkurse gehen von acht bis zwölf.“ Brittany zog ihren langen Zopf aus ihrer Jacke. „Nachmittags passt für mich also gut.“ Sie zögerte, dann senkte sie die Stimme. „Das war sie also? Michelle, meine ich?“
Carly nickte.
„Sie ist überhaupt nicht so, wie ich es erwartet habe. Ich dachte nicht, dass sie so Furcht einflößend sein würde. Nicht, dass sie irgendwas Schlimmes gemacht hätte, es ist nur … Ich weiß auch nicht …“
Carlys erster Impuls war, Michelle zu verteidigen, was bewies, dass dumme Verhaltensweisen nicht so leicht abzuschütteln waren.
„Sie ist eigentlich gar nicht so übel“, sagte sie, um einen inneren Kompromiss zu finden, was ziemlich großzügig von ihr war, angesichts der Tatsache, dass sie soeben gefeuert worden war.
„Okay, einen schönen Abend euch noch.“
Brittany ging und Carly ließ sich auf dem Sofa nieder. Ihre Tochter kuschelte sich an sie und legte den Kopf auf ihre Schulter.
„Ich mag sie nicht“, wisperte Gabby. „Muss sie hierbleiben?“
Carly hätte gerne gesagt, dass sie Michelle auch nicht mochte, doch sie wusste, dass das ein Fehler gewesen wäre. Ständig das Richtige tun zu müssen kann ganz schön nerven, dachte sie und streichelte über das Haar ihrer Tochter.
„Lass uns erst mal sehen, wie es so läuft, bevor wir ein Urteil fällen“, sagte sie betont heiter und ignorierte das Gefühl von drohendem Unheil.
„Das machst du dauernd, Mom“, sagte Gabby seufzend. „Alles immer von beiden Seiten betrachten, meine ich. Willst du nicht manchmal einfach nur total ausrasten?“
„Öfter, als du denkst.“
Es war eine Tatsache, dass Michelle sie brauchte. Zumindest kurzfristig. Jemand musste schließlich das Inn führen, und da Brenda nicht mehr da war, blieb nur sie. Michelle würde Zeit brauchen, um wieder gesund zu werden und sich in die Arbeit hier einzufinden. Der Rausschmiss war eine Kurzschlussreaktion gewesen. Leere Worte, die jeder Grundlage entbehrten.
Es war, als würde sie im Dunklen pfeifen, um sich Mut zu machen, oder immer noch nicht an Geister glauben, obwohl die Beweislage erdrückend war. Sie zog ihre Tochter näher an sich.
Anderthalb Stunden später küsste Carly ihre Tochter auf die Stirn. „Schlaf schön“, flüsterte sie. „Ich hab dich lieb.“
„Ich dich auch, Mom.“
Gabby klang schläfrig, ihr fielen bereits die Augen zu. Obwohl ihre Tochter schon seit Jahren keine Gutenachtgeschichte mehr hören wollte, mochte sie es, von ihr ins Bett gebracht zu werden. Sie war neun, im Herbst würde sie zehn werden. Wie lange würde es noch dauern, bis sie ihre Mutter eher als Nervfaktor denn als Freundin betrachtete?
Carly konnte sich nicht mehr erinnern, wie alt sie gewesen war, als sie anfing, alles, was ihre Eltern taten, entweder bescheuert oder peinlich zu finden. Mit siebzehn hatte sie sich nichts sehnlicher gewünscht, als sie loszuwerden. Seltsam, dass erst ihre Mutter davonlaufen musste, ehe ihr bewusst wurde, wie sehr sie sie in Wirklichkeit brauchte. Doch da war es zu spät gewesen, um ihr das zu sagen und all die Dinge von ihr zu lernen, die ihr dabei geholfen hätten, eine erwachsene Frau zu werden.
Bevor sie aufstand, gab sie Gabby noch einen Kuss und schwor sich innerlich, ihr Kind niemals im Stich zu lassen, was auch passieren mochte. Ein Nachtlicht leuchtete ihr den vertrauten Weg aus dem Kinderzimmer. Obwohl Gabby immer öfter nach mehr Eigenständigkeit verlangte, war ihre Tochter weiterhin froh über das sanfte Licht, das über ihren Schlaf wachte.
Auf der Türschwelle wandte Carly sich um und betrachtete das schlafende Mädchen, dann ging sie in ihr Zimmer. Die Vorhänge hatte sie selbst genäht und die Regale eigenhändig aufgearbeitet. Farbe war billig und so jagte sie gerne im Trödelladen von Blackberry Island nach Schnäppchen. Auch den bunten Quilt, der noch in der Plastikverpackung des Ladens steckte, hatte sie auf die Art gefunden. Ganz unten in ihrem Schrank bewahrte sie ein großes Einweckglas auf, in das sie all ihr Kleingeld legte. Das war ihr „Sparstrumpf“ für den Geburtstag ihrer Tochter und für Weihnachten. Trotz des chronischen Geldmangels waren sie immer über die Runden gekommen.
Das würde sich jedoch schlagartig ändern, wenn man sie feuerte. Dann würde sie nicht nur ihre Arbeit verlieren, sondern auch ihr einziges Zuhause.
Einen Moment lang stand sie reglos im Halbdunkeln und dachte daran, wie es gewesen war, als dieses Zimmer Michelle gehört hatte. Damals verbrachten sie an den Wochenenden viele Nächte gemeinsam, meistens im Inn, denn dort war es besser. Sicherer. Als sie in Gabbys Alter waren, bastelten sie Ketten aus Margeriten für sich selbst und für die Gäste. Sie liefen zum Strand hinunter und warfen Steine ins Meer. Michelle watete in das kalte Wasser, doch sie blieb am Ufer. Sie hatte immer schon Angst vor Wasser gehabt. Es gab keinerlei Erklärung dafür, kein frühkindliches Trauma, die Phobie war einfach da. Und leider hatte sie sie an ihre Tochter vererbt.
In den guten Momenten sagte sie sich, dass sie dies mit ihrer Liebe, ihrer Fürsorge und einem beständigen Zuhause mehr als ausgeglichen hatte. Gabbys Welt war geordnet und vorhersehbar, und sie waren glücklich zusammen. Und was auch immer sie tun musste, sie hatte dafür zu sorgen, dass das so blieb.
Das Motel-Zimmer hätte an jeder beliebigen Straße Amerikas liegen können. Das Bett war schmal und hart, die Laken rau, der Teppich voller Flecken. Die dunklen Vorhänge schlossen nicht ganz, Autoscheinwerfer streiften das Fenster und warfen Muster auf die gegenüberliegende Wand. Aus dem Badezimmer war das stetige Tropfen eines Wasserhahns zu hören.
Michelle vermutete, dass sie ein schöneres Zimmer hätte finden können, doch das war ihr nicht wichtig gewesen. Dieses würde für die heutige Nacht genügen. Es hatte zudem den Vorzug, nahe am Highway zu liegen und ein bevorzugter Übernachtungsort für Trucker zu sein. Es war unwahrscheinlich, dass sie hier jemanden traf, den sie kannte. Anonymität war gerade genau das, wonach sie suchte.
Sie ließ das Wasser in der Dusche laufen, bis das kleine Bad von Dampf erfüllt war. Nachdem sie ihre Kleider abgestreift hatte, trat sie in den feuchten Nebel und ließ das heiße Wasser an sich hinabrinnen. Sie nahm das winzige Stück Seife, rieb ihr Haar damit ein und spülte es dann aus.
Trotz der Hitze zitterte sie. Nach einer Weile drehte sie die Wasserhähne zu und trocknete sich mit dem dünnen, schmalen Motel-Handtuch ab. Sie konnte sich nicht im Spiegel sehen, doch das war ihr nur recht so. Sie würde ohnehin kein Make-up auftragen. Das einzige Zugeständnis, das sie ihrer Haut während der Stationierung gemacht hatte, hatte aus der Verwendung von Sonnencreme bestanden. Nun, da sie zurück im kühlen Nordwesten der USA war, musste sie sich nicht mal mehr damit herumschlagen.
Als sie sich anzog, vermied sie es, die Wunden auf ihrer Hüfte anzusehen. Sie war sich sicher, dass der Chirurg sein Bestes getan hatte, als er ihre Schusswunde flickte und die Narben auf ein Minimum reduziert hatte, doch es war nicht viel Haut übrig gewesen, mit der er hätte arbeiten können.
Ihr war klar, dass sie Glück im Unglück gehabt hatte. An ihr war noch alles dran. Eine neue Teilhüfte war nichts im Vergleich zu dem, was andere hatten durchmachen müssen. Sie hatte überlebt und somit das höchste Ziel eines jeden Soldaten erreicht: Nicht sterben. Der Rest würde sich schon von selbst regeln.
Sie verließ das kleine Bad. Auf dem winzigen Schreibtisch in der Ecke des Zimmers lag ein Stapel Take-away-Speisekarten. Es wäre vermutlich keine so schlechte Idee, etwas zu essen. Sie musste noch immer Antibiotika und Schmerzmittel einnehmen und mit etwas im Magen würde sie die Tabletten leichter herunterbekommen. Sie könnte sie aber auch einfach weglassen und das Problem anders lösen.
Die Papiertüte stand auf dem Nachttisch. Sie ging hinüber und zog die Wodka-Flasche daraus hervor.
„Hallo, du“, murmelte sie und schraubte sie auf. „Ich suche nichts Festes. Wie wär’s, willst du die Nacht mit mir verbringen?“
Der Psychologe im Krankenhaus hatte sie davor gewarnt, dass Humor als Abwehrmechanismus ihre vollständige Genesung womöglich behinderte. Sie hatte ihm geantwortet, dass dies ein Makel sei, mit dem sie leben könne.
Die Nacht war ruhig. Das stetige Rauschen der vorbeifahrenden Autos war praktisch ein Schlummerlied im Vergleich zu dem, was sie noch vor ein paar Monaten beim Einschlafen gehört hatte. Es drohten keine Explosionen, kein Getöse schwerer Panzerfahrzeuge, es flogen keine Kampfflieger über sie hinweg. Die Nacht war kühl und nicht heiß, der Himmel bewölkt statt klar.
Sie würde ein paar Entscheidungen treffen müssen. Sie konnte das Inn nicht meiden, sie gehörte dorthin, oder zumindest hatte sie das einmal. Und dann war da das Problem mit Carly. Ihr mitzuteilen, dass sie gefeuert war, hatte sich so gut angefühlt. Vielleicht sollte sie sie dabehalten, um sie immer wieder feuern zu können. Als kleines Geschenk an sich selbst.
„Das ist richtig böse, sogar für deine Verhältnisse“, sagte sie laut, während sie den Wodka anstarrte.
Die Erschöpfung ließ ihre Glieder schwer werden und weckte das Bedürfnis, sich hinzulegen und die Augen zuzumachen. Sie widerstand ihm, obwohl sie den Schlaf dringend benötigte, um wieder gesund zu werden, denn er hatte seinen Preis. Mit ihm kamen die Träume und die waren eine Vorstufe zur Hölle.
„Mit dir ist das ganz anders“, sagte sie und hob die Flasche an die Lippen. „Mit dir habe ich einfach nur Spaß.“
Sie nahm einen tiefen Schluck, ließ die brennende Flüssigkeit durch ihre Kehle rinnen und sie ihren leeren Magen füllen. Dann trank sie weiter, bis sie sicher war, dass sie traumlos schlafen würde und eine Nacht lang alles vergessen konnte.
4. KAPITEL
Ein Klopfen an der Hintertür in der Küche veranlasste Gabby dazu, von ihrem Stuhl zu rutschen und dem Geräusch entgegenzulaufen.
„Ich geh schon!“, rief sie.
Es hat einfach keinen Sinn, ihr zu sagen, dass sie leiser sein soll, dachte Carly. Gabby war ein Morgenmensch. An den meisten Tagen machte ihr das nichts aus, doch nach einer durchwälzten Nacht wie heute bohrte sich die grelle Stimme ihrer Tochter wie ein dicker Glassplitter in ihr Gehirn.
Gabby fummelte am Schloss herum, dann riss sie die Tür auf.
„Onkel Robert!“
Sie stürzte mit offenen Armen auf den Mann zu, der im Türrahmen stand, alles an ihr strahlte freudige Erwartung aus. Robert fing sie auf und warf sie hoch in die Luft.
„Wie geht’s meinem tollsten Mädchen?“, fragte er und gab ihr einen Kuss auf die Wange.
„Gut. Wir essen gerade Pancakes mit Brombeeren.“
Robert lachte leise. „Na, das ist ja mal ganz was Neues.“
Sie lachten beide, dann setzte er sie wieder auf dem Boden ab. Gabby ging zu ihrem Stuhl zurück und Robert schloss die Tür hinter sich.
„Wie war’s?“, fragte er, als er in die Küche trat.
Carly wusste sofort, wovon er sprach, jedoch nicht, was sie antworten sollte. Also zuckte sie nur unbestimmt die Achseln und machte sich daran, ihm einen Kaffee einzuschenken. Robert setzte sich auf seinen gewohnten Platz – er war ein regelmäßiger Gast an ihrem Frühstückstisch, er kam mehrmals pro Woche vorbei.
„Danke“, sagte er und nahm die Kaffeetasse entgegen. Dann wandte er sich Gabby zu. „Bist du fertig für die Schule?“
Sie nickte eifrig, wobei ihr blonder Pferdeschwanz auf und ab wippte. Gabby liebte die Schule, den Unterricht ebenso wie ihre Freunde. Wenigstens dort war sie fröhlich und gesellig.
„Und was lernst du diese Woche?“, fragte er weiter. „Integralrechnung? Du bist doch schon auf dem College, stimmt’s?“
Gabby kicherte. „Onkel Robert, ich bin erst neun!“
„Wirklich? Du siehst viel älter aus. Ich dachte, du wärst mindestens zwanzig.“
Die Unterhaltung lief in vertrauten Bahnen ab. Gabby liebte ihren Onkel, es bestand eine tiefe Verbindung zwischen den beiden. Familie war etwas Gutes, sagte Carly sich. Allerdings hatte sie erst Gabby bekommen müssen, um zu dieser Überzeugung zu gelangen. Ihre Tochter war ein Geschenk, von dem sie nicht sicher war, ob sie es verdiente. Ihre übrigen familiären Beziehungen waren bestenfalls zweifelhaft.
Robert war immer überaus lieb und mehr als großzügig mit seiner Zeit und seiner Aufmerksamkeit gewesen. Vieles tat er aus Schuldgefühl, das wusste sie. Robert war ein guter Mann, jemand, der seine Pflichten ernst nahm und das Gleiche auch von anderen erwartete. Sein Bruder Allen hatte Roberts Pflichtgefühl jedoch nicht geteilt und sie sitzen gelassen, noch bevor Gabby geboren wurde.
Verlassen zu werden war schon Schock genug gewesen, noch schlimmer war allerdings, dass er ihr gesamtes Bankkonto leer geräumt und ihr jeden Penny genommen hatte, den sie besaß.
Damals war Robert eingesprungen und hatte ihr angeboten, bei ihm zu wohnen. Sie hatte jedoch abgelehnt und stattdessen die Stelle im Inn angenommen. Robert hatte seinen Bruder aufgespürt, doch Allen hatte das ganze Geld bereits auf den Kopf gehauen und weigerte sich, ihr etwas zurückzugeben. Es folgte die Scheidung. Allen zahlte keinen Unterhalt und verzichtete dafür auf sämtliche Rechte an seiner Tochter. Obwohl sie das Geld dringend hätte gebrauchen können, glaubte sie, einen guten Tausch gemacht zu haben. Es war besser, dass er weg war. Er gehörte zu den Männern, die Unglück säten und sich dann aus dem Staub machten, ohne auch nur einen Gedanken an den Scherbenhaufen zu verschwenden, den sie hinterließen.
Gabby beendete ihr Frühstück und trug ihre Schüssel zur Spüle.
„Ich geh mir die Zähne putzen“, verkündete sie und rannte aus dem Raum.
Robert folgte ihr mit dem Blick. „Ich kann nicht fassen, wie groß sie geworden ist.“
„Sie wird bald zehn.“ Carly goss sich einen Kaffee ein und setzte sich an den Tisch.
„Hast du sie gestern gesehen?“, fragte er.
Sie brauchte nicht nachzufragen, wer „sie“ war. Sie hatte Robert ihre Bedenken bezüglich Michelles Rückkehr anvertraut. Zudem war er Zeuge ihrer Auseinandersetzungen vor zehn Jahren gewesen.
„Ja“, gab sie zu. „Kurz. Sie ist … anders. Dünner. Und sie humpelt, was aber wohl kein Wunder ist.“
„Sie hat einen Schuss in die Hüfte abbekommen, stimmt’s? Hab ich jedenfalls gehört.“
Carly nickte.
„Habt ihr miteinander geredet?“, fragte er.
„Nicht wirklich. Sie war müde.“
Das hatte sie zumindest vermutet. Sie würde nicht zugeben, was Michelle zu ihr gesagt hatte. Sie würde nicht einmal daran denken, ehe sie dazu gezwungen war. Erst dann würde sie sich etwas überlegen.
Die Panik kehrte zurück, doch sie ignorierte sie. Sie würde später noch ausreichend Zeit haben durchzudrehen. Wenn sie allein wäre. Ihrer Angst jetzt nachzugeben, ihre Sorgen vor Robert auszubreiten, würde eine Situation herbeiführen, die sie nicht wollte.
Er sah Allen ähnlich genug, um einerseits anziehend auf sie zu wirken und andererseits ihren Fluchtinstinkt zu wecken. Beide Männer waren mittelgroß, hatten dunkles Haar, dunkle Augen und breite Schultern. Allen, der fast sechs Jahre jünger war als Robert, hatte jedoch die Attitüde und das freigiebige Lächeln eines Mannes, der sich auf seinen Charme verließ. Dass er sie sitzen gelassen hatte, war so unvermeidlich gewesen wie die Wellen, die an die Felsenküste der Insel schwappten.
Robert sah beinahe ebenso gut aus, hatte aber nicht die zerstörerische Veranlagung. Er besaß eine Autowerkstatt am anderen Ende der Stadt. Er war ein guter Mann, der sich um sie und Gabby kümmern wollte, und sie hatte es zugelassen. Weil es so einfach war. Und weil er keine echte Beziehung verlangte und sie keine wollte.
Doch allmählich fragte sie sich, ob diese Einfachheit einen höheren Preis hatte, als ihr klar gewesen war. Ob sie einander nicht nur benutzten, um nicht bei einem anderen Menschen nach dem suchen zu müssen, was sie wirklich wollten. Sollte Michelle sie tatsächlich entlassen, wäre das allerdings kein Thema für sie. Sie hatte so ein Gefühl, dass es sie in der Dating-Szene weniger attraktiv machen würde, wenn sie obdachlos wäre.
![Es geschehen noch Küsse und Wunder (Fool's Gold 30) [ungekürzt] - Susan Mallery - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/1203f8a9d2392d768c0151e86639310c/w200_u90.jpg)

![Spiel, Kuss und Sieg (Fool's Gold 20) [ungekürzt] - Susan Mallery - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/5c895f4d798af186b780b13113e39b30/w200_u90.jpg)