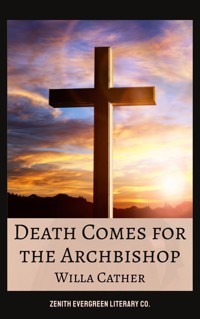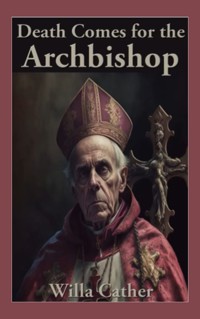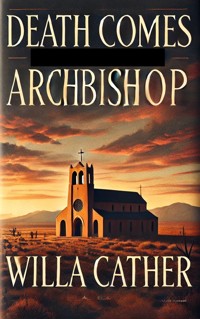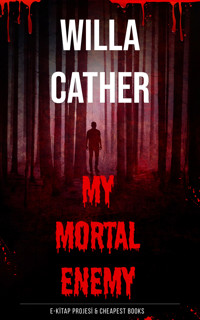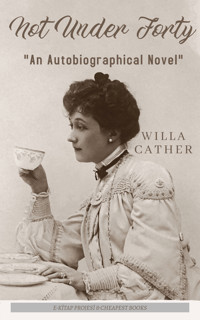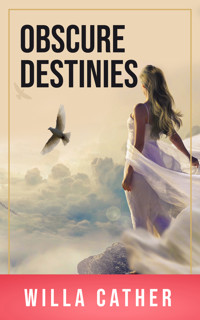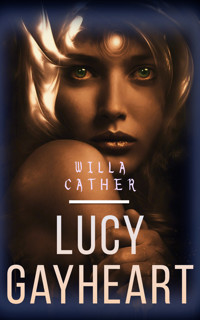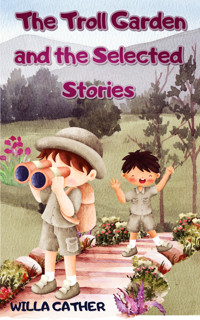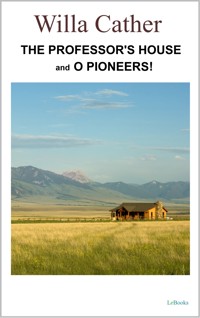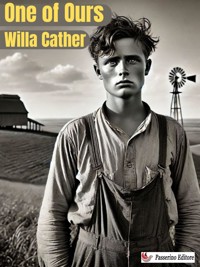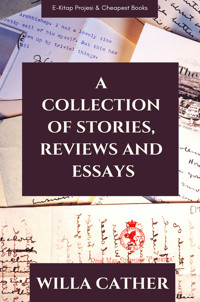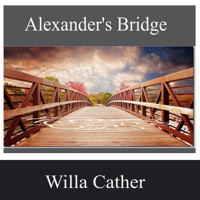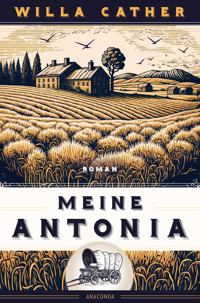
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Anaconda Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nebraska, die Prärie der Great Plains: Hier lebt das Mädchen Antonia, seit sie mit ihrer Familie aus Böhmen in die USA eingewandert ist. Die mühevolle Existenz als Siedler schmeckt nicht jedem, doch die zupackende Antonia liebt die Weite und Ursprünglichkeit der Landschaft und erschafft sich allen Widrigkeiten zum Trotz ihr ganz eigenes Stück neue Heimat. Davon erzählt in der Rückschau ihr Jugendfreund Jim Burden, der eines Tages loszog, sein Glück in den Städten der Ostküste zu suchen. Dieser Roman rund um eine starke junge Frau voller Pioniergeist ist ein Klassiker der amerikanischen Literatur.
- »... und alles ist von einer ganz unwiderstehlichen Klarheit und Schönheit, der Sätze? der Welt? - wer will solche Unterschiede machen, wenn er nichts will als weiterlesen.« (Die Zeit)
- »Willa Cather schreibt eine eminent kluge, ehrliche, von allen Attitüden freie Prosa.« FAZ
- »Ohne Cather wären Truman Capote und E. Annie Proulx kaum denkbar.« Die Welt
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 432
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
WILLA CATHER
MEINE ANTONIA
ROMAN
Aus dem Englischenvon Stefanie Kremer
Anaconda
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten
Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b
UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Titel der amerikanischen Originalausgabe:
My Antonia (Boston: Houghton Mifflin 1918).
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© dieser Ausgabe 2023 by Anaconda Verlag, einem Unternehmen der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
© der Übersetzung 2008 by Albrecht Knaus Verlag, einem Unternehmen der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH Alle Rechte vorbehalten.
Umschlagmotive: A field of wheat in the countryside, Adobe Stock / 2ragon (Landschaft).
- Covered wagon, Adobe Stock / Bitter (Kutsche)
Umschlaggestaltung: www.katjaholst.de
ISBN 978-3-641-31150-6V001
www.anacondaverlag.de
Optima dies … prima fugit
VERGIL
FÜR
CARRIE UND IRENE MINER
In Erinnerung an eine alte,wahre Freundschaft
EINFÜHRUNG
Als ich letzten Sommer während einer heftigen Hitzewelle mit dem Zug durch die Ebenen Iowas fuhr, hatte ich das Glück, gemeinsam mit James Quayle Burden zu reisen – Jim Burden, wie wir ihn im Westen noch immer nennen. Er und ich sind alte Freunde – wir sind in derselben Kleinstadt in Nebraska zusammen aufgewachsen –, und wir hatten uns viel zu erzählen. Während der Zug die endlosen Meilen reifen Weizens durchschnitt, vorbei an ländlichen Städtchen, leuchtend bunt blühenden Wiesen und kleinen Eichenwäldern, deren Laub in der Sonne welkte, saßen wir im Panoramawagen; das Holz fühlte sich heiß an, und alles war dick mit rotem Staub überzogen. Der Staub und die Hitze, der sengende Wind, all das ließ viele Erinnerungen in uns wach werden. Wir sprachen darüber, wie es ist, seine Kindheit in solchen kleinen Städten zu verbringen, begraben unter Weizen und Mais, in stetem Kampf gegen die Kapriolen des Wetters: in den glühend heißen Sommern, wenn das Land grün und wogend unter einem strahlend blauen Himmel liegt, wenn die üppige Pflanzenwelt einen schier erstickt mit den Farben und Gerüchen des wuchernden Unkrauts und der reichen Ernten; in den stürmischen, schneearmen Wintern, wenn das ganze Land grau und kahl gefegt ist wie Eisenblech. Wir waren uns einig, dass niemand, der nicht in einer kleinen Präriestadt aufgewachsen ist, auch nur das Geringste darüber wissen kann. Es sei wie eine eingeschworene Gemeinschaft, sagten wir.
Obwohl Jim Burden und ich alte Freunde sind und beide in New York wohnen, sehe ich ihn dort nicht oft. Er arbeitet als Rechtsbeistand für eines der großen Eisenbahnunternehmen im Westen, und manchmal ist er wochenlang nicht in seinem New Yorker Büro. Das ist einer der Gründe, weshalb wir uns so selten treffen. Ein anderer ist, dass ich seine Frau nicht mag.
Als Jim noch ein unbekannter junger Rechtsanwalt war, der darum kämpfte, sich in New York durchzusetzen, wurde seine Karriere plötzlich durch eine glänzende Verbindung vorangebracht. Genevieve Whitney war die einzige Tochter einer hochrangigen Persönlichkeit. Ihre Vermählung mit dem jungen Burden gab damals Anlass zu allerlei Klatsch und Tratsch. Man erzählte sich, ihr Vetter, Rutland Whitney, habe sie auf schändliche Weise sitzen lassen, und diesen Unbekannten aus dem Westen heirate sie aus einer bloßen Laune heraus. Schon damals war sie ein ruheloses, dickköpfiges Mädchen gewesen, das seine Freunde gern verblüffte. Auch später, nachdem ich sie kennengelernt hatte, war sie immer wieder für Überraschungen gut. Sie stellte eines ihrer Stadthäuser den Suffragetten als Hauptquartier zur Verfügung, inszenierte eines ihrer Stücke am Princess Theater*, wurde festgenommen, als sie während eines Streiks der Textilarbeiter demonstrierte, und so fort. Ich habe noch nie so recht daran geglaubt, dass sie für die Dinge, denen sie ihren Namen und ihr flüchtiges Interesse leiht, echte Anteilnahme aufbringt. Sie ist attraktiv, energiegeladen und tatkräftig, doch für mich hat es den Anschein, als wäre sie durch nichts zu beeindrucken und schon von ihrer Veranlagung her unfähig zu jeder Begeisterung. Ich vermute, dass sie über die harmlosen Schwärmereien ihres Gatten ziemlich aufgebracht ist, stattdessen hält sie es für lohnend, als Gönnerin einer Gruppe junger Dichter und Maler aufzutreten, die sich durch fortschrittliche Ideen und recht mittelmäßiges Talent auszeichnen. Sie hat ihr eigenes Vermögen und lebt ihr eigenes Leben. Aus irgendeinem Grund möchte sie Mrs. James Burden bleiben.
Was Jim anbelangt, so hatten die Enttäuschungen des Lebens seine von Natur aus romantische, leidenschaftliche Art nicht dämpfen können. Diese Leidenschaftlichkeit, die ihn als Jungen oftmals sehr komisch wirken ließ, war eine der wichtigsten Grundlagen seines Erfolgs. Er hängt mit ganzem Herzen an diesem großartigen Land, durch das kreuz und quer die Räder seiner Eisenbahn rattern. Sein Glaube an und sein Wissen über das Land haben eine bedeutende Rolle bei dessen Erschließung gespielt. Immer wieder treibt er Kapital für neue Vorhaben in Wyoming und Montana auf, und er hat den jungen Männern dort geholfen, im Minen-, Holz- und Ölgeschäft Bemerkenswertes zu leisten. Gelingt es einem jungen Burschen mit einer Idee erst einmal, Jim Burdens Aufmerksamkeit zu gewinnen und ihn zu begleiten, wenn er sich in die Wildnis aufmacht, um neue Routen durch die Berge zu entdecken oder unbekannte Canyons zu erkunden, dann lässt das Geld, mit dem man die Dinge in Angriff nehmen kann, gewöhnlich nicht lange auf sich warten. Jim kann sich noch immer in diesen grandiosen Träumen des Westens verlieren. Auch wenn er nun schon über vierzig ist, begegnet er neuen Menschen und Unternehmungen mit der gleichen Begeisterung, die seine Freunde aus der Jugendzeit noch an ihm kennen. Ich habe den Eindruck, dass er niemals älter wird. Seine frische Gesichtsfarbe, das sandbraune Haar und die wachen blauen Augen sind die eines jungen Mannes, und in seinem mitfühlenden Interesse an Frauen spürt man die Jugend ebenso wie den Westen und ganz Amerika.
Im Laufe dieses glühend heißen Tages, an dem wir Iowa durchquerten, kam unser Gespräch immer wieder auf eine zentrale Gestalt zurück, ein Mädchen aus Böhmen, das wir vor langer Zeit gekannt und beide sehr bewundert hatten. Mehr als jeder andere Mensch, an den wir uns erinnerten, verkörperte dieses Mädchen für uns das Land, die Umstände, das ganze Abenteuer unserer Kindheit. Wir mussten nur ihren Namen aussprechen, und schon wurden Bilder von Menschen und Orten wieder wach, wie bei einem stillen Schauspiel im Kopf. Ich hatte sie völlig aus den Augen verloren, aber Jim hatte sie nach langen Jahren wiedergefunden und eine Freundschaft erneuert, die ihm sehr viel bedeutete, und er hatte von seinem geschäftigen Leben genügend Zeit abgezweigt, um diese Bande zu pflegen. An jenem Tag war er ganz von ihr erfüllt. Er schaffte es, dass ich sie wieder vor mir sah, ihre Gegenwart wieder spürte, er ließ all meine alte Zuneigung zu ihr wieder aufleben.
«Ich verstehe einfach nicht», sagte er unvermittelt, «wieso du nie etwas über Antonia geschrieben hast.»
Ich sagte ihm, ich hätte immer das Gefühl gehabt, andere Menschen – er, zum Beispiel – hätten sie viel besser gekannt als ich. Aber ich war bereit, eine Abmachung mit ihm zu treffen; ich wollte alles über Antonia niederschreiben, woran ich mich erinnerte, wenn er das Gleiche tat. Auf diese Weise konnten wir vielleicht ein Bild von ihr gewinnen.
Er fuhr sich mit einer aufgeregten Geste durchs Haar, die bei ihm oft einen spontanen Entschluss verrät, und ich sah, dass mein Vorschlag ihn gepackt hatte. «Vielleicht mache ich das, vielleicht mache ich das!» Er starrte ein Weilchen aus dem Fenster, und als er sich wieder zu mir umdrehte, hatte sein Blick diese einzigartige Klarheit, die von einer plötzlichen Eingebung herrührt. «Natürlich», sagte er, «müsste ich es sehr direkt angehen und eine ganze Menge über mich selbst erzählen. Genauso, wie ich sie wahrgenommen und erlebt habe, denn ich wüsste nicht, wie ich es anders schreiben könnte.»
Ich sagte ihm, dass ich genau das über Antonia wissen wollte: wie er sie gekannt und erlebt hatte. Er hatte Momente mit ihr gehabt, die mir, dem kleinen Mädchen, das zugesehen hatte, wie Antonia kam und ging, verwehrt geblieben waren.
Monate später, an einem stürmischen Winternachmittag, kam Jim Burden in meine Wohnung, unter seinem Pelzmantel trug er einen Aktenordner, der förmlich aus allen Nähten platzte. Er brachte ihn ins Wohnzimmer, und während er sich die Hände wärmte, klopfte er mit einigem Stolz ein paarmal auf den Deckel.
«Ich bin gestern Abend damit fertig geworden – mit dieser Antonia-Geschichte», sagte er. «Und, wie steht es mit dir?»
Ich musste ihm gestehen, dass ich nicht über einige wenige Notizen hinausgekommen war.
«Notizen? So etwas habe ich gar nicht erst gemacht.» Er trank seinen Tee mit einem Zug aus und stellte die Tasse ab. «Ich habe keine Gliederung entworfen und auch später nichts mehr umgestellt. Ich habe einfach nur aufgeschrieben, was Antonias Name in meiner Erinnerung wachgerufen hat – über sie, über mich, über andere Menschen. Es ist ziemlich durcheinander, schätze ich. Es hat nicht einmal einen Titel.» Er ging ins Nebenzimmer, setzte sich an meinen Sekretär und schrieb das Wort «Antonia» auf den rötlichen Deckel des Ordners. Einen Moment lang blickte er es nachdenklich an, dann schrieb er ein zweites Wort davor, so dass «Meine Antonia» daraus wurde. Damit war er offensichtlich zufrieden.
«Lies es, sobald du kannst», sagte er und stand auf, «aber lass nicht zu, dass es deine eigene Geschichte beeinflusst.»
Meine eigene Geschichte wurde nie geschrieben. Die folgende Erzählung entspricht im Großen und Ganzen Jims Manuskript, so wie er es mir gegeben hat.
* Für avantgardistische Aufführungen bekanntes Broadway-Theater.
BUCH I
Die Shimerdas
I
Das erste Mal hörte ich von Antonia* während einer schier endlosen Reise durch die riesigen Ebenen Nordamerikas. Ich war damals zehn Jahre alt; innerhalb eines Jahres hatte ich Vater und Mutter verloren, und meine Verwandten in Virginia hatten mich zu meinen Großeltern geschickt, die in Nebraska lebten. Ich reiste in der Obhut von Jake Marpole, einem Jungen aus den Bergen und Gehilfen auf der Farm meines Vaters am Fuß der Blauen Berge, der nun nach Westen fuhr, um für meinen Großvater zu arbeiten. Jake hatte noch nicht viel mehr von der Welt gesehen als ich. Bis zu jenem Morgen, an dem wir uns aufmachten, unser Glück in einer neuen Welt zu versuchen, war er noch nie mit dem Zug gefahren.
Wir reisten die ganze Strecke in einem Abteilwagen und wurden mit jeder Etappe rußverschmierter und verschwitzter. Jake kaufte alles, was die Jungen mit den Bauchläden feilboten: Süßigkeiten, Orangen, Kragenknöpfe aus Messing, einen Anhänger für die Uhrkette und für mich Das Leben des Jesse James, das mir als eine der spannendsten Geschichten in Erinnerung geblieben ist, die ich je gelesen habe. Ab Chicago kümmerte sich ein freundlicher Schaffner um uns, er wusste alles über das Land, in das wir fuhren, und gab uns, da wir ihm so viel Vertrauen entgegenbrachten, eine Menge guter Ratschläge. In unseren Augen war er ein erfahrener, weltgewandter Mann, der schon fast überall gewesen war; wenn er sprach, streute er ganz nebenbei die Namen entfernter Staaten und Städte ein. Er trug die Ringe und Nadeln und Abzeichen verschiedener Bruderschaften, denen er angehörte. Selbst in seine Manschettenknöpfe waren Hieroglyphen eingraviert, und es waren mehr Inschriften auf ihm zu entdecken als auf einem ägyptischen Obelisken.
Als er sich wieder einmal zum Plaudern zu uns setzte, erzählte er uns, dass im Wagen mit den Einwanderern weiter vorne eine Familie «von jenseits des Teichs» mitfahre, die dasselbe Reiseziel habe wie wir.
«Von denen spricht keiner ein Wort Englisch außer einem kleinen Mädchen, und alles, was die Kleine sagen kann, ist: ‹Wir fahren Black Hawk, Nebraska.› Sie ist nicht viel älter als du, zwölf oder dreizehn vielleicht, und sie ist ganz schön aufgeweckt. Willst du nicht nach vorn gehen, Jimmy, und sie kennenlernen? Sie hat auch richtig hübsche braune Augen!»
Diese letzte Bemerkung schüchterte mich ein, und ich schüttelte den Kopf und vergrub mich wieder in meinen Jesse James. Jake nickte zustimmend und sagte, dass man sich von Ausländern leicht Krankheiten hole.
Ich erinnere mich weder daran, wie wir den Missouri River überquerten, noch an sonst etwas auf dieser langen Tagereise durch Nebraska. Wahrscheinlich hatte ich zu diesem Zeitpunkt schon so viele Flüsse überquert, dass sie mir gleichgültig geworden waren. Das Einzige, was mir an Nebraska auffiel, war, dass es den lieben, langen Tag über Nebraska war, immer nur Nebraska.
Als wir Black Hawk erreichten, lag ich schon eine ganze Weile zusammengerollt auf einem roten Plüschsitz und schlief. Jake weckte mich und nahm mich bei der Hand. Wir stolperten aus dem Zug auf einen hölzernen Bahnsteig, auf dem Männer mit Laternen hin und her liefen. Ich konnte keine Stadt sehen, nicht einmal ein Licht in der Ferne; wir waren umgeben von vollkommener Dunkelheit. Die Lokomotive schnaufte heftig nach der langen Fahrt. Im roten Schein des Heizkessels hatte sich eine kleine Gruppe Menschen auf dem Bahnsteig zusammengedrängt, über und über beladen mit Schachteln und Bündeln. Ich wusste, dass das die Einwandererfamilie sein musste, von der uns der Schaffner erzählt hatte. Die Frau hatte ein Tuch mit Fransen um den Kopf gebunden und trug in den Armen eine kleine Kiste aus Blech; sie drückte sie an sich, als wäre es ein Baby. Neben ihr stand ein alter Mann, groß und gebeugt. Zwei halbwüchsige Jungen und ein etwa dreizehnjähriges Mädchen hielten Bündel aus Wachstuch in den Händen, und ein kleines Mädchen klammerte sich an die Röcke der Mutter. Gleich darauf näherte sich ihnen ein Mann mit einer Laterne und begann, laut und heftig auf sie einzureden. Ich spitzte die Ohren, denn das war das allererste Mal, dass ich eine fremde Sprache hörte.
Eine weitere Laterne kam näher, und eine vergnügte Stimme rief: «Hallo, seid ihr die Jungs von Mr. Burden? Wenn ja, dann wartet ihr auf mich. Ich bin Otto Fuchs. Ich bin Mr. Burdens Gehilfe und soll euch zu ihm rausfahren. Hallo, Jimmy, hast du denn gar keine Angst, so weit in den Westen zu kommen?»
Interessiert schaute ich zu dem unbekannten Gesicht im Laternenschein auf. Der Mann hätte den Seiten von Jesse James entstiegen sein können. Er trug einen Cowboyhut mit breitem Lederband und schimmernder Schnalle, und die Enden seines Schnurrbarts hatte er steif in die Höhe gezwirbelt wie kleine Hörner. Ich fand, er sah lebhaft und verwegen aus, so als hätte er eine wilde Vergangenheit. Über seine Wange lief eine lange Narbe, die den Mundwinkel zu einem unheimlichen Kräuseln verzog. Die obere Hälfte seines linken Ohrs fehlte, und er war so braun gebrannt wie ein Indianer. Es war das Gesicht eines Desperados, ganz gewiss. Als er in seinen Stiefeln mit den hohen Absätzen den Bahnsteig entlangging und nach unseren Koffern Ausschau hielt, sah ich, dass er ein recht schmaler Mann war, wendig, drahtig und flink. Wir hätten eine lange Fahrt durch die Nacht vor uns, sagte er, und sollten uns besser auf den Weg machen. Er führte uns zu einem Holm, an dem zwei Pferdewagen angebunden waren, und ich sah, wie sich die ausländische Familie in einen der beiden hineinzwängte. Der andere Wagen war für uns. Jake kletterte zu Otto Fuchs auf den Kutschbock, und ich rollte mich auf dem Stroh, das auf der Ladefläche lag, in eine Decke aus Büffelfell ein. Die Einwanderer rumpelten davon in die leere Dunkelheit, und wir folgten ihnen.
Ich versuchte zu schlafen, doch bei dem Gerüttel und Geschüttel biss ich mir auf die Zunge, und bald tat mir alles weh. Als sich das Stroh gesetzt hatte, wurde mein Lager sehr hart. Vorsichtig schlüpfte ich unter dem Büffelfell hervor, kniete mich hin und lugte über den Wagenrand. Aber da war nichts zu sehen, weder Zäune noch Bäche noch Bäume, weder Hügel noch Felder. Wenn es eine Straße gab, dann konnte ich sie im schwachen Licht der Sterne nicht erkennen. Es gab nichts außer der schwarzen Erde: Das war nicht einmal ein Land, das war nur der Stoff, aus dem Länder gemacht sind. Nein, es gab nichts außer der Erde – der Boden war leicht gewellt, das wusste ich, weil die Räder oft an der Bremse schleiften, wenn wir in eine kleine Senke fuhren und auf der anderen Seite mit einem Ruck wieder herausrumpelten. Mir war, als hätten wir die Welt hinter uns gelassen, als wären wir über den Rand der Welt hinausgefahren und befänden uns nun außerhalb der Gerichtsbarkeit der Menschen. Noch nie zuvor hatte ich zu einem Himmel emporgeschaut, vor dem sich kein vertrauter Bergrücken erhob. Hier wölbte sich das gesamte Himmelszelt, überall war Himmel. Ich glaubte nicht, dass mein toter Vater und meine tote Mutter mich von dort oben beobachteten; sie suchten mich wohl noch immer bei den Schafen unten am Bach oder auf der weißen Straße, die zu den Bergwiesen hinaufführte. Selbst ihre Geister hatte ich hinter mir gelassen. Der Wagen holperte weiter und trug mich fort, wohin, ich wusste es nicht. Ich glaube nicht, dass ich Heimweh hatte. Und wenn wir nie irgendwo angekommen wären, es hätte mir nichts ausgemacht. Zwischen dieser Erde und diesem Himmel fühlte ich mich unsichtbar, ausgelöscht. An jenem Abend sprach ich meine Gebete nicht: Was hier geschehen würde, würde geschehen, das spürte ich.
II
An unsere Ankunft auf der Farm meines Großvaters irgendwann vor Tagesanbruch nach einer Fahrt von fast zwanzig Meilen mit schweren Arbeitspferden kann ich mich nicht erinnern. Als ich aufwachte, war es Nachmittag. Ich befand mich in einem kleinen Zimmer, das kaum größer war als das Bett, in dem ich lag, und im Fenster über meinem Kopf wehten die Vorhänge im warmen Wind. Eine große Frau mit runzliger brauner Haut und schwarzem Haar stand vor mir und blickte auf mich herab; ich wusste, dass das meine Großmutter sein musste. Ich sah, dass sie geweint hatte, aber als ich die Augen aufschlug, lächelte sie, sie schaute mich besorgt an und setzte sich ans Fußende des Bettes.
«Na, Jimmy, gut geschlafen?», fragte sie munter. Dann sagte sie in einem gänzlich anderen Ton, wie zu sich selbst: «Du liebe Güte, wie ähnlich du doch deinem Vater siehst!» Mir fiel ein, dass mein Vater ihr kleiner Junge gewesen war; sie musste ihn oft auf diese Weise geweckt haben, wenn er verschlafen hatte. «Hier sind deine sauberen Sachen», fuhr sie fort; während sie redete, strich sie mit ihrer braun gebrannten Hand über die Decke. «Aber erst einmal kommst du mit hinunter in die Küche und nimmst hinter dem Ofen ein schönes heißes Bad. Bring deine Sachen mit; es ist sonst niemand im Haus.»
«Hinunter in die Küche» klang komisch in meinen Ohren; zu Hause war es stets «hinüber in die Küche» gewesen. Ich nahm meine Schuhe und Strümpfe und ging hinter ihr her durch die Wohnstube und eine Treppe hinunter in das Kellergeschoss. Dieses war unterteilt in ein Esszimmer, das rechts von der Treppe, und eine Küche, die links davon lag. Beide Räume waren verputzt und weiß getüncht – der Putz war direkt auf die Wand aufgetragen worden, wie man es auch in Erdhöhlen machte. Der Boden war aus Zement. Unter der Decke aus Holz waren schmale Fensterchen mit weißen Vorhängen, und auf den tiefen Fenstersimsen standen Töpfe mit Geranien und Ampelkraut. Als ich in die Küche trat, roch ich den angenehmen Duft frisch gebackener Ingwerplätzchen. Dort stand ein sehr großer Ofen mit glänzenden Beschlägen aus Nickel, und dahinter an der Wand sah ich eine lange Holzbank und eine zinnerne Waschwanne, in die meine Großmutter heißes und kaltes Wasser goss. Als sie Seife und Handtücher brachte, sagte ich ihr, dass ich für gewöhnlich ohne Hilfe badete.
«Kannst du dir denn auch die Ohren waschen, Jimmy? Ganz sicher? Na, das nenne ich aber einen geschickten kleinen Jungen.»
Es war sehr heimelig in der Küche. Durch das nach Westen gehende Fensterchen fiel die Sonne in mein Badewasser, und eine große blauschwarze Katze kam herbeigelaufen, strich um die Waschwanne herum und beäugte mich neugierig. Während ich mich schrubbte, machte sich meine Großmutter im Esszimmer zu schaffen, bis ich besorgt rief: «Großmutter, ich fürchte, die Plätzchen verbrennen!» Da kam sie lachend zurück und schwenkte ihre Schürze hin und her, als wollte sie Hühner verscheuchen.
Sie war eine hagere, groß gewachsene Frau, die etwas gebeugt ging und manchmal den Kopf mit einem aufmerksamen Gesichtsausdruck nach vorn schob, als suchte oder hörte sie etwas weit Entferntes. Als ich älter wurde, kam ich schließlich zu der Überzeugung, das liege nur daran, dass sie so oft an weit entfernte Dinge und Begebenheiten dachte. Ihre Bewegungen waren stets flink und schwungvoll. Sie hatte eine hohe, ziemlich schrille Stimme, und oft klang sie besorgt, denn vor allem anderen war sie darauf bedacht, dass die Dinge mit der gebotenen Ordnung und Schicklichkeit vonstatten gingen. Auch ihr Lachen war schrill und vielleicht sogar ein wenig schneidend, doch es schwang ein wacher Verstand darin. Sie war damals 55 Jahre alt, eine kräftige Frau von ungewöhnlicher Zähigkeit.
Nachdem ich mich angezogen hatte, erkundete ich den langen Keller neben der Küche. Er lag unter dem Seitenflügel des Hauses, war verputzt und hatte ebenfalls einen Zementfußboden sowie eine Treppe und eine Tür, die nach draußen führte und durch welche die Männer kamen und gingen. Unter einem der Fenster gab es einen Platz, wo die Männer sich waschen konnten, wenn sie von der Arbeit nach Hause kamen.
Während meine Großmutter das Abendessen richtete, machte ich es mir auf der Holzbank hinter dem Ofen bequem und schloss nähere Bekanntschaft mit der Katze – es war ein Kater, der nicht nur Ratten und Mäuse fing, sondern auch Erdhörnchen, wie ich erfuhr. Der goldgelbe Sonnenfleck auf dem Boden wanderte zur Treppe hinüber, und Großmutter und ich unterhielten uns über meine Reise und über die Ankunft der neuen Familie aus Böhmen; sie würden, sagte Großmutter, unsere nächsten Nachbarn sein. Über die Farm in Virginia, die so viele Jahre ihr Zuhause gewesen war, sprachen wir nicht. Doch als die Männer vom Feld zurückgekommen waren und wir alle um den Esstisch saßen, fragte sie Jake nach der alten Heimat und nach unseren Freunden und Nachbarn dort.
Mein Großvater sprach nur wenig. Als er hereingekommen war, hatte er mir zunächst einen Kuss gegeben und freundlich mit mir geredet, ansonsten aber war er sehr zurückhaltend. Er verströmte eine Würde und Bedächtigkeit, die ich sofort spürte, und das flößte mir ein bisschen Ehrfurcht ein. Jedem fiel gleich sein schöner, lockiger, schneeweißer Bart auf. Einmal hörte ich, wie ein Missionar sagte, der Bart sehe aus wie der eines arabischen Scheichs. Das kahle Haupt meines Großvaters hob ihn eindrucksvoll hervor.
Großvaters Augen glichen nicht im Geringsten denen eines alten Mannes; sie waren strahlend blau und versprühten ein frisches, frostiges Funkeln. Er hatte weiße, gleichmäßige Zähne – sie waren so gesund, dass er sein Leben lang nicht zum Zahnarzt gehen musste. Seine Haut war sehr empfindlich und wurde durch Wind und Sonne schnell rau. Als junger Mann hatte er rote Haare und einen roten Bart gehabt; seine Augenbrauen waren noch immer kupferfarben.
Bei Tisch warfen Otto Fuchs und ich uns immer wieder verstohlene Blicke zu. Großmutter hatte mir, während sie das Abendessen zubereitet hatte, erzählt, dass er als junger Bursche aus Österreich hierhergekommen war und bei den Goldgräbern und Cowboys ganz im Westen ein aufregendes Leben geführt hatte. Seine eiserne Konstitution war durch eine Lungenkrankheit, die er sich in den Bergen geholt hatte, stark angegriffen, und er hatte beschlossen, für eine Weile in ein milderes Klima zu ziehen. Er hatte Verwandte in Bismarck, einer deutschen Siedlung nördlich von uns, und er arbeitete nun schon seit einem Jahr für Großvater.
Kaum hatten wir zu Abend gegessen, zog Otto mich in die Küche und teilte mir im Flüsterton mit, dass draußen in der Scheune ein Pony stehe, das extra für mich gekauft worden sei; er habe es bereits geritten, um zu sehen, ob es irgendwelche Launen habe, aber es sei ein «vollkommener Gentleman» und heiße Dude. Fuchs erzählte mir alles, was ich wissen wollte: Wie er sein Ohr in einem Blizzard in Wyoming verloren hatte, als er dort Postkutschen fuhr, und wie man ein Lasso wirft. Er versprach mir, am kommenden Tag noch vor Sonnenuntergang einen jungen Ochsen für mich einzufangen. Er holte seine Cowboyhosen und die silbernen Sporen hervor, um sie Jake und mir zu zeigen, und seine besten Cowboystiefel, deren Schäfte mit kühnen Motiven bestickt waren – mit Rosen und Liebesknoten und unverhüllten Frauengestalten. Letztere, so verkündete er feierlich, seien Engel.
Ehe wir zu Bett gingen, wurden Jake und Otto zum Gebet in die Stube gerufen. Großvater setzte eine Brille mit silbernem Rand auf und las mehrere Psalmen vor. Seine Stimme klang so eindringlich, und er las so fesselnd, dass ich mir wünschte, er hätte eines meiner Lieblingskapitel aus dem Buch der Könige ausgewählt. Mich beeindruckte tief, wie er das Wort «Sela»* aussprach. «Er erwählt uns unser Erbteil, die Herrlichkeit Jakobs, den Er lieb hat. SELA.» Ich hatte keine Ahnung, was dieses Wort bedeutete; vielleicht wusste nicht einmal er es. Doch wenn er es aussprach, wurde es zu einem geheimnisvollen Wort, zum heiligsten aller Wörter.
Am nächsten Morgen lief ich schon früh nach draußen, um mich umzuschauen. Ich hatte gehört, dass unser Haus das einzige Holzhaus westlich von Black Hawk war – bis hin zur norwegischen Siedlung, in der einige Blockhäuser standen. Unsere Nachbarn wohnten in grasgedeckten Häusern und Erdhöhlen – behaglich, doch nicht allzu geräumig. Unser weißes Holzhaus, das sich anderthalb Stockwerke über dem Keller erhob, befand sich am östlichen Ende dessen, was man wohl den Hof nennen könnte; direkt neben der Küchentür stand das Windrad. Vom Windrad aus fiel das Gelände nach Westen ab, hinunter zu den Scheunen und Getreidespeichern und Schweinekoben. Der Hang war hart und kahl getrampelt, vom Regen ausgewaschene Furchen schlängelten sich überall hinab. Jenseits des Maisspeichers, am Grund der flachen Senke, lag ein schlammiger kleiner Teich, an dessen Rändern rostfarbene Weidenbüsche wuchsen. Die Straße, die von der Poststation kam, verlief direkt vor unserer Tür, führte über den Hof, wand sich um den kleinen Teich und kletterte dahinter in westlicher Richtung die sanft ansteigende offene Prärie empor. Am westlichen Horizont führte sie um ein riesiges Maisfeld herum, das viel größer als jedes andere Feld war, das ich je gesehen hatte. Dieses Maisfeld und das kleine Hirsefeld hinter der Scheune waren weit und breit das einzige bestellte Land. So weit das Auge reichte, gab es nichts als struppiges, stacheliges rotes Gras, das mir an vielen Stellen über den Kopf ragte.
Nördlich des Hauses, noch vor den Gräben, die zum Schutz vor Bränden gezogen waren, wuchsen dicht an dicht niedrige, buschige Eschenahornbäumchen, deren Blätter sich bereits gelb verfärbten. Sie bildeten eine Hecke, die fast eine Viertelmeile lang war, aber ich musste sehr genau hinschauen, um sie überhaupt zu erkennen. Vor dem Gras hoben sich die kleinen Bäume kaum ab. Es sah aus, als wollte das Gras über sie hinwegfegen und auch über den kleinen Pflaumengarten hinter dem erdgedeckten Hühnerstall.
Als ich mich umsah, konnte ich spüren, dass das Gras eins mit dem Land war, so wie das Wasser eins mit dem Meer ist. Das Rot des Grases verlieh der ganzen, riesigen Prärie die Farbe verschütteten Rotweins, die Farbe von manchen Seetangarten, wenn sie gerade an Land gespült werden. Und es war eine solche Bewegung darin, das ganze Land schien hin- und herzulaufen.
Ich hatte beinahe vergessen, dass ich eine Großmutter hatte, da kam sie aus dem Haus, den Sonnenhut auf dem Kopf und einen Getreidesack in der Hand, und fragte mich, ob ich mit ihr in den Garten kommen und Kartoffeln für das Mittagessen ausgraben wolle.
Der Garten lag seltsamerweise eine Viertelmeile vom Haus entfernt, und der Weg dorthin führte an der Viehweide vorbei und eine flache Senke hinauf. Großmutter machte mich auf einen kräftigen Stock aus Hickoryholz mit einer Spitze aus Kupfer aufmerksam, der an einem Lederriemen von ihrem Gürtel herabhing. Das, sagte sie mir, sei ihr Stock für die Klapperschlangen. Ich dürfe niemals ohne einen schweren Stock oder ein Maismesser in den Garten gehen; sie selbst habe auf ihrem Weg hin und zurück schon eine Menge Klapperschlangen getötet. Ein kleines Mädchen, das an der Straße nach Black Hawk wohne, sei in den Knöchel gebissen worden und den ganzen Sommer lang krank gewesen.
Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie das Land an jenem frühen Septembermorgen auf mich wirkte, als ich neben meiner Großmutter den Weg mit den undeutlichen Wagenspuren entlangging. Vielleicht war ich ja noch vom Rollen der langen Zugfahrt erfüllt, denn mehr als alles andere spürte ich eine Bewegung in dieser Landschaft; im frischen, sanft dahinstreichenden Morgenwind und im Erdboden selbst, als wäre das struppige Gras ein locker übergeworfenes Laken, und darunter galoppierten Herden wilder Büffel dahin, dahin …
Alleine hätte ich den Garten wohl nie gefunden – außer vielleicht dank der dicken, gelben Kürbisse, die ungeschützt an ihren vertrockneten Blättern und Ranken herumlagen –, und als ich ankam, schien er mir nicht sonderlich bemerkenswert. Ich wollte geradewegs weiter durch das rote Gras gehen und über den Rand der Welt hinaus, der nicht mehr allzu weit weg sein konnte. Die laue Luft um mich herum verriet mir, dass die Welt hier zu Ende war; es gab nur noch die Erde und die Sonne und den Himmel, und wenn man noch ein Stückchen weiterging, würde es nur noch die Sonne und den Himmel geben, und man würde vollends darin aufgehen, wie die gelbbraunen Falken, die über unseren Köpfen dahinsegelten und deren Schatten langsam über das Gras glitten. Während Großmutter nach der Forke griff, die in einer der Furchen stand, und Kartoffeln ausgrub, während ich die Kartoffeln aus der weichen, braunen Erde klaubte und in den Sack legte, sah ich immer wieder zu den Falken hinauf, zu denen ich mich so gern emporgeschwungen hätte.
Als Großmutter fertig war und wieder zum Haus zurückgehen wollte, sagte ich ihr, dass ich gerne noch ein wenig im Garten bleiben würde.
Sie blinzelte mich unter ihrem Sonnenhut hervor an. «Hast du denn keine Angst vor Schlangen?»
«Ein bisschen», gab ich zu, «aber ich würde trotzdem gern noch etwas hierbleiben.»
«Na gut, und wenn du eine Schlange siehst, dann lass sie einfach in Ruhe. Die großen braungelben tun dir nichts; das sind Bullennattern, die sorgen dafür, dass die Erdhörnchen nicht überhandnehmen. Und krieg keinen Schrecken, wenn aus dem Loch in der Böschung dort drüben jemand herausschaut. Das ist ein Dachsbau. Der Dachs ist etwa so groß wie ein großes Opossum, und er hat ein schwarz-weiß gestreiftes Gesicht. Ab und zu holt er sich ein Huhn, aber ich lasse nicht zu, dass die Männer ihm etwas antun. In einem neuen Land sollte der Mensch den Tieren freundlich begegnen. Ich habe es gern, wenn er aus seinem Bau kommt und mir bei der Arbeit zusieht.»
Großmutter warf sich den Sack mit den Kartoffeln über die Schulter und ging den Pfad hinab, wobei sie sich ein wenig vornüber beugte. Der Weg folgte den Windungen der Senke; als sie die erste Biegung erreicht hatte, winkte sie mir zu und verschwand. Nun war ich mit diesem neuen Gefühl der Leichtigkeit und Zufriedenheit allein.
Ich setzte mich in der Mitte des Gartens auf den Boden, dort, wo kaum eine Schlange unbemerkt herankriechen konnte, und lehnte mich an einen warmen, gelben Kürbis. Entlang der Furchen wuchsen einige Erdkirschensträucher, die voller Früchte hingen. Ich streifte die papierdünnen, dreieckigen Blätter ab, die die Kirschen schützten, und aß ein paar. Rings um mich herum vollführten riesige Grashüpfer akrobatische Kunststückchen zwischen den vertrockneten Ranken – sie waren doppelt so groß wie alle Grashüpfer, die ich bislang gesehen hatte. Die Erdhörnchen huschten die gepflügten Furchen auf und ab. Dort in meiner Kuhle war ich vor dem Wind geschützt, doch ich konnte hören, wie er über die Prärie murmelte und brauste, und ich sah das hohe Gras wogen. Die Erde, auf der ich saß, war warm, und warm war die Erde, die ich zwischen den Fingern zerbröckelte. Komische kleine rote Käfer kamen hervor und krabbelten in Kolonnen langsam um mich herum. Sie hatten glänzende zinnoberrote Panzer mit schwarzen Punkten. Ich verhielt mich so still, wie ich nur konnte. Nichts geschah. Ich erwartete nicht, dass etwas geschehen würde. Ich war da, spürte die Sonne, war wie die Kürbisse, und mehr wollte ich gar nicht sein. Ich war vollkommen glücklich. Vielleicht fühlen wir uns ja genau so, wenn wir sterben und Teil eines großen Ganzen werden, ob das nun Sonne ist und Luft oder Güte und Wissen. Dies jedenfalls ist das Glück; aufzugehen in etwas Umfassendem, Großem. Und wenn es über einen kommt, dann kommt es so selbstverständlich wie der Schlaf.
III
Am Sonntagvormittag sollte Otto Fuchs uns zu unseren neuen böhmischen Nachbarn fahren, damit wir Bekanntschaft mit ihnen schließen konnten. Wir nahmen ein paar Vorräte für sie mit, denn sie waren in ein Stück Wildnis gezogen, wo es weder einen Garten gab noch einen Hühnerstall und nur sehr wenig bestelltes Land. Fuchs holte einen Sack Kartoffeln und einen Pökelschinken aus dem Keller, und Großmutter packte ein paar Brote vom Vortag, ein Töpfchen Butter und mehrere Kürbispasteten in das Stroh auf dem Wagen. Wir kletterten auf den Kutschbock und rumpelten an dem kleinen Teich vorbei die Straße entlang, die zu dem großen Maisfeld hinaufführte.
Ich konnte es kaum erwarten zu sehen, was hinter diesem Maisfeld lag; aber da war nur das gleiche rote Gras wie bei uns, sonst nichts, obwohl man von dem hohen Kutschbock aus weit in die Ferne blicken konnte. Die Straße schlängelte sich wie ein wildes Tier, den tiefen Senken wich sie aus, und die breiten, flachen durchquerte sie. Und in allen Gräben entlang der Straße, wo und wie sie auch verlief, wuchsen die Sonnenblumen; einige waren so groß wie kleine Bäume, mit riesigen, stacheligen Blättern und zahllosen Ästen, an denen Dutzende Blüten hingen. Sie zogen ein goldenes Band durch die Prärie. Hin und wieder rupfte eines der Pferde einen Stängel voller Blüten ab und mampfte ihn im Weitergehen vor sich hin; die Blumen wippten im Takt der Bissen, mit denen der Gaul sich zur Blüte vorfraß.
Während wir die Straße entlangfuhren, erzählte Großmutter mir, dass die böhmische Familie ihre Farm von Peter Krajiek, einem Landsmann, gekauft und mehr dafür bezahlt habe, als sie wert sei. Der Vertrag war, noch bevor die Familie die alte Heimat verlassen hatte, über einen Vetter Krajieks geschlossen worden, der gleichzeitig auch mit Mrs. Shimerda verwandt war. Die Shimerdas waren die erste Familie aus Böhmen, die in diesen Teil Nebraskas gekommen war. Krajiek war ihr einziger Dolmetscher, und er konnte ihnen erzählen, was immer er wollte. Sie sprachen zu schlecht Englisch, um jemanden um Rat fragen oder auch nur ihre dringlichsten Bedürfnisse mitteilen zu können. Einer der Söhne, so berichtete Fuchs, sei ein gut gebauter Bursche, kräftig genug, um das Land zu bestellen, doch der Vater sei alt und gebrechlich und habe keine Ahnung von Ackerbau und Viehzucht. Er sei Weber und sehr geschickt in der Herstellung von Teppichen und Polsterstoffen. Er habe seine Geige mit nach Amerika gebracht, die ihm hier jedoch nur wenig nützen werde, auch wenn er in Böhmen Geld damit verdient habe.
«Wenn es nette Leute sind, finde ich die Vorstellung, dass sie den Winter in Krajieks Höhle verbringen sollen, einfach schrecklich», sagte Großmutter. «Die ist doch um keinen Deut besser als ein Dachsbau; nicht einmal eine richtige Erdhöhle ist das. Und ich habe gehört, dass er ihnen zwanzig Dollar für seinen alten Küchenofen abgeknöpft hat, der keine zehn wert ist.»
«Das stimmt, Ma’m», sagte Otto, «und er hat ihnen seine Ochsen und seine beiden alten Klepper zum Preis von guten Gespannen angedreht. Wegen den Pferden hätte ich mich ja eingemischt – der alte Mann versteht wohl etwas Deutsch –, wenn ich geglaubt hätte, dass es was nützt. Aber die Böhmen misstrauen den Österreichern von Natur aus.»
Großmutter blickte interessiert drein. «Warum denn das, Otto?»
Fuchs zog Stirn und Nase kraus. «Na ja, Ma’m, das ist was Politisches. Das zu erklären würde lange dauern.»
Die Landschaft wurde schroffer; sie erzählten mir, dass wir uns dem Squaw Creek näherten, der den Besitz der Shimerdas im Westen durchschnitt und das Land für den Ackerbau fast wertlos machte. Bald schon konnten wir die zerklüfteten, grasbewachsenen Lehmhänge erkennen, die den Windungen des Flusses folgten, und wir sahen die glitzernden Wipfel der Pappeln und Eschen, die unten in der Schlucht wuchsen. Einige Pappeln verfärbten sich bereits, und mit den gelben Blättern und der schimmernden weißen Rinde sahen sie aus wie die goldenen und silbernen Bäume aus den Märchen.
Als wir uns der Behausung der Shimerdas näherten, sah ich noch immer nichts als bucklige rote Hügel und Senken mit steilen Böschungen, aus denen dort, wo die Erde weggebröckelt war, lange Wurzeln herauslugten. Und dann bemerkte ich, an eine dieser Böschungen gelehnt, eine Art Schuppen, der mit dem gleichen rotweinfarbenen Gras gedeckt war, das überall wuchs. Daneben stand das schiefe Gerüst eines verfallenen Windrads ohne Rad. Wir hielten bei dem Gerippe und banden die Pferde an, und da sah ich, tief eingesunken in die Böschung, eine Tür und ein Fenster. Die Tür stand offen, und eine Frau und ein vierzehnjähriges Mädchen liefen heraus und blickten uns hoffnungsvoll entgegen. Hinter ihnen kam ein kleineres Mädchen herbeigetrottet. Die Frau hatte dasselbe bestickte Tuch mit Seidenfransen um den Kopf geschlungen, das sie auch schon getragen hatte, als sie in Black Hawk aus dem Zug gestiegen war. Sie war nicht alt, aber sie war ganz gewiss auch nicht mehr jung. Sie hatte einen wachsamen, lebhaften Gesichtsausdruck, ein spitzes Kinn und listige, kleine Augen. Energisch schüttelte sie Großmutter die Hand.
«Sehr froh, sehr froh!», stieß sie hervor. Gleich darauf deutete sie auf die Böschung, aus der sie gekommen war, und sagte: «Haus nicht gut, Haus nicht gut!»
Großmutter nickte tröstend. «Nach einer Weile werden Sie es ganz behaglich haben, Mrs. Shimerda; gutes Haus bauen.»
Meine Großmutter sprach immer sehr laut mit Ausländern, als wären diese taub. Sie gab Mrs. Shimerda zu verstehen, dass wir sie in freundlicher Absicht besuchten, und die Frau aus Böhmen befingerte die Brotlaibe und roch sogar daran, und sie untersuchte neugierig und aufmerksam die Pasteten, wobei sie immer wieder ausrief: «Viel gut, viel Dank!» – und erneut Großmutters Hand ergriff.
Ambrož – sie riefen ihn Ambrosch –, der älteste Sohn, kam aus der Höhle und stellte sich neben seine Mutter. Er war neunzehn Jahre alt, von kleiner Statur, mit breiten Schultern, einem kurz geschorenen, flachen Kopf und einem runden, flachen Gesicht. Seine haselnussbraunen Augen waren wie die seiner Mutter klein und listig, aber auch voller Argwohn und Tücke; mit seinem Blick verschlang er förmlich das mitgebrachte Essen. Die Familie hatte seit drei Tagen nur von Maiskuchen und Hirsebrei gelebt.
Das kleine Mädchen war hübsch, doch Antonia – sie betonten den Namen auf der ersten Silbe, wenn sie mit ihr sprachen – war noch viel hübscher. Mir fiel wieder ein, was der Schaffner über ihre Augen gesagt hatte. Sie waren groß und warm und voller Licht, wie sonnenbeschienene braune Weiher im Wald. Auch ihre Haut war braun, und die Wangen glühten in einem satten, kräftigen Farbton. Das braune Haar fiel ihr in ungebändigten Locken herab. Ihre kleine Schwester, die sie Yulka riefen, war blond und sah sanftmütig und folgsam aus. Während ich verlegen vor den beiden Mädchen stand, kam Krajiek aus der Scheune, um zu sehen, was los war. Mit ihm kam ein weiterer Sohn der Shimerdas herbei. Selbst aus der Ferne konnte man erkennen, dass mit diesem Jungen irgendetwas nicht stimmte. Als er näher kam, fing er an, grunzende Laute von sich zu geben, und er hielt die Hände hoch, um uns seine Finger zu zeigen, die Schwimmhäute hatten, wie Entenfüße. Als er sah, dass ich zurückwich, juchzte er entzückt und krähte: «Hoo, hoo-hoo, hoo-hoo!», wie ein Hahn. Seine Mutter sah ihn finster an und rief streng: «Marek!», dann sagte sie schnell etwas auf Böhmisch zu Krajiek.
«Ich soll Ihnen sagen, dass er keinem was tut, Mrs. Burden. Er ist so auf die Welt gekommen. Die anderen sind richtig im Kopf. Ambrosch hier, der wird guten Farmer abgeben.» Er klopfte Ambrosch auf den Rücken, und der Junge lächelte vielsagend.
In diesem Augenblick trat der Vater aus dem Loch in der Böschung. Er trug keinen Hut, und sein dickes, eisengraues Haar war aus der Stirn nach hinten gebürstet. Es war so lang, dass die Haarbüschel hinter den Ohren hervorlugten, und er sah damit aus wie die Gestalten auf den alten Porträts, an die ich mich noch aus Virginia erinnerte. Er war groß und schlank, seine schmalen Schultern gebeugt. Er blickte uns freundlich und aufmerksam an, dann nahm er Großmutters Hand und neigte sich darüber. Mir fiel auf, wie weiß und wohlgeformt seine Hände waren. Sie wirkten irgendwie sehr bedächtig, sehr geschickt. Seine Augen waren voller Schwermut und lagen tief in den Höhlen. Er hatte ein markantes Gesicht, doch es wirkte aschfahl – als wäre alle Wärme, alles Licht darin erloschen. Alles an diesem alten Mann war in Einklang mit seinem würdevollen Auftreten. Er war sehr sorgfältig gekleidet. Unter seiner Jacke trug er eine graue Strickweste, und anstelle eines Kragens hatte er einen dunkelgrünen Seidenschal akkurat um den Hals gelegt und mit einer roten Korallennadel festgesteckt. Während Krajiek für Mr. Shimerda übersetzte, kam Antonia zu mir herüber und streckte mir einladend die Hand entgegen. In der nächsten Sekunde liefen wir zusammen die steile Anhöhe hinauf, Julka kam uns hinterhergetrabt.
Als wir oben anlangten und die goldenen Baumwipfel sehen konnten, deutete ich in ihre Richtung, und Antonia lachte und drückte meine Hand, als wollte sie mir sagen, wie sehr sie sich freute, dass ich gekommen war. Wir rannten los, auf den Squaw Creek zu, und hörten erst auf zu laufen, als der Boden selbst aufhörte – er fiel so unvermittelt vor uns ab, dass der nächste Schritt uns in die Baumwipfel geführt hätte. Wir standen keuchend am Rand der Schlucht und blickten auf die Büsche und Bäume, die unter uns wuchsen. Der Wind blies so heftig, dass ich meinen Hut festhalten musste, und die Röcke der Mädchen blähten sich weit auf. Das schien Antonia zu gefallen; sie hielt ihre Schwester fest an der Hand und plapperte wie ein Wasserfall in dieser Sprache, die klang, als würde sie so viel schneller gesprochen als meine. Sie blickte mich an, und in ihren Augen loderten all die Dinge, die sie nicht sagen konnte.
«Name? Wie Name?», fragte sie und berührte meine Schulter. Ich sagte ihr meinen Namen, und sie wiederholte ihn und ließ ihn dann auch Julka sagen. Sie zeigte auf die goldene Pappel, hinter deren Wipfel wir standen, und fragte wieder: «Wie Name?»
Wir setzten uns hin und machten uns in dem hohen roten Gras ein Versteck. Julka rollte sich zusammen wie ein kleines Kaninchen und spielte mit einem Grashüpfer. Antonia deutete zum Himmel und sah mich fragend an. Ich sagte ihr das Wort, aber sie war nicht zufrieden und zeigte auf meine Augen. Ich sagte: «Augen», und sie wiederholte das Wort, das aus ihrem Mund ganz fremd klang. Sie deutete zum Himmel, dann auf meine Augen, dann wieder zum Himmel und bewegte sich so schnell und impulsiv, dass ich ganz verwirrt war und keine Ahnung hatte, was sie wollte. Sie kniete sich hin und rang die Hände. Sie zeigte auf ihre eigenen Augen und schüttelte den Kopf, dann zeigte sie auf meine und zum Himmel und nickte heftig.
«Ah», rief ich, «blau; blauer Himmel.»
Sie klatschte in die Hände und murmelte: «Blauer Himmel, blauer Augen», als würde ihr das großen Spaß machen. Während wir gemütlich in unserem windgeschützten Versteck hockten, lernte sie fast zwei Dutzend Wörter. Sie war munter und sehr eifrig. Wir saßen so tief im Gras, dass wir nur den blauen Himmel über uns und den goldenen Baum vor uns sehen konnten. Es war herrlich. Nachdem Antonia die neuen Wörter wieder und wieder gesagt hatte, wollte sie mir einen kleinen, ziselierten Silberring schenken, den sie am Mittelfinger trug. Sie schmeichelte und drängte, doch ich wies sie mit Bestimmtheit zurück. Ich wollte ihren Ring nicht und fand es leichtsinnig und übertrieben, dass sie ihn einem Jungen geben wollte, den sie nie zuvor gesehen hatte. Kein Wunder, dass Krajiek diese Leute übers Ohr hauen konnte, wenn sie sich so benahmen.
Während wir uns noch wegen des Rings stritten, hörte ich eine klagende Stimme, die «An-tonia, An-tonia!» rief. Sie sprang wie ein Feldhase auf die Füße. «Tatinek! Tatinek!*», rief sie, und wir liefen dem alten Mann entgegen. Antonia war als Erste bei ihm, sie ergriff seine Hand und küsste sie. Als ich dazukam, nahm er mich bei der Schulter und sah mir mehrere Sekunden lang forschend ins Gesicht. Das machte mich etwas verlegen, denn für gewöhnlich wurde ich von den Erwachsenen nicht weiter beachtet.
Wir gingen zusammen mit Mr. Shimerda zu der Erdhöhle zurück, wo Großmutter schon auf mich wartete. Bevor ich auf den Wagen kletterte, zog er ein Buch aus der Tasche, schlug es auf und zeigte mir eine Seite, auf der zwei Alphabete standen, ein englisches und ein böhmisches. Er legte das Buch meiner Großmutter in die Hände, blickte sie flehentlich an und sagte mit einem feierlichen Ernst, den ich nie vergessen werde: «Le-e-hren, le-e-hren meine An-tonia!»
IV
Noch am Nachmittag desselben Sonntags unternahm ich unter Ottos Aufsicht den ersten ausgedehnten Ausritt auf meinem Pony. Von dem Tag an machten Dude und ich uns zweimal in der Woche auf den Weg zur Poststation, die sechs Meilen östlich von unserem Haus lag, und ich sparte den Männern viel Zeit, indem ich die Botenritte zu unseren Nachbarn übernahm. Wenn wir uns etwas borgen mussten oder die Mitteilung überbracht werden sollte, dass in dem grasgedeckten Schulhaus eine Predigt abgehalten würde, stets war ich der Bote. Früher hatte Fuchs diese Dinge nach der Arbeit erledigt.
All die Jahre, die seither vergangen sind, haben meine Erinnerung an jenen ersten, prachtvollen Herbst nicht verblassen lassen. Das neue Land lag offen vor mir: Damals gab es noch keine Zäune, und ich konnte mir meinen eigenen Weg durch das grasbewachsene Hochland bahnen, immer im Vertrauen darauf, dass das Pony wieder nach Hause finden würde. Manchmal folgte ich auch den mit Sonnenblumen gesäumten Straßen. Fuchs hatte mir erzählt, dass die Mormonen die Sonnenblumen in dieses Land gebracht hätten; glaubte man ihm, hatten die Mitglieder des ersten Erkundungstrecks Missouri zur Zeit der Verfolgung verlassen und waren in die Wildnis aufgebrochen, um einen Ort zu finden, an dem sie Gott auf ihre Weise verehren konnten. Als sie auf ihrem Weg nach Utah die Ebenen durchquerten, streuten sie Sonnenblumensamen entlang ihrer Route. Im Sommer darauf konnten die langen Wagentrecks, die mit den ganzen Frauen und Kindern nachkamen, einer Allee aus Sonnenblumen folgen. Ich bezweifle zwar, dass ein Botaniker Fuchs’ Geschichte bestätigen würde; er würde wohl vielmehr darauf beharren, dass die Sonnenblume in diesen Ebenen heimisch ist. Und doch waren mir diese Bilder im Gedächtnis geblieben, und mit Sonnenblumen gesäumte Straßen sind für mich immer die Straßen in die Freiheit.
Mit Vorliebe ritt ich ziellos die großen blassgelben Maisfelder entlang und hielt nach den feuchten Stellen Ausschau, die man bisweilen am Feldrand finden konnte und in denen der Wasserpfeffer sich langsam leuchtend kupferrot verfärbte, die schmalen braunen Blätter hingen eingerollt wie Kokons von den dicken Knoten der Stängel herab. Manchmal ritt ich auch nach Süden, um unsere deutschen Nachbarn zu besuchen und ihr Wäldchen aus Trompetenbäumen zu bewundern oder um die riesige Ulme anzuschauen, die aus einer tiefen Erdspalte gewachsen war und in deren Zweigen ein Falke sich sein Nest gebaut hatte. Bäume waren in diesem Land so rar und mussten sich ihr Dasein so hart erkämpfen, dass wir uns immer Sorgen um sie machten und ihnen Besuche abstatteten, als wären es Menschen. Es war wohl der Mangel an Abwechslung in der lohgelben Landschaft, der sie so kostbar machte.
Von Zeit zu Zeit ritt ich zur großen Kolonie der Präriehunde im Norden und beobachtete die braunen Höhleneulen, die am späten Nachmittag nach Hause geflogen kamen und sich gemeinsam mit den Präriehunden in ihre unterirdischen Nester verkrochen. Antonia Shimerda begleitete mich immer gern, und wir staunten sehr über diese Vögel, die unter der Erde lebten. In der Kolonie mussten wir auf der Hut sein, da dort immer Klapperschlangen auf der Lauer lagen. Die Schlangen führten bei den Hunden und Eulen, die ihnen praktisch wehrlos ausgeliefert waren, ein Leben wie im Schlaraffenland; sie nahmen die gemütlichen Höhlen in Beschlag und fraßen die Eier und Welpen. Uns taten die Eulen leid. Es war immer wieder ein trauriger Anblick, wenn sie bei Sonnenuntergang nach Hause geflogen kamen und unter der Erde verschwanden. Doch trotz allem hatten wir das Gefühl, dass geflügelte Geschöpfe, die auf diese Weise lebten, recht würdelose Kreaturen sein mussten. Die Hundekolonie lag weit entfernt von jedem Teich oder Bach. Otto Fuchs sagte, er habe in der Wüste riesige Hundekolonien gesehen, in deren Umkreis es fünfzig Meilen weit keine oberirdische Wasserstelle gegeben habe; er behauptete steif und fest, dass ein paar der Erdlöcher bis hinunter zum Grundwasser reichen müssten – in dieser Gegend an die 200 Fuß tief. Antonia sagte, das glaube sie nicht; die Präriehunde leckten vermutlich früh am Morgen den Tau auf, so wie Kaninchen.
Antonia hatte zu allem eine eigene Meinung, und bald schon konnte sie sie auch ausdrücken. Sie kam fast täglich über die Prärie gelaufen, um sich von mir eine Lesestunde geben zu lassen. Mrs. Shimerda murrte zwar, doch sie sah ein, wie wichtig es war, dass ein Mitglied der Familie Englisch lernte. Wenn der Unterricht vorüber war, gingen wir für gewöhnlich zu dem Beet mit den Wassermelonen hinter dem Garten. Ich teilte die Melonen mit einem alten Maismesser, und wir holten das Fruchtfleisch heraus und aßen es, während uns der Saft durch die Finger rann. Die weißen Wintermelonen rührten wir nicht an, aber wir beäugten sie neugierig. Sie wurden erst spät im Jahr geerntet, wenn die harten Fröste schon eingesetzt hatten, und für den Winter gelagert. Nach Wochen auf dem Meer hatten die Shimerdas einen schier unstillbaren Hunger auf Obst. Die beiden Mädchen liefen auf der Suche nach Erdkirschen meilenweit die Ränder der Maisfelder auf und ab.
Antonia mochte es, meiner Großmutter in der Küche zu helfen und zu lernen, wie man kocht und den Haushalt führt. Sie stand immer dicht neben ihr und beobachtete jede ihrer Bewegungen. Gerne glaubten wir, dass Mrs. Shimerda in ihrer Heimat eine gute Hausfrau gewesen war, doch mit den neuen Bedingungen kam sie nur schlecht zurecht: Und die Bedingungen waren wahrlich erbärmlich!
Ich weiß noch, wie entsetzt wir über das säuerliche, aschgraue Brot waren, das sie ihrer Familie zu essen gab. Wie wir herausfanden, knetete sie den Teig in einem alten Viertelscheffelmaß, das Krajiek in der Scheune benutzt hatte. Wenn sie den Teig zum Backen aus dem Maß herausnahm, ließ sie immer ein paar Teigreste an den Seiten kleben, stellte das Maß auf das Bord hinter dem Ofen und ließ die Reste gären. Wenn sie dann das nächste Brot buk, kratzte sie dieses säuerliche Zeug als Hefe in den frischen Teig.
In jenen ersten Monaten fuhren die Shimerdas nie in die Stadt. Krajiek bestärkte sie in ihrem Glauben, dass sie in Black Hawk auf geheimnisvolle Weise um ihr ganzes Geld gebracht würden. Sie hassten Krajiek, doch gleichzeitig klammerten sie sich an ihn, war er doch der einzige Mensch, mit dem sie reden und von dem sie Auskünfte bekommen konnten. Er schlief mit dem alten Mann und den beiden Jungen in der in den Hang gegrabenen Scheune, neben den Ochsen. Sie behielten ihn aus dem gleichen Grund in ihrer Höhle und gaben ihm zu essen, aus dem die Präriehunde und die braunen Eulen den Klapperschlangen Unterschlupf gewährten – sie wussten nicht, wie sie ihn loswerden sollten.
V
Wir wussten, wie hart das Leben für unsere böhmischen Nachbarn war, doch die beiden Mädchen waren immer fröhlich und beklagten sich nie. Sie waren stets bereit, ihre Sorgen zu vergessen und mit mir über die Prärie zu laufen, Kaninchen zu erschrecken oder Wachtelschwärme aufzuscheuchen.