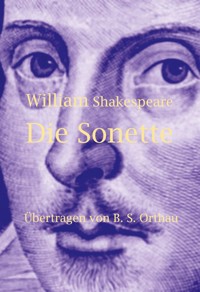
7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Die Sonette Shakespeares liegen auf Deutsch in zahlreichen Übertragungsvarianten vor, und immer noch erscheinen neue. Der Grund dafür dürfte darin zu suchen sein, dass keine davon bisher gänzlich genügen konnte. Hier soll daher all diesen Varianten keine weitere, ebenfalls in Gänze genauso wenig befriedigende hinzugefügt werden. Es wurde vielmehr unter Bezug auf vorliegende und trotz allem relativ gut gelungene Übertragungen (für die das Urheberrecht erloschen ist), der Versuch unternommen, eine deutsche Fassung der Sonette zu schaffen, die Shakespeare besser gerecht wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Die Versuche, das Andenken der Menschen am Leben zu erhalten, statt sie selbst, sind immerhin noch das Größte, was die Menschheit bis jetzt geleistet hat.
E. Canetti
Nach Gott hat Shakespeare am meisten geschaffen.
A. Dumas
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Die Sonette
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV
XXXV
XXXVI
XXXVII
XXXVIII
XXXIX
XL
XLI
XLII
XLIII
XLIV
XLV
XLVI
XLVII
XLVIII
XLIX
L
LI
LII
LIII
LIV
LV
LVI
LVII
LVIII
VIX
LX
LXI
LXII
LXIII
LXIV
LXV
LXVI
LXVII
LXVIII
LXIX
LXX
LXXI
LXXII
LXXIII
LXXIV
LXXV
LXXVI
LXXVII
LXXVIII
LXXIX
LXXX
LXXXI
LXXXII
LXXXIII
LXXXIV
LXXXV
LXXXVI
LXXXVII
LXXXVIII
LXXXIX
XC
XCI
XCII
XCIII
XCIV
XCV
XCVI
XCVII
XCVIII
IC
C
CI
CII
CIII
CIV
CV
CVI
CVII
CVIII
CIX
CX
CXI
CXII
CXIII
CXIV
CXV
CXVI
CXVII
CXVIII
CXIX
CXX
CXXI
CXXII
CXXIII
CXXIV
CXXV
CXXVI
CXXVII
CXXVIII
CXXIX
CXXX
CXXXI
CXXXII
CXXXIII
CXXXIV
CXXXV
CXXXVI
CXXXVII
CXXXVIII
CXXXIX
CXL
CXLI
CXLII
CXLIII
CXLIV
CXLV
CXLVI
CXLVII
CXLVIII
CIL
CL
CLI
CLII
CLIII
CLIV
Anmerkungen
Einleitung
Es klingt sehr nach den sprichwörtlichen Eulen und Athen, wenn eine weitere Übertragung der Sonette Shakespeares den vielen bereits vorliegenden hinzugefügt wird.
Ein Grund für das Vorliegen vieler, ständig mehr werdender Varianten der Übertragung – hier vereinfacht als Obergriff für Übersetzungen und Nachdichtungen – dürfte sein, dass anscheinend keine davon völlig befriedigen kann, bisher noch keine vorgelegt wurde, die in Gänze wirklich und vollständig zu überzeugen vermag. Darum müsste es aber gehen: Eine Übertragung der Sonette zu schaffen, die ideal ist, die (trotz all der mit einer solchen Zielsetzung verbundenen Problematik) als möglichst weitgehende Annäherung an das Original gesehen werden kann, wie etwa die Schlegel-Tieck-Übersetzungen als Standard, quasi als Shakespeare auf Deutsch, betrachtet wird oder wie im Deutschen Wollschlägers Ulysses-Übertragung als kaum mehr verbesserbare Fassung des Joyce’schen Werkes anerkannt ist.
Was Übertragungen anbelangt, mag von unterschiedlichen historischen und kulturellen Gegebenheiten und Veränderungen und den damit verbundenen Schwierigkeiten auszugehen sein. Wenn aber jedem künstlerischen Werk ein zeitunabhängiger Anspruch auf Unversehrtheit zugebilligt wird, bedeutet das vor allem für die Übertragung poetischer Werke, dass versucht werden muss, ihnen in einer je anderen Sprache eine Fassung zu geben, die „Gehalt, Form und Stimmung“, wie Celan das ausgedrückt hat, möglichst adäquat wiedergibt und die auch nicht ständig „aktualisiert“ werden muss.
Shakepeare schreibt beherrscht, mit Maß, trotz seines Einfallsreichtums und der Gehobenheit seiner Sprache einfach. Für eine anderssprachige Fassung seiner Sonette muss das bedeuten, dass sie gemessen, klar und verständlich sein muss, dass sie dem Leser verständlich macht, was Shakespeare ausdrückt, dass sie einerseits nicht altertümelnd verschwurbelt, andererseits aber auch nicht zu forsch, zu „neu“ oder schnoddrig daherkommen darf. Sie muss Shakespeare sprechen lassen, ohne ihn zu reduzieren oder zu vereinfachen, wie G. Wolff das manchmal tut, ohne ihn zu interpretieren und seine Metaphern zu übersetzen, wie man das bei K. Kraus oft finden kann, und ohne ihm des Morgenstern’schen Wiesels wegen Dinge zu unterschieben, die er so nicht gesagt hat.
Überblickt man die Übertragungen der Sonette ins Deutsche, erscheint vorstellbar, dass die Variationsmöglichkeiten noch längst nicht ausgeschöpft sind. Betrachtet man sie genauer, stellt man aber oft fest, dass „Neues“ eigentlich nur dann möglich wird, wenn man – wie etwa C. Schüncke oder M. Marti – einen etwas neuzeitlicheren Sprachgebrauch und auch Jugendsprache, Neologismen und anderes nicht scheut, sofern man – was dann wiederum als eigenständige künstlerische Leistung angesehen werden kann – nicht ohnehin Shakespeare gleich in Mundart oder Slang überführt.
Betrachtet man die Übertragungen, die von D. Tieck 1826, G. Regis 1836, E. Wagner (L. R. Walesrode) 1840, F. M. v. Bodenstedt 1862, F. A. Gelbcke 1867, A. Neidhardt 1870, O. Gildemeister 1871, F. Krauss 1872 bzw. 1882, M. J. Wolff 1903, T. Robinson 1927 und K. Kraus 1933 publiziert worden sind (es sind auch die, an die sich die hier vorgelegte Übertragung anlehnt), dann stellt man dort Überschneidungen und Ähnlichkeiten fest, die eher die Annahme einer durch das Original vorgegebenen Grenze nahelegen, die nicht beliebig verschoben werden kann.
Eine ausführliche kritische und vergleichende Würdigung dieser Übertragungen kann hier nicht vorgenommen werden. Was jedoch dort in der Übertragung eines Sonetts gelingt, wird in einer anderen oder den nächsten Versen manches Mal vertan, verschlimmbessert oder unverständlich. Das liegt sicherlich auch daran, dass jeder Autor zur Vermeidung des Plagiatsverdachts versuchen muss, originell und anders als die andern vor ihm zu übertragen, möglichst wenig von diesen zu übernehmen, sich andererseits aber auch vieles gleichen oder ähnlich sein muss, weil eben manches nur auf bestimmte Weise übertragen werden kann.
Daher wäre davon auszugehen, dass es wenig sinnvoll sein kann, dem Vielen noch etwas möglichst Eigenständiges und vermutlich genauso wenig gänzlich Befriedigendes hinzuzufügen. Es bleibt dann nur, das zu tun, was alle Übersetzer und Übersetzerinnen bisher mehr oder weniger selektiv, verschwiegen oder einfach auch gezwungenermaßen taten, oder mehr noch: Möglichst von jedem das Beste zu nehmen, um damit eine bessere Annäherung an Shakespeare zu erreichen. Wie in der Wissenschaft in aller Regel jeder auf dem Werk anderer aufbaut, könnte ein Weg darin gegeben sein, aus dem bereits Vorliegenden das Beste zu machen und quasi mit solchen (zwangsvereinten oder vereinnahmten) Kräften Shakespeare besser gerecht zu werden, als dies ein einzelner offenbar kann oder konnte, der eigenen Kreativität dabei den Raum gebend, den sie ausfüllen und beanspruchen kann, aber die Lösung einer oder eines andern dann zu nutzen, wenn diese nicht zu übertreffen und besser ist, als es die eigene je sein könnte.
Das klingt nach Plagiat und erloschene Urheberrechte wären keine Ausrede. Wenn einem das Genie Brechts fehlt, kann man weder dessen „sprichwörtliche Laxheit in Fragen des geistigen Eigentums“ noch die Entschuldigung, die K. Kraus für ihn hatte, in Anspruch nehmen; man kann nur darauf hoffen, dass die für das Vorhaben genannte Zielsetzung als ausreichende Legitimierung angesehen wird, insbesondere, wenn das Vorgehen so weit als möglich offengelegt wird und das Ergebnis dann für sich spricht.
Der Plagiatsvorwurf wäre sicherlich damit auszuräumen, dass jede Übernahme einer Formulierung oder eines Gedankens als wörtliches oder sinngemäßes Zitat gekennzeichnet wird. Gerade das aber erscheint hier kaum möglich. Jeder Versuch nämlich, während der Arbeit an der Übersetzung eines Sonetts bei jedem Schritt die herangezogenen, teils verworfenen, teils umgestalteten oder neuformulierten Vorlagen festzuhalten, hätte sich als kontraproduktiv für die eigentliche Tätigkeit erwiesen müssen. Auch ein Sonett, das in jedem Vers oder jedem Abschnitt mehr oder minder zahlreiche Referenzen aufwiese, wäre dem Leser kaum noch zumutbar – es sei denn für analytische literaturwissenschaftliche Zwecke. Wo es also hier nicht durch eine synoptische Kennzeichnung aller parallelen und identischen, vollständig oder in Teilen übernommenen Formulierungen möglich scheint, jeden übernommenen Reim, jedes übernommene oder ähnlich Wort einer Verszeile eines dieser Autorinnen und Autoren in der sonst nötigen Form als Zitat auszuweisen, mag es vielleicht als ausreichend scheinen, am Beispiel des Sonetts LXX zu zeigen, welche Beziehungen zwischen den verschiedenen Varianten der genannten Autoren und der hier vorliegenden Übertragung bestehen (siehe Anhang).
Andere Übertragungen wie die von George oder die von Celan wurden wegen ihres teilweise sonderlichen Umgangs mit Shakespeare (bei Celan wird das etwa an der Übertragung von Sonett V deutlich, bei George genügt es vielleicht, auf die von K. Kraus geübte Kritik hinzuweisen) nicht in Betracht gezogen, auch nicht neuere wie von M. Marti oder C. Schüncke. Selbst wenn hier Urheberrechtsfragen keine Rolle gespielt hätten, sprachen andere Gründe, die hier nur kurz angedeutet werden können, dagegen. Bei Schüncke z. B. kommen unpassender Weise Wendungen wie leere Konten, Eindruck schinden, Dass ich nicht lach!, auf’s Kreuz legen, Tastatur oder mir abgehen gemeinsam mit der Schönheit Erbteil, der Seele Schoß, O süßer Trug, von Keckheit übermannt, Wunden heilendem Balsam (Sonette 4, 26, 34 und 42) vor, genauso auch fragwürdige Reime wie verheißt und geitzt (1), fehlt und Welt (11), entzückt und lügt (17), Juwel und hell (27), dann und getan (30), Träne und erkenne (31), abgeht und gelegt (42) usw. vor. Ähnliches und Vergleichbares ließe sich gegen andere einwenden, wobei M. Marti auch in anderer Hinsicht (s. die Anmerkung zu CLI 1) übertreibt.
Januar 2025
B. S. Orthau
Die Sonette
I
From fairest creatures we desire increase,
That thereby beauty’s rose might never die,
But as the riper should by time decrease,
His tender heir might bear his memory:
But thou, contracted to thine own bright eyes,
Feed’st thy light’s flame with self-substantial fuel,
Making a famine where abundance lies,
Thyself thy foe, to thy sweet self too cruel.
Thou that art now the world’s fresh ornament
And only herald to the gaudy spring,
Within thine own bud buriest thy content
And, tender churl, makest waste in niggarding.
Pity the world, or else this glutton be,
To eat the world’s due, by the grave and thee.
II
When forty winters shall besiege thy brow,
And dig deep trenches in thy beauty’s field,
Thy youth’s proud livery, so gazed on now,
Will be a tatter’d weed, of small worth held:
Then being ask’d where all thy beauty lies,
Where all the treasure of thy lusty days,
To say, within thine own deep-sunken eyes,
Were an all-eating shame and thriftless praise.
How much more praise deserved thy beauty’s use,
If thou couldst answer ‘This fair child of mine
Shall sum my count and make my old excuse’
Proving his beauty by succession thine!
This were to be new made when thou art old,
And see thy blood warm when thou feel’st it cold.
Man will, dass jedes Schöne sich vermehrt,
Damit der Schönheit Rose nie vergeht
Und, so’s Gereifte welkt, dann unversehrt
Im holden Spross die Schönheit neu ersteht.
Dich aber, nur dem eignen Glanz verbunden,
Verzehren Flammen, aus dir selbst genährt,
Du hast in dir den eignen Feind gefunden,
Machst Hungersnot, wo Überfluss nur währt.
Dem Frühling gleich könnt’st du aus vollen Händen
Die Welt erfreun mit deiner Schönheit Reiz;
Doch deiner Knospen Hüll’ verwehrt die Spenden,
Du, Rüpel zart, schaffst Überfluss an Geiz.
Erbarm der Welt dich, lass die schuld’ge Gab’
Vergehen nicht durch dich und einst im Grab.
Wenn’s Alter dir dereinst die Stirn bedrängt,
In deinem Antlitz Falt um Falt sich mehrt,
Wird deiner Jugend Pracht, dir einst geschenkt,
Zerflettert Unkraut sein von mindrem Wert.
Gefragt, wo all die Schönheit blieb zurück
Und all der Jugend Glanz und Schätz’ so reich,
Zu sagen, in der trüben Augen Blick,
Wär ohne Maß, wär Preis und Schand zugleich.
Doch viel des Lobs wär dir dereinst zum Lohn,
Könnst sagen du: Sie ist im Spross erneut;
Seht meine Schönheit nun in meinem Sohn,
Zeigt er nicht meines Daseins Recht und Freud?
So wärest du verjüngt, obschon du alt,
Säh’st warm dein Blut, obschon du fühlst es kalt.
III
Look in thy glass, and tell the face thou viewest
Now is the time that face should form another;
Whose fresh repair if now thou not renewest,
Thou dost beguile the world, unbless some mother.
For where is she so fair whose unear’d womb
Disdains the tillage of thy husbandry?
Or who is he so fond will be the tomb
Of his self-love, to stop posterity?
Thou art thy mother’s glass, and she in thee
Calls back the lovely April of her prime:
So thou through windows of thine age shall see
Despite of wrinkles this thy golden time.
But if thou live, remember’d not to be,
Die single, and thine image dies with thee.
IV
Unthrifty loveliness, why dost thou spend
Upon thyself thy beauty’s legacy?
Nature’s bequest gives nothing but doth lend,
And being frank she lends to those are free.
Then, beauteous niggard, why dost thou abuse
The bounteous largess given thee to give?
Profitless usurer, why dost thou use
So great a sum of sums, yet canst not live?
For having traffic with thyself alone,
Thou of thyself thy sweet self dost deceive.
Then how, when nature calls thee to be gone,
What acceptable audit canst thou leave?
Thy unused beauty must be tomb’d with thee,
Which, used, lives th’ executor to be.
Sieh in den Spiegel, sag deinem Angesicht,
Dass an der Zeit sei, dass es sich erneu’,
Denn sonst enttäuschst die Welt du, leidest nicht,
Dass sich ein Weib der Mutterschaft erfreu’.
Wo wär’ die Schön’, die weigert ihren Schoß
Dem Bette, sich dem eh’lich Bund mit dir?
Wer wär das Grab gern eigner Liebe bloß,
Allein und ohne eines Sprosses Zier?
Du bist der Mutter Spiegel, zeigest ihr
Die Jugend, ihres eignen Frühlings Glück,
Bist du dann alt, so ruft dein Kind in dir
Die eigne holde Jugendzeit zurück.
Doch bist allein zu bleiben du gewillt,
Dann bleib allein, und’s stirbt mit dir dein Bild.
Verschwendrisch’ Anmut, du vergeudest nur
Für dich allein den dir vererbten Reiz,
Es leiht uns nur und schenkt nichts die Natur,
Dass man großherzig sei und frei von Geiz.
Drum, schöner Geizhals, du versagst der Welt
Das Gut, das dir verliehn, um es zu geben;
Häufst, Wuch'rer du, dir Schätze an und Geld,
Weist aber nicht, wie du sollst damit leben.
Wer stets sich mag nur mit sich selbst befassen,
Betrügt sich selbst um seinen eignen Wert,
Und was kann er der Nachwelt hinterlassen,
Wenn die Natur einst Rechenschaft begehrt?





























