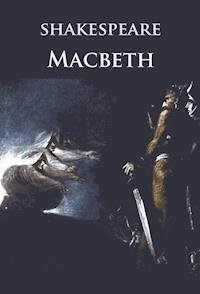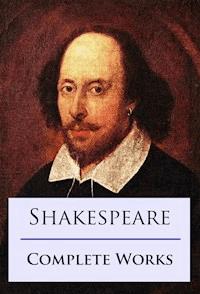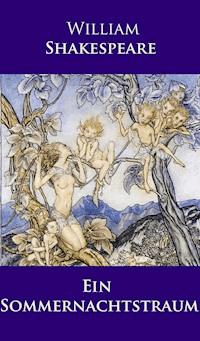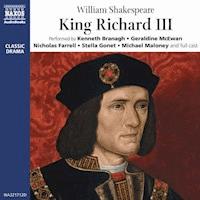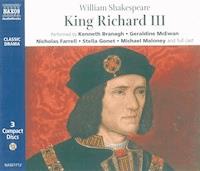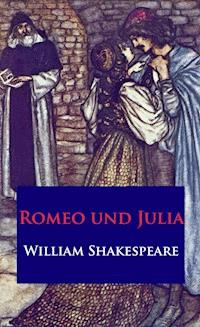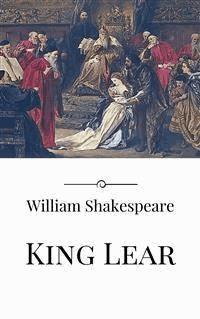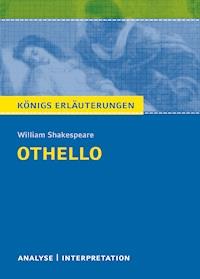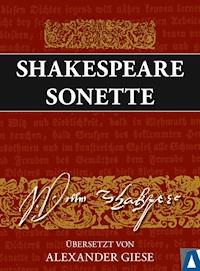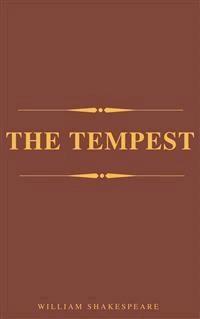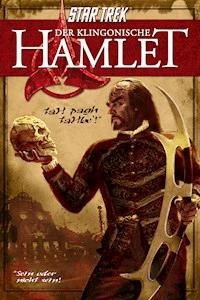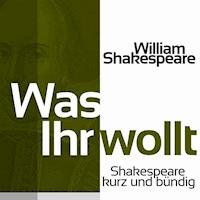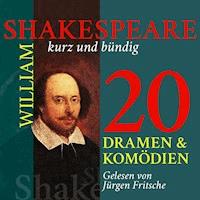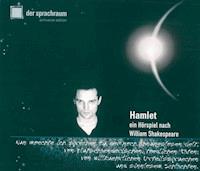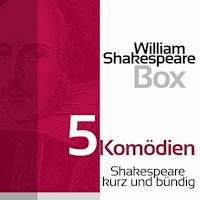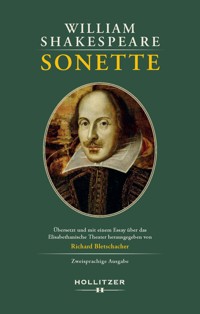
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: HOLLITZER Verlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Shakespeares' Sonette transportieren einen nie enden wollenden Zauber, über ihnen scheint ein besonderes Geheimnis zu walten. Der Dichter spricht darin in der Ich-Form zu uns, er nennt sich selbst beim Namen: Will. "Will", das ist im Englischen aber auch der Wille und so nennt sich auch jener, dem ein Großteil der Gedichte gewidmet ist. Und doch ist von vielen der Sonette keineswegs mit Gewissheit zu sagen, ob sie sich an einen Mann oder an eine Frau wenden. An wen sie auch gerichtet sein mögen – die Sonette erzählen in unnachahmlicher Weise von den Himmel- und Höllenfahrten der Liebe eines Dichters, der schon zu Lebzeiten für unsterblich gegolten hat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 232
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SHAKESPEARE • SONETTE
WILLIAMSHAKESPEARE
SONETTE
Übersetzt und mit einem Essay über das Elisabethanische Theater herausgegeben von Richard Bletschacher
Zweisprachige Ausgabe
Mit freundlicher Unterstützung von
William Shakespeare:
Sonette
Übersetzt und mit einem Essay über das Elisabethanische Theater
herausgegeben von Richard Bletschacher
© Hollitzer Verlag, Wien 2025
Umschlagabbildung: William Shakespeare, Flower Portrait (19.Jh.), Royal Shakespeare Company (public domain)
Der englische Text folgt
in Schreibung und Interpunktion der Ausgabe:
William Shakespeare: The Sonnets, ed. John Dover Wilson.
Cambridge: Cambridge University Press, 1966
(The New Cambridge Shakespeare, vol. 6)
Erstauflage Deuticke, Wien 1996
Der Text wurde für die vorliegende Ausgabe der neuen deutschen Rechtschreibung angepasst.
Satz und Covergestaltung: Daniela Seiler
Hergestellt in der EU.
Alle Rechte vorbehalten.
Hollitzer Wissenschaftsverlag
Trautsongasse 6/6, A-1080 Wien
www.hollitzer.at
ISBN Druckausgabe: 978-3-99094-283-3
ISBN ePub: 978-3-99094-284-0
INHALT
Einleitung
Sonette 1 – 154
Von der Kunst der Darstellung auf dem Elisabethanischen Theater
Anmerkung
EINLEITUNG
Die Sammlung der Sonette Shakespeares ist ein Rätselbuch. Dies Wort mag für alle Bücher gelten, die anspruchsvolle Gedichte enthalten. Doch über diesen Versen des größten aller Dramatiker scheint ein besonderes Geheimnis zu walten. Schon beim Lesen weniger Zeilen hat man das unabweisbare Gefühl, dass hier eine Stimme, die man sonst nur aus den Mündern erfundener Theaterfiguren gehört hat, aus dem ureigensten und innersten Lebensraum des Dichters spricht, eines Mannes, den man weniger zu kennen meint als sonst einen der großen Künstler des Abendlandes. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass in den Sonetten der Lyriker in der Ich-Form zu Wort kommt, dass er sich selbst beim Namen nennt, dass er seine Beglückungen und Leidenschaften bekennt und von den Menschen redet, die ihm nahe stehen und sein Wohl und Wehe bestimmen. Er nennt sich Will, nicht William, geschweige denn so, wie alle Welt ihn kennt, Shakespeare. Will ist der Name, den seine Freunde und Liebsten für ihn gebrauchen. Und schon damit beginnen die Rätsel. Will heißt der Autor. „Will“ heißt auf Deutsch auch „der Wille“, und noch etwas anderes, das man bei uns zulande schon einmal als „der freie Wille“ bezeichnet hat: das Organ seiner Männlichkeit. Man vergleiche hierzu die kaum mehr zweideutigen Anspielungen des Sonetts Nr. 136. Will nennt sich aber offenbar auch sein bedrohlicher Nebenbuhler, und nicht zuletzt wohl auch der Adressat eines Großteils seiner Gedichte und Widmungsträger der ganzen Sammlung, dessen Initialen vom Herausgeber mit W. H. angegeben werden. Einmal wird dieses vieldeutige Wort im Ernst, ein anderes Mal wird es im Scherz genannt. Sicher kann man sich nie bei seiner Zuweisung sein. Was gäbe es denn auch für eine Sicherheit im Reich der Gefühle? Wer ist dieser andere Will, dieser siegreiche Wille, dieser geliebte und bewunderte zweite William der Sonette? Darüber ist viel gerätselt worden, ohne dass eine überwiegende Meinung sich hätte behaupten können. Drei historische Personen immerhin sind mehr als alle anderen genannt worden: William Herbert, Earl of Pembroke, Lord Chamberlain und, gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder, einer der beiden Widmungsträger der ersten Folio-Ausgabe von Shakespeares Theaterstücken; dann William Hall, ein Beamter der Registratur für neue Druckwerke, dessen Namen man – unter Weglassung der Interpunktion – aus der ersten Zeile der Widmung des Herausgebers ablesen könnte: „MR. WH. ALL“; und dann auch noch William Harvey, der zweite Gatte der Lady Southampton. Der allerdings könnte wegen seines Alters bestenfalls als Auftraggeber für die ersten siebzehn Sonette gelten, in denen der eigentliche Adressat zu Heirat und Kinderzeugung ermuntert wird. Glaubt man jedoch, in dem zweiten Will oder William etwa des Sonetts Nr.135 eine andere Person auszumachen zu müssen als den Widmungsträger W. H., so kann man für den letzteren auch noch auf den Grafen von Southampton selbst tippen, dessen Name Henry Wriotesley lautet und dem die beiden ersten Publikationen Shakespeares, die Versepen „Venus and Adonis“ und „The Rape of Lucrece“ zugeeignet sind. In diesem Fall müsste man die doch etwas seltsame Umkehrung der Initialen W. H. in H. W in Kauf nehmen.
Da hier nicht der Raum ist, um all diese Theorien, und auch noch einige andere, weniger überzeugende, zu begründen oder zu widerlegen, sei es gestattet, das Ergebnis meiner eigenen Schlussfolgerungen zu nennen. Ich zweifle nicht, dass William Herbert, der 1580 geborene, jugendliche Graf von Pembroke, zugleich der zweite Will des Dichters als auch der W. H. des Herausgebers ist. Für meine Annahme spricht, dass dieser kunstliebende, vielbewunderte Aristokrat ein großer Förderer des Theaters und ein besonderer Freund des Dichters war; dass er überdies zur Zeit der Veröffentlichung der Sonette in unbestrittenem öffentlichen Ansehen stand, was man von dem nach der Verschwörung des Grafen Essex über mehrere Monate inhaftierten Henry Wriotesley nicht sagen kann. Als weiteres Indiz für eine Widmung der Sonette an den jungen Grafen Pembroke mag gelten, dass im Sonett Nr.3 von der Mutter des jungen Mannes gesprochen wird, die in ihrem Sohn die Erinnerung an die Blüte ihrer eigenen Schönheit findet. Die verwitwete Gräfin Pembroke war um 1600 eine der angesehensten Damen des englischen Hofes. In diesem Zusammenhang fällt auf, dass von einem Vater des Adressaten W. H. nur als von einem Verstorbenen die Rede ist. Der frühe Tod des älteren Grafen Pembroke und die damit auf den minderjährigem Sohn gefallene Erbschaft von Titel und Vermögen setzte diesen in den Stand, als Mäzen für Burbages Theatertruppe zu wirken, brachte aber auch die Verpflichtung zu jener standesgemäßen Heirat mit sich, von der in den ersten siebzehn Sonetten die Rede ist. Dass der junge Aristokrat diesen frommen Wunsch nicht so bald zu erfüllen gewillt war, beweist ein Brief seiner Mutter aus dem Jahr 1612, in dem er noch einmal aufgefordert wird, sich doch endlich zu vermählen.
Für wen auch immer sich unsere Vorliebe entscheidet, sein Name würde uns wohl einige Fragen zu Shakespeares Biographie zu beantworten helfen, für das Verständnis oder gar die Bewertung der Sonette wäre er aber nicht von essentieller Bedeutung. Es muss uns genügen, dass der Dichter ihm auf eine schicksalhafte Weise verbunden war, die sein Leben und Wirken stärker prägte, als Männerfreundschaften dies gemeinhin tun. Wenn es sich bei diesem jüngeren, einmal gepriesenen, einmal beschuldigten Mann stets um ein und dieselbe Person handelt, hat sein Glück und Unglück bestimmender Einfluss gewiss nicht allein die Sonette, sondern auch manche andere Dichtung Shakespeares berührt. Und es soll uns nicht wundern, wenn einige Verse Töne anstimmen, die uns aus den lyrischen Passagen der frühen Komödien oder den sarkastischen Monologen der späteren Jahre bekannt sind. Es ist oft behauptet worden, die ersten 126 der insgesamt 154Sonette seien allesamt dem einen, an Jahren jüngeren, an Ansehen und Besitz aber höhergestellten Adressaten zuzuordnen. Ich wage diese These zu bezweifeln. Von vielen dieser Sonette ist keineswegs mit Gewissheit zu sagen, ob sie sich an einen Mann oder an eine Frau wenden. Das englische Original ist in dieser Hinsicht nicht so eindeutig, wie manche voreilige Übersetzung es haben möchte. Wenn man zu der wohl begründeten Ansicht gelangt, dass keinesfalls der Dichter selbst die Herausgabe besorgt haben kann, so gibt es auch keine Gewähr dafür, dass die gewählte Reihenfolge dem Schaffenszusammenhang entspricht. Den Leser hindert also nichts, eine große Zahl der leidenschaftlichsten Liebesgedichte ebensogut einem weiblichen wie einem männlichen Adressaten zuzuordnen. Ich nenne als Beispiele nur die Sonette Nr. 18, 25, 29, 49 und 71, bei deren Übersetzung ich versucht habe, die Unentschiedenheit des Originals weitgehend zu wahren. Dies vor allem aus dem Grund, dass ich die Reihung der Gedichte weder nach ihrer Entstehungszeit noch nach ihrer inhaltlichen Verwandtschaft für authentisch halte. Hier scheint vielmehr, ebenso wie bei den Raubdrucken von Schauspieltexten der frühen Quartos, eine sorglos eilige Willkür am Werk gewesen zu sein. Gewiss gehören die ersten siebzehn Sonette in einen thematischen Zusammenhang. Sicherlich sind auch die Nummern 78 bis 95, mit einigen Einschränkungen, mit ein und derselben Tinte geschrieben. Aber wie gerieten die konventionellen Reimereien rund um die Nummer 100 in diese Gesellschaft? Und wie wäre es möglich, dass nach den bittersten Verwünschungen die harmlosesten Liebenswürdigkeiten sich geben, als wäre nichts geschehen? Für gewöhnlich retten sich die Interpreten vor solchen Fragen in die Postulierung eines geschlechtslosen „lyrischen Ich“, das über den Wassern schwebt. Damit sind die erschütternden Bekenntnisse einer immer aufs Neue verwundeten und geheilten Seele nicht zu entschlüsseln. Der Mitleidende allein wird von ihrem Geheimnis betroffen.
Kein Zweifel dürfte an der Tatsache bestehen, dass die letzte Gruppe der Sonette, etwa ab der Nummer 127, sich an eine weibliche Geliebte wendet, die in der Shakespeare-Literatur den geheimnisvollen Namen „black lady“ trägt. Von ihr ist gewiss auch schon in den Nummern 41 und 42 die Rede. Zum ersten Mal angesprochen wird sie in den beiden ersten Sonetten der im Jahre 1599 erschienenen Gedichtsammlung „The Passionate Pilgrim“. Diese Verse sind mit geringen Abänderungen als die Nummern 138 und 144 in die Sonett-Edition von 1609 aufgenommen worden. Manche Interpreten glauben aus den wenigen Zeilen, die ihr äusseres Erscheinungsbild beschreiben, entnehmen zu können, dass die Frau, die in unserem Dichter ebensoviel Liebesleidenschaft wie Verzweiflung auszulösen imstande war, nicht nur schwarzhaarig und schwarzäugig, sondern auch von dunkler Hautfarbe gewesen sein müsse. So könnte man, wenn man will, die Verse 10 bis 12 im Sonett Nr. 131 deuten, und so liest man es auch unter anderem in dem phantasievollen Roman von Anthony Burgess. Andere wollen eine Hofdame der Königin mit Namen Mary Fitton in ihr wiedererkennen. Ich entschlage mich hierin jeder eigenen Meinung und gebe nur zu bedenken, dass der gelegentlich angemeldete Anspruch einer Wirtin Davenant aus Oxford – Mutter des Dichters William Davenant, der sich als illegitimer Sohn Shakespeares bezeichnete – wohl kaum akzeptiert werden kann. Dies schon allein wegen ihrer ehelichen Bindung an einen doch einen Tagesritt vom Schauplatz der Handlung entfernten Wohnort. Denn dass sich Shakespeares Leben, Lieben und Leiden in den Jahren, die für die Entstehung der Sonette in Betracht kommen, also von etwa 1595 bis 1609, in London abgespielt haben, darüber kann es doch keine geteilten Meinungen geben. Auch sträubt man sich wohl mit Recht, diese Sonette als das Ergebnis einiger amouröser Exkursionen oder gelegentlicher Nächtigungen auf dem Heimweg zu seiner Familie in Stratford anzusehen. Im Übrigen ist bemerkenswert, dass diese mysteriöse Dame dem Dichter nur wenige heitere Liebesstunden, wie etwa in dem bezaubernden Musiksonett Nr. 128 beschrieben, gegönnt haben dürfte. Selten wird sie von ihm gepriesen, oft wird sie verflucht. Und wenn Francis Meres im Jahre 1598 die Gedichte Shakespeares als „sugared sonnets among his friends“ bezeichnet, so hat er die bittersten unter ihnen noch nicht gekannt. In der Tat möchte man diese auch am ehesten in die Zeit der großen seelischen Bedrängnisse und Enttäuschungen datieren, also in die Entstehungszeit des „Hamlet“ (um 1600) und des „King Lear“ (um 1605).
In zumindest fünf Gedichten der Sammlung, den Nummern 42, 133, 134, 135 und 144, ist die schmerzliche Rede davon, dass sich Freund und Freundin des Dichters zu einem Liebespaar vereinigen. An anderer Stelle kommt ein zweiter Dichter ins Spiel, dessen hohes Talent von Shakespeare neidvoll anerkannt wurde, dessen Identität aber wiederum Anlass zu Spekulationen gab. Der Dramatiker George Chapman ist hier der Favorit der Rätselrater. Wer immer es gewesen sein mag, wenn Shakespeare den Rivalen als einen „besseren Geist“ bezeichnet, muss man ihm widersprechen. Denn bessere Gedichte als jene, die er uns mit den schönsten seiner Sonette geschenkt hat, hat vor ihm und nach ihm kaum ein anderer geschrieben.
Dennoch sei an dieser Stelle nicht verschwiegen, dass eines der erstaunlicheren Rätsel, das uns diese Sammlung bietet, darin besteht, dass sie neben Kronjuwelen des Genies auch einige Handwerksarbeiten geringeren Wertes enthält. Da sind zum Beispiel drei Gedichte zu nennen, die man nur mit gutem Willen überhaupt als Sonette bezeichnen kann. Wenn das Shakespearesche Sonett – im Gegensatz zu der von Petrarca begründeten italienischen Tradition, die zwei Vierzeiler, gefolgt von zwei Dreizeilern, fordert – durch drei kreuzweise gereimte Vierzeiler und einen paarweise gereimten Zweizeiler gebildet wird, so findet man in den Gedichten Nr.99 und 126 statt der orthodoxen vierzehn einmal fünfzehn und einmal zwölf Zeilen. Auch sind die Verse von Nr.126 allesamt paarweise und nicht übers Kreuz gereimt. Es ergibt sich dadurch nicht nur eine veränderte Form, sondern auch ein anderer Fluss der Gedanken, und selbst die kraftvoll zusammenfassende Wirkung der beiden Schlusszeilen, des sogenannten „heroic couplet“, wird dadurch gemindert. Auch wenn im Sonett Nr.145 aus den traditionellen fünffüßigen Jamben mit einem Mal vierfüßige werden, stellt sich Verwunderung ein. Mögen dies nur formale Kriterien sein, so fallen die qualitativen noch stärker ins Gewicht. Durch die allzu häufige Wiederholung ein und desselben Themas in den ersten Gedichten und die überraschend konventionelle Sprache und Imagination ausgerechnet der beiden letzten Gedichte wird noch einmal die Vermutung bestätigt, dass der Autor an der Edition seiner Verse nicht beteiligt war. Dies ist umso wahrscheinlicher, als auch die vorangestellte Widmung des Buches nicht wie bei früheren Publikationen von seiner, sondern von der Hand des Verlegers stammt. Damit kommen wir zu den Zeilen, deren Entzifferung nicht allein den fremdsprachigen Übersetzern, sondern auch den englischen Forschern seit jeher die größten Probleme bereitet hat. Man wird mir verzeihen, wenn ich nicht alle Deutungsversuche dieser dem Band vorangesetzten Widmung kommentiere, zumal ich glaube, dass die angerichteten Verwirrungen um Shakespeares Leben und Werk ohnehin größer sind, als dies die zahlreichen bekannten Fakten rechtfertigen. Ich habe hier, wie in allen anderen Belangen einer wort- und sinngetreuen Übersetzung, keinen Raum für linguistische Spitzfindigkeiten gelassen und eine deutsche Version der ominösen Zeilen angeboten, die keine neuen Fragen aufwirft, sondern die vorgefundenen nach bestem Wissen zu beantworten sucht. Dass der Unterzeichner T. T. der Londoner Buchhändler und Verleger Thomas Thorpe war, wurde inzwischen mehrfach beglaubigt. Ich sehe keinen Anlass, daran zu zweifeln, dass mit der Bezeichnung „ONLIE. BEGETTER.“ der Inspirator der nachfolgenden Verse – und nicht, wie etwa der verehrte W. H. Auden annimmt, der Übergeber oder Besorger des Manuskripts – gemeint war; denn wie sonst käme der Empfänger und Verleger Thorpe dazu, diesem Anonymus den kostbaren Band mit den persönlichsten Bekenntnissen unseres unsterblichen Dichters („BY. OVR. EVER-LIVING. POET.“) zu widmen? Warum Thorpe den Herrn Grafen nicht mit My Lord anredet, sondern mit Mr.W.H., das fragt nur einer, der nicht anerkennen will, dass der vom Inhalt des Werkes so persönlich betroffene Anreger und Widmungsträger dieser Sonette ungenannt bleiben wollte. Eingeweihten war zu Lebzeiten des Dichters das, was uns heute allzu sehr in Verwirrung bringt, wohl ohnehin kein Geheimnis. Lassen wir nun aber, nachdem das Nötigste gesagt wurde, die historischen Betrachtungen beiseite und öffnen wir die Sinne dem nie endenwollenden Zauber unseres Dichters. Er hat, wie selten einer vor ihm, zu Lebzeiten schon für unsterblich gegolten und hat die Aureole und die Bürde seines Ruhms mit Stolz und auch mit Demut getragen. Davon und von den Himmel- und Höllenfahrten seiner Liebe künden diese Gedichte. Die besten unter ihnen stehen seinen dramatischen Meisterwerken an Tiefe der Empfindung und Gewalt der Sprache nicht nach. In manchen Versen fühlt man sich von derselben herz- und geistbezwingenden Kraft angerührt, die auch im „Sommernachtstraum“, in „Was Ihr wollt“, im „Hamlet“ oder im „König Lear“ waltet. Wenn es mir gelungen sein sollte, auch nur einen Abglanz davon in „mein geliebtes Deutsch zu übertragen“, so ist die Mühe einer Arbeit, die mich über mehrere Jahrzehnte begleitet hat, reichlich belohnt.
R. B.
TO. THE. ONLIE. BEGETTER. OF.
THESE. INSVING. SONNETS.
MR. W. H. ALL. HAPPINESSE.
AND. THAT. ETERNITIE.
PROMISED.
BY.
OVR. EVER-LIVING. POET.
WISHETH.
THE. WELL-WISHING.
ADVENTURER. IN.
SETTING.
FORTH.
T.T.
DEM EINZIGEN INSPIRATOR
DER NACHFOLGENDEN SONETTE,
MR. W. H., ALLES GLÜCK
UND JENE EWIGKEIT,
DIE
UNSER EWIG LEBENDER DICHTER
VERSPROCHEN HAT,
WÜNSCHT
DER WOHLMEINENDE
WAGEMUTIGE, INDEM
ER SIE
HERAUSGIBT.
T.T.
Widmung der von Thomas Thorpe
1609 veröffentlichten Erstausgabe der Sonette
1
From fairest creatures we desire increase,
That thereby beauty’s rose might never die,
But as the riper should by time decease,
His tender heir might bear his memory:
But thou, contracted to thine own bright eyes,
Feed’st thy light’s flame with self-substantial fuel,
Making a famine where abundance lies,
Thyself thy foe, to thy sweet self too cruel:
Thou that art now the world’s fresh ornament,
And only herald to the gaudy spring,
Within thine own bud buriest thy content,
And, tender churl, mak’st waste in niggarding:
Pity the world, or else this glutton be,
To eat the world’s due, by the grave and thee.
1
Vermehren sollen sich die schönsten Wesen,
auf dass der Schönheit Rose nie verderbe,
dann mag, was reif ist, welken und verwesen,
sein Angedenken trüg’ ein zarter Erbe.
Verliebt in deine eignen Augen muss
dein Feuer aber an dir selber zehren,
und Hunger leidest du im Überfluss,
dein eigner Feind, willst du dich selbst verheeren.
Du bist der Erde junge Zierde nun,
des hellen Frühlings einziger Verkünder,
und lässt die Blüte in der Knospe ruhn.
Durch deine Schuld, du Geizhals, herrscht der Winter.
Erbarme dich und zahl der Welt Tribut,
dass nicht das Grab verschlingt ihr höchstes Gut!
2
When forty winters shall besiege thy brow,
And dig deep trenches in thy beauty’s field,
Thy youth’s proud livery, so gazed on now,
Will be a tattered weed, of small worth held:
Then being asked, where all thy beauty lies,
Where all the treasure of thy lusty days;
To say within thine own deep-sunken eyes,
Were an all-eating shame, and thriftless praise.
How much more praise deserved thy beauty’s use,
If thou couldst answer ‘This fair child of mine
Shall sum my count, and make my old excuse’
Proving his beauty by succsession thine.
This were to be new made when thou art old,
And see thy blood warm when thou feel’st it cold.
2
Wenn deine Stirn von vierzig Wintern kündet
und durch ihr blüh’ndes Feld einst Furchen gehen,
dann wird der Kranz, den dir die Jugend windet,
wie ein zerschlissnes Unkraut dich umwehen.
Wenn sie dich dann nach deiner Schönheit fragen
und nach den Schätzen deiner frohen Zeiten,
was deine eingesunknen Augen darauf sagen,
das kann nur Schmach und Schande dir bereiten.
Weit größre Ehre würdest du erwerben,
wenn deine Antwort wär’: Seht her, verzeiht,
was mir verwelkte, blüht in meinem Erben,
und was ich einstmals war, das ist er heut.
So wüchse neues Leben aus dem alten,
und warmes Blut entspränge aus dem kalten.
3
Look in thy glass, and tell the face thou viewest
Now is the time that face should form another,
Whose fresh repair if now thou not renewest,
Thou dost beguile the world, unbless some mother.
For where is she so fair whose uneared womb
Disdains the tillage of thy husbandry?
Or who is he so fond will be the tomb,
Of his self-love to stop posterity?
Thou art thy mother’s glass and she in thee
Calls back the lovely April of her prime,
So thou through windows of thine age shall see,
Despite of wrinkles, this thy golden time.
But if thou live remembered not to be,
Die single, and thine image dies with thee.
3
Wenn du an deinem Spiegelbild dich freust,
so schaff ein neues Bild aus diesen Zügen;
denn wenn du jetzt nicht deren Glanz erneust,
wirst du die Welt und eine Frau darum betrügen.
Wo wäre die, so schön und stolz geboren,
dass ihre Furche solche Saat verschmähte,
und wo der Mann, so in sich selbst verloren,
dass er ins eigne Grab die Zukunft säte?
Du dienst der Mutter als ein Spiegel nun,
dass sie des eignen Frühlings sich entsinnt.
Bald wirst auch du solch einen Rückblick tun
in goldne Zeiten, die vergangen sind.
Doch wenn du lebst und stirbst als fremdes Wesen,
vergehst du so, als wärst du nie gewesen.
4
Unthrifty loveliness why dost thou spend
Upon thy self thy beauty’s legacy?
Nature’s bequest gives nothing but doth lend,
And being frank she lends to those are free:
Then beauteous niggard why dost thou abuse,
The bounteous largess given thee to give?
Profitless usurer, why dost thou use
So great a sum of sums yet canst not live?
For having traffic with thy self alone,
Thou of thy self thy sweet self dost deceive,
Then how when nature calls thee to be gone,
What acceptable audit canst thou leave?
Thy unused beauty must be tombed with thee,
Which used, lives th’ executor to be.
4
Warum vergeudest du der Schönheit Blüh’n,
verstreust den Liebreiz wie ein eitler Erbe?
Die Erbschaft der Natur ist nur geliehn,
auf dass ein Freier sie sich frei erwerbe.
Warum, du schöner Geizhals, gibst du aus,
was dir die Großmut einst so reich vermacht?
Wieviel Profit schlägst du am End’ daraus,
dass du nicht leben kannst von all der Pracht?
Doch da du nur allein mit dir verkehrst,
betrügst du dich um deinen eignen Zins;
und wenn du einst den letzten Becher leerst,
wo bleibt die Rechnung deines Reingewinns?
Die ungenützte Schönheit sinkt ins Grab;
drum schenke weiter, was man dir einst gab.
5
Those hours that with gentle work did frame
The lovely gaze where every eye doth dwell
Will play the tyrants to the very same,
And that unfair which fairly doth excel:
For never-resting time leads summer on
To hideous winter, and confounds him there,
Sap checked with frost and lusty leaves quite gone,
Beauty o’er-snowed, and bareness every where:
Then were not summer’s distillation left
A liquid prisoner pent in walls of glass,
Beauty’s effect with beauty were bereft,
Nor it nor no remembrance what it was.
But flowers distilled though they with winter meet,
Leese but their show, their substance still lives sweet.
5
Die Stunden, die ein feines Netz dir spinnen
um deine Augen, die von Liebreiz strahlen,
sie werden bald die Oberhand gewinnen
und deine Schönheit hässlich übermalen.
Die Zeit drängt deinen Sommer rastlos fort,
dass in des Winters Krallen er verdirbt
Die Säfte frieren und das Laub verdorrt,
bis unterm Schnee der Hauch des Lebens stirbt.
Blieb die Essenz der Schönheit nicht erhalten
so wie ein Destillat ins Glas gezwungen,
nie könnte sich die Blüte mehr entfalten
und mit ihr stürben die Erinnerungen.
Ihr Duft kann selbst den Winter überstehen,
mag auch die Blütenpracht im Frost vergehen.
6
Then let not winter’s raggéd hand deface,
In thee thy summer ere thou be distilled:
Make sweet some vial; treasure thou some place,
With beauty’s treasure ere it be self-killed:
That use is not forbidden usury,
Which happies those that pay the willing loan;
That’s for thy self to breed another thee,
Or ten times happier be it ten for one,
Ten times thy self were happier than thou art,
If ten of thine ten times refigured thee:
Then what could death do if thou shouldst depart,
Leaving thee living in posterity?
Be not self-willed, for thou art much too fair,
To be death’s conquest and make worms thine heir.
6
Lass von des Winters rauen Fäusten nicht
den Sommer deiner Schönheit jäh beenden.
Vergrab den Schatz. Erfüll die süße Pflicht.
Denn sein Gedeih’n liegt nur in deinen Händen.
In dem Gebrauch kann man nicht Wucher sehen,
der die beglückt, an die du dich verschwendest.
So wird ein zweites Du aus dir entstehen,
ein zehntes gar, wenn du es zehnfach spendest.
Es muss sich zehnfach auch dein Glück vermehren,
wenn du in zehn Gestalten neu erstehst.
Wie könnt’ der Tod dir dann das Leben wehren?
Du lebst doch weiter, wenn du auch vergehst.
Lass Selbstsucht deine Schönheit nicht verderben,
sonst siegt der Tod, und nur die Würmer erben.
7
Lo in the orient when the gracious light
Lifts up his burning head, each under eye
Doth homage to his new-appearing sight,
Serving with looks his sacred majesty,
And having climbed the steep-up heavenly hill,
Resembling strong youth in his middle age,
Yet mortal looks adore his beauty still,
Attending on his golden pilgrimage:
But when from highmost pitch with weary car,
Like feeble age he reeleth from the day,
The eyes (fore duteous) now converted are
From his low tract and look another way:
So thou, thy self outgoing in thy noon:
Unlooked on diest unless thou get a son.
7
Sieh, wie im Ost das anmutsvolle Licht
sein brennend Haupt erhebt! Und staunend strebt
ein jeder Blick dem jungen Angesicht
zu huldigen, das so voll Hoheit schwebt.
Und ist es dann am Himmel aufgezogen,
voll ausgereifter Kraft im steilen Kreise,
bewundert unser Aug den stolzen Bogen,
den es erfüllt auf seiner goldnen Reise.
Doch, müd vom Weg, auf kühner Höhe wendet
es sich, so wie sich Greise beugen, nieder.
Die Augen irren, die einst Licht gespendet,
ganz langsam ab, dann sinken ihm die Lider.
So schnell ist, der du noch zum Mittag gehst,
wenn du nicht Söhne hast, dein Glanz verwest.
8
Music to hear, why hear’st thou music sadly?
Sweets with sweets war not, joy delights in joy:
Why lov’st thou that which thou receiv’st not gladly,
Or else receiv’st with pleasure thine annoy?
If the true concord of well-tunéd sounds,
By unions married do offend thine ear,
They do but sweetly chide thee, who confounds
In singleness the parts that thou shouldst bear:
Mark how one string sweet husband to another,
Strikes each in each by mutual odering;
Resembling sire, and child, and happy mother,
Who all in one, one pleasing note do sing:
Whose speechless song being many, seeming one,
Sings this to thee, ‘Thou single wilt prove none’.
8
O horch: Musik! Du trauerst und sie tönt.
Die Lieb’ weckt Liebe, Glück macht Glück entzücken.
Dich aber freut nicht das, was dich verschönt.
Fühlst du denn Lust, wenn dich die Leiden drücken?
Wenn dir zum Einklang wohlgestimmte Töne,
wie Liebende gepaart, das Ohr verletzen,
so ist selbst ihre Rüge eine schöne.
Du trennst den Klang und sollst zusammensetzen.
Sieh, wie ein Gatte neigt sich diese Saite
zur andern hin in wechselndem Erklingen,
Wie Vater, Kind und Mutter, die in Freude
die Harmonie des reinen Wohllauts singen.
Wortloses Lied, in vielen Dingen spricht’s
wie eine Stimme: Einsam bleibst du nichts.
9
Is it for fear to wet a widow’s eye,
That thou consum’st thy self in single life?
Ah, if thou issueless shalt hap to die,
The world will wail thee like a makeless wife,
The world will be thy widow and still weep,
That thou no form of thee hast left behind,
When every private widow well may keep,
By children’s eyes, her husband’s shape in mind:
Look what an unthrift in the world doth spend
Shifts but his place, for still the world enjoys it;
But beauty’s waste hath in the world an end,
And kept unused the user so destroys it:
No love toward others in that bosom sits
That on himself such murd’rous shame commits.
9
Dass sich kein Frauenaug mit Tränen nässt,
ist dies der Grund für deine Einsamkeit?
Ach, wenn du kinderlos die Welt verlässt,
dann trägt die Welt um dich ein Trauerkleid.
Als deine Witwe wird sie um dich weinen,
der du kein Abbild hinterlassen hast,
und jede andre wird ihr glücklich scheinen,
die doch ein Kind als Liebespfand umfasst.
Was ein Verschwender in den Wind zerstreut,
das bleibt der Welt an anderm Ort erhalten,
die Schönheit aber lebt nur hier und heut,
einmal zerstört, kann nichts sie neu entfalten.
Doch leer von Menschlieb’ ist deine Brust,
wenn du als Feind dich selbst vernichten musst.
10
For shame deny that thou bear’st love to any
Who for thy self art so unprovident.
Grant if thou wilt, thou art beloved of many,
But that thou none lov’st is most evident:
For thou art so possessed with murd’rous hate,
That ’gainst thy self thou stick’st not to conspire,
Seeking that beauteous roof to ruinate
Which to repair should be thy chief desire:
O change thy thought, that I may change my mind,
Shall hate be fairer lodged than gentle love?
Be as thy presence is gracious and kind,
Or to thyself at least kind-hearted prove,
Make thee another self for love of me,
That beauty still may live in thine or thee.
10
Aus Scham bestreit es nur, doch du liebst keinen,
da dich dein eignes Wohl so wenig schert.
Gesteh, dass manche heimlich um dich weinen,
du aber hast noch keinen je begehrt.
Du wütest gegen dich in solchem Hass,
dass du dich gegen’s eigne Haus verschwörst,
an Dach und Säulen stößt ohn’ Unterlass
und endlich, was du retten sollst, zerstörst.
O ändre dich, dass ich im Unrecht bin!
Soll Lieb’ im Elend, Hass in Schönheit wohnen?