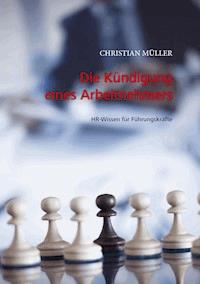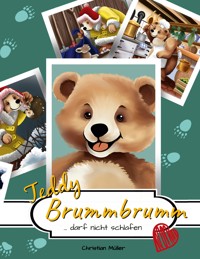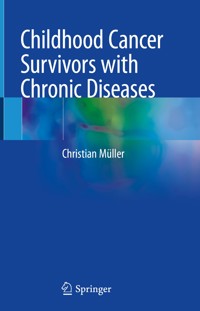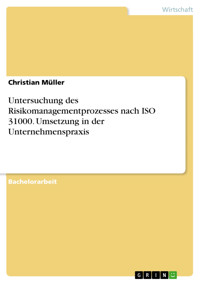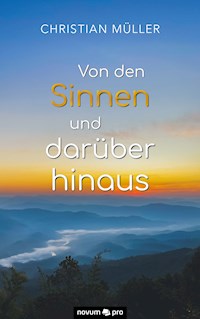2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
"Wir schaffen das!" Ein Satz, der zusammenschweißen wollte, aber zu einer Spaltung geführt hat. Ein spannender (Kriminal)roman aus dem Umfeld eines Ehrenamtlichen in der Flüchtlingsarbeit. Zwar nur ein namentlich bekannter Toter, aber viele in Betracht kommende Schuldige und einige gesellschaftskritische Fragen nach dem "Warum?".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 302
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Paul ist über den Klimawandel erschüttert, den Wandel des Klimas in der Flüchtlingspolitik.
Von der Willkommenskultur zur Abschottungskultur. Und das nach nur einer Nacht. Der Silvesternacht in Köln.
Die Aussetzung des Familiennachzuges für „subsidiär Schutzbedürftige“ hält er für einen Skandal.
Er hat sein Herz auf dem „rechten“ Fleck und versucht, nach wie vor den Flüchtlingen auf dem langen, dornenreichen Weg zur Integration zu helfen.
Aber es klappt nicht immer.
Manch einer bleibt auf der Strecke.
Christian Müller wurde 1952 in Langenhagen bei Hannover geboren. Und wenn er nicht gestorben ist, lebt er immer noch und arbeitet an einer Fortsetzung, die durch die Verlängerung der Aussetzung des Familiennachzuges zwingend erforderlich ist.
Christian Müller
Wir schaffen das,
aber nicht jeder ist Wir
Etwaige Ähnlichkeiten zwischen den in diesem Roman geschilderten Begebenheiten, Örtlichkeiten, Persönlichkeiten und Wirklichkeiten waren unvermeidbar, denn Dichtung und Wahrheit liegen oft dicht beieinander.
© 2018 Christian Müller
Umschlaggestaltung: Alexandra Lüdtke und Silvia Müller
Verlag und Druck: tredition GmbH, Hamburg
ISBN
Paperback:978-3-7469-1802-0
Hardcover:978-3-7469-1803-7
e-Book:978-3-7469-1804-4
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Prolog
Auf dem Hauptbahnhof in München steht ein junger Mann, der sich ein Plakat um den Hals gehängt hat, auf dem die Worte „Warum, warum?“, zu lesen sind. Er steht dort schon seit mehr als zehn Minuten, aber niemand hat ihn, wie die spätere Auswertung der auf dem Bahnhof auf Gleis 7 installierten Videokameras ergibt, angesprochen.
Er holt sein Handy aus der Hosentasche und führt ein sehr kurzes Telefongespräch.
Plötzlich bückt er sich, holt aus dem vor ihm stehenden Rucksack eine Thermoskanne, übergießt sich mit der darin befindlichen Flüssigkeit, nimmt seelenruhig ein Feuerzeug aus seiner Hosentasche, zündet sich mit ruhiger, nicht zittriger Hand an und stirbt, noch ehe jemand eingreifen kann, ohne ein Sterbenswörtchen zu sagen.
Augenzeugen haben später übereinstimmend berichtet, dass der Mann wie ein Wahnsinniger kurze Zeit auf dem Bahnsteig hin - und hergerannt sei und wild um sich schlagend versucht habe, die Flammen, die ihn umschlungen hatten, zu löschen. Dabei habe er wie von Sinnen geschrien.
Allerding waren die Zeugenaussagen darüber, was der Mann geschrien hat, äußerst unbefriedigend, denn es gab hierzu die unterschiedlichsten Angaben: Manche Augenzeugen oder sollte man besser sagen Ohrenzeugen, denn es ging ja in diese Phase ihrer Zeugenvernehmung darum, was sie gehört, nicht darum, was sie gesehen hatten, haben bekundet, dass der Unbekannte „Warum, warum?“, geschrien habe. Andere haben bei ihrer Vernehmung erklärt, die Worte „Allahu Akbar“ vernommen zu haben und wieder andere wollten diese oder jene Worte gehört haben.
Wochenlang beherrschte der Suizid des unbekannten Mannes die Schlagzeilen der regionalen und überregionalen Presse.
Wer war dieser Mann? Warum hat er sich verbrannt? Warum hat er die Worte „Warum, warum?“ auf das Plakat geschrieben?
Irgendwann wurde von einem schlauen Journalisten die Frage aufgeworfen, warum die Polizei nicht ein Foto des „Bahnhofsselbstmörders“ veröffentlich habe, und die Polizei musste einräumen, dass ein Malheur passiert sei. Die Videoaufnahmen, mittels derer man hätte ein Foto anfertigen und an die Presse geben können, seien versehentlich unwiederbringlich gelöscht worden.
Das Ganze roch nach Skandal, aber trotz hartnäckiger, teilweise illegaler Praktiken der eine Wahnsinnsstory witternden Journalisten und Fernsehreporter blieb die Identität des Brandopfers, das zugleich der Täter war, unbekannt, weil die mit dem Fall befassten zuständigen Polizeibediensteten die Öffentlichkeit hierüberüber im Unklaren ließen, sei es, weil sie die Identität des „Bahnhofsselbstmörders“ nicht preisgeben wollten oder dies objektiv nicht konnten.
Es gelingt in Deutschland nicht oft, Namen von an spektakulären Ereignissen beteiligten Personen vor der Öffentlichkeit geheim zu halten, aber manchmal eben doch, wie der Fall der evangelischen Bischöfin Margot Käßmann vor einiger Zeit gezeigt hat, die von ihren Ämtern zurückgetreten ist, weil sie auf einer Trunkenheitsfahrt erwischt worden war, und bei der immer noch viele Jahre später darüber gerätselt wurde, wer ihr Beifahrer war; denn diese Information haben die seinerzeit zuständigen Polizeibeamten für sich behalten und nicht der gierig, mitunter auch mit illegalen Mitteln, nach neusten Informationen suchenden Meute der Journalisten offenbart.
Mal wurde in der regionalen und auch überregionalen Presse über die Selbstverbrennung unter der Überschrift „Es geschah am helllichten Tag“, mal unter der Schlagzeile „So kann es nicht weitergehen“, zumeist aber unter der Head – Line „Neues vom Bahnhofsselbstmörder“, „berichtet“, obwohl es über ihn gar nichts Neues zu berichten gab, sodass die Überschriften besser gelautet hätten : „Neue Spekulationen.“
Irgendwann war dann der Vorfall auf dem Bahnhof in München in Vergessenheit geraten und landete im Nirwana der Berichterstattung durch die freie Presse und Medien, weil andere Ereignisse, wie das verbale Aufrüsten zwischen Trump und Pjöngjang, die Folgen des Diesel - Skandals wegen manipulierter Messwerte, vergiftete Eier aus Holland, der Sieg der Deutschen Fußballnationalmannschaft im Confed Cup oder der Austritt von Elke Twesten aus der Fraktion der Grünen und die dadurch erforderlichen Neuwahlen in Niedersachsen sowie die bevorstehende Bundestagswahl im Herbst 2017 bessere Themen zu sein schienen, um Auflagen oder Einschaltquoten zu erhöhen.
1
Maria und Paul Herbst sitzen auf dem erst kürzlich angeschafften roten, vor allem aber bequemen Sofa - sie wollen es sich im Alter auch einmal gut gehen lassen -, und sehen, wie viele andere Fernsehzuschauer auch, wieder einmal eine der im Spätsommer 2015 fast täglich im Fernsehen ausgestrahlten Sendungen über die Flüchtlinge, die in großer Zahl nach Öffnung der Grenzen seit dem 13. September 2015 nach Deutschland einreisen und eine Welle der Hilfsbereitschaft auslösen, wie beispielsweise in München, wo die Ankommenden in überschwänglichem Maße von der bayrischen Bevölkerung mit Getränken und Decken versorgt werden.
Maria, die die meiste Zeit ihres Lebens aufopferungsvoll in dem kleinen Ort Bad Vilbel in der Nähe von Frankfurt als Arzthelferin tätig war, ist seit einigen Monaten Rentnerin. Sie profitiert von der kürzlich durch die amtierende Regierung, der Großen Koalition, beschlossene Rentenreform zu Lasten der jüngeren Generation, der „abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren“ und genießt es, endlich auch einmal in materieller Hinsicht Glück in ihrem Leben gehabt zu haben.
Paul, der demnächst in den vorzeitigen Ruhestand gehen wird, lehrt noch an einer Fachhochschule für Soziale Arbeit das von den Studierenden nicht unbedingt geliebte Fach „Recht und Verwaltung“, das inzwischen nicht mehr so heißt, weil auch an Universitäten und Fachhochschulen der Trend zu „altem Weinin neuen Schläuchen“ nicht Halt gemacht hat und es seit einigen Jahren keine Fächer mehr gibt, sondern nur noch Module, obwohl die Fachhochschulen weiterhin Fachhochschulen und nicht Moduleschulen heißen.
Nur in Hannover ist dieser Anachronismus offensichtlich aufgefallen und die ehemalige, aus der evangelischen Fachhochschule Hannover hervorgegangene Fachhochschule heißt seit einigen Jahren schlicht und einfach „Hochschule Hannover“.
Die Denkfabrik in Hannover für angehende Akademiker hat damit im Zuge von Modernisierungsbestrebungen einen Namen erhalten, der so nichtssagend ist, wie der Name „Oberschule“.
Früher war der erfolgreiche Besuch der „Oberschule“ der Garant für einen gut bezahlten, wenn auch nicht immer glücklich machenden Arbeitsplatz. Durch das Abitur war damals der Weg geebnet, zumindest in materieller Hinsicht am Ende der Ausbildung auf der Sonnenseite zu leben, wohingegen durch die kürzlich erfolgte „(Um)Taufe“ der bisherigen Hauptschule in Oberschule sich für deren Absolventinnen nichts geändert hat und ändern wird, da für sie nach wie vor Arbeitslosigkeit oder ein permanenter Kampf um das Existenzminimum vorprogrammiert ist.
Maria ist von der Berichterstattung über die Flüchtlinge sichtlich betroffen, schaltet den Fernseher aus und seufzt: „Da muss man doch etwas tun und helfen, wenn die Flüchtlinge auch zu uns nach Oberursel kommen.“
Paul pflichtet ihr bei, ohne sich darüber im Klaren zu sein, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang er bereit wäre, sich für den Fall der Fälle zu engagieren.
Er hat zwar keinen Zweifel daran, dass die signalisierte Hilfsbereitschaft von Maria nicht bloßes Gerede ist und sie zupacken wird, wenn die Situation es erfordert, denn schließlich lebt er seit mehr als zehn Jahren mit ihr zusammen, und so ist es ihm nicht verborgen geblieben, dass sie schon oft anderen Menschen nicht nur sporadisch helfend zur Seite gestanden hat.
Er ist allerdings skeptisch, ob bei den vielen am Bahnhof in München stehenden Helfern die Welle der Begeisterung anhalten und deren Hilfsbereitschaft nachhaltig sein wird.
Seine Skepsis rührt daher, dass er sich an die Zeit der Maueröffnung vor mehr als 25 Jahren – damals war die Geburtsstunde der Ossi – und Wessiwitze -,erinnert, als die „Brüder und Schwestern“ aus der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik auch euphorisch von der Westdeutschen Bevölkerung begrüßt wurden, und wenig später „Ossis und Wessis“ sich nicht nur beim Kampf um Arbeitsplätze und preisgünstigem Wohnraum mitunter fast feindlich gegenüberstanden.
Als Maria einige Tage später in der örtlichen Presse liest, dass in einer ehemaligen Fabrikhalle eine vom Deutschen Roten Kreuz betreute Flüchtlingsunterkunft aufgemacht ist und dringend ehrenamtliche Helfer gesucht werden, wendet sie sich nicht an die in der Zeitung genannte Vermittlungsstelle für Ehrenamtliche. Sie hat nämlich eine tiefe Abneigung gegen alles Bürokratische und fährt deshalb zu der Notunterkunft, wo sie ihre Hilfe vor Ort direkt anbietet. Diese wird dankbar angenommen.
Maria verbringt im Herbst 2015 viele Stunden in der Notunterkunft und hilft, wo Hilfe benötigt wird, sei es als Hilfskrankenschwester vor Ort beim Verarzten kleinerer Blessuren, sei es durch die Besorgung von notwendigen Bekleidungsstücken für den bevorstehenden Winter aus der langsam im Aufbau befindlichen Kleiderkammer oder durch Spielen mit den vielen Kindern in der trostlosen Notunterkunft, in der die auf engstem Raum lebenden Flüchtlinge keinerlei Privatsphäre haben, und die Kinder ein ärmliches Dasein fristen.
„Aber sie haben wenigstens ein Dach über dem Kopf und genug zu essen“, sagt sie häufiger abends zu Paul, wenn dieser sich nach ihren Erlebnissen und Erfahrungen in der Unterkunft erkundigt. So erfährt Paul, der in seinem letzten Semester an der Fachhochschule noch viel zu erledigen hat, durch Marias Erzählungen viel Positives über die Flüchtlinge in seiner Heimatstadt Oberursel:
von deren Dankbarkeit und Höflichkeit, von ihren Versuchen, mit Hilfe ihrer Smartphones erste deutsche Worte zu lernen, von der Freude und Bescheidenheit der Kinder, wenn Maria etwas mitgebracht hat und sei es nur einen Luftballon oder einige alte Tennisbälle, mit denen sie „Dosenwefen“ spielen.
So vergeht Tag für Tag. Zwar ohne spektakuläre Ereignisse, aber mit vielen kleinen positiven Erlebnissen, von denen Maria als eine der ersten Ehrenamtlichen berichten kann und auch im Bekanntenkreis gerne erzählt, ohne dass ihr Unverständnis oder gar Hass entgegenschlägt, wie sie das später leider des Öfteren ertragen muss.
2
Aber schon bald kommt die Wende:
In der Silvesternacht 2015/2016 sollen etliche Flüchtlinge in Köln gegenüber Frauen sexuell übergriffig geworden sein, was die Öffentlichkeit bewegt und auch in der veröffentlichten Meinung zu einem Meinungsumschwung führt. Der Beginn einer Entwicklung von einer Willkommenskultur zu einer Ablehnungskultur ist eingeleitet.
Der Slogan von Angela Merkel „Wir schaffen das“ gerät mehr und mehr in die Kritik und viele äußern nicht mehr nur versteckt und hinter vorgehaltener Hand, sondern zum Teil mit geballter Faust die Meinung:
„So kann es nicht weitergehen.“
Maria lässt sich davon allerdings nicht beirren und arbeitet auch nach den Vorkommnissen in der „legendären“ Silvesternacht von Köln mit dem gleichen Engagement in der Notunterkunft weiter und sieht, ebenso wie Paul, mit Sorge, dass sich das gesellschaftspolitische Klima verändert.
„Mir sind auch die Männer in der Notunterkunft immer mit Respekt begegnet“, nimmt sie die Flüchtlinge vor den seit der Silvesternacht immer häufiger im Raum stehenden, auch von guten Bekannten geäußerten Pauschalvorwürfen in Schutz, und hat manchmal das Gefühl, sich für ihr Engagement für Flüchtlinge rechtfertigen zu müssen.
Auch Pauls Haltung gegenüber Flüchtlingen hat sich seit der Silvesternacht nicht geändert.
Er ist allerdings davon überzeugt, dass die Integration der angekommenen und noch ankommenden Flüchtlinge weitaus schwerer sein wird, als dies nach den offiziellen politischen Verlautbarungen zu vermuten wäre, weil er bezweifelt, dass die Flüchtlinge in der Mehrzahl über eine gute Schul – und Hochschulausbildung oder Berufsausbildung verfügen.
Und seine Zweifel sind berechtigt, wie sich mehr als einundeinhalb Jahre später herausstellt, als im Sommer 2017 durch einen Bericht des Bundesinstituts für Berufsbildung (BiBB) bekannt wird, dass neunundfünfzig Prozent der Flüchtlinge, die in den Jahren 2015 und 2016 nach Deutschland gekommen sind, über keinen Schulabschluss verfügen.
Was er allerdings nicht geahnt hat, ist die erschreckende Tatsache, dass die geschönten Zahlen der Bundesagentur für Arbeit dadurch zu Stande gekommen sind, dass ein Viertel aller Flüchtlinge die Frage nach dem Schulabschluss unbeantwortet gelassen hat, und die Verantwortlichen der Bundesagentur für Arbeit bei der Erstellung der Statistiken davon ausgegangen sind, dass diese dann wohl eine Schulausbildung hätten.
Ein unglaublicher Skandal, der allerdings den Medien nur eine Randnotiz wert war, vielleicht, weil man sich damit abgefunden hat, dass allen Statistiken ohnehin seit jeher der Makel des Beliebigen anhaftet, was Winston Churchill schon vor mehr als achtzig Jahren zu der häufig im Zusammenhang mit Statistiken zitierten Aussage veranlasst haben soll:
„Trau keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast.“
Paul jedenfalls hat schon im Herbst 2015 Zweifel an den offiziellen Verlautbarungen über den Bildungsstand der Flüchtlinge, und man hat ihn schon damals häufiger empört sagen hören:
„Woher wollen die das wissen? Die wissen doch gar nicht, wie viele Flüchtlinge angekommen sind und schaffen es nicht einmal, die Flüchtlinge namentlich zu registrieren. Aber sie behaupten, genau zu wissen, was für eine Ausbildung die Flüchtlinge haben. Das ist doch absurd“, hatte er nicht nur einmal von sich gegeben, obwohl im Herbst 2015 die allgemeine Stimmung noch so war, dass man fast schon als rechtsradikal und ausländerfeindlich beschimpft wurde, wenn man es wagte, einmal eine kritische Äußerung von sich zu geben oder eine kritische Nachfrage zu stellen.
3
Im Januar 2016 beginnt für Paul ein neuer Lebensabschnitt, der Vorruhestand, für den er sich viel vorgenommen hat:
die Mitarbeit an einem juristischen Kommentar, zusammen mit einem Freund und Kollegen von der Fachhochschule, die Neuauflage eines anderen Buches mit einer hierfür gewonnenen jüngeren Kollegin als Co- Autorin, mehr Klavierspielen und vielleicht die Aufnahme neuer Lieder auf Tonträger in einem Tonstudio, falls ihm oder Daggi, mit der er seit mehr als zwanzig Jahren Musik macht, mal wieder eine neue Melodie und ein dazu passender Text einfallen sollte.
Als er eines Tages in den wöchentlich erscheinenden „Oberurseler Nachrichten“ liest, dass im Gemeindehaus der evangelischen Kirche Deutschunterricht für Flüchtlinge angeboten werden soll und noch Ehrenamtliche gesucht werden, fühlt er sich angesprochen und fasst den Entschluss, mitzuhelfen.
Nicht, weil er Angst davor hat, sich als Pensionär zu langweilen, sondern weil er keinen Zweifel daran hat, dass eine der größten Herausforderungen der nächsten Jahre, die Integration der Flüchtlinge, nur dann gelingen kann, wenn diese die Chance bekommen und nutzen, Deutsch zu lernen.
Er nimmt sich allerdings vor, dass er auf keinen Fall für die Flüchtlinge juristisch tätig sein will, da er schließlich im Ruhestand ist und keine Ambitionen verspürt, sich in ein neues Rechtsgebiet wie das Asyl – und Ausländerrecht einzuarbeiten, zumal er auf Grund von Gesprächen mit seinem ehemaligen Kollegen, der Mitautor eines Kommentars zum Ausländerrecht ist, weiß, dass dieses Rechtsgebiet wegen ständiger Gesetzesänderungen einem undurchsichtigen Dschungel gleicht, und dass es verheerende und existenzbedrohliche Folgen für die Betroffenen haben kann, wenn man sich in dem Paragraphendickicht verirrt und als Rechtsbeistand einen Fehler macht.
Von daher beschließt er, Stillschweigen darüber zu bewahren, dass er Jurist ist, nachdem er zuvor Maria, deren Rat ihm oft sehr wichtig ist, gefragt hat, ob sie dies in Ordnung findet, und diese ihn darin bestärkt hat, sich auf keinen Fall für juristische Tätigkeiten einbinden zu lassen, weil sie weiß, wie schwer es ihm manchmal fällt, „nein“ zu sagen.
Aber da er davon überzeugt ist, dass Sprache der wichtigste Schlüssel zur Integration ist, ist er bereit, zweimal wöchentlich Deutschunterricht für Flüchtlinge zu erteilen.
Deshalb notiert er in seinem Terminkalender für den 18.1.2016:
„Vorgespräch, Erster Termin: Deutsch für Flüchtlinge, Gemeindehaus, 16:00 Uhr.“
Am Abend vor diesem Termin überlegt er zwar kurz, was morgen auf ihn zukommen wird. Da er sich aber den Ablauf partout nicht so richtig vorstellen kann und nicht weiß, was ihn erwartet und was man eventuell von ihm erwartet, findet er sich damit ab, alles auf sich zukommen zu lassen, obwohl dies seinen sonstigen Gepflogenheiten widerspricht.
4
Paul weiß zwar, dass es oft anders kommt, als man denkt, aber er ist dennoch ein Mensch, der versucht, sich auf Prüfungen und andere vergleichbare Situationen, bei denen er vielleicht von anderen Menschen gemustert wird, möglichst gut vorzubereiten.
Als er sich vor mehr als dreißig Jahren um eine Richterstelle beworben hatte, hatte er sich mit seiner damaligen Ehefrau Edeltraut durch Rollenspiele auf das Bewerbungsgespräch vorbereitet, was ihm die notwendige Sicherheit gab, um sich auch durch unvorhergesehene Fragen, wie beispielsweise die Frage, ob er denn etwa nicht „gedient“ habe, nicht aus der Fassung bringen zu lassen.
Bei seiner erfolgreichen Bewerbung um die Professur an einer Fachhochschule für Sozialwesen hatte er etlichen Fragen nur deshalb souverän beantworten können, weil er sie bei seiner Vorbereitung antizipiert hatte, sich also hatte vorstellen können, dass man ihm in etwa genau diese oder jene Frage stellen werde, und so hatte er sich auch nicht aus der Ruhe bringen lassen, als ein Mitglied der Berufungskommission ihm beharrlich und mit aggressivem Unterton Fragen zu seiner Dissertation gestellt hatte.
In seiner Dissertation über einen bestimmten Paragraphen des Unterhaltsrecht zwischen geschiedenen und getrenntlebenden Eheleuten hatte Paul die These vertreten, und auf etwas mehr als zweihundert Seiten untermauert, dass einer Frau auch dann, wenn sie ihren Ehemann wegen eines anderen Mannes verlässt, ein Unterhaltsanspruch zustehen müsse.
Dies konnte ein penetrant auf seiner Dissertation rumhackendes Mitglied der Berufungskommission wohl nicht ertragen, weil es, so vermutete Paul, wohl ein durch Unterhaltszahlungen frustrierter Ehemann war, der von seiner Frau verlassen worden war.
Auf Fragen zu seiner Dissertation war Paul zwar nicht gefasst, aber da er diese selbst geschrieben hatte, und nicht, wie manch prominenter Politiker von einem Ghostwriter hatte schreiben lassen, konnte er mit fast stoischer Ruhe sachkundig die in zunehmend feinseligerem Ton vorgetragenen Fragen des gehörnten Ehemannes beantworten.
Viele Jahre später hat Paul von einem Mitglied der Berufungskommission erfahren, dass die Mehrheit von seiner ruhigen und kompetenten Art beeindruckt war, mit der er auf die zum Teil unverschämten Fragen des „Unterhaltsgeschädigten“ geantwortet hatte, und dass er es letztlich diesem Umstand zu verdanken hatte, dass er auf Platz eins der Berufungsliste gesetzt worden war.
Auch bei seiner Bewerbung um die Professur hat sich somit eine seiner tief verinnerlichten Lebensweisheiten bewahrheitet, dass es gut ist, sich vorzubereiten. Denn nur dadurch, dass er auf die Fragen, die ihm zuerst gestellt wurden, gut vorbereitet war und von Minute zu Minute sicherer wurde, konnte er die späteren Fragen des Quengelgeistes ohne große Nervosität und Verunsicherung beantworten.
Allerdings war auch etwas oder viel Glück mit im Spiel, denn wer weiß, wie das Berufungsverfahren verlaufen wäre, wenn das unter seiner Unterhaltslast leidende Mitglied der Berufungskommission zu Beginn des Bewerbungsgesprächs seine Fragen gestellt hätte.
Es gehört eben immer auch Glück dazu, wenn man eine Situation erfolgreich meistert, in der andere über einen selbst Entscheidungen treffen.
Auch auf seine Psychologieprüfung im Rahmen des ersten Staatsexamens zum Grund – und Hauptschullehrer hatte er sich intensiv vorbereitet.
Er verfügte damals noch über die insbesondere von Sabinchen, der Ehefrau seines Freundes Dirk, bewunderte Fähigkeit, konzentriert zu lesen und gleichzeitig im Fernsehen einen Film, ein Fußballspiel oder einen olympischen Wettkampf zu verfolgen, eine Fähigkeit, die mit zunehmendem Alter allerdings langsam abzunehmen begann.
Er wollte ursprünglich die Prüfung bei einem Professor namens Scholz, bei dem er mit großem Genuss und Gewinn einige Veranstaltungen besucht hatte, absolvieren. Da er sich jedoch entgegen seinen sonstigen Gewohnheiten wegen der Ablenkungen, die eine kurzfristige Liebschaft mit sich brachte, erst auf den letzten Drücker für die Prüfung bei Herrn Scholz angemeldet hatte und auf dessen Liste schon zu viele Prüflinge standen, die sich bei dem allseits beliebten Professor prüfen lassen wollten, blieb ihm nichts anderes übrig, als sich einen anderen Prüfer zu suchen.
So kam er letztendlich zu Frau Koblinke, bei der er zuvor kein Seminar besucht hatte, und beging bei der persönlichen Anmeldung einen entscheidenden Fehler, als er dieser immer finster dreinschauenden Professorin, deren Vorlesungen nur von wenigen Studierenden besucht wurden, sagte, dass er eigentlich lieber die Prüfung bei Herrn Scholz habe machen wollen, dieser aber keine Prüflinge mehr annehme.
Schon auf dem Nachhauseweg war ihm klar geworden, dass es nicht besonders geschickt war, Frau Koblinke das Gefühl zu vermitteln, nur ein Notnagel zu sein.
Da er befürchtete, dass eine Voreingenommenheit von Frau Koblinke den Prüfungsablauf und das Prüfungsergebnis eventuell negativ beeinflussen könnte - er hatte noch vor Augen, wie sich deren Gesichtsausdruck verändert hatte, als sie hörte, dass er ursprünglich bei Herrn Scholz die Prüfung ablegen wollte - , hatte er Dirk gebeten, an der Prüfung als Zuhörer teilzunehmen, um gegebenenfalls einen Zeugen zu haben, falls Frau Koblinke aus gekränkter Eitelkeit heraus unfaire Prüfungsmethoden anwenden sollte.
Trotz guter Vorbereitung ging er mit einem etwas mulmigen Gefühl in den Prüfungsraum,--und mit ihm Dirk.
Eigentlich konnte nichts schiefgehen, denn Psychologie war neben Philosophie sein Lieblingsfach.
Mit Sigmund Freud, dem „Steckenpferd“ von Frau Koblinke, die Jahr für Jahr zahlreiche Veranstaltungen zur Psychoanalyse anbot, die aber schlecht besucht wurden, weil sie das Wort „Vorlesung“ allzu wörtlich nahm, indem sie einfach nur aus den Werken von Freud vorlas, hatte er sich intensiv beschäftigt, und auf die beiden mit der Prüferin vereinbarten Themen „Psychoanalytische Grundlagen der Erziehung“ und „die Gestaltpsychologie von Köhler“ hatte er sich gewissenhaft vorbereitet.
Nach einem kurzen Vorgeplänkel, ob Dirk überhaupt das Recht habe, an der Prüfung als Zuhörer teilzunehmen und dem von Frau Koblinke nicht zu wiederlegenden Hinweis von Paul, dass sich dieses Recht aus der geltenden Prüfungsordnung ergebe, begann die eigentliche Prüfung.
Zunächst verlief diese, wie von Paul erwartet.
Er konnte seine vorbereiteten Thesen erläutern und auf Nachfragen, seiner Einschätzung nach sachlich fundiert, antworten.
Doch dann kam eine Frage, mit der er nicht gerechnet hatte, die noch dazu in schnippischen Ton gestellt worden war:
„Wann hat denn Freud seine Traumdeutung veröffentlicht?“
Paul antwortete, dass das um die Jahrhundertwende gewesen sein müsse, woraufhin Frau Koblinke ihn triumphierend tadelte:
„Das ist leider nicht richtig. Die Traumdeutung ist erstmals 1900 erschienen.“
Paul war fassungs –und sprachlos.
Wenn er das Wirken von Freud in die Antike, das Mittelalter oder die Mitte des 19.Jahrhunderts verlegt hätte, dann hätte dies sicherlich zu denken geben müssen und einen Tadel sowie einen gravierenden Punktabzug gerechtfertigt.
Aber die Antwort, dass die Traumdeutung von Freud um die Jahrhundertwende erschienen ist, quasi als falsch zu bezeichnen, hielt er schon für eine Frechheit, aber er entschloss sich, das von seiner Großmutter so oft gehörte Sprichwort „Reden ist Silber, Schweigen ist Gold“ zu beherzigen; denn ab diesem Moment war ihm klar, dass Frau Koblinke darauf aus war, ihm heimzuzahlen, dass er sie als Notnagel benutzt hatte.
Interessiert sich diese Idiotin eigentlich auch für Inhalte und dafür, ob jemand das, was er gelesen hat, auch verstanden hat?, fragte er sich allerdings insgeheim, denn seiner Ansicht nach sollte das doch Gegenstand einer Prüfung sein.
Es folgten weitere Fragen und fast wie aus der Pistole geschossene, zutreffende Antworten von Paul.
Dann auf einmal die überraschende Frage, auf die er nicht gefasst war, mit der vermutlich aber auch kein anderer gerechnet und die ihn fast aus der Fassung gebracht hätte.
„Kennen Sie nicht das kleine rote Büchlein von Köhler?“
„Nein das kenne ich nicht.“
„Sie müssen doch das kleine rote Büchlein von Köhler kennen! Kennen Sie das denn wirklich nicht?“, fragte die selbstherrliche Frau Koblinke erneut, diesmal allerdings in noch vorwurfsvollerem Ton.
Paul merkte, dass sie ihn wieder aufs Glatteis führen, unbedingt Wissenslücken herausfragen wollte, die, protokollarisch festgehalten, eine schlechte Prüfungsbewertung rechtfertigen sollten.
„Nein, ich kenne das kleine rote Büchlein von Köhler nicht“, entgegnete Paul fast schon resigniert, weil er befürchtete, dass diese im Prüfungsprotokoll vielleicht festgehaltene „Unkenntnis“ ihm vielleicht zum Verhängnis werden könnte.
Aber dann kam ihm eine geniale Idee:
„Können Sie mir bittet sagen, welchen Titel das „kleine rote Büchlein von Köhler“ hat. Ich versuche mir nämlich bei wichtigen Büchern, die im Laufe der Menschheitsgeschichte geschrieben worden sind, den Titel zu merken und natürlich auch die wesentlichen Inhalte, nicht jedoch die Farbe des Einbandes und das Format, in dem die Gedanken festgehalten sind - und auch nicht das exakte Erscheinungsjahr.“
Das saß, denn nun war Frau Koblinke sprach – und fassungslos und zwar in einem Maße, dass ihr anzusehen war, wie sie krampfhaft versuchte, sich den Titel des kleinen roten Büchleins in Erinnerung zu rufen.
Aber er fiel ihr nicht ein.
Frau Koblinke befreite sich dann aus der peinlichen Situation dadurch, dass sie auf ihre Uhr schaute und die Prüfung für beendet erklärte, weil die in der Prüfungsordnung vorgesehene Prüfungsdauer von dreißig Minuten erreicht sei, obwohl die Prüfung tatsächlich nur fünfundzwanzig Minuten gedauert hatte.
Paul hat die Prüfung, sehr zu seiner Überraschung, mit „gut“ bestanden und führt dies auch heute noch darauf zurück, dass er eben auch Glück gehabt hat, nämlich das Glück, dass vermutlich die Zweitprüferin, eine selbstbewusste Akademische Rätin, bei der er einige Seminare über Gruppendynamik besucht hatte, den Mut besessen hatte, ihre ältere, in der akademischen Hierarchie über ihr stehende, aber nicht weisungsbefugte Kollegin, Frau Prof. Koblinke, in ihre Schranken zu weisen.
Gott sei Dank ist in der Prüfungsordnung der Pädagogischen Hochschule vorgesehen, dass mündliche Prüfungen in der Regel vor mindestens zwei prüfenden Personen abzulegen sind, hatte Paul damals gedacht.
Er hat erst später in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Prüfungsausschusses der Fachhochschule erfahren, dass in fast allen Prüfungsordnungen das „Zweitprüferprinzip“ bei mündlichen Prüfungen verankert ist.
5
Sehr unsicher in Bezug auf das, was auf ihn zukommt, weil gänzlich unvorbereitet, begibt sich Paul zusammen mit Maria an dem in seinem Terminkalender notierten Nachmittag im Januar in das Gemeindehaus der evangelischen Kirche, wo offenkundig bereits einige andere ehrenamtliche Helfer, die weder Paul noch Maria kennen, auf die Flüchtlinge warten, um sie bei dem Erlernen der deutschen Sprache zu unterstützen.
Frau Jablonski, die Organisatorin, begrüßt die beiden in herzlichem Ton und bittet sie, an einem in der Mitte des Raumes befindlichen größeren runden Tisch Platz zu nehmen.
Pünktlich um vier Uhr eröffnet sie das Vorgespräch und nach der obligatorischen Vorstellungsrunde, in der jeder Gelegenheit hat, sich, wie der Name schon sagt, vorzustellen (Name, Alter, Beruf; manch einer meint zwar, auch noch seine Hobbys oder anderes Wichtiges oder Belangloses mitteilen zu müssen, aber im Großen und Ganzen sind alle Vorstellungen ganz nach dem Geschmack von Paul, der lange Monologe und noch mehr ausufernde Selbstdarstellungen hasst), erklärt sie den insgesamt sechs anwesenden freiwilligen Helfern, wie sie sich den Ablauf vorstellt:
„Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie viele Flüchtlinge nachher kommen werden. Wir haben ja vor zwei Wochen einen Kaffeenachmittag mit interessierten Bürgern und Flüchtlingen durchgeführt, zu dem fast vierzig Flüchtlinge und ungefähr gleich viele Oberurseler Bürger gekommen sind, und über das Projekt „Hilfe beim Deutschlernen“, das heute Abend um sechs Uhr starten soll, informiert wurden.“
Frau Jablonski macht eine kurze Atempause und fährt fort:
„Ich weiß, wie gesagt nicht, wie viele Flüchtlinge nachher kommen werden, und ich weiß auch nicht, welche Nationalität sie haben werden.“
Wieder folgt eine kurze Pause.
„Und ich wusste bis vor wenigen Minuten auch noch nicht, wie viele ehrenamtliche Helfer für das von der evangelischen Kirche Oberursel ins Leben gerufene Projekt zur Verfügung stehen werden.
Wie ich sehe, sind wir, ohne mich, sechs Ehrenamtliche, so dass ich vorschlage, dass sich jeder von euch an einen Tisch setzt. Ich werde dann nachher die vermutlich nach und nach eintrudelnden Flüchtlinge so auf die Tische verteilen, dass möglichst in etwa gleich große Lerngruppen entstehen. Gibt es da irgendwelche Einwände?“
Präzise Ansage, keine Einwände und folgerichtig ein Tische– und Stühlerücken, bis sechs Tischgruppen entstehen.
Da es erst fünf Uhr ist, überbrücken sieben Ehrenamtliche die Wartezeit bis zum Eintreffen der Flüchtlinge durch Smalltalks.
Warten, warten, warten, - eine Zeit des Nichtstuns, die Paul schon immer gehasst hat.
Warten bei Karstadt, wenn seine Mutter ihn und seinen fünfjährigen Zwillingsbruder Jakob vor Karstadt in Frankfurt stehen ließ und sagte:
„Wartet hier, ich komme gleich wieder“, und die Zeit wegen der bangen Frage, ob sie wiederkommt, unendlich schien.
„Karstadtgefühle“ hat Jakob das später einmal bei einem seiner Besuche genannt, als er schon längst erwachsen war und nicht mehr in Oberursel wohnte.
Endlos langes Warten und die Frage der beiden verzweifelt wartenden „Brüderchen“, wie sie oft von ihrem großen Bruder genannt wurden:
„Warum kommt sie nicht? Warum, warum?“
Warten auf Maria, wenn er wieder einmal abmarschbereit vor der der Haustür stand, und sie noch einmal meinte, zurückgehen zu müssen, um noch einmal einen Schluck Mineralwasser zu trinken, den Labellostift zu suchen oder nochmals zu überprüfen, ob tatsächlich auch alle Fenster geschlossen sind.
Warten auf Edeltraut, seine erste Ehefrau, die Mutter seiner Kinder, wenn er bei dreißig Grad Celsius vor dem für den Urlaub abfahrbereiten Auto stand, in das er trotz unglaublich vieler Koffer so gerade eben noch alles untergebracht hatte, was sie meinte mitnehmen zu müssen, um einen angenehmen Urlaub verbringen zu können. Sie brachte ihn fast immer zur Weißglut, wenn sie noch einmal wegging und sagte, dass sie noch etwas vergessen habe, und dann mit einem Kosmetikköfferchen oder einem anderen wichtigen Utensil zurückkam, das auch noch Platz in dem vollgestopften VW Passat finden sollte und auch fand.
Wie viele Schweißtropfen mögen diese Situationen gekostet haben?
Warten, warten, warten.
Warten ist ätzend, zerstörerisch, destruktiv.
„Warte, warte nur ein Weilchen, dann kommt Hamann mit dem….“
Aber:
Warten ist für Paul, nicht nur wegen seiner Erfahrungen aus der Kindheit, sondern auch deshalb so unangenehm, weil Zeit für ihn ein so kostbares Gut ist.
„Denkt an das fünfte Gebot, schlagt eure Zeit nicht tot.“
So oder so ähnlich hat der von ihm so sehr geschätzte Erich Kästner wohl einmal formuliert, und damit für ihn den Nagel auf den Kopf getroffen.
Es ist bereits fünf nach sechs, und noch hat kein Flüchtling den Raum der evangelischen Kirche betreten.
Paul wird langsam ungeduldig.
Warten bedeutet für ihn, zur Untätigkeit verurteilt zu sein, denn in der Zeit des Wartens ist er wie gelähmt und nicht in der Lage, etwas Sinnvolles zu tun, weil er immer mit dem Gedanken beschäftigt ist, dass es sich ohnehin nicht lohne, weil der Verursacher des Wartens, der Zu – Spät – Kommende, sicherlich gleich kommen werde.
Paul selbst ist immer sehr bemüht, pünktlich zu sein, weil er niemanden warten lassen will.
Deshalb kommt er fast nie zu spät. Aber einen Haken hat das Ganze:
Er kommt oft zu früh.
- Nicht in dem Sinne, wie manch Leser oder Leserin möglicherweise jetzt denkt.
Nein, er kommt oft zu früh zu Menschen, die er gut kennt. Er klingelt dann schon mal zehn oder fünfzehn Minuten vor dem verabredeten Termin, davon ausgehend, dass das ja nichts ausmache, sich aber gelegentlich verschätzend, denn manchmal sind auch gute Freunde oder Bekannte nicht unbedingt erbaut von seiner zu frühen Pünktlichkeit.
Paul sieht auf der an der Wand hängenden, hässlichen Uhr, dass es inzwischen 18:12 Uhr ist, als die ersten Flüchtlinge nach und nach schüchtern den Raum betreten und sich an den ihnen von Frau Jablonski freundlich mit Handzeichen zugewiesenen Tisch setzen, an dem bereits jeweils ein ehrenamtlicher Helfer wartet und sie begrüßt.
Auf diese Weise entstehen sechs erste, der Größe nach in etwa gleich große Lerngruppen.
Nach kurzer Begrüßung und einigen allgemeinen Informationen in deutscher, arabischer und persischer Sprache durch Frau Jablonski und zwei Dolmetscherinnen über wichtige Termine und sonstige Modalitäten beginnt die erste Deutschstunde.
An den Tisch von Paul haben sich nach und nach sieben Menschen gesetzt, die er zuvor noch nie in seinem Leben gesehen hat, und über die er in den folgenden zwei Stunden einiges, wenn auch scheinbar nicht viel, erfährt:
ihre Namen, das Land, aus dem sie kommen, ihr Alter sowie die Tatsache, dass Flüchtlinge aus Afghanistan häufig Persisch oder Dari und Flüchtlinge aus dem Irak und Syrien arabisch sprechen, womit auch schon die Länder genannt sind, aus denen die meisten Flüchtlinge gekommen sind, die im Gemeindehaus der evangelischen Kirche in Oberursel Deutsch lernen wollen.
Beim Verlassen des Gemeindehauses nach der ersten Deutschstunde erfährt er noch von einem jungen syrischen Flüchtling, der schon erstaunlich gut Deutsch und sehr gut Englisch spricht, dass er Ende 2014 nach Deutschland gekommen sei, dass er Angela Merkel und den Deutschen sehr dankbar dafür sei, dass er so herzlich in Deutschland aufgenommen worden sei und sich schon sehr darauf freue, demnächst sicherlich seine noch in Syrien lebende Frau wiedersehen und sie und seinen kleinen Sohn in den Arm nehmen zu können.
Das alles scheint nicht viel zu sein, aber dennoch:
Ein erster Anfang ist gemacht.
Und es ist ein guter Anfang, wie sich später herausstellt, denn es ist vermutlich schon bei der ersten Begegnung in den sechs Lerngruppen gelungen, Ansätze von Neugier und Lust auf Lernen zu wecken und diese später aufrechtzuerhalten, was sich daran festmachen lässt, dass viele Flüchtlinge in den nächsten Monaten ziemlich regelmäßig wiederkommen.
Paul führt das später, wenn er sich an die Anfangsphase des freiwilligen Deutschunterrichts für Flüchtlinge durch Ehrenamtliche erinnert, auch auf die ausgelassene und heitere Stimmung in dem Übungsraum mit den fünf, manchmal sechs oder sieben Tischen, je nachdem wie viele ehrenamtliche Lehrkräfte da waren, zurück, und auch darauf, dass an den Tischen jeweils ein zwar nicht ausgebildeter, aber, was viel wichtiger ist, ein zum Glück nicht eingebildeter Ehrenamtlicher saß, und auch darauf, dass bei der anfänglichen Verständigung mit Handzeichen und Pantomime viel gelacht wurde.
Dennoch waren die ersten Wochen mitunter auch sehr chaotisch, was nicht verwunderlich ist.
Wenn nämlich viele Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammenkommen, um eine ihnen fremde Sprache zu lernen und auf ehrenamtliche „Lehrer“ treffen, die noch nie „ Deutsch als Fremdsprache“ unterrichtet haben, dann ist das Chaos wahrscheinlich unvermeidlich.
Ständig wechselnde Lerngruppen, unter anderem dadurch bedingt, dass manchmal bis zu sieben neue Flüchtlinge zum Deutschkurs hinzukamen und versorgt werden mussten und mitunter nicht genügend ehrenamtliche Lehrkräfte zur Verfügung standen, führten nicht selten zu dem Gefühl, auf der Stelle zu treten und immer wieder von vorne anfangen zu müssen, weil man nie wusste, was man voraussetzen konnte, wenn man beispielsweise einen Flüchtling das letzte Mal vor sechs Wochen gesehen hatte. Nicht etwa deshalb, weil dieser unregelmäßig kam, sondern weil er mal von dem einen und mal von dem anderen ehrenamtlichen „Lehrer“ betreut wurde.
So stellte sich sehr bald heraus, dass es sinnvoll ist, wenn die Lerngruppen nicht nach dem Zufallsprinzip sondern nach bestimmten Kriterien zusammengesetzt sind:
Einzelunterricht für Flüchtlinge, die auch in ihrer Heimatsprache weder lesen noch schreiben können, und getrennter Gruppenunterricht (Gruppengröße zwischen drei und maximal fünf Personen) für arabisch und für persisch sprechende Flüchtlinge.
Auch zeigte sich sehr bald, dass es von Vorteil ist, wenn die Gruppen nicht manchmal durch den einen und manchmal durch den anderen ehrenamtlichen Helfer betreut werden, so dass das ursprünglich beinahe zwangsläufig aus dem Nichts entstandene Rotationsmodell nach und nach fast automatisch, also ohne aufwändige zeitraubende Teambesprechungen, durch ein Kontinuitätsmodell mit festen Lerngruppen und Lehrpersonen ersetzt wurde.
Diese, vermutlich von allen ehrenamtlichen Helfern als wünschenswert angesehene Veränderung, gelang relativ problem – und komplikationslos und wurde insbesondere durch zwei Umstände begünstigt:
einerseits wurde schon einige Monate nach Beginn des Deutschangebotes für die Flüchtlinge der Kreis der ehrenamtlichen Lehrkräfte größer, andererseits nahm die Anzahl neu ankommender Flüchtlinge von Monat zu Monat ab.
6
Fast zwei Monate, sind vergangen, seit Paul und Maria begonnen haben, zweimal wöchentlich in den ihnen langsam schon sehr vertrauten Räumlichkeiten des Gemeindehauses der evangelischen Kirche den Flüchtlingen beim Erlernen der deutschen Sprache zu helfen. Die Umstellung auf das Kontinuitätsmodell ist erfolgt, und sie betreuen nunmehr ausschließlich Flüchtlinge aus Afghanistan, die in etwa das gleiche Sprachniveau haben und deren Muttersprache „Dari“ ist und nicht das ebenfalls in Afghanistan als Amtssprache zugelassen „Paschto“.
Sehr bald stellt sich für Paul und Maria die Frage, ob es nicht sinnvoll ist, die bisherige Zettelwirtschaft, nämlich das Arbeiten mit hektisch vor Kursbeginn oder während des Kurses jeweils kopierten Übungsblättern - wenn sich beispielsweise zu Beginn herausstellte, dass drei der fünf Flüchtlinge die Wochentage nicht kannten, weil sie Neuangekommene waren, dann ging man schnell in den Kopierraum und kopierte ein entsprechendes Übungsblatt –, durch die Anschaffung eines geeigneten Arbeitsbuches zu ersetzen.
Aber die Suche erweist sich als sehr schwierig.
Paul hat sich in einer Buchhandlung in Frankfurt, die etwa fünfundzwanzig Kilometer von Oberursel entfernt liegt, fünf verschiedene Arbeitshefte besorgt, um sich einen Überblick zu verschaffen, welches Arbeitsbuch er für die Flüchtlinge, mit denen er in Zukunft kontinuierlich arbeiten wird, anschaffen will.
Bei dem ersten Arbeitsbuch welches er durchblättert, wundert er sich darüber, was sich die Autoren wohl dabei gedacht haben, wenn schon in einer der ersten Lektionen das „Fahren mit dem Taxi“ oder „Wohnen im Hotel“ abgehandelt wird und Worte wie „Fünf- Sterne- Hotel“ auftauchen.