
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Alan ist passionierter Gamer. Sein Talent im Computerspielen hat ihm den Job seiner Träume eingebracht: Auf einer Militärbasis an einem geheimen Ort wird er als Drohnenpilot ausgebildet. Lex lebt im Streifen – im übervölkerten, von Bomben zerstörten und abgeriegelten Außenbezirk Londons. An die wachsamen, feindlichen Drohnen, die in der Luft über ihm sirren, hat Lex sich längst gewöhnt ... Diese beiden jungen Männer werden sich nie treffen, doch ihre Leben werden sich auf dramatische Weise kreuzen: Weil Alan gerade ein hochrangiges Ziel zum Abschuss zugewiesen wurde. Für Alan ist es #K622. Doch für Lex ist es sein Vater ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 304
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
William Sutcliffe
Wir sehen alles
Roman
Aus dem Englischen von Uwe-Michael Gutzschhahn
Über dieses Buch
Der 16-jährige Lex lebt im überfüllten, zerbombten Teil von London, in dem es nur ein paar Stunden pro Tag Strom gibt, wenig Arbeit, wenig Hoffnung. Die Stadt ist von einer Sperrzone umgeben, und die Bewohner dürfen diesen «STRIP» nicht verlassen. Überwacht werden sie von Drohnen, die ständig über der Stadt kreisen und alles und jeden beobachten – zum Beispiel Lex’ Vater und dessen Freunde, die in einer Untergrundorganisation aktiv sind. Bald schon wird auch Lex in ihrem Visier sein, der sich der Untergrundorganisation anschließt. Und auch Zoe, Lex’ Freundin, der einzige Lichtblick in diesen gefährlichen Zeiten, die mit ihrer Familie im Keller der British Library lebt.
Auf der Seite der gnadenlosen Beobachter steht Alan, ein begabter Computerspieler – ein Talent, das ihm zum Traumjob verholfen hat: In einer Militärbasis an einem geheimen Ort arbeitet er jetzt als Drohnenpilot, auch wenn seine Mutter ihn dafür hasst. Seine Aufgabe: mögliche Verräter zu beobachten und auf Befehl zu eliminieren.
Lex und Adam sollen sich niemals begegnen, doch ihre Schicksale kreuzen sich. Denn Alan wird ein wichtiges Ziel zum Abschuss zugeteilt. Er kennt es nur unter der Bezeichnung #K622. Doch Lex nennt ihn Dad.
Vita
William Sutcliffe, geboren 1972 in London, ist Autor zahlreicher Romane. Sein vielbeachteter Jugendroman «Auf der richtigen Seite» war für den Deutschen Jugendliteraturpreis und den Katholischen Kinder- und Jugendbuchpreis nominiert. William Sutcliffe lebt mit seiner Familie in Edinburgh.
Für Maggie
Wie soll man dabei schlafen? Wie soll man überhaupt nur an Schlaf denken? Der Schlafmangel lässt dich irgendwann durchdrehen, die Leuchtgeschosse am Himmel, die Explosionssymphonie, das Getöse der Mörser, das Sirren der Drohnen … Dieses Chaos wird dich besiegen, wenn du es zulässt.
Atef Abu Saif: «Frühstück mit der Drohne.
Tagebuch aus Gaza» (2015)
Die Stadt
Ich weiß nicht, ob ich das schaffen werde.
An die Mauer gedrückt, die von Granatsplittern durchsiebt ist, starre ich über die Fläche aus zusammengestürzten Backsteinen, aufgebrochenem Teer, zerstörtem Beton und verbogenem Stahl auf die Brombeersträucher, die ich gestern entdeckt habe, gleich hinter dem Anfang der Sperrzone.
Ich könnte in wenigen Sekunden dort sein. An jedem anderen Ort wär das ganz einfach. Aber an jedem anderen Ort wären die Brombeeren auch längst weg.
Eine Frau mit grauen Haarsträhnen, die trotz der warmen Septembersonne einen dicken Wintermantel trägt, tritt hinter mir aus dem Wohnblock. Sie beäugt mich misstrauisch, bevor sie davonschlurft.
Man sieht in dieser Gegend am äußeren Stadtrand von London nicht viele Leute auf den Straßen. Gerade deshalb komm ich hierher, schaue hinaus auf die Sperrzone und fühle mich für eine kurze Zeit allein, weit weg von dem Lärm und den Menschenmassen im Zentrum. Es ist ein gespenstischer Ort, doch nirgendwo sonst kann man einen Windhauch spüren oder etwas sehen, was weiter entfernt ist als die andere Straßenseite.
Die ganze Nacht habe ich überlegt, ob ich es wagen soll, diesen verödeten Todesstreifen zwischen mir und dem Zaun zu betreten, und selbst jetzt, nachdem ich mit Tüten zurückgekehrt bin, um die Beeren zu sammeln, kann ich mich immer noch nicht entscheiden.
Ist es wirklich wahrscheinlich, dass jemand die ganze Zeit diesen verlassenen Streifen bewacht und so aufmerksam ist, dass er einen Jugendlichen bemerkt, der für ein paar Sekunden aus der Deckung hervorkommt? Und wenn er mich sieht, würde er dann tatsächlich schießen?
Ich schaue über die Brache hinweg zum nächsten Wachturm und versuche, die Entfernung abzuschätzen, sie nach der kleinsten Bewegung oder dem kurzen Aufblitzen eines reflektierten Sonnenstrahls zu scannen, doch der Beton und das getönte Glas geben nichts preis.
Als mein Blick wieder zu den Brombeersträuchern zurückkehrt und an den dunklen, reifen Beeren hängenbleibt, läuft mir plötzlich das Wasser im Mund zusammen, und sämtliche schrecklichen Warnungen vor dem Betreten der Sperrzone, die ich gehört habe, lösen sich in meinem Kopf in nichts auf. Nach einer ganzen Nacht ängstlichen Hin-und-her-Überlegens scheint es, als würden jetzt meine Beine statt mein Kopf die endgültige Entscheidung treffen.
Ich ducke mich, sprinte los, wie eine Kakerlake, auf die Mulden und Hügel aus Schutt zu, und stoße bei jedem geduckten Schritt mit den Knien fast gegen mein Kinn. Obwohl ich schnell laufe, scheint sich die Distanz zu dem Gebüsch zu vergrößern. Ich halte die Luft an, fühle mich wie auf dem Präsentierteller und erwarte jeden Moment den Einschlag einer Kugel, die ich wahrscheinlich erst hören werde, wenn sie schon in mein Fleisch eingedrungen ist.
Während ich wie ein Gejagter weiter über die verwinkelte, staubige Fläche renne, hallt eine geisterhafte Stimme durch meinen Schädel: Wieso tust du das? Warum bist du so dämlich? Seit wann riskierst du dein Leben für so etwas Lächerliches?
Ich werfe mich im Schutz der Sträucher zu Boden, reiße mir das Knie an einer vorstehenden Betonkante auf, spüre aber nur den dumpfen Widerhall eines Schmerzes, selbst als Blut durch die Jeans tropft. Ich kann es kaum fassen, dass ich es bis hier geschafft habe, in diesen niedergewalzten Streifen Land, der das umgibt, was von London übrig ist.
Ich liege still unter dem stachligen Laub, bis sich das übelkeiterregende Rasen meines Herzens beruhigt und meine Gedanken sich nicht mehr wild drehen. Schließlich hebe ich vorsichtig meinen Oberkörper vom Boden und schaue mich um. Ich kenne niemanden, der es je gewagt hat, einen Fuß auf dieses verbotene Gelände zu setzen, doch ich fühle mich seltsam losgelöst von der Realität des Ortes, an dem ich mich befinde. Als ob der Junge, der hier draußen versteckt unter dem Brombeergesträuch hockt, geschützt vor dem Grenzzaun, unmöglich ich sein kann. Auch wenn ich weiß, dass ich erschossen werden könnte, umgibt mich ein vages Gefühl von Immunität, beinahe Unsterblichkeit. Dieses Gefühl von anwesend und zugleich abwesend sein erinnert mich an das Sichverlieren in einem Videospiel.
In dieser Stadt scheint der Tod permanent über allem zu schweben wie ein armseliger Tyrann, der ständig Aufmerksamkeit verlangt. Doch wegen seiner grausamen Unvorhersehbarkeit ist es manchmal, als hätte er einen vergessen.
Ich weiß nicht mehr, wann ich das letzte Mal nicht dem klaustrophobischen Druck der Stadt ausgesetzt war. Die Leere, die sich um einen herum ausbreitet, sanfte Erd- und Schuttwälle in alle Richtungen, all das kommt einem beinahe bizarr und köstlich vor. Und das Beste von allem ist diese Stille.
Oder Fast-Stille. Ich höre nur meinen eigenen Atem, ein fernes Verkehrsrauschen und das gewohnte immerwährende Sirren aus dem Himmel.
Jeder Atemzug fühlt sich an wie ein kleines, schwereloses Paket voll Zeit, das man erst festhält und dann freigibt. Es ist ein so wunderbares Gefühl, dass ich am liebsten den ganzen Nachmittag hierbleiben würde, fern von dem Lärm, den Menschenmassen, dem Stress, den beengt hausenden und kämpfenden Millionen.
Ich weiß, ich sollte mich lieber aufrichten, die Beeren pflücken und dann schnell wieder von hier verschwinden, doch der Kitzel, ganz für mich allein zu sein, still und unentdeckt, durchdringt meinen Körper. Ich rolle mich auf den Rücken und schaue hoch. Anstatt mich weiter durch den Tag zu schlagen, könnte ich einfach nur hier liegen und die Stunden über mich hinwegstreichen lassen.
Es ist lange her, dass ich so viel Himmel gesehen habe. Nur auf den größten Trümmergeländen oder hier draußen kann man etwas sehen, das einem Horizont ähnelt, oder spüren, dass der Himmel mehr ist als bloß schmale Luftkorridore, die über den Straßen hängen.
Die Wolken stehen heute ganz hoch am Himmel, ferne blasse Streifen, vor denen man die Drohnen leichter erkennen kann als sonst, diese riesigen Heuschrecken mit ihren digitalen Insektenaugen, die Tag und Nacht über London kreisen und alles registrieren, was wir tun.
Die nächste lauert direkt über mir, ändert dann plötzlich ihre Neigung und verschwindet zurück Richtung Stadt.
Die Sonne prickelt köstlich auf meinem Gesicht. Langsam bilden sich Schweißtropfen auf Stirn und Oberlippe. Ich kämpfe gegen den Impuls an, sie fortzuwischen, und stelle mir vor, wie sie verdunsten und davonschweben: Ein winziger Teil von mir inszeniert eine unsichtbare Flucht aus dieser Gefängnisstadt.
An der Unterseite eines Blattes entdecke ich einen Marienkäfer. Ich habe schon seit Jahren keinen mehr gesehen, strecke den Zeigefinger aus und verleite den Marienkäfer dazu, auf meinen Handrücken zu steigen. Er krabbelt in Richtung Handgelenk, und seine Füße kitzeln so leicht auf der Haut, dass ich nicht weiß, ob ich sie wirklich spüre.
Ich drücke meinen Ärmel eng zusammen, damit er nicht meinen Arm hochkrabbeln kann, und der Marienkäfer stößt ein paarmal gegen das Hindernis, dann kehrt er um und läuft an meinem Daumen hoch. An der Spitze angekommen, weiß er nicht weiter, bewegt seine Antennen und scheint zu überlegen.
Genau so wirke ich wahrscheinlich auf den, der da oben in der Drohne sitzt. Obwohl in einer Drohne natürlich niemand sitzt. Jemand hockt irgendwo und beobachtet, aber ganz sicher nicht am Himmel über mir.
Inzwischen sind meine Glieder schwer geworden, sie genießen zu sehr den Moment der Faulheit, doch ich muss endlich schnell das Brombeerenpflücken erledigen und dann verschwinden. Ich drücke mich in die Hocke, ziehe zwei Plastikbeutel aus der Tasche, stülpe sie zu einer Korbform und stelle sie auf den Boden. Die ersten Beeren wandern direkt in meinen Mund, und ich spüre, wie mir die Tränen kommen; von der süßen Strenge, die sich auf meine Zunge legt, aber auch von einer Woge heißer, wirrer Empfindung. In all dem Chaos – den Bomben, dem Tod, der Trauer, dem Unfrieden – fühlt sich der simple Vorgang, eine Beere zu finden und sie zu essen, an wie ein Wunder. Und dass so etwas Kleines so wunderbar erscheinen kann, erzeugt ein Gefühl von unsäglicher Trauer.
Aber ich kann meine Zeit nicht mit Selbstmitleid vergeuden und darf auch nicht zu viele Beeren essen. Sie sind schließlich nicht für mich. Ich bekomme für sie einen guten Preis, und das Geld brauch ich.
Ich ernte einen Zweig nach dem andern ab, schiebe meine Hände zwischen den dornigen Stengeln hindurch, um sie leerzupflücken. Meine Hände sind bald zerkratzt und voller dunkelroter Flecken. Wie viel davon Saft ist und wie viel Blut, weiß ich nicht, aber das interessiert mich auch kaum, während ich pflücke und pflücke und die Tüten immer weiter mit den festen schwarzen Früchten fülle.
Keine Ahnung, wie lange ich brauche. Alles, was hinter dem Strauch liegt, scheint zu verschwinden, während ich arbeite, bis ich auf einmal jemanden meinen Namen rufen höre – mit panischem Ton.
«LEX! LEX! Was tust du da? Verdammt noch mal, was tust du da?»
Ich schaue hoch. An der Ecke, da, wo ich noch vor kurzem selber gestanden habe, steht mein Vater. Sein Gesicht ist rot vor Wut, sein Arm stößt in den leeren Raum zwischen uns.
Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Der Anblick der Panik und Wut in seinem Gesicht reißt mich aus meinen Gedanken, lähmt mich durch dieses plötzliche Bewusstsein, dass ich keine Erklärung habe, wieso ich hier in der militärischen Sperrzone Beeren pflücke.
«LEX! LEX!»
Er klingt, als würde ich von der zurückweichenden Flut ins Meer gezogen werden und ertrinken, und er ruft, um zu sehen, ob ich noch zu retten bin.
«Ich … ich komme», sage ich.
«Nein! Nicht! Sie werden schießen!»
«Bleib da. Ich komme», wiederhole ich.
«NEIN! RÜHR DICH NICHT VOM FLECK!», schreit er zurück.
Er springt los und läuft tief geduckt über den unebenen Boden zu mir herüber.
In Sekundenschnelle hat er mich erreicht. Noch immer geduckt, packt er mich an den Schultern und reißt mich zu Boden.
«WAS MACHST DU?», brüllt er. «WIE KONNTEST DU BLOSS SO DUMM SEIN?»
Er hebt den Arm, und auch wenn es nur einen Grund für diese Bewegung geben kann, glaube ich noch immer nicht, dass er mich tatsächlich schlagen wird, denn das hat er noch nie getan. Deshalb zucke ich zusammen, als er mir mit der offenen Hand ins Gesicht schlägt, sodass mein Kopf zur Seite fliegt und ich ein loderndes Brennen auf der Wange spüre.
Ich kippe aus der Hocke und falle hin. Er zieht mich hoch, reißt mich in der Deckung der Sträucher an sich und drückt mich so fest an seine Brust, dass sich die Knöpfe seiner Jacke schmerzhaft in meine Rippen graben. «Wieso hast du das gemacht? Willst du, dass sie dich umbringen?», fragt er.
Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe keine Erklärung außer der nutzlosen, unbeschreiblichen Vorstellung, dass man manchmal etwas tun muss – irgendwas –, um sich zu befreien.
Schließlich schweigt er und lockert seinen Griff, lässt mich aber noch immer nicht los. Er drückt meine Schultern und wendet das Gesicht zur Seite, als wollte er mich festhalten und sich gleichzeitig vor mir verbergen.
«Wieso?», fragt er wieder.
Ich zucke mit den Schultern. Tränen kämpfen sich mit einem wachsenden Stechen in meiner Kehle ihren Weg nach oben. Ich fühle mich plötzlich hoffnungslos verloren, überfordert von der Hilflosigkeit, die sich für einen Moment in dem unendlich müden Ausdruck auf dem Gesicht meines Vaters zu spiegeln scheint. In diesem Meer aus Trümmern sind wir zwei verzweifelte Schiffbrüchige.
«Woher wusstest du, dass ich hier bin?», frage ich schließlich statt einer Antwort.
Mit dünner, krächzender Stimme sagt er: «Ein Freund», und zeigt vage zu den Wohnblöcken an der Stadtgrenze. «Er hat dich gesehen. Er hat mich angerufen. Er hat sich Sorgen gemacht.»
«Alles in Ordnung. Ich bin in Sicherheit.»
Ein neuer Anflug von Wut blitzt in seinem Gesicht auf.
«Sei nicht so dumm. Du bist doch wesentlich klüger. Beleidige mich nicht mit dem Versuch, mir zu erklären, dass es hier sicher ist. Und jetzt lass uns von hier verschwinden. Wir reden zu Hause weiter.»
Zaghaft späht er durch das Laub in Richtung des Grenzzauns. Über uns entdecke ich wieder eine Drohne, diesmal tiefer, und sie fliegt einen engeren Kreis als beim letzten Mal. Das Sirren ist lauter, höher, insektenhaft.
Dad packt meinen Arm und rennt los. Ich habe gerade noch Zeit, nach einer Tüte zu greifen, erwische sie aber nur an einem Henkel und halte sie fest, während wir bereits laufen, um Schutz zu suchen.
Wieder mache ich mich auf Schüsse vom Grenzzaun bereit, doch es kommt kein Laut, kein Angriff.
Selbst als wir der Pufferzone entkommen sind, wird Dad nicht langsamer. Wir eilen an dem äußersten Wohnblock der Stadt vorbei, jagen um eine Ecke und rennen weiter die Camden Road hoch, an einer Reihe gleich aussehender Backsteinhäuser entlang, von denen die meisten stehen geblieben sind. Nur einen Block weiter ist der klaustrophobische Druck der Stadt wieder da. Die beißenden Abgase des Verkehrs erfüllen die Straßen, endlose Schlangen verrosteter und heruntergekommener Autos kämpfen gegen Fahrräder, Motorroller, Motorräder und Händler mit ihren Handkarren um jeden Zentimeter Asphalt, doch selbst als wir uns im Menschenstrom verlieren, zieht Dad mich immer noch im Laufschritt weiter.
Eine Gruppe von Schülern steht vor dem City-and-Islington-College, ihre Bücher und Schreibblöcke fest unter den Arm geklemmt, und raufen oder flirten unter der grauen, flappenden Abdeckplane vor der Fassade. Dad zerrt mich über die Straße auf ein Tor zu, durch das wir hinter dem Gebäude in eine dunkle Gasse mit grauen Steinmauern und zugenagelten Fenstern gelangen. Neben einem übervollen Müllcontainer, an einem Ort bedrückender Stille, entlässt er mich endlich aus seinem Griff.
Ich brauche eine Weile, um mich an die schmutzige, nach Fäulnis stinkende Luft zu gewöhnen. Während ich seinem schnellen, keuchenden Atem lausche, offenbart sich langsam sein Gesicht: kalt, erschöpft und wütend.
Er nimmt die schwarze Drahtgestellbrille ab, die sonst wie ein fester Bestandteil seines Gesichts scheint, und fährt sich über den Nasenrücken. Die Haut unter den Augen ist geschwollen und von winzigen Pockennarben gesprenkelt. Einen Moment lang wirkt er zerbrechlich und hilflos, doch als er die Brille wieder aufsetzt und mich mit einem eiskalten Blick anstarrt, durchläuft mich ein Angstschauer. Ich weiche einen Schritt zurück. Vor dem heutigen Tag hat er mich nicht ein einziges Mal geschlagen, noch habe ich ihn jemals den Tränen so nahe erlebt. Es ist fast, als würde durch seine vertrauten Züge ein ganz anderer Mann hervordringen, der nicht mein Vater ist. Er hat sonst immer, unabhängig von allem andern, so vorhersehbar gewirkt. So konstant. Doch in diesem Moment habe ich keine Ahnung, was er als Nächstes tun wird.
«Tut mir leid, dass ich dich geschlagen habe», sagt er nach langem Schweigen.
Ich nicke, hebe die Hand an die Wange, die sich unter den Fingerspitzen immer noch heiß anfühlt.
«Aber du hast es verdient», fügt er hinzu.
Ich zucke mit den Schultern.
«Wieso bist du da hingegangen?»
Ich zucke mit den Schultern.
«Sag’s mir. Denkst du, du bist was Besonderes? So eine Art Superheld, an dessen Haut sämtliche Kugeln abprallen?»
Ich schaue nach unten, mein Blick fällt auf ein Stück Himmel, das sich in einer öligen Pfütze spiegelt.
«Weißt du, wie lange es dauert, erschossen zu werden? Den Bruchteil einer Sekunde. Glaubst du, die interessiert, wer du bist? Glaubst du, die schießen nur auf Erwachsene?»
Ich schüttle den Kopf.
«Wie konntest du nur so dumm sein?», faucht er.
Eine Welle unterdrückter Wut jagt durch meinen Körper. Plötzlich habe ich das Gefühl, als ob alles seine Schuld ist, als ob dieses eingesperrte, eingeschränkte, verängstigte Leben eine Erfindung meines Vaters sei, um mich zu quälen. Am liebsten würde ich ihn dafür würgen. Als ob ich ihm, wenn ich meine Hände um seinen Hals lege und zudrücke, zeigen könnte, was es heißt, ich zu sein.
Doch ich sage nichts.
Er tritt einen Schritt vor, schließt den Abstand zwischen uns und spricht mit einer langsamen, drohenden Stimme, die klingt, als müsste er sie aus der unendlichen Tiefe seines Körpers nach oben ziehen. «Ich verstehe, dass du ein eigenständiger Mensch sein musst. Ich weiß, wie das mit sechzehn ist. Du wirst nicht mehr alles tun, was man dir sagt. Aber in diesem Punkt wirst du dich mir nicht widersetzen. Du gehst dort nie wieder hin. Wenn du stirbst, bist nicht nur du es, der stirbt. Du würdest deine ganze Familie töten. Hast du verstanden?»
Ich nicke, aber ich habe noch nicht die Tüte mit Brombeeren aufgegeben, die ich zurücklassen musste.
«Wenn du egoistisch sein willst, dann bitte, aber nicht in diesem Punkt. Die Warnung ist eindeutig. Sie schießen, sobald sie dich sehen.»
Ich nicke noch einmal und drehe mich weg.
«ANTWORTE MIR!», faucht er und stößt mir gegen die Schulter.
«Was soll ich denn sagen?»
«Sag mir, dass du nie wieder dort hingehst.»
«Mach ich nicht.»
«Sag es ordentlich.» Er drückt seinen rauen Daumen gegen mein Kinn und hebt meinen Kopf an. Ich spüre, wie mich meine Augen verraten, doch ich halte seinem Blick stand.
«Mach ich nicht.»
Er lässt nicht los und versucht, in meinem Gesicht zu lesen, aber ich weiß, dass er das nicht kann.
Er schnauft entnervt, dreht sich weg und jagt mit der Schuhspitze einen Schotterregen in die Luft.
«Bring die deiner Mutter nach Hause», sagt er und zeigt auf die Tüte mit den Brombeeren. Mein Herz sinkt. Der ganze Aufwand und das Risiko – alles umsonst.
«Ich wollte sie verkaufen.»
«Nein. Das geht nicht.»
«Wieso nicht? Die bringen gutes Geld.»
«Genau. Und danach wirst du es wieder tun wollen.»
«Werd ich nicht.»
«Warum sollte ich dir glauben?»
«Weil ich’s nicht tun werde.»
«Gib sie Mum. Erzähl ihr, was du getan hast.»
«Wenn ich’s ihr sage, macht sie sich doch bloß Sorgen.»
«Du willst sie also anlügen?»
«Keine Ahnung …»
«Du willst, dass ich sie anlüge?»
«Wär vielleicht besser.»
«Bring die Brombeeren nach Hause. Sag ihr die Wahrheit. Wir unterhalten uns später.»
«Kommst du nicht mit?»
«Ich muss los. Bin schon spät dran.»
«Wofür?»
«Für ein Treffen.»
Es ist Abend, und er trägt nicht mehr seine Arbeitskleidung. Seit wann beendet ein Automechaniker seine Arbeit, um danach zu einem Treffen zu gehen?
Er geht, verschwindet aus der Gasse. Ich laufe ihm hinterher, um ihn einzuholen.
«Was für ein Treffen?»
«Nichts Besonderes. Bloß so ein Zusammensein.»
Als wir den Bürgersteig erreichen, schaut er nach oben. Ich folge seinem Blick und sehe zwei hoch oben kreisende Drohnen. Ich registriere nur kurz, wie merkwürdig es ist, gleich zwei so dicht zusammen zu sehen, doch als ich den Blick wieder senke, ist Dad schon weitergegangen, und als ich ihn einhole, hab ich die Drohnen bereits vergessen.
«Wo gehst du hin?», frage ich.
«ES IST NICHTS!», faucht er. «Vergiss es einfach. Du musst jetzt nach Hause.»
In der Nähe des weitgehend zerstörten Holloway-Gefängnisses bleibt er stehen, blickt sich um und dann wieder nach oben. Ein Mann mittleren Alters in einem schmuddeligen Anzug und mit tief ins Gesicht gezogener Baseballkappe überquert vor uns die Straße, und ich merke, wie er meinen Dad ansieht und danach schnell wegschaut. Der Blickkontakt ist nur flüchtig, doch ich spüre, dass sie etwas austauschen. Sie kennen sich und wissen, dass sie das vor mir nicht zeigen dürfen.
Dad bleibt am Bordstein stehen und beobachtet, wie der andere im nächsten Gebäude verschwindet, einem heruntergekommenen Pub, dessen Schild – das rissige Bild eines alten Schlosses – gefährlich schief herabhängt und über dem Eingang hin und her schwingt. Dann sieht er mich an, die Stirn gerunzelt, als würde er eine komplizierte Rechnung anstellen.
«Ich bringe dich ein Stück nach Hause», sagt er und marschiert schnellen Schrittes die Camden Road entlang.
«Warum die Eile?», frage ich.
«Hörst du wohl auf damit?»
«Was meinst du?»
«Mit der endlosen Fragerei! Geh einfach nach Hause.»
«Ich hab doch nur gefragt, warum so eilig.»
Er geht weiter, schneller denn je, und bleibt stets ein paar Schritte vor mir. Wir kommen an den schiefen, spinnenartigen Trümmern einer zerbombten Baustelle vorbei, das Gerüst ist verbogen und in sich zusammengesackt wie riesige Spaghetti. Wir laufen weiter. Je weiter wir uns vom Londoner Stadtrand entfernen, desto voller wird es auf dem Gehweg: Teenager schlendern in Gruppen, schmuddelige Kinder ziehen Karren aller Art hinter sich her und wühlen in Mülleimern und auf Trümmergrundstücken. Ab und zu kommen Verrückte in stinkenden Klamotten vorbei und murmeln wütend vor sich hin, und Massen von missmutigen Londonern halten zerfledderte Taschen und Tüten mit dem umklammert, was sie den Tag über an Essen zusammengesammelt haben.
An der nächsten Ecke bleibt Dad stehen, schaut erst auf die Uhr, dann auf die Straße und in den Himmel. «Geh nach Hause», sagt er. «Ich muss hier lang. Bis nachher.»
Nach einem kurzen Nicken zum Abschied läuft er in eine kleine Seitenstraße mit Stümpfen von Bäumen, die längst zu Brennholz geworden sind. Ich sehe, wie er nach oben blickt, doch nicht zu mir zurück.
Er biegt nach links ab und kehrt auf unsere Strecke zurück. In dem Moment beschließe ich, ihm zu folgen. Er verheimlicht etwas. Ich weiß nicht viel über seine Vergangenheit, doch genug, um zu ahnen, wohin er wahrscheinlich will, wen er wahrscheinlich trifft.
Ich fange an zu rennen, an einem Wohnblock vorbei, von dem die oberen Stockwerke ohne Fenster und rußgeschwärzt sind, und laufe über eine provisorische Rampe aus alten Paletten, die über einen abgestandenen Tümpel aus widerlich graubraunem Wasser gelegt sind.
Als ich um die Ecke komme, seh ich ihn wieder, immer noch im Eilschritt, zu weit weg, um mich wahrzunehmen. Ich passe mich seinem Tempo an, eine schmale, von Balkonen voller Wäsche gesäumte Straße entlang.
An der nächsten Kreuzung biegt er erneut nach links ab und vollendet den Kreis um den Wohnblock. Ich bleibe jetzt auf Distanz und verstecke mich zwischen geparkten Autos. Nach wenigen Minuten ist er wieder da, wo wir den Mann mit der Baseballkappe getroffen haben.
Er bleibt stehen, schaut erneut hoch, wirft einen Blick auf seine Uhr, dann wendet er sich um. Bevor ich mich wegducken kann, sehe ich kurz sein Gesicht. Er wirkt in sich gekehrt, konzentriert. Ich habe das Gefühl, ich könnte aus meinem Versteck treten und er würde mich nicht wahrnehmen.
In diesem Moment fällt mir ein, dass er mich vielleicht gar nicht bloß geschlagen hat, weil ich in der Pufferzone herumgestreunt bin oder weil er um meine Sicherheit besorgt war. Es muss etwas anderes mit ihm passiert sein.
Ich spähe zwischen den Autos hervor und sehe, wie er die Straße überquert und in den Eck-Pub geht, an dem wir vor ein paar Minuten vorbeigekommen sind.
Mein Vater ist kein Trinker. Ich habe ihn ab und zu mit Freunden ein Bier trinken sehen, aber er ist kein In-den-Pub-Geher. Er wird dort den Mann mit dem Anzug und der Baseballkappe treffen wollen, den wir vorhin in das gleiche Gebäude haben gehen sehen.
Es ist nur ein kurzer Augenblick, in dem ich begreife, wer der Mann sein könnte, und mir überlege, wer wohl noch an dem Treffen teilnimmt, doch das reicht, um alles zu verändern. Auch wenn es der schlimmste Schock meines Lebens ist, weiß ich sofort, was als Nächstes geschieht. Fast bin ich weniger überrascht, als ich eigentlich sein müsste. Der Lichtstreifen, der so schnell durch den Himmel schießt, dass ich nicht sicher bin, ob ich ihn wirklich gesehen habe; der weiße Blitz einen Sekundenbruchteil vor dem ohrenbetäubenden Knall, das Saugen und Zischen der Luft, ein heißer Luftzug, der über mein Gesicht fährt, das kriechende Sichausbreiten einer herannahenden Staubwolke, die mich in Schmutz hüllt, als ich mich viel zu spät zu Boden werfe.
Als ich mich wieder aufrichte, piepst es so laut in meinen Ohren, dass ich nichts anderes hören kann, nicht mal die Schreie der Leute um mich herum. Es fällt mir erst schwer, mein Gleichgewicht zu finden. Der Boden scheint zu kippen. Ich halte mich an einem parkenden Lieferwagen fest. Dann schaue ich auf meine Brust, meine Arme, Beine und Füße. Kein Blut. Es fehlt nichts. Ich bin unverletzt. Ich hebe den Kopf und starre durch die Staubwolke, die allmählich, qualvoll preisgibt, dass an der Straßenecke kein Pub mehr ist, sondern nur ein verkohlter, lodernder Trümmerhaufen.
Die Basis
Niemand dachte, dass ich es je zu was bringen würde. Die Lehrer hatten mich von Anfang an abgeschrieben, warfen mir vor, bloß rumzuhängen und mich nicht anzustrengen, und meinten, dass ich in der Schule ständig schlafen würde, weil ich die halbe Nacht am Computer spielte. Mum genauso. Ich erinnere mich an ihre endlosen Predigten, dass ich mich auf die reale Welt konzentrieren müsse, statt meine ganze Aufmerksamkeit auf Spiele zu verschwenden, und dass ich meine Zeit lieber mit «echten Menschen» verbringen solle, als wären die Online-Freunde, mit denen ich spielte, eine Ausgeburt meiner Phantasie.
Alles Dinosaurier, die in der Vergangenheit leben und immer noch glauben, dass es ein «real» und ein «virtuell» gibt und dass das eine irgendwie wirklicher ist als das andere.
Als ich es ins Landeshalbfinale schaffte, mit Tausenden von Klicks von überall in der Welt auf die YouTube-Mitschnitte meiner Games, begriff keiner von diesen Idioten, was das bedeutete. Alle meinten immer noch, dass ich bloß meine Zeit vertrödelte, während ich in bestimmten Kreisen schon fast eine Berühmtheit war.
Selbst nachdem die Leute vom Rekrutierungsteam fürs Militär gekommen waren und sich einen ganzen Haufen von uns für das Drohnen-Programm geschnappt hatten, sogar Leute, die ich schon im Viertelfinale erledigte, hielt Mum mich immer noch für einen Loser, doch ich wusste genau, was ich wollte. Ich war genauso gut wie jeder andere, den sie angeworben hatten, und mir war klar, dass ich es schaffen würde, wenn ich die Sache konzentriert genug anging.
Nach wochenlangen Tests und Ausleseverfahren, gefolgt von einem todlangweiligen, zähen Trainingsprogramm und weiteren zehn Monaten endloser Routinearbeit wie Monitoring und ergebnisloses Screen-Protokolle-Erstellen, ist er endlich gekommen: der Tag, für den sich das Ganze gelohnt hat. Meine erste Mission als qualifizierter Pilot mit eigener Workstation, wo ich eine Drohne über London steuere mit dem Ziel: Subjekt #K622.
Diese Leute sind gerissen und wissen genau, dass sie überwacht werden, also musst du nach engen Gassen mit vielen Ausgängen suchen, aber das haben wir alles im Training gelernt. Wir haben Methoden, um auf fast alles zu reagieren.
Das erste Mal, als ich den Flugraum betrat, warf es mich buchstäblich um. Milliarden waren investiert worden, um die Parameter des Möglichen zu verändern und ein Beinahewunder zu erschaffen. Das Ziel einer jeden Armee in der Vergangenheit war es, den Feind zu sehen, ohne selbst gesehen zu werden, anzugreifen, bevor sich der Gegner verteidigen oder verstecken konnte. Unsere Technik treibt dies so weit wie überhaupt möglich: Wir haben die Fast-Unsichtbarkeit für uns und die absolute Transparenz für den Gegner erreicht.
Wir sehen alles, und wir können jeden töten. Wir haben die absolute Macht, ohne einen einzigen Soldaten am Boden. Die Feinde krabbeln über unsere Bildschirme und meinen, sie haben alles im Griff. Sie verhalten sich, als wenn ihr Widerstand auch nur den kleinsten Effekt hätte, doch wir können zerquetschen, wen immer wir wollen, wann immer wir wollen.
Das machen wir natürlich nicht. Wir sind die disziplinierteste Armee der Welt. Es gibt Regeln und Protokolle. Aber wir könnten es.
Die Menschen schuften ihr ganzes Leben, hetzen sich ab, um ein Fitzelchen Macht über andere zu gewinnen, rackern für jeden kleinen Vorteil, aber seht, was aus mir geworden ist. Ich bin zwanzig Jahre alt, und so weit habe ich es schon gebracht. #K622 und ich. Wenn ich versuche, mir die Macht vorzustellen, die ich über ihn habe, wird mir ganz schwindelig. Wenn er wüsste, wer ich bin, würde er Ehrfurcht vor mir haben. Er würde alles tun, um mein Wohlwollen zu gewinnen. Er würde vor mir auf die Knie fallen und um Gnade betteln. Und wie viele Menschen können das von sich behaupten? Wie viele «Loser» können das sagen?
Mum hat ihre Haltung geändert, seit ich den Job habe. Sie tut nicht mehr so, als ob sie Mitleid mit mir hätte. Sie scheint sich keine Sorgen mehr zu machen, dass ich es zu nichts bringe und mein Leben nicht finanzieren kann. Stattdessen ist da jetzt dieses Misstrauen, diese Skepsis und eine Art resignierte Enttäuschung, als hätte ich sie im Stich gelassen.
Es hat keinen Sinn zu versuchen, ihr zu gefallen oder jemals der Sohn zu werden, den sie gewollt hat. Sobald ich genug Geld gespart habe, ziehe ich bei ihr aus. Das ist das Einzige, auf was ich mich im Moment konzentriere: genug Geld zu kassieren, um für immer wegzuziehen, weg von ihrem verurteilenden Hundeblick, mit dem sie mich im Haus verfolgt und sich dabei heimlich wünscht, dass ich nicht ich wäre.
Meine Kollegen könnten nicht unterschiedlicher sein. Großartige Leute sind das. Es herrscht echte Kameradschaft. Das meiste von dem, was wir tun, ist geheim, deshalb können wir nur hier, auf der Arbeit, wirklich wir selbst sein. Bei jedem andern außerhalb der Basis gibt es immer zu viel, was du nicht sagen darfst.
Die Piloten und Sensor-Operators sind alle Gamer, hochbegabte, scharfsinnige, gute Leute. Nur ein paar aus dem riesigen Rekrutierungsschwung haben das Training geschafft. Die handwerklichen Voraussetzungen hatten alle, doch in dem Programm waren wir wie Ratten in irgendeinem psychologischen Labyrinth, die auf jede Entscheidung, jeden kleinsten Ansatz von Emotion, jeden Moment der Schwäche und Angst überwacht und geprüft wurden. Die Kiffer hielten höchstens ein paar Tage durch.
Sie haben bloß die allerstärksten Köpfe herausgepickt – Leute, deren Hände umso ruhiger werden, je mehr der Druck steigt, Männer mit Laser-Hirnen. Wir wurden wieder und wieder getestet, und jeder von uns hat die innere Kraft zu tun, was getan werden muss, wenn es an der Zeit ist.
Als ich heute Morgen die Basis betrat, in Uniform für den ersten Tag meines Einsatzes, sah ich kurz mein Spiegelbild in einem Fenster und musste stehen bleiben. Ich konnte nicht einfach weitergehen, ohne die Realität dessen zu erfassen, was mit mir geschehen war. Es fiel mir schwer zu glauben, dass der grinsende Pilot in Uniform, der sich in der Scheibe spiegelte, tatsächlich ich war.
Und ich werde bezahlt! Ich verdiene ein gutes Gehalt damit, Teil dieses Clubs zu sein, zu dem ich immer gehören wollte, obwohl ich nie wusste, dass es ihn überhaupt gab.
Man hatte mir gesagt, dass ich selbst in der aktiven Arbeit mit einem speziellen Subjekt von einem längeren Zeitraum ausgehen müsste, in dem nichts Interessanteres passiert als Beobachten, Protokollieren und Musterfinden.
Doch so ist es nicht. Tag eins ist wirklich unglaublich.
Man bekommt nicht viele Informationen über sein Subjekt. Ich habe lediglich erfahren, dass #K622 Mechaniker ist, aber das war auch so ziemlich alles. Ich nehme an, ich werde schon noch früh genug jedes Detail seines Lebens kennenlernen, doch was man nie rauskriegt – außer dem, was man durch eigene Beobachtungen ableiten kann –, ist, warum derjenige beobachtet wird und ob es ein Endspiel ist. Mein Job besteht darin, einfach Bilder zu sammeln. Mein Stream geht an die Analysten, die ich nie zu Gesicht bekomme, und wird in Daten verwandelt, von denen ich nie etwas erfahren werde. Ich und die andern Jungs, wir sind bloß technische Dienstleister. Wir tun, was uns gesagt wird. Wir drücken Knöpfe, die wir zu drücken gelernt haben, und stellen keine Fragen.
Obwohl ich total heiß auf meinen neuen Job bin, ist das, was ich den ersten Tag über tue, so sehr Routine, dass man es fast langweilig nennen könnte. Ich beobachte, wie #K622 von zu Hause zur Arbeit geht. Er bleibt nirgends stehen oder redet mit jemandem. Und danach gibt es keine weitere Bewegung bis zum Mittag, als er einen kurzen Spaziergang macht und etwas aus einer kleinen Tüte isst. Ich kann aber noch nichts über sein Alter, sein Äußeres oder seine Persönlichkeit sagen. Den Nachmittag verbringe ich damit, auf das Dach von seiner Arbeitsstelle zu stieren.
Doch gerade als ich anfange, daran zu zweifeln, ob das hier wirklich mein Traumjob ist, kommt #K622 überraschend aus dem Gebäude und rennt los. Mein Körper spannt sich, richtet sich in dem Stuhl auf, als ich sehe, wie er über Londons überfüllte Bürgersteige nach Osten läuft und sich sein Gang allmählich in eine Art Torkeln verwandelt. Als er den Stadtrand erreicht, bleibt er stehen und starrt zu der Pufferzone hinüber, als wenn er den Ort noch nie gesehen hätte, als ob er nicht einmal wüsste, dass dort eine Grenze ist. Dann legt er seine Hände um den Mund und scheint zu rufen. Ruft wie ein Irrer in Richtung des leeren Geländes.
Obwohl ich genau weiß, was ich tun müsste, zögere ich. Ich möchte nicht am ersten Tag überreagieren oder Aufmerksamkeit auf mich ziehen, doch es gibt einen Ablaufplan für die aktuelle Situation.
Mein Mund fühlt sich trocken an, mein Finger zittert leicht, als ich ein erhöhtes Gefahrenlevel auslöse und einen Alarm-Feed an das Analysten-Team schicke.
Ich zoome mich ran und gehe auf maximale Auflösung, als er gerade etwas Ungewöhnliches tut, etwas unvorstellbar Gefährliches. Er fängt an zu rennen, direkt auf den Zaun zu. Eine Sekunde lang verliere ich ihn auf dem Bildschirm, dann zoome ich zurück und bekomme einen klaren Blick auf seinen seltsamen, stolpernden Spurt über die Trümmerfläche. Sofort drücke ich die höchste Alarmstufe. Oben links auf dem Bildschirm erscheint ein orangefarbenes Quadrat.
Die Pufferzone ist einhundert Prozent steril. Niemand setzt einen Fuß in die Pufferzone. Es gibt keine Warnungen, es werden kein Tränengas oder Gummigeschosse verwendet. Wenn du die Zone betrittst, erwartet dich Kampfmunition, der Todesschuss.
Könnte das da ein Selbstmordkommando gegen den Zaun oder einen der Wachtürme sein? Wenn ja, dann ist das neu und unklug, denn er hat keine Chance, auch nur in die Nähe eines der Ziele zu kommen.
Er hat knapp ein Drittel der Pufferzone durchquert, als er sich plötzlich in eine Erdmulde duckt, die von einem großen Gebüsch verdeckt wird. In diesem Moment sehe ich den Jungen, der sich bereits dort befindet. #K622 packt den Jungen und reißt ihn in so was wie eine Umarmung, dann schlägt er ihm ins Gesicht. Der Junge fällt hin.
Beide ducken sich, klammern sich aneinander, vielleicht im Kampf – schwer zu sagen –, doch ohne große Bewegung. Es scheint, als ob sie versuchen, nicht in die Blickachsen des Zauns zu geraten, was zwecklos ist, da dieser Feed direkt an den nächsten Wachturm geht.
Sie sind so dicht zusammen, dass sie zu einer Silhouette verschwimmen. Ich kann nicht erkennen, was sie tun. Eine Weile rührt sich nichts weiter. Das orangefarbene Quadrat in der Ecke meines Bildschirms wird genau in dem Moment rot, als sich die beiden wieder in zwei getrennte Gestalten zurückverwandeln und aus der Pufferzone herausjagen. Der Mann scheint den Jungen hinter sich herzuziehen. Der Junge hat ein weißes Bündel bei sich.
Ich signalisiere die nach dem Rückzug aus der Pufferzone verringerte Bedrohungslage, doch das Icon links oben auf dem Bildschirm bleibt rot.
Mein Herz schlägt jetzt ganz schnell. Im Training habe ich so ein Ereignis nie gehabt. Was auch immer sie dir an Situationen zumuten, selbst bei der schrecklichsten Übung weißt du, es ist nicht real. Aber das hier ist real. Ich beobachte zwei Leute, die um ihr Leben rennen, und weiß, dass sie nur noch Sekunden von ihrem Tod entfernt sind, einem Tod, der sich in Echtzeit auf meinem Bildschirm abspielen wird, direkt vor meinen Augen.
Ich zoome dicht an das weiße Bündel heran. Es lässt sich nicht identifizieren, doch ich markiere es.

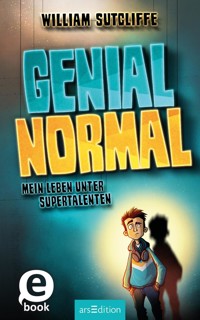

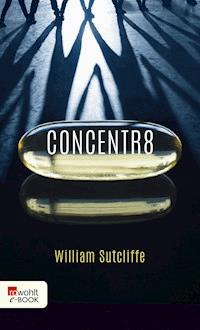













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)











