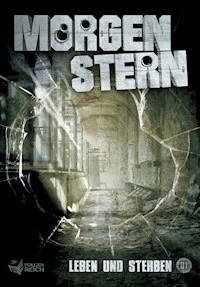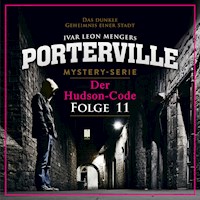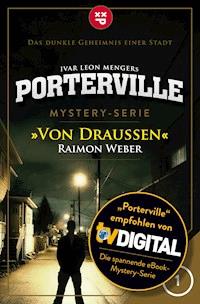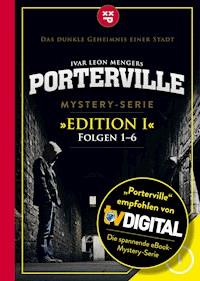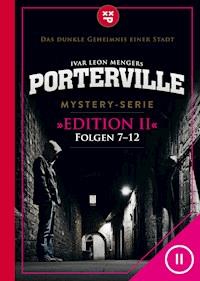Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Psychothriller GmbH E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Eine westfälische Kleinstadt im Spätsommer 1975: Ein verlassener Bauernhof, der Inhalt eines vergessenen Kühlschranks und der verbotene Keller. Fünf Jungen erleben einen Albtraum aus Gewalt und Erpressung, in dem Lüge und Wahrheit miteinander verschmelzen. Sie wollen dem Schwächsten ihrer Clique helfen und schmieden einen riskanten Plan. Er beginnt wie ein schlecht durchdachter Jugendstreich und endet mit der ersten Leiche. 20 Jahre später holt sie die Vergangenheit ein. Ein Roman über mysteriöse Todesfälle, langjährige Freundschaften und den Glauben an die Unsterblichkeit ... "Webers besonderes Talent besteht darin, den Leser in die Ängste, die Panik seiner Personen eintauchen zu lassen. Hier agieren keine eiskalten Killer, sondern normale Menschen, die, überfordert von der Situation, von einem Desaster ins nächste tappen. Man spürt die Glaubwürdigkeit der Akteure und leidet mit ihnen, wenn ihnen der Boden unter den Füßen weggezogen wird." WAZ
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 198
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wir waren unsterblich
Raimon Weber
1. Auflage 2012
ISBN 978-3-942261-21-0
Psychothriller GmbH
www.psychothriller.de
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der mechanischen, elektronischen oder fotografischen Vervielfältigung, der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, des Nachdrucks in Zeitschriften oder Zeitungen, des öffentlichen Vortrags, der Verfilmung, der Vertonung als Hörbuch oder -spiel, oder der Dramatisierung, der Übertragung durch Rundfunk, Fernsehen, Video oder Internet, auch einzelner Text- und Bildteile, sowie der Übersetzung in andere Sprachen.
Für Meikel
„Habe da einiges nicht erfreulich finden können.“
Herbst 1975
Niemand gab uns die Schuld. Jungen in dem Alter suchen das Abenteuer, hieß es. Und halten sich natürlich an verbotenen Orten auf. Dem Bauern hingegen machte man schwere Vorwürfe. Er hätte uns niemals so erschrecken dürfen. Es kam zwar zu keiner Gerichtsverhandlung, aber nach einiger Zeit verkaufte er seinen Hof und zog fort.
Ausgerechnet durch Töffels Tod geschah genau das, was ich mir am meisten gewünscht hatte: Hilko, Markus, Leo und ich gingen nie mehr nach Hausfriedensbruch. Wir versuchten einfach, den Lichtlosen und die ganze Geschichte zu vergessen.
Winter 1995
Die Friedhofskapelle war fast leer. Gerade mal ein Dutzend Leute war gekommen, um von Hilko Abschied zu nehmen. In der ersten Reihe saßen sein Bruder und seine Mutter. Der Rest der Trauernden bestand aus mir unbekannten Verwandten und Markus. Der Pfarrer hielt eine Rede und tat so, als habe er Hilko gekannt. Dabei war ich mir sicher, dass unser Freund niemals freiwillig einen Gottesdienst besucht hätte.
Als sie den Sarg ins Grab senkten, fing es an zu schneien. Niemand weinte. Alles schien in einer gewissen Distanz zu geschehen, als ob ich es durch eine Glasscheibe betrachtete. Wir schaufelten jeder einen Brocken gefrorenen Lehm auf den Sargdeckel und wandten uns schweigend ab.
Etwas abseits der Trauergesellschaft stand ein Paar und starrte zu uns hinüber. Es war kalt und sie trugen dunkle Wollmützen und lange Mäntel. Der Mann tätschelte der Frau die Wange, flüsterte ihr etwas ins Ohr und kam dann auf uns zu. Der Schnee knirschte unter seinen Schritten.
„Es ist Leo“, sagte Markus. Wir hatten ihn seit damals nicht mehr gesehen. Er hatte ordentlich an Gewicht zugelegt, die Haare waren sauber gescheitelt und sein Mantel schien teuer gewesen zu sein. Aber auch ich erkannte ihn sofort. Die Art, wie er die schmalen Lippen aufeinander presste, so dass sie zwei blutleere Striche bildeten. Wenn er sprach, führte er meistens eine Faust zum Mund, um seine schlechten Zähne zu verbergen. So wie jetzt.
„Ich habe es aus der Zeitung erfahren“, sagte Leo. Er nickte Markus und mir ernst zu und gab uns die Hand. Das Ganze wirkte sehr förmlich, wie ein Treffen unter Geschäftspartnern oder Politikern. Ich freute mich ihn wiederzusehen, aber es war gleichzeitig auch ein Gefühl der Peinlichkeit, dass uns ausgerechnet dieser Anlass zusammenführte.
„Ich habe Hilko ein paar Mal in Kleve besucht. Damals nahm er noch keine harten Drogen, aber ... .“ Er seufzte hinter seiner Faust. „Der Weg führte dahin. Ich hätte es wissen müssen.“
„Ich habe versucht, deine Adresse herauszufinden.“ Das stimmte zwar, aber als ich Leo nicht auf Anhieb ausfindig machen konnte, strengte ich mich nicht weiter an.
„Ich habe Astrids Familiennamen angenommen.“ Leo deutete mit einem Kopfnicken auf die Frau mit der Wollmütze. Sie pustete sich gerade warmen Atem in ihre Hände. Der Schnee fiel jetzt in dicken Flocken. Ein kleiner Schaufelbagger knat-terte durch die weißen Schleier und der Fahrer machte sich bereit, das Grab aufzufüllen. Ein Moment des Schweigens entstand. „Tja“, sagte ich. „Ziemlich ungemütlich hier. Wollen wir noch irgendwo was trinken?“
Leo zögerte. „Wir haben nicht viel Zeit.“ Seine Frau kehrte uns den Rücken zu, aber trotzdem glaubte ich, ihre Ungeduld zu spüren. Leo trat ganz nahe an uns heran. „Wir müssen reden. Es geht um den Lichtlosen.“
Ich fror. Der Wind fuhr unter mein viel zu dünnes Jackett.
„Warum tust du das, Leo?“ Markus klang gereizt. „Warum musst du diese alten Geschichten wieder aufwärmen?“ Mit einem Mal blitzte der Jähzorn seiner Jugend wieder auf. „Es ist schon schlimm genug, Hilko unter die Erde zu bringen. Und du kommst mit dieser ... Scheiße!“
„Es muss sein“, beharrte Leo und nur ein nervöses Zucken seiner Augenlider zeigte, dass noch immer etwas von der Furcht vor Markus´ Wutausbrüchen geblieben war. „Es gibt wirklich wichtige Neuigkeiten.“
„Was für Neuigkeiten?“, fragte ich.
„Schlechte Neuigkeiten.“
Hinter uns gab es ein hässliches Knirschen, als der Fahrer des Schaufelbaggers einen falschen Gang einlegte. „Nicht hier.“ Zwei Tränen rannen über Leos Gesicht. Es war, als leisteten sie sich ein Wettrennen. Er reichte jedem von uns eine Visitenkarte. Unter dem Namen seiner Baufirma standen zwei Adressen: die seines Büros und seine private.
„Du wohnst im Zedernweg?“ Markus hielt ihm die Visitenkarte vor die Nase und einen Moment lang befürchtete ich, er würde Leo schlagen. „Bist du pervers, Mann?“
„Nein. Passt euch morgen Abend um acht?“
Ich stammelte ein Ja. Leo nickte uns kurz zu und ging. Markus schnaubte und machte einen energischen Schritt nach vorn. Ich hielt ihn fest. „Ich will das nicht“, knurrte er. „Der Kerl muss verrückt sein. Nach allem, was dort geschehen ist, wohnt er ausgerechnet im Zedernweg.“
Leos Frau drehte sich im Weggehen noch einmal nach uns um. Selbst aus der Entfernung konnte ich erkennen, dass sie zart, fast zerbrechlich aussah. In ihrem Blick für uns lag nichts Freundliches. Für sie waren wir die unseligen Relikte einer Vergangenheit, die ihren Mann noch immer verfolgte.
Ich schloss kurz die Augen und in meinem Kopf erschienen die Bilder von damals. Sie ließen sich nicht mehr vertreiben und bildeten in meinem Bewusstsein schmerzende Druckstellen der Schuld. Alles war wieder da.
Sommer 1975
Jeder hat einen glücklichen Geruch. Plötzlich ist er da, erinnert an einen ganz besonderen Augenblick, einen Menschen, den man liebte – vielleicht noch immer liebt – oder an die Kindheit.
Mein Geruch ist der Duft frisch gemähter Getreidefelder. Schwer hängt er im Spätsommer über den harten, gelben Stoppeln. Ich atme tief ein, spüre ein trockenes Kratzen in der Kehle und weiß, wie es damals war, als ein Jahr mindestens dreimal so lang zu sein schien und wir glaubten, alles erreichen zu können. Wir fühlten uns unsterblich. Wir würden erleben, dass die Menschen Kolonien auf dem Mars errichten und die Autos fliegen können.
Ich nenne es die Zeit der großen Freundschaft und des Lebens im Zwischenreich: zu alt, um ein Kind zu sein und doch noch weit entfernt von der Welt der Erwachsenen.
Wir waren zu fünft: Markus, Hilko, Leo, Töffel – der eigentlich Christoph hieß – und ich. Nur die Lehrer zitierten mich mit meinem richtigen Namen an die verhasste Tafel: Richard. Für meine Freunde war ich Ritsch.
Es gab noch andere in unserem Bekanntenkreis, aber die spielen keine große Rolle. Sie wissen nichts von jenen Ereignissen in den Siebzigern. Deshalb haben sie auch überlebt.
Unser Stadtteil gehörte der NEUEN HEIMAT, der Kanzler hieß für alle Ewigkeiten Helmut Schmidt und wir erkundeten die Welt zu Fuß. Wir drückten uns bei den beiden Zweiradhändlern der Stadt herum, zählten täglich unser Erspartes – das nie sonderlich anwuchs, weil wir ständig Geld für die Musik von Deep Purple, Alice Cooper und David Bowie ausgaben – und hofften zum 15. Geburtstag auf eine grüne Zündapp oder eine orangefarbene Kreidler. Bis dahin sollten aber noch unendliche Monate ins Land gehen.
Die Fahrräder verrosteten in den Garagen der Eltern, zum Fahrradfahren fühlten wir uns zu alt – zu erwachsen. Fahrräder galten seit einiger Zeit als peinlich. Und dennoch legten wir jeden Tag etliche Kilometer zurück. In das Stadtzentrum, wo die Älteren ihre frisierten Mopeds aufheulen ließen. Wir lehnten uns an den Brunnen auf dem Alten Markt, beobachteten sie neidisch und redeten. Wenn es regnete, gingen wir in die nahe Bibliothek, blätterten in den Bildbänden, staunten über die Tierwelt von Australien und die Straßenschluchten New Yorks, verschlangen die Dokumentationen über das Römische Imperium und den Absturz der Hindenburg. Die exotischsten Orte, die wir bisher besucht hatten, waren die holländische Nordseeküste oder die Alpen, aber keinen von uns zog es in die Ferne. Es war uns egal, dass wir fast nie aus Unna herauskamen. Die spannendsten Abenteuer fanden in unseren Köpfen statt.
„Wie klangen denn die Ameisen?“ Töffel knabberte an seinem Daumennagel und sah mich erwartungsvoll an.
„Wie Grillen“, erwiderte ich. „Wie viel zu große Grillen.“
Töffel schien sich einen Moment lang das Zirpen von Grillen in Erinnerung zu rufen. Er zog sich über den Rand des steinernen Brunnens und versuchte, etwas von dem weißen Schaum auf der Oberfläche des Wassers zu erhaschen. Immer wieder schüt-teten Witzbolde Waschpulver hinein. „Formicula hieß der Film“, sagte er dann. An Töffels Fingern glitzerte Seifenschaum. Er pustete und die kleinen Flocken wirbelten wie Schnee davon. „Ich hab’s in der Fernsehzeitung gelesen. Ameisen werden durch Atomstrahlen zu riesigen Monstern ... .“
„Es heißt Radioaktivität“, murmelte Hilko. Hilko war kein Klugscheißer. Das wussten wir. Er kramte aus den Tiefen seines Bundeswehrparkas ein Paket billigen Tabak und begann, eine seiner dünnen Zigaretten zu drehen. Ohne dabei auf seine Finger sehen zu müssen. Eben routiniert. Hilko war mit fast sechzehn der Älteste von uns. Er besaß trotzdem noch kein Mofa, weil seine Eltern meinten, er müsste es sich durch Arbeit verdienen.
Hilko war der Einzige von uns, der regelmäßig rauchte. Ich hatte es ein paar Mal probiert, aber die Versuche endeten jedes Mal mit einem schlimmen Hustenanfall. So, als wenn ich den beißenden Rauch eines Lagerfeuers inhalierte. Auch der Geschmack war ganz ähnlich.
„Dieser Ameisenfilm ist doch eine uralte Schwarte.“ Leo gähnte demonstrativ. Dabei achtete er peinlich genau darauf, die Hand vor den Mund zu halten. Nicht als Ausdruck guten Benehmens, sondern weil er sich wegen seiner schlechten Zähne schämte. Sie sahen so aus, als müssten sie ihm permanent Schmerzen bereiten. Aber Leo mied den Zahnarzt trotzdem wie die Pest. Schon oft hatte ich mir vorgenommen, ihn mal darauf anzusprechen, aber irgendwie ergab sich nie die richtige Gelegenheit. Also lief er weiter mit der Hand vor dem Mund durch die Gegend. Leo trug auch als Einziger von uns viel zu weite, dunkelbraune Kordhosen anstelle der angesagten knallengen Jeans. Dennoch hatte er sich gestern mit einem Mädchen getroffen. Sie hatte ihm im Unterricht einen Zettel zugeschoben. Es ging darum, ob er mit ihr „gehen“ wollte. Verschiedene Antwortmöglichkeiten waren vorgegeben. Leo hatte VIELLEICHT angekreuzt. Bei dem trotzdem zustande gekommenen Treffen schwiegen sie dann die meiste Zeit. Später zeigte er ihr dann eine nicht verheilte Schnittwunde an seinem rechten Daumen. Ich fand das ziemlich verrückt. Und vor allem falsch. Nach meinem Kenntnisstand konnte man so keinen Eindruck auf Mädchen machen.
„Formicula ist ein Klassiker“, widersprach Hilko paffend. „Der Anfang mit dem umherirrenden Mädchen in der Wüste ist echt unheimlich.“
Leo verdrehte die Augen. Er stand auf Inspektor Columbo und Erik Ode als Kommissar Keller.
„Und weiter?“, drängte mich Töffel mit seiner piepsenden Stimme, die mich immer an die ängstlichen Nebenfiguren in den amerikanischen Zeichentrickfilmen erinnerte. Hühner, Mäuse oder Babyelefanten. Aber das hatte ich ihm nie gesagt. Töffel war genau so wie sein Spitzname. Wer ihn das erste Mal sah, hielt ihn für neun, na ja, höchstens zehn. Aber er war so alt wie wir und dennoch einen Kopf kleiner als ich. Er fügte sich, trottete hinterher und gab sehr wenig von sich preis. Er schwieg, wenn wir über den Ärger mit unseren Eltern und den Lehrern redeten. Sein Vater und seine Mutter ließen sich vor drei Jahren scheiden. Töffel lebte seitdem bei einer Tante. Vielleicht beschloss damals etwas in ihm, sich möglichst klein und unauffällig zu machen. Ich musste ihm immer die Filme vom Wochenende erzählen. Seine Tante verbot ihm das Fernsehen am Abend. Weil sie dann das Wohnzimmer für sich brauchte, wie Töffel mal erwähnt hatte.
Ich war gerade bei der Vernichtung der Ameisenkönigin in der Kanalisation von Los Angeles angelangt, als mir Markus seine Pranken auf die Schulter legte. „Neunzig!“, dröhnte er mir ins linke Ohr. Er hatte sich in der letzten Viertelstunde bei den Mopedfahren vor der Stadtbücherei herumgedrückt. „Ritsch! Das Ding läuft über neunzig!“ Er deutete auf ein schwarzes Mofa mit abgesägten Schutzblechen und bunten Zierbändern am Lenker. Der Besitzer hockte lässig auf dem Sattel und genoss die Bewunderung der anderen Jungen.
Wir alle wünschten uns ein Mofa. Aber niemand so sehr wie Markus. Er war versessen auf die Dinger. In der Garage seines großen Bruders stand bereits eine verrottete Peugeot, die er für ein paar Mark besorgt hatte. Daran schraubte er ständig herum, zerlegte sie in alle Einzelteile, um, wie er sagte, das Frisieren zu beherrschen, wenn er eine „vernünftige“ Karre besaß. Denn eine Peugeot galt nicht als „vernünftig“. Mädchen fuhren Peugeot und Vespa, wir brauchten Kreidler oder Zündapp.
Der Bursche mit dem schwarzen Mofa startete, fuhr ein paar Meter auf dem Hinterrad und raste mit lautem Knattern in Richtung Schäferstraße davon. Ein Ehepaar sprang entrüstet zur Seite. Es roch nach verbranntem Zweitaktergemisch.
Markus schnupperte und seufzte.
„Wie wäre es jetzt mit Hausfriedensbruch?“, schlug Töffel mit leiser Stimme vor.
Ein Vorschlag von Töffel, wenn auch zaghaft vorgetragen, war etwas Seltenes. Wir waren sofort einverstanden. Es fehlte nur der notwendige Proviant: ein paar Flaschen Bier. Um Bier zu bekommen, musste man sich nicht besonders anstrengen. Jeder Supermarkt verkaufte an uns Bier und alle Sorten Fusel.
Eine knappe Stunde später näherten wir uns, bestückt mit einem Sechserpack Kronen Pils und zwei Flaschen Erdbeersekt, Hausfriedensbruch.
Ich erinnere mich nicht mehr daran, wem dieser Name eingefallen war. Aber wahrscheinlich entstand er aus einem Hauch schlechten Gewissens, denn wir wussten genau, dass wir uns nicht ganz legal verhielten.
Wir bogen in den Feldweg ein. Die Asphaltdecke wies tiefe Schlaglöcher auf und aus Rissen wuchsen kleine, zähe Pflanzen. In einiger Entfernung rauschte der Verkehr über die Autobahn. Mit etwas Fantasie klang das wie Meeresbrandung.
Wir beeilten uns, an dem kleinen Backsteinhaus mit den windschiefen Kaninchenställen vorbeizukommen. Es stellte die letzte Barriere dar. Meistens ließ sich dort niemand sehen. Aber wenn uns der Kaninchenzüchter oder seine Frau entdeckten, hetzten sie uns Bauer Grote auf den Hals. Zwischen dem Backsteingebäude und Grotes Bauernhof am Ende der Sackgasse lag unsere Zuflucht: Hausfriedensbruch. Ein verlassenes Gehöft. Vom Feldweg durch eine schnurgerade Reihe von Birken und einer Hecke getrennt. Es bestand nicht aus malerischen, westfälischen Fachwerkhäuschen und einer hölzernen Scheune, sondern aus zweckmäßigen Betonbauten mit Schieferdächern. Wahrscheinlich nicht älter als zwanzig Jahre.
Es gab ein großes, zweistöckiges Wohnhaus mit einem direkten Zugang zu den Ställen. Ich stellte mir immer vor, wie der Bauer einst in aller Frühe nach einer ersten Tasse Kaffee den Flur entlang ging und die Tür zum Stall öffnete. Mindestens zwei Dutzend Kühe warteten dort auf ihn. Unruhig schabten sie an den hölzernen Trennwänden und ihr Atem stieg in der Kälte des Morgens wie feuchter Nebel auf. Vielleicht gab es auch Schweine, die grunzend ihre Schnauzen durch die Gitter der Koben reckten.
Jetzt waren sie alle verschwunden. Der Hof stand leer. Ausnahmslos jede Fensterscheibe an der Vorderfront der Gebäude war zerschmettert worden.
Nicht von uns. Denn wie sagte Hilko immer: „Der Bär kackt nicht in den eigenen Wald.“ Oder so ähnlich.
Am meisten reizte uns der riesige, quadratische Raum über den Ställen. Jetzt, nach der Ernte. lagerte dort der Bauer Grote vom Ende der Sackgasse sein Stroh. Die gelben Ballen türmten sich bis unter die hohe Decke. Für uns wurden sie zu übergroßen Bauklötzen. Man konnte aus ihnen Mauern und Türme, sogar ganze Burgen bauen. Wir erstürmten Schutzwälle, kugelten Abhänge aus stacheligem Heu herab, bis wir trockenen Staub husteten.
Das Ganze war nicht ohne Risiko. Zum Einen versteckten sich unter den Grannen und Halmen quadratische Öffnungen, richtige Fallgruben. Wer dort hinunter fiel, konnte sich leicht ein paar Knochen brechen. Zum anderen tauchten gelegentlich Bauer Grote oder einer seiner Knechte auf. Wenn überraschend ein Schädel mit braunem Kordhut auf der Treppe zum Heuboden erschien, stoben wir auseinander, sprangen durch die Fallgruben nach unten oder flüchteten durch die zerschlagene Fensterfront. Direkt dahinter lag ein Flachbau. Das Dach mit Teerpappe federte unter unserem Aufprall wie die Sprungbretter im Sportunterricht, wir landeten auf dem Acker und rannten. Der Bauer stand im Fenster des Heubodens, sah, wie wir über den braunen Lehm rannten und brüllte wüste Drohungen. Er verfolgte uns nie.
„Wartet!“ Markus duckte sich unter den Birkenzweigen und kroch durch die Büsche, die den Hof vom Feldweg abschirm-ten. Er liebte es, bei solchen Aktionen der Erste zu sein. Nach einer Minute kehrte unser selbsternannter Scout zurück. „Die Luft ist rein“, verkündete Markus wichtig.
In einiger Entfernung startete ein Trecker, kam nicht näher, sondern fuhr in entgegengesetzter Richtung davon.
Wir krochen durch die Büsche. Ein Zweig peitschte mir ins Gesicht. Der jähe Schmerz war nicht so schlimm wie das Gefühl in meinem Bauch. Jedes Mal, wenn ich den verlassenen Hof betrat, verwandelte sich mein Magen in der ersten Zeit in einen Fremdkörper, der wie eine bleierne Murmel in der Mitte meines Körpers hockte. Es war die Furcht, erwischt zu werden. Sie trocknete meine Kehle aus und ich räusperte mich ständig, damit es den anderen nicht auffiel. Ich fragte mich, ob sie ähnlich empfanden. Zumindest Leo und Töffel. Markus und Hilko schienen sich keine Gedanken darüber zu machen. Freiwillig setzten sie sich der Gefahr aus, rannten stets als letzte davon, balancierten auf den rutschigen und lockeren Schindeln des Dachs oder schlugen beim gegenseitigen Kräftemessen mit hölzernen Stöcken wild auf sich ein. Zu wild, wie ich fand. Es war erstaunlich, dass sie noch beide Augen besaßen.
Das heißt, es gab da einen Ort, vor dem auch sie sich fürchteten. Hier auf Hausfriedensbruch. Wenn sie ihre Angst auch immer mit flapsigen Bemerkungen zu verbergen suchten.
Ausgerechnet dieser Ort sollte sehr bald unser Leben verändern.
Die Heuballen füllten fast zwei Drittel des Raumes aus.
Das Sonnenlicht schien durch die leeren Fensterrahmen und ließ den Staub in der Luft aufblitzen. Eine gelbe, beinahe goldene Welt.
Das hustende Motorengeräusch des Traktors näherte sich und Markus spähte durch einen Spalt in dem großen Tor. Dort brachte der Bauer mit seinen Leuten das Heu hinauf. Ich wusste noch immer nicht, wie er das schaffte. Warfen sie die Ballen? Über die Distanz von nahezu drei Metern? Bauer Grote war ein riesiger, beinahe quadratischer Kerl. Ich traute im das glatt zu.
„Er fährt vorbei“, sagte Markus.
Leo kramte ein paar grüne Brocken hervor und befreite sie von einigen Krümeln und Fusseln. Dann stopfte er sich das Zeug in den Mund.
„Wollt ihr auch was?“ Es klang eigentlich wie „Woht ih au wa?“, denn was immer er da in den Tiefen seines Anoraks entdeckt hatte, bot seinen Zähnen eine Menge Widerstand.
Hilko verzog das Gesicht. Markus hob abwehrend beide Hände. Leo hatte zwei Brüder und vier Schwestern. Sein Vater hatte Mühe, die Familie zu ernähren. Leo bekam nie ein paar Mark zugesteckt. Außer an seinem Geburtstag. Der war im Juni. Bei seinem letzten gab er uns allen ein Eis aus und das Geld war futsch.
„Was hast du denn da?“, fragte ich aus reiner Höflichkeit. Leo brachte keine Schokolade oder Bonbons mit. Er nahm aus dem Küchenschrank, was sich gerade anbot und von seiner Mutter hoffentlich nicht vermisst wurde: ein paar Brocken Kandiszucker, Rosinen oder – das war der Tag, an dem ich erkannte, wie schlecht es seiner Familie gehen musste – eine Tüte mit Paniermehl.
Er schluckte. Ich sah deutlich, wie sich etwas Leos Kehle hinunterzwang. „Zitronat.“
„Später vielleicht.“ Ich versuchte völlig normal zu klingen.
„Ich möchte!“ Töffel schob sich an mir vorbei und streckte die Hand aus. Er kaute, ohne eine Miene zu verziehen, und sah sich dabei nachdenklich um. „Ich weiß, wie wir den Bauern austricksen.“
Wir waren ziemlich verblüfft. Töffel hatte sonst nie Ideen, geschweige denn eine, die auch nur im geringsten nach Risiko klang. Er war noch vorsichtiger als ich.
Töffel deutete auf die Heuballen. „Es sind jetzt so viele, dass es nicht auffällt.“
„Was auffällt?“ Hilko rauchte schon wieder. Ich hielt das für ziemlich gefährlich zwischen dem ganzen trockenen Zeug, schwieg aber.
Töffel bekam vor Aufregung rote Ohren. „Wir ...“ Für einen Moment verlor er den Faden. Er nahm einen Schluck aus der noch fast vollen Bierflasche in seiner Hand. Vielleicht bereitete ihm Leos Zitronat Kummer. Er wischte sich den Mund ab. Töffel hatte die kleinsten Hände von uns. Mit ganz zarten, kurzen Fingern und abgekauten Nägeln.
„Wir bauen uns ein Versteck“, begann er neu. „Da!“
Alle folgten seinem kleinen Zeigefinger – Babypfoten hatte Markus einmal halblaut gespottet, Töffel aber anschließend einen freundschaftlichen Knuff in die Seite verpasst. Wir starrten die meterhoch gestapelten Ballen an.
„Wir nehmen die inneren Heuballen raus und packen sie woanders hin. Das fällt bei der Menge keinem auf. Vorn lassen wir eine Wand stehen. Wenn der Grote kommt, verstecken wir uns dort. Der findet uns nie.“
Markus und Hilko grübelten, Leo kramte nach Zitronat und ich sagte: „Gute Idee! Wenn wir das in der linken Ecke machen, haben wir das Fenster im Rücken. Als Fluchtweg. Falls doch etwas schief geht.“
Töffel strahlte mich an. Hilko dachte nach und nickte dann.
Wir brauchten eine ganze Stunde, um unser Versteck auszubauen. Anschließend kletterten wir zur Probe hinein. Es gab uns ein gutes Gefühl. Wir waren für die Außenwelt unsichtbar geworden. Duftende Wände aus gepresstem Stroh umgaben uns. Wir legten uns auf den Boden und betrachteten durch die zerborstenen Fensterscheiben den Acker hinter dem Hof.
Ein einzelner Raubvogel kreiste in der Luft. Sein heiserer Schrei drang zu uns herüber. Untermalt von dem nie endenden Verkehr der nahen Autobahn. Plötzlich stieß der Vogel steil herab und bohrte seine Krallen in einen zuckenden, grauen Pelz. Das Kaninchen bäumte sich auf und versuchte zu entkommen. Es schlug keine schnellen Haken mehr, schaffte nur einen taumelnden Hopser und der Raubvogel stakste ohne Eile – geradezu überheblich – über die vom Pflug aufgewühlte Erde. Sein schnabelbewehrter Schädel zuckte dabei vor und zurück.
Das Licht des Tages wurde schwächer. Es würde noch für ungefähr eine Stunde hell sein. Fast unmerklich verlor der Himmel sein Blau. Am Abend versank der alte Bauernhof in völlige Dunkelheit. Hier gab es keine Elektrizität mehr, keine Straßenlaternen. Nur aus der Ferne glommen dann die erleuchteten Fenster der Neubausiedlung. Gartenvorstadt nannte man sie. Obwohl sich dort die wenigsten Menschen einen Garten leisten konnten.
„Ihr sucht uns“, schlug Hilko vor. Wen er mit uns meinte, wurde mir sofort klar, als er Markus angrinste. Ich spürte, wie Eifersucht in mir hochstieg. Wenn es um ein Abenteuer ging, tat sich Hilko immer mit Markus zusammen.
„Ihr gebt uns fünf Minuten“, verlangten die beiden.
„Aber ohne Keller“, erwiderte ich hastig.
Hilko und Markus sprangen durch eines der Löcher in den darunterliegenden Stall.
Die Gebäude boten so viele Verstecke und Fluchtwege. Es konnte lange dauern, bis wir die Gesuchten entdeckten. Der Keller war tabu. Sein Labyrinth erstreckte sich wahrscheinlich unter der ganzen Fläche des Bauernhofs. Nur an wenigen Stellen drang dort Licht hinein. Ein einziges Mal hatten wir uns dort hinunter getraut. Wir taten so, als wäre es in den Gängen mit der niedrigen Decke langweilig, aber jeder redete zu viel und zu laut. Bis wir die Knochen eines Tieres fanden. Viel zu groß, um von einem Kaninchen zu stammen. Der fein säuberlich abgenagte Schädel befand sich in einer anderen Ecke des Raumes. Leo glaubte, dass es die Überreste eines Hundes waren. Wir rätselten während unseres Rückzugs, welches Tier in unserer Gegend stark genug war, um einen Hund mittlerer Größe zu töten und dann komplett aufzufressen. Wir fanden es nie heraus, aber manchmal glaubten wir, Geräusche aus dem Gewölbe zu hören.
Töffel sah auf seine Armbanduhr. Ein klobiges Teil mit roten Leuchtziffern. Das Metallband schlackerte an seinem dünnen Handgelenk. „Die Zeit ist gleich um ... Jetzt!“
Wir nahmen die Treppe. Im leeren Stall hielten wir inne und lauschten.
„Wir bilden zwei Gruppen“, schlug ich vor.
„Zu dritt kann man keine zwei Gruppen bilden“, widersprach Töffel.
„Du bleibst mit Leo zusammen. Ich suche allein. Wer sie findet, ruft laut.“ Töffel entspannte sich. Für einen Moment hatte er wohl geglaubt, allein losgehen zu müssen. Jetzt, wo die Sonne verschwand, die Schatten in die Flure und Zimmer krochen.
Leo schob sich hinter vorgehaltener Hand einen letzten Brocken Zitronat in den Mund und zerrte Töffel mit sich.