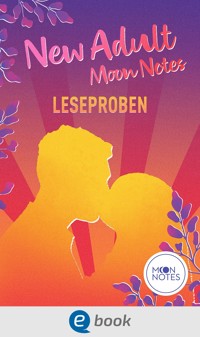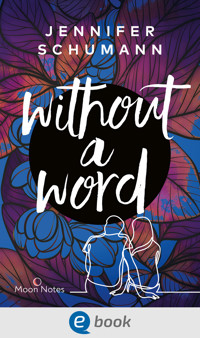
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Moon Notes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die junge ehrgeizige Schauspielerin Madeleine nimmt sich eine Auszeit vom Theater und hilft stattdessen für eine Weile im Café ihrer Freundin aus. Dort begegnet sie täglich einem Stammgast. Obwohl dieser nicht spricht und sie nicht ansieht, ist sie unglaublich fasziniert von seiner Ausstrahlung. Hartnäckig versucht Madeleine dem gut aussehenden jungen Mann näherzukommen. Und nach und nach wird ihr klar, warum er sich so abweisend verhält, und auch, dass man manchmal gar keine Worte benötigt, um sich zu verlieben!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Sammlungen
Ähnliche
Über dieses Buch
Es war Zeit.
Es gab kein Zurück.
Es war vorbei.
Als ich dich zum ersten Mal in diesem Café gesehen habe, hatte ich keine Ahnung, wie weit unser Weg noch sein würde. Du warst so abweisend und hast kein Wort mit mir geredet. Aber du hast keine Worte gebraucht, um mich um den Finger zu wickeln. Wenn ich zu dem Zeitpunkt schon gewusst hätte, was uns blüht, wäre ich vielleicht ganz weit weggelaufen. Obwohl, sind wir ehrlich, ich würde alles ganz genau noch mal so machen.
Wärst du bereit, jemanden ohne Aussicht auf eine Zukunft zu lieben?
Jennifer
Liebe*r Leser*in,
wenn du traumatisierende Erfahrungen gemacht hast, können einige Passagen in diesem Buch triggernd wirken. Sollte es dir damit nicht gut gehen, sprich mit einer Person deines Vertrauens. Auch hier kannst du Hilfe finden:
www.nummergegenkummer.de
Schau gern unter »Triggerwarnung«, dort findest du eine Auflistung der potenziell triggernden Themen in diesem Buch. (Um keinem*r Leser*in etwas zu spoilern, steht der Hinweis hinten im Buch.)
Dieses Buch ist all den wahren Helden gewidmet,
die viel zu früh gehen mussten.
Vor allem meinem Großvater.
Playlist
Slide Away – Miley Cyrus
My Life – Imagine Dragons
Scumbag (Acoustic) – Goody Grace
Ordinary World – Green Day
Hurt – Johnny Cash
The Cave – Mumford & Sons
Everlong – Foo Fighters
Bad Habit – The Kooks
Friday I’m In Love – Phoebe Bridgers
Wicked Game – Grace Carter
Never There – Sum 41
Roller Coaster – Danny Vera
Seaside – The Kooks
Afterglow – Ed Sheeran
Out Of Reach – Gabrielle
Mr. Brightside – The Killers
Woman – Mumford & Sons
Falling – Harry Styles
Liability – Lorde
The Messenger – Linkin Park
One More Light – Linkin Park
Collide (Acoustic Version) – Howie Day
Brace Yourself – Howie Day
I’ll Stand By You – Pretenders, Bob Clearmountain
Right on Time – Brandi Carlile
More Than Words – Extreme
World Gone Mad – Bastille
Not Today – Imagine Dragons
Longest Night – Howie Day
Kapitel 1Madeleine
Danach
»Hallo, Madeleine. Bitte nehmen Sie Platz!« Dr. Witman scheint weniger verwundert über meinen Besuch in ihrer Praxis zu sein als ich. Immerhin habe ich mir selbst hoch und heilig geschworen, nicht mehr herzukommen. Aber da stehe ich nun doch leibhaftig vor ihr, wenn auch nicht ganz so selbstsicher wie geplant.
»Danke«, murmele ich.
Sie öffnet ihre Mappe, greift nach ihrem Stift und lächelt mich erwartungsvoll an. Ich wende den Kopf ab und sehe lieber aus dem Fenster, hinaus zu dem Sportplatz der Schule nebenan, wo sich einige Kinder in der eisigen Kälte beim Ballspiel abquälen. Ständig unter Beobachtung der Argusaugen ihres Lehrers mit Trillerpfeife um den Hals.
»Es freut mich, dass Sie meinem Rat gefolgt sind und doch noch einmal um einen Termin gebeten haben. Ich weiß, dass Sie frustriert sind, Madeleine, aber glauben Sie mir, das ist auch eine Empfindung, die ihre Berechtigung hat. Es zeugt von Stärke, dass Sie sich all diesen verschiedenen Emotionen stellen. Dafür haben Sie meinen größten Respekt.«
Dr. Witman erinnert mich manchmal an eine Venusfliegenfalle. Was sie sagt, klingt so harmlos, bestätigend und verlockend. Doch wenn ich mich auf sie einlasse, bin ich verloren. Sie benutzt Phrasen wie »damit abschließen« oder »die Vergangenheit ruhen lassen«. Aber das kann ich nicht. Das möchte ich nicht.
Und trotzdem bin ich heute hier.
Wieder mal.
Warum nur?
Wahrscheinlich auch deshalb, weil Dr. Witman einer der wenigen Menschen in dieser Stadt ist, mit denen ich reden kann. Vor allem aber, weil ich ihre Hilfe nun dringender brauche als die Isolation der vergangenen beiden Wochen, die mir bislang noch Sicherheit bot.
Kurzerhand entscheide ich, die Bombe platzen zu lassen, auch wenn ich damit meine ganze Verzweiflung offenbare.
»Ich habe ihn gesehen.«
Dr. Witman holt tief Luft, legt Brille und Stift zur Seite, allzeit bereit, in meine seelischen Qualen einzutauchen. »Okay … und wo? Wo haben Sie ihn gesehen?«
»Im Fernsehen. Darauf war ich wirklich nicht vorbereitet.« Oft frage ich mich, ob Dr. Witman über meine offensichtliche Überforderung enttäuscht ist, schließlich liegen bereits einige Therapiestunden hinter uns. Ich selbst hingegen hege nicht mehr allzu hohe Erwartungen, was mich betrifft. Ich setze mir derzeit kleine Ziele – in der Früh aufstehen, anziehen, überleben. Das Übliche. Daily Business eben. Früher hatte ich den großen Traum einer tollen Karriere als Theaterschauspielerin, heute bin ich bescheidener.
»Mittlerweile glaube ich, dass es nie besser werden wird.« Ich zappele auf der mintgrünen Verloursledercouch herum und lasse mal wieder die Pessimistin raushängen. Eine Seite an mir, die ich wirklich verabscheue.
»Madeleine, wollen Sie, dass sich Ihre Situation verbessert?«
»Verbessert? Ja, natürlich.«
»Aber Sie wissen auch, dass Sie, um eine Verbesserung zu erreichen, akzeptieren müssen, was geschehen ist.«
»Sie wollen, dass ich es vergesse. Aber das kann ich nicht. Niemals!«
Dr. Witman beugt sich vor. Sie stemmt die Ellbogen auf den Tisch, und ihr durchdringender Blick ruht auf mir. Nun gibt es kein Entrinnen mehr. »Die Vergangenheit zu akzeptieren, bedeutet nicht, sie zu vergessen, Madeleine, denn sie wird immer ein Teil von Ihnen sein. Doch Sie müssen die Ketten lösen, um weiterleben zu können. Sie sind am Leben, ist Ihnen das eigentlich bewusst? Ihr Körper scheint es mit jedem Atemzug, den Sie machen, zu spüren. Ihr Geist aber ist wie eine vertrocknete Pflanze, die darauf wartet, endlich Wasser zu bekommen. Finden Sie heraus, was Ihnen guttut, was Ihnen die Kraft gibt, den nächsten Tag zu überstehen. Das ist ein erster Schritt.«
Bevor ich eine Stunde später Dr. Witmans Praxis verlasse, gibt sie mir den Ratschlag, jene Augenblicke meiner Vergangenheit noch einmal gedanklich durchzuspielen, um zu erkennen, wie viel Kraft ich daraus schöpfen kann. Sie händigt mir auch eine Karte aus, die eine gemütliche, sommerliche Terrasse zeigt. Als Ort würde ich auf Frankreich tippen. Unter dem warmen Licht unzähliger Lampions ist eine Tafel zu sehen, auf der halb leere Gläser und abgebrannte Kerzen stehen. Dieser Tisch scheint der Mittelpunkt fröhlicher Gespräche und guten Essens gewesen zu sein. Auf der Rückseite der Karte lese ich einen Spruch, der mir als Ankerpunkt bis zu meiner nächsten Therapieeinheit dienen soll. Leuchtende Tage. Nicht weinen, dass sie vorüber. Lächeln, dass sie gewesen.
Das kleine Apartment in Queens, in dem ich seit meiner Ankunft in New York wohne, ist der einzige Ort in dieser Stadt, an dem ich mich halbwegs sicher fühle. Vollgestopft mit all meinen Erinnerungen an eine bessere Zeit, gleicht meine Wohnung einem Museum, das den Themen Verlust, Abschied und Selbsthass gewidmet ist.
Auch Dr. Witmans Karte bekommt darin nun einen passenden Platz. Ich entscheide, sie als Zeichen meiner Motivation, mein Leben in den Griff bekommen zu wollen, an den Kühlschrank zu heften. Dorthin führt mich mein Weg zwar äußerst selten, aber immerhin bleibt sie so in meinem Blickfeld. Von der Couch aus, auf der ich die meiste Zeit meines Tages verbringe, kann ich nämlich den gesamten Raum überblicken.
Heute jedoch zieht mich das magische Band, das Dr. Witman als Ketten meiner Vergangenheit bezeichnet hat, ins Schlafzimmer. Unter meinem Bett bewahre ich die Erinnerungen an mein altes Ich in einem ebenso alten Schuhkarton auf. Den Inhalt kann ich mit voller Überzeugung als mein Lebenselixier bezeichnen. Dennoch zögere ich, den Deckel abzunehmen.
Mit meinem Telefon in der Hand und dem Karton auf meinem Schoß setze ich mich aufs Bett. Ich scrolle zu einer Sprachnachricht von ihm, die Charlize mir weitergeleitet hat. Mein Daumen schwebt zögernd über dem dreieckigen Symbol, das die Aufnahme abspielen wird. Wenn ich seine Stimme höre, wird das mein Untergang sein, so viel steht fest. Doch die Verlockung ist zu groß. Zu stark die Hoffnung, dass darin der Schlüssel zu meiner Heilung liegt. Es ist wie eine Sucht, ein Drang, der überhandgenommen hat.
»Hi, ich bin’s. Ich habe heute schon mehrmals versucht, dich zu erreichen, aber du hebst nicht ab.« Er seufzt, und ich höre den Straßenlärm, der ihn umgibt. Seine Stimme klingt verzweifelt und hoffnungsvoll zugleich. Sie ist mir so vertraut und doch so fremd. »Alles okay bei dir? Na ja, jedenfalls wollte ich dir sagen, dass ich gleich noch den Termin beim Doc habe und danach nach Hause fahren werde. Ruf mich an, wenn du Zeit hast. Bis bald.«
Letzte Momente unbewusster Glückseligkeit. Ich wünschte, ich könnte genau dort die Zeit anhalten, um ihn zu retten. Doch die Zeit ist weitergelaufen, wie sie es soll.
Sekunde für Sekunde. Stunde für Stunde. Tag für Tag. Monat für Monat.
Immer weiter bringt sie uns auseinander, trübt meine Erinnerung an ihn. Ich frage mich, ob diese irgendwann genauso vergilbt sein wird wie die vielen handschriftlichen Notizen, die ich in meinem Schuhkarton aufbewahre.
Das Traurige aber ist, dass in dem Moment, als die Sprachnachricht endet, nicht nur jede Hoffnung dahin ist, sondern ich ihn auch nicht mehr anrufen werde. Weder heute noch morgen. Niemals.
Ich habe ihn genauso wenig retten können wie mich selbst. Ich habe in jeder Hinsicht versagt.
Dr. Witman meinte, ich solle mich bewusst den Ereignissen der vergangenen eineinhalb Jahre stellen. Ich müsse diese Momente noch einmal durchleben, um zu begreifen, dass sie hinter mir liegen und nicht mehr wiederkommen. Denn erst das wird mir helfen, in die Gegenwart zu finden.
Wie eine Richtschnur soll meine Vergangenheit mein aus den Fugen geratenes Leben wieder ins Lot bringen. Als Hilfsmittel dient mir mein Karton voller Erinnerungen. Die sind der Fahrplan.
Während ich den Deckel abnehme, verspüre ich Resignation und auch Hoffnungslosigkeit. Natürlich könnte mich diese Reise, zu der Dr. Witman mir geraten hat, endgültig zerstören. Aber wenn auch nur die geringste Hoffnung besteht, mein jetziges Leben zu verbessern, bin ich bereit, dafür jedes Risiko in Kauf zu nehmen.
Für ihn. Damit nicht alles umsonst war.
Kapitel 2Madeleine
Davor
Mit gerade mal dreiundzwanzig Jahren meine am Anfang stehende Karriere vorerst auf Eis zu legen, um sich selbst zu finden, würden einige als mutig bezeichnen. Andere würden wohl behaupten, ich sei undankbar. Meine beste Freundin Leona hielt mich einfach für verrückt, aber ich wusste, dass ich mich auf sie verlassen konnte. Denn wir hatten uns geschworen, dass wir uns gegenseitig bei jeder Dummheit unterstützen würden, solange es nicht bedeutete, im Krankenhaus oder im Knast zu landen.
Meine Mum hatte, glaube ich, den Ausdruck »riskant«, benutzt, als ich ihr von meinen Plänen, vorerst keine weiteren Rollen anzunehmen, berichtete. Wir hatten bei uns zu Hause in Paddington gesessen, in dem Haus, in dem ich aufgewachsen war. Neue Möbel, alter Charme. Erinnerungen, archiviert in Bildern, die an den Wänden hingen. Und davor meine Mum mit ihrem herzlichen Lächeln, dem sanften Blick und der Rundumversorgung in Form von Tee und Kuchen.
»Du wirst deinen Weg gehen, Liebes«, hatte sie gesagt, auch wenn ich spürte, dass ihre Sorge um mich wuchs.
»Ich brauche diese Auszeit«, hatte ich erklärt. »Ich weiß nicht, ob ich meine Arbeit noch liebe.«
»Abstand ist manchmal die beste Medizin.«
Doch einzig vom Nichtstun konnte ich schließlich auch schlecht leben. Außerdem war ich nie jemand gewesen, der gern untätig war. Gut, verregnete Sonntage auf der Couch damit zu verbringen, Serien zu schauen und Unmengen an Popcorn zu verputzen, war großartig. Aber die restlichen sechs Tage der Woche brauchte ich eine Aufgabe.
Das wusste auch Leona. Einst waren wir, wie wir gern sagten, von unseren Müttern zwangsbefreundet worden, die sich, beide mit riesigem Babybauch, im Hyde Park kennengelernt hatten. Meiner Mum war durch einen Windstoß der Hut – einer dieser schrecklich schrillen, bunten 90er-Jahre-Hüte – vom Kopf geweht worden. Leonas Mum Sarah war ihr zur Hilfe geeilt. Gemeinsam hatten sie das hässliche Ding vor einem unwürdigen Ende in einer Pfütze gerettet. Aufgrund ihrer beider Schwangerschaften waren sie schnell ins Gespräch gekommen und hatten sich fortan getroffen, um sich gegenseitig ihr Leid zu klagen und aufzumuntern. Ich hatte fünf Wochen vor Leona, an einem verregneten Maitag, das Licht der Welt erblickt. Seither waren wir unzertrennlich.
Unsere Freundschaft war voll mit wirklich schönen Erinnerungen. Zum Beispiel, wie wir beide schier ausgeflippt waren, als wir zu Weihnachten die gleiche Barbie-Traumvilla bekommen und uns daraufhin wochenlang jeden Tag zum Spielen getroffen hatten. Wir hatten eigene Kleider aus Stoffen genäht, die Leonas Mum für uns gekauft hatte, und hatten dann Fotoshootings veranstaltet. Noch heute existierten davon Fotos mit gruselig starren Puppen, die in dilettantisch zusammengeflickten Baumwollstreifen steckten, um für uns zu posieren. Wir hatten uns als die nächste Donatella Versace gesehen – und das war nur einer unserer Mädchenträume, von denen wir unzählige hatten.
Als wir älter geworden waren, machten wir zusammen den üblichen Quatsch durch: erste Zigarette, erste Liebe, erster Schmerz, erster Absturz. Wir waren sogar einmal in den gleichen Jungen verknallt gewesen, doch am Ende hatten wir heldenhaft entschieden, dass niemand, nicht einmal der Mädchenschwarm unserer Schule, je zwischen uns stehen würde. Leona hatte ihm auf einer Party sogar Wodka-Bull ins Gesicht geschüttet, nachdem er mich vor all unseren Freunden eine verklemmte Zicke genannt hatte. Ich war so stolz auf sie gewesen, weil ich gewusst hatte, wie sehr sie sich zu dieser Zeit wünschte, von ihm beachtet zu werden.
Uns verband außerdem die Liebe zur Kreativität. Während ich meine Leidenschaft fürs Theater und das magische Gefühl, Texten Leben einzuhauchen, entdeckt hatte, hatte Leona begonnen, sich für das Backen zu interessieren. Schon als Teenager hatte sie die abgefahrensten Tortenkreationen erschaffen und mit dem Verkauf ihr Taschengeld aufgebessert. Dass sie ihr Hobby irgendwann einmal zum Beruf machen würde, war abzusehen gewesen. Tatsächlich hatte sie sich bald einen Namen als Konditorin gemacht und sogar für Elton John eine Geburtstagstorte gebacken. Bevor die damals ausgeliefert worden war, hatten wir ehrfürchtig die Hände darüber ausgebreitet und Can You Feel the Love Tonight gesungen – der Soundtrack zum Lieblingsfilm unserer Kindheit.
Dass mir Leona angeboten hatte, während meiner Kreativpause bei ihr im Laden in Covent Garden auszuhelfen, hatte nicht nur einen karitativen Hintergrund, sondern war auch fast ein Hilferuf, da zwei ihrer Mitarbeiter auf unbestimmte Zeit ausfielen. Ich half natürlich liebend gern. Und da ich im Verkauf, im Gegensatz zur Backstube, den wenigsten Schaden anrichten konnte, wurde ich nach einer äußerst spärlichen Einführung ins Geschäft seitens meiner Freundin an meinem ersten Arbeitstag blindlings in die Schlacht geschickt, wie sie das Morgengeschäft nannte. Tatsächlich kam es mir vor, als würden einige Kunden um ihr Leben und nicht um einen Bagel kämpfen. Ich war verloren und hätte am liebsten gleich wieder alles hingeschmissen, biss mich aber durch. Nicht zuletzt, weil ich Leona nicht hängen lassen und enttäuschen wollte.
Von Tag zu Tag wurde es besser. Ich hatte zwar immer noch keinen Überblick über unser Sortiment, doch ich kämpfte mich durch und durfte bleiben. Und tatsächlich blühte ich auf, so ganz weit weg von meinem ehemaligen Alltag, der zum größten Teil aus Probenstress, Leistungsdruck und dem Konkurrenzkampf mit anderen Schauspielern bestand. In meiner Welt drehte sich plötzlich alles um Gebäck. Von süß bis sauer. Von salzig bis scharf.
Gewissermaßen vermisste ich den Applaus zwar – eine Sehnsucht, die jeder Künstler, der einmal auf einer Bühne stand, kennt. Das Rauschen von klatschenden Händen, untermalt mit Beifallsrufen, kam einer Seelendusche gleich. Nun fing ich an, mich genauso sehr über das Trinkgeld zu freuen. Es stimmt: Manchmal zählen die kleinen Gesten. Ein Lächeln inmitten all der Hektik zum Beispiel. Ein Dank, anstatt mir die Tüte aus den Händen zu reißen und wortlos zu verschwinden.
Langsam merkte ich mir die Gesichter. Die drei Mädels vom Schuhgeschäft die Straße runter kamen zum Beispiel jeden Tag, um Kaffee und Sandwiches zu kaufen. Ich mochte sie, weil sie wirklich nett waren – und die Schuhe, die sie trugen, einfach der Hammer waren. Dann gab es diesen gestressten Bankier, der sein Handy immer entweder am Ohr oder in der Hand hielt. Meine Aufgabe, hatte ich beschlossen, bestand darin, ihn zum Lächeln zu bringen. Eine Mission, die utopisch erschien.
Und dann gab es da noch ihn.
Er kam fast jeden Tag und war immer in Begleitung dieser hübschen, dunkelhaarigen Frau mit den unglaublich langen Beinen und einem entwaffnenden Lächeln. Sie trug teuer aussehenden Schmuck, stylishe Kleidung, und ihr Haar war entweder perfekt gelockt oder perfekt geglättet. Es schimmerte spektakulär im bläulichen Licht der Deckenlampen, und häufig stellte ich mir vor, dass sie nebenbei als Model für Haarshampoos arbeitete. Ich zumindest hätte mir das Produkt, für das sie warb, sofort gekauft.
Seine Begleitung, die ich für seine Frau oder zumindest für seine Freundin hielt, trat jedes Mal ohne ihn an unseren Verkaufstresen. Er blieb im Hintergrund und war stets mit seinem Handy oder seiner Zeitung beschäftigt.
Vom ersten Augenblick an hatte er meine Aufmerksamkeit. Seine Größe und die aufrechte Körperhaltung strahlten Stolz aus. Sein Haar war fast ebenso dunkel wie das seiner Freundin. Er trug es an den Seiten kürzer, oben länger. Manchmal war sein Bart länger, manchmal hatte er ihn fast ganz abrasiert. Ich konnte mich nicht entscheiden, welcher Look mir an ihm besser gefiel, entschied mich dann aber, dass er in jeder Lebenslage attraktiv war. Ich hatte nur noch Augen für ihn, aber seine Begleiterin fungierte wie ein Schutzschild zwischen uns, als wüsste sie genau, wie er auf Frauen wirkte. Dabei war ich keines dieser Mädchen, das sich an vergebene Männer ranmacht. Zumindest dachte ich immer, genügend Ehrfurcht vor der Beziehung anderer zu besitzen.
Doch mit jedem Mal, mit dem ich ihn sah, wie er mich ignorierte und seine Freundin vorschickte, wuchs meine Neugier auf ihn. Wer war er? Wie war er? Würde er mich auf charakterlicher Ebene ebenso beeindrucken, wie es ihm durch sein Äußeres gelungen war, oder war er ein Arschloch? Ein überheblicher, gut aussehender Trottel?
Ich wusste zwar, dass sie beide im Gebäude schräg gegenüber arbeiteten, doch irgendwann reichte auch diese Information nicht mehr aus, um meine Faszination für diesen Fremden zu stillen.
Wann war ich zur krankhaften Stalkerin mutiert?
Ich glaube, Leona hatte recht – ich brauchte ein Hobby.
Manchmal war ich überzeugt, dass er einfach nur eingebildet war und es nicht für notwendig hielt, sich mit einer schnöden Verkäuferin abzugeben. Dafür war seine dunkelhaarige Begleitung aber umso höflicher. »Die Zitronentarte, die du mir gestern empfohlen hast, war übrigens hervorragend.«
»Freut mich, wenn sie dir geschmeckt hat. Wenn ich es richtig verstanden habe, wird nächste Woche wieder Nachschub produziert.«
»Sicher mir bitte ein Stück«, bat sie und zückte ihre Brieftasche. »Ich glaube, heute nehmen wir bloß zwei Croissants.« Kurz drehte sie den Kopf zu ihrem Begleiter, aber er blickte weiter auf sein Handy. »Ja, das entscheide ich jetzt mal ganz spontan.«
An diesem Tag nahm ich all meinen Mut zusammen. Getrieben von der Wirkung des Fremden, entschloss ich mich, im Privatleben dieser beiden Menschen zu graben. »Du arbeitest drüben in dem Gebäude mit der roten Tür«, sagte ich, steckte zwei Croissants in eine Papiertüte und ließ ein unsichtbares Fragezeichen stehen.
Die Frau nahm die Tüte und erklärte mir: »Richtig. Wir teilen uns das Haus mit einem Zahnarzt. Diese permanente Konfrontation mit meinen Ängsten hat aber bis jetzt noch nicht geholfen. Ich halte die Bohrgeräusche immer noch nicht aus.«
Ich lächelte und sah erneut zu ihm. »Dann bist du also Architektin und keine Zahnärztin?«
»Du meine Güte, nein. Ich saniere lieber Häuser statt Kiefer.« Sie bezahlte und verschwand mit ihm im Schlepptau.
Als er ihr beim Rausgehen die Tür aufhielt und seine Hand auf ihren Rücken legte, empfand ich Eifersucht, aber auch Freude über seine offensichtliche Zuneigung dieser Frau gegenüber. Ich hatte nicht allzu viel über ihn in Erfahrung bringen können, wusste nun aber, dass er zumindest kein egoistischer Macho war. Ich hielt ihn für jemanden, der die Leute gut behandelte, und das fand ich schön. Ganz egal, ob ich ihn jemals näher kennenlernen würde oder nicht. Für seine Distanziertheit musste es andere Gründe geben. Gründe, denen ich wohl niemals auf die Spur kommen würde.
Aber ich fand es fair, dass die sympathische Frau einen netten Mann an ihrer Seite hatte.
Als ich an diesem Abend Feierabend machte, ging ich nicht, wie Leona mir angeboten hatte, mit in einen Pub gleich in der Nähe, sondern fuhr nach Hause. Auf dem Weg zur Tube blieb ich vor dem Gebäude mit der roten Tür und der dunkelblau vertäfelten Fassade stehen. Auf einem Messingschild, das neben dem Treppenaufgang angebracht worden war, entdeckte ich schließlich den Namen der Firma, für die die Frau arbeitete – Price Architecture.
In der Tube sah ich mir auf meinem Smartphone die Firmenhomepage an und fand dort tatsächlich ein Foto des Mannes, der meine Gedanken in den vergangenen Tagen beherrscht hatte. Sein Name war Eden Bail. Gemeinsam mit einer gewissen Charlize Bail war er also Angestellter des Architekturbüros. Sie hatten den gleichen Nachnamen. Mehr musste ich nicht wissen, damit mein Tag ruiniert war.
Während ich seufzend das Handy wegsteckte, beglückwünschte ich Charlize aber innerlich zu ihrem Ehemann und nahm mir vor, mir diesen aus dem Kopf zu schlagen.
Kapitel 3Madeleine
Leona und ich aßen unser Mittagessen häufig in ihrem Büro, welches durch eine Glasscheibe vom restlichen Betrieb abgetrennt war. Die Räumlichkeiten der Bäckerei waren suboptimal, es war eng, und ganz ehrlich, der Anlieferungsbereich war die Hölle. Doch Leona liebte den Laden. Er hatte ja auch wirklich Charme und war gemütlich – zumindest, was den Verkaufsraum anging. Sie hatte die Entdeckung ihres Geschäftslokals vor zwei Jahren sogar als »Glücksgriff« bezeichnet.
Meine Auszeit hätte ich natürlich auch mit einem globalen Roadtrip verbringen können, anstatt mich in Leonas Laden abzurackern. Ich hätte einen Rucksack packen, mich in ein Flugzeug setzen und zwölf Monate lang kulturelle Erfahrungen sammeln können. Doch erstens wollte ich Leona auf dieser Reise dabeihaben und zweitens wäre mir meine Entscheidung mit dem Verlassen des Landes so endgültig vorgekommen. Blieb ich in London, war ich dem Theater nahe. Ich war sozusagen auf der sicheren Seite. Offenbar, und das war mir erst gar nicht bewusst gewesen, hatte ich ein starkes Verlangen nach Kontinuität, die ich, um meine innere Ruhe zu bewahren, nur bis zu einem gewissen Grad strapazieren durfte.
Dass ich meinen Fuß immer noch in der Tür zu meinem eigentlichen Beruf hatte, musste auch Leona an diesem Tag zwischen zwei Bissen Hühnercurry feststellen. »Was ist das denn?«, fragte sie verdutzt in Richtung des Skripts, das zur Hälfte aus meiner Handtasche ragte.
Ich seufzte, wie ich es auch getan hatte, als mich das Päckchen meiner Agentur erreichte. »Meine Agentin ist der Meinung, dass ich perfekt in die Rolle der Sybil Vane passen würde. Sie hat mich überredet, das Stück zumindest zu lesen. Was nicht einmal so schwer war, wenn man bedenkt, wie sehr ich Wilde liebe.«
»Oh ja.« Leona verdrehte die Augen, was ich ihr durchgehen ließ. »Du bist völlig verknallt in den Kerl.«
»Als Liebe würde ich das nicht bezeichnen. Wenn schon bin ich verknallt in die Form seines Humors, die Weise, wie er Dinge auf den Punkt bringt und wie überspitzt er dabei manchmal klingt.« Ich holte schnell Luft, kam von meinem Oscar-Wilde-Trip runter und strich mit dem Finger nachdenklich über den Rand des Tellers vor mir. »Aber ich bin mir im Moment einfach so unsicher. Was, wenn ich die Rolle bekomme und es dann nicht schaffe, meinen eigenen Standards gerecht zu werden? Dann werfe ich mir das bis in alle Ewigkeit vor.«
Leona nippte an ihrem Schwarztee. »Es könnte aber auch passieren, dass du durch diese Rolle wieder zurück zu deiner alten Stärke findest.«
Oder ich würde noch tiefer fallen, wenn ich die Rolle der Sybil Vane erst gar nicht bekam. Davor hatte ich in Wahrheit nämlich die größte Angst.
Ich zuckte mit den Schultern und wollte das Thema beenden, bevor Leona anfing, auf meinen schmerzhaften Punkten herumzudrücken. »Ich werde es mir einmal in Ruhe ansehen und im Anschluss entscheiden, wie es weitergehen soll.«
»Meine Unterstützung hast du, Maddy. Du kannst, solange du möchtest, hier arbeiten. Ich bin wirklich froh über deine Hilfe.«
Ich griff nach Leonas Hand, schenkte ihr ein herzliches Lächeln und aß mein Curry auf.
Im Anschluss kehrte ich zurück an meinen Arbeitsplatz. Es war ein normaler Tag, vielleicht war es sogar etwas ruhiger als üblich. Dennoch taten mir abends die Beine weh.
Bevor ich die Bäckerei verließ, tauschte ich meine weißen Sneakers gegen pfirsichfarbene Ballerinas und öffnete meine zusammengebundenen, ein wenig zerwühlten Haare. Draußen auf dem Bürgersteig stöpselte ich mir meine kabellosen Kopfhörer in die Ohren, schaltete Musik von Goody Grace ein und trottete in Richtung Tube-Station. Mein Weg führte mich vorbei an einem Bekleidungsgeschäft, einem Restaurant und dann an dem Gebäude mit der roten Tür und der dunklen Fassade.
Mein Herzschlag beschleunigte sich, als ich Eden Bail die Treppe, die zu dem Architekturbüro führte, herunterkommen sah. Uns trennten nur wenige Schritte, doch er hatte mich nicht bemerkt, während ich stehen geblieben war, um diesen für mich so faszinierenden Mann zu beobachten. In seiner rechten Hand hielt er eine Aktentasche, die halb von seinem Jackett bedeckt wurde, das er sich über den Arm gelegt hatte. Zielsicher steuerte er auf einen schwarzen Wagen zu, der am Straßenrand parkte. Er öffnete die linke Hintertür, warf Tasche und Jackett auf die Rückbank und blickte dann direkt in meine Richtung.
Sein Blick aus den braunen Augen, die im düsteren Abendlicht noch sehr viel dunkler wirkten, glitt urteilend über mich. Es war, als hielt er mich für einen unliebsamen Eindringling in seine Privatsphäre. Als wäre ich bereits zu weit gegangen, weil ich dieselbe Straßenseite wie er benutzte. Er wollte mich in die Flucht schlagen, so viel stand fest.
Es mochte jedoch diesem geheimnisvollen Leuchten seiner Augen und meiner unbändigen Neugier geschuldet sein, dass ich die Schultern straffte und einen Schritt auf ihn zu machte. Eden Bail warf die Autotür zu und taxierte mich weiterhin wie ein wildes Tier, dem er nicht traute. Ich schluckte und bemühte mich, mein Lächeln aufrechtzuerhalten, bis ich auf gleicher Höhe mit ihm war.
Mir fiel auf, dass ich ihm noch nie so nahe gewesen war und deshalb im ersten Moment von seiner Größe überrascht war. Dazu hatte er breite Schultern, war aber trotzdem schlank. Vielleicht war es auf die Faszination zurückzuführen, die ich für diesen Mann entwickelt hatte, aber ihn schien eine besondere Aura zu umgeben. Eine Energie, die nach mir schrie und mich einwickelte wie die stacheligen Ranken einer Rosenhecke.
Und tatsächlich schmerzte mich jede Begegnung mit Eden Bail auf unerklärbare Weise. Mal war dies seiner Ignoranz, mal der Vermutung, dass er einer anderen gehörte, geschuldet. Heute erschütterte mich sein deutliches Signal, dass er nichts mit mir zu tun haben wollte.
Doch weil ich dem Mysterium seiner offensichtlichen Aversion mir gegenüber auf die Spur kommen wollte, blieb ich stehen und würgte ein »Hi« hervor.
Eden Bail kniff daraufhin bloß seine Lippen und seine Augenbrauen zusammen.
»Wir kennen uns … aus der Bäckerei. Erinnerst du dich? Mein Name ist Madeleine. Ich … Ich wollte bloß mal Hallo sagen.« Ich verstummte, als er, anstatt irgendetwas zu erwidern, die Fahrertür öffnete und einstieg.
Zumindest besaß er genug Anstand, das Gesicht kurz entschuldigend zu verziehen, ehe er die Wagentür hinter sich zuzog und den Motor startete.
Weil ich Stärke zeigen wollte, reckte ich das Kinn. Doch sobald Bail davongefahren war und ich wie ein völliger Schwachkopf allein auf dem Bürgersteig stand, verwandelte ich mich in ein jämmerliches Häufchen mit tränenfeuchten Augen. Ich wusste nicht, ob ich sagen konnte, dass man mit dreiundzwanzig schon viel erlebt hatte, aber zumindest hatte mich noch nie jemand mit so wenigen Worten fast zum Heulen gebracht.
War etwas falsch mit mir? Stank ich? Oder hatte ich es verbotenerweise gewagt, die ach so wertvolle Zeit dieses Mannes für mich zu beanspruchen?
Ich wusste, dass ich zwei Möglichkeiten hatte, damit umzugehen. Ich konnte den restlichen Abend entweder Trübsal blasen oder aber mit Leona ordentlich einen draufmachen.
Mit einem süffisanten Grinsen kaufte ich daher zwei Flaschen Rotwein, schickte Leona ein Bild davon und fühlte mich in diesem Moment tatsächlich ein bisschen erhaben.
Kapitel 4Eden
Wir trafen Carol und Peter Sanders im Pub gegenüber von unserem Büro, der sich zu Charlize’ Hotspot entwickelt hatte – zumindest, wenn es ums Mittagessen ging. Meist holte sie für uns beide Essen von dort und versuchte, mich mit irgendwelchen ausgefallenen Kreationen zu ihrem vegetarischen Glauben zu bekehren. Bis jetzt war sie daran aber gescheitert. Ich wusste auch nicht, was mit mir nicht stimmte, aber ich konnte Tofu einfach nichts abgewinnen.
Während Charlize also einen fleischlosen Burger aß, hatten die Sanders und ich die tierische Antwort darauf gewählt. Die Sanders, beide etwa Mitte dreißig, zählten zu der Sorte neureich, die ich, wenn es ums Geschäft ging, schätzte, da ihnen nichts zu teuer zu sein schien. Privat war ich anderer Meinung – aber die hatte hier und heute nichts zu suchen.
Peter Sanders hatte, wie er zwischen zwei Bissen verriet, seine erste Million durch harte Arbeit und seine zweite durch kluges Investment verdient. Dass nach dem obligatorischen Sportwagen, der draußen vor der Tür parkte, nun eine attraktive Luxusvilla folgte, war abzusehen.
Peter Sanders, der Nörgeln zu seinem liebsten Hobby auserkoren zu haben schien, mit Essen ruhigzustellen, war Charlize’ Idee gewesen. Offensichtlich erfolgreich.
Bald würde Charlize ihren Abschluss in der Tasche haben und von meinem Boss Joseph Price hoffentlich übernommen werden. Ich hatte ihr den Praktikumsplatz verschafft, sie unter meine Fittiche genommen und ihr zunehmend mehr Aufgaben übertragen, die sie allesamt mit Bravour meisterte. Beruflich wie privat waren wir ein echtes Dream-Team.
Als solches gelang es uns, die letzten Details für die Planung zu besprechen. Mein bereits zur Hälfte gefüllter Block lag vor mir. Die Ideen sprudelten nur so aus Charlize heraus. Sie und Carol wurden sich schnell einig, während Peter die Unterhaltung argwöhnisch verfolgte.
Als er sich gerade über einen Vorschlag seiner Frau beschwerte, wanderte mein Blick zu einer Sitznische an der Fensterfront. In einem grünen, mit Samt bezogenen Ohrensessel sitzend, die Nase in ein abgegriffenes Buch vergraben, entdeckte ich jene Frau, die in den vergangenen Tagen unwillkürlich Bestandteil meiner Gedankenwelt gewesen war. Schuld daran war zu einem Großteil ihre Aufdringlichkeit, aber auch ihre ständige Heiterkeit, von der ich mich weigerte, irgendeine Wirkung bei mir erzeugen zu lassen.
Wurde ich mit der Fröhlichkeit anderer Menschen konfrontiert, lief ich weg. Doch ich tat das nicht aus Angst, sondern weil es furchtbar ermüdend war, sich etwas zu stellen, das in meinem Leben keinerlei Bedeutung mehr hatte.
Das banale Glück einer lustigen Unterhaltung war für mich gleichzusetzen mit Aufdringlichkeit. Und Madeleine wollte reden. Sie wollte mich vollquatschen, wollte Kontakt zu mir knüpfen, und vielleicht war sie zur Krönung auch noch scharf auf mich.
Für einen Peter Sanders bedeutete wahrscheinlich der Anblick einer weiteren Million auf seinem Konto pure Glückseligkeit. Und inmitten all dem war ich froh, den nächsten Atemzug machen zu können.
»Eden, wo hast du den Vermerk zur Energieersparnis eingefügt?«, kappte Charlize’ Frage mein Interesse rund um diese Madeleine und katapultierte mich zurück ins wahre Leben.
Ich fand die Notiz sofort und tippte mit meinem Finger auf das Blatt in der Tischmitte. Dabei begegnete ich dem besorgten Blick von Peter Sanders, der mich ansah, als wäre ich eine tickende Zeitbombe. Sanders war nicht der erste Mensch, der mir dieses Gefühl gab.
Er kriegte sich jedoch schnell wieder ein, wandte sich ab und versuchte, sich auf die Fakten zu konzentrieren, die Charlize runterratterte. Ich hingegen nutzte die Chance, ein weiteres Mal zur Sitznische zu linsen. Madeleine las mit gerunzelter Stirn, starrem Blick und bewegte dabei kaum merklich ihre Lippen.
Schon allein das regte mich irgendwie auf. Diese Freimütigkeit. Diese Unbefangenheit. Dass diese nervtötende Frau immer genau dort aufkreuzte, wo auch ich war. Dass es ihr dann auch noch gelang, meine Aufmerksamkeit zu gewinnen, war der Gipfel der Absurdität.
Ich schloss frustriert die Augen und war unglaublich dankbar, als Charlize ihren Vortrag beendete und die Sanders ihre Getränke leerten. Sie vertrödelten keine Zeit mit weiterem Small Talk – schließlich musste die nächste Million ja auch irgendwie verdient werden. Stattdessen erhoben sie sich, ließen sich zu einer unpersönlichen Verabschiedung herab und zogen schleunigst von dannen.
»Es lief doch gut«, stellte Charlize resümierend fest.
Ich zuckte zuerst die Schultern, nickte dann aber, als Charlize schnaubte. Während sie die Unterlagen einsammelte, ging ich schnell zur Toilette.
Als ich zurückkehrte, stand Madeleine vor unserem Tisch. Unsere Blicke trafen sich nur ganz kurz. Ihre Augen waren grün und strahlten. Wie meine wohl auf sie wirkten? Braun und verbittert?
In diesem winzigen Moment spürte ich sofort den imaginären Druck eines Lastwagens auf meiner Brust. Am liebsten wäre ich aus dem Laden gestürmt, doch ich blieb und beschäftigte mich, indem ich die restlichen Unterlagen in der schwarzen Ledertasche verstaute.
»Na ja, ich wollte dich auch gar nicht weiter stören«, murmelte Madeleine und presste sich das Buch mit dem bräunlichen Einband gegen die Brust.
Aus den Augenwinkeln nahm ich wahr, wie sie lächelte, ehe Charlize meinte: »Ich wünsche dir noch einen erholsamen freien Tag.«
»Danke, den werde ich haben.« Ein weiterer prüfender Blick zu mir, dann trat Madeleine den Rückzug an.
Bedauerte ich es, die Illusionen dieses Mädchens zerstören zu müssen? Ja … gewissermaßen.
Doch ihre immerzu freundliche Art erschien mir inmitten meiner Verdammnis auch wie der erste Lichtstrahl seit Ewigkeiten. Wie ein Rettungsseil, das man mir hinhielt und nach dem ich bloß greifen müsste.
Ich schüttelte den Kopf über meine irrwitzigen Trugschlüsse, von denen ich gedacht hatte, längst losgekommen zu sein, und schnappte mir stattdessen das Tablett mit den leeren Gläsern. Während Charlize bereits nach draußen ging, trug ich unser benutztes Geschirr zu dem silbernen Wagen neben der Theke.
Als ich mich umdrehte, stand Madeleine vor mir. Ihre Gesichtszüge waren zart – volle Lippen, zierliche Nase, große Augen. Sie war hübsch, überaus attraktiv sogar. Ich wettete, sie brauchte bloß zu lächeln und schon lagen ihr die Typen reihenweise zu Füßen.
Für mich hatte sie diesmal aber kein Lächeln parat, sondern musterte mich aufgebracht. »Ich habe mir vorgenommen, keine große Sache aus deinem Verhalten mir gegenüber zu machen. Aber … ich kann nicht anders. Es regt mich zu sehr auf, was für ein unverschämter … Idiot du bist.«
Sonst wurde ich von den Leuten in meinem Umfeld immer mit Samthandschuhen angefasst, es tat also erstaunlich gut, von dieser Frau als Idiot beschimpft zu werden.
Mit meinem Grinsen befeuerte ich ihren Unmut aber nur noch weiter.
»Leute wie du sollten mir egal sein. Ich sollte mich nicht weiter darum kümmern, was du über mich denkst oder wie du mich behandelst. Aber ich muss zu meiner Schande gestehen, dass mich deine Abneigung wirklich verletzt hat. Vielleicht kannst du mir einfach sagen, was ich dir getan habe, zum Teufel noch mal!«
Sie redete so laut, dass die Leute, die in unmittelbarer Nähe saßen, den Kopf hoben und uns neugierig musterten.
»Deine Freundin ist so nett. Du hingegen bist der respektloseste Kerl, dem ich jemals begegnet bin. Wie du mich da vorgestern auf dem Gehweg einfach hast stehen lassen. Das war überhaupt nicht freundlich.« Madeleine hob die Arme, ließ sie wieder sinken und seufzte. »Nur damit das geklärt ist: Ich wollte mich nicht an dich ranmachen oder so, sondern einfach nur höflich sein.«
Ihr sehnsüchtiges Warten auf irgendeine Erwiderung von mir verursachte Haarrisse in meinem Schutzpanzer. Leute wie Madeleine machten mich normalerweise unglaublich wütend. Leute, die dachten, ständig labern zu müssen. Sie würden nie begreifen, welchen Wert Wörter haben konnten. Vor allem für mich.
Meine Hilflosigkeit verleitete mich dazu, meine Brieftasche aus meiner Hosentasche zu ziehen und das laminierte Kärtchen, das Charlize für mich angefertigt hatte, zum allerersten Mal hervorzukramen. Denn während ich in die grünen Augen dieser Frau sah, erwachte in mir zum ersten Mal der Wunsch, mich zu erklären.
Mein Magen verknotete sich beim Anblick der Karte. Ich kniff die Augen zusammen, strich mit meinem Daumen über ihre glatte Oberfläche und wagte den emotionalen Sprung.
Die rosige Farbe in ihrem Gesicht wich schlagartig einem verzweifelten, reumütigen und mitleidvollen Weiß, als sie die Karte ansah.
Man könnte meinen, sie derart fassungslos zu erleben, würde mich mit Genugtuung erfüllen. Doch stattdessen schwappten ihre Gefühle auf mich über. Für einen kurzen Moment offenbarte ich ihr all meine Ängste. Und dieser Augenblick genügte, um mich dieser fremden Frau näher zu fühlen als den meisten Personen in meinem Umfeld.
»Sie können nicht sprechen«, fasste sie die Botschaft meiner Karte ergriffen zusammen.
Ich nickte zaghaft, verstaute die Karte an ihrem ursprünglichen Platz und verließ den Pub.
Kapitel 5Madeleine
Ich wollte Haltung zeigen.
Ich wollte den Fehler wiedergutmachen, den ich begangen hatte. Ich hatte deswegen zwar keine schlaflosen Nächte, empfand aber zumindest genügend Reue, um zwei Tage nach meiner letzten Begegnung mit Eden Bail vor dessen Büro auf ihn zu warten.
Ich hatte dafür sogar extra früher Feierabend gemacht und Leona belogen. Mit einem Stück Zitronentarte aus der Bäckerei brachte ich mich auf der Bank vor dem imposanten Gebäude in Stellung. Es wäre nicht verwunderlich, sollte Bail bei meinem Anblick die Polizei alarmieren.
Um siebzehn Uhr, die Zeit, zu der Price Architecture laut Homepage seine Pforten schloss, wurde ich nervös. Denn mal ganz abgesehen von der Herausforderung, eine Entschuldigung zu formulieren, hatte ich keine Ahnung, wie ich mit einem Menschen kommunizieren sollte, der selbst nicht sprechen konnte.
In den vergangenen Tagen hatte ich zu verstehen versucht, wie ich Bails Stummheit falsch hatte deuten können. Der Tag, an dem er in seinen Wagen eingestiegen war, ohne ein Wort mit mir zu wechseln – ich war überzeugt gewesen, dass er ein Mistkerl war. Seine Zurückhaltung in der Bäckerei – alles Indizien, die ich falsch gedeutet hatte.
Möglicherweise war er auch wirklich ein Mistkerl – ein stummer, verschlossener Mistkerl. Dennoch hatte ich Gewissensbisse, weil ich mich anderen Menschen gegenüber eigentlich nicht dermaßen aggressiv verhielt.
Die Ausgangssituation war kompliziert, meine Gefühle in Aufruhr, und mein Verstand wollte mich davon abhalten, von dieser Bank aufzustehen, um Bail erneut hinterherzulaufen. Ich war schlecht darin, Aussprachen zu führen. Vor allem dann, wenn es an einem essenziellen Bestandteil, nämlich der Sprache, fehlte.
Benutzte Bail seine Hände, um sich mitzuteilen? Setzte er bei seinem Gegenüber voraus, die Wörter von seinen Lippen ablesen zu können? Denn daran würde ich scheitern.
Meine Hemmschwelle, mich dieser Herausforderung zu stellen, war groß. Mein Wunsch, reinen Tisch zu machen, jedoch größer. Deshalb stand ich schließlich todesmutig auf, ging die vier dunkelgrauen Stufen hoch, öffnete die rote Tür und betrat den Eingangsbereich von Price Architecture.
Der Vorraum war mit blau satinierten Vintage-Fliesen ausgelegt und hatte beige gestrichene Wände, an denen schwarz gerahmte Bilder hingen. In der Stille des leeren Raums erschienen mir meine Schritte extrem laut. Für einen Rückzug war es daher zu spät. In einer der linken Türen, die neben drei anderen vom Empfangsbereich abging, erschien Bail. Er wirkte überrascht, leicht genervt sogar. Ihm war bestimmt klar, dass ich nicht hier war, weil ich ein Bauprojekt verwirklichen, sondern ihn vollquatschen wollte. Darauf schien Eden nicht wirklich Lust zu haben.
»Hi … ich schon wieder«, sagte ich zur Begrüßung. »Irgendwie tauche ich immer auf, obwohl du keine Lust auf mich hast.«
Wie blöd war ich? Ich klang wie eine Irre, die sich gleich die Klamotten vom Leib reißen würde.
Außerdem kam es mir auf einmal seltsam vor, zu sprechen. Als würde ich es Bail auf die Nase binden: Ich kann reden, du nicht.
Auch den zweiten Eindruck hatte ich mal gründlich versaut. Yeah.
Notiz an mich selbst: Leg dir bei der nächsten Aussprache besser vorher ein paar passende Worte zurecht. Das wird dich vor weiteren Peinlichkeiten retten.
Ich schwenkte die weiße Papiertüte wie eine Friedensflagge und hoffte, dies würde mein Gestammel relativieren. »Ich habe eine Kleinigkeit mitgebracht, mit der ich hoffe, etwas von deiner Zeit beanspruchen zu dürfen. Das wäre so eine Art Tausch: Zitronentarte gegen fünf Minuten mit dir. Also … irgendwie klingt alles, was ich in deiner Gegenwart sage, seltsam. Aber du weißt schon, was ich meine. Hoffentlich.«
Er schob seinen Unterkiefer nach rechts und taxierte mich prüfend. Dann deutete er mir mit seiner rechten Hand, ihm dorthin zu folgen, wo er gerade hergekommen war. Nervös tat ich das und fand mich in seinem Büro wieder.
Der Schreibtisch, der auf einem dunkelroten, orientalischen Teppich stand, bildete den Mittelpunkt des Raumes. Dahinter befand sich ein Fenster mit weißen Sprossen, das in einen Hinterhof zeigte, der erstaunlich grün und ansehnlich für einen Hinterhof war. Da Bail stehen blieb, setzte auch ich mich nicht hin. Als würde in der Papiertüte eine Bombe stecken, legte ich sie vorsichtig auf seinen aufgeräumten Schreibtisch.
Daran sollte sich Leona mal ein Beispiel nehmen. Bei ihr wusste man nicht einmal mehr, welche Farbe ihre Tischplatte hatte.
»Ich wollte mich noch einmal aufrichtig bei dir für mein Verhalten entschuldigen«, begann ich und studierte seine strenge Mimik. Ich glaubte aber, darin einen Hauch von Bewunderung wahrzunehmen. Vielleicht überlegte er auch nur, wie er sich gegen die Irre in seinem Büro zur Wehr setzen konnte, sollte ich handgreiflich werden.
»Ich hätte mich dir weder derart peinlich aufdrängen noch dich einen Idioten nennen dürfen. Manchmal schadet es nicht, sich eine Sekunde Zeit zu nehmen, um das Verhalten anderer Menschen zu hinterfragen. Ich habe nicht über den Tellerrand hinausgeblickt, sondern gedacht, du hättest etwas gegen mich persönlich. Ich wusste nicht, dass …«
Mir fiel nicht einmal ein Wort für Bails Stummheit ein. In meinem Kopf hörte sich jede Bezeichnung heikel an. Schließlich wollte ich ihn nicht gleich wieder beleidigen.
Mir lag ein »Tut mir leid für dich« auf den Lippen, das ich aber nicht aussprach, weil ich glaubte, Bail würde mir diese unpassende Mitleidsbekundung übel nehmen. Er schien stark, nicht nur körperlich, sondern auch charakterlich. Ich glaubte nicht, dass er jemand war, der sich von seinem Schicksal niederringen ließ.
Ihn auf seine Defizite zu reduzieren, wäre total abwertend.
Ich ließ mich aber davon, wie er mich musterte, stark verunsichern und kam mir seinem Urteil ausgeliefert vor.
Irgendwann kniff er seine Augen zusammen, griff nach der Tüte und sah hinein. Danach grinste er nachtragend, lehnte sich gegen seinen Schreibtisch und schrieb etwas auf einen handlichen Ringblock. Wie auch schon die Karte im Pub drehte er die Vorderseite des Blattes zu mir, sodass ich lesen konnte, was er geschrieben hatte.
»Und du gehst davon aus, dass ich auch jetzt nichts gegen dich persönlich habe, sondern bloß ein stummer Idiot bin?«
Er machte es mir echt nicht leicht, sondern ließ mich eiskalt abblitzen. Schriftlich, aber punktgenau. »Ich … Weißt du, darum geht es auch gar nicht. Ich bin nicht hergekommen, um dein Lieblingsmensch zu werden, sondern um mein Gewissen zu erleichtern.«
Seine Nasenflügel blähten sich auf, während er schrieb. »Wie humanitär. Den Punkt der Selbstlosigkeit kannst du auf deiner Bucket List also abhaken.«
Wir betrachteten einander. Bail taxierte mich erneut von oben bis unten, presste die Lippen aufeinander und steckte die Hände in die Taschen seiner schwarzen Anzughose.
»Du hast recht«, sagte ich. »Meine Entschuldigung ist nicht ehrlich. Du hast sie nicht einmal verdient. Im Grunde habe ich ja gar nichts falsch gemacht. Zufälligerweise haben sich unsere Wege mehrmals gekreuzt, und das nimmst du mir übel.«
Ich schaute ihm zu, wie er an einer Antwort feilte. Er hatte lange, schlanke Finger, kein Ring, kein Anzeichen dafür, dass Charlize seine Frau war. »Ich nehme dir übel, wie herablassend du klingst. Und nur um eins klarzustellen: Heute haben sich unsere Wege nicht zufälligerweise gekreuzt, sondern du bist absichtlich hergekommen.«
»Ich klinge herablassend?«, fragte ich und tippte mir mit dem Finger an die Brust.
Er nickte.
»Ich wollte freundlich sein, mehr nicht.«
Das Lächeln, das er mich sehen ließ, war unaufrichtig und trist zugleich, und ich spürte, dass er vorgab etwas zu sein, was er in Wirklichkeit nicht war. Er wollte niemanden an sich heranlassen, deshalb war er vermutlich so gemein. Aber hinter dieser Fassade glaubte ich, etwas zu erkennen, das mein Herz berührte. Etwas Trauriges, Verzweifeltes.
Ich erinnerte mich an Mr Hayts, den Nachbarn meiner Eltern, der alle Menschen in seiner Umgebung terrorisierte. Beim kleinsten Lärm rief er die Polizei. Hatten wir früher als Kinder auf der Straße gespielt, hatte er aus dem Fenster gebrüllt, dass wir die Klappe halten sollten. Jeder mied ihn, niemand mochte ihn. Irgendwann aber war herausgekommen, dass seine Frau und seine Tochter bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen waren und er seither gegen seine Trauer ankämpfte. Wegen seines Schmerzes hatte er eine Ablehnung gegen Fröhlichkeit und Kinderlachen entwickelt und sich seine eigene einsame Insel gebaut.
Seit ich über Mr Hayts’ Vergangenheit Bescheid wusste, sah ich ihn mit anderen Augen. Ich nahm mir nicht mehr alles, was er tat oder sagte, zu Herzen. Ich hatte Verständnis für ihn, dachte sogar, dass er Hilfe gebraucht hätte.
Bail strahlte die gleiche Verbitterung aus – und das in seinem jungen Alter. Er konnte nicht viel älter sein als ich. Was also war ihm widerfahren?
»Spar dir deine verdammte Freundlichkeit!«, teilte mir dieser handschriftlich mit und brachte meine Gedanken zurück ins Hier und Jetzt.
»Das werde ich«, erwiderte ich und schob meinen Vorsatz, Bail verständnisvoll zu begegnen, aufgrund seiner verletzenden Worte beiseite. »Lass mich noch eins sagen, bevor du mich rauswirfst: Das Schicksal mischt die Karten, und wir spielen. Vielleicht solltest du dir überlegen, welches Spiel du gern spielen möchtest.«
Mit Schopenhauers Zitat traf ich ihn, brachte ihn genauso aus der Fassung, wie ich es gehofft und geplant hatte. Seine Augen weiteten sich, seine Körperhaltung verlor an Spannung, und es war, als würde er jeden Augenblick zusammenbrechen.
Als würde der Schmerz, der in ihm schlummerte, auf mich überschwappen, hatte ich plötzlich Tränen in den Augen. Ich atmete durch, presste meine Handtasche an meine Brust und zwang mich, zu gehen.
»Ich wünsche dir alles Gute«, sagte ich, drehte mich um und verließ sein Büro.
Kapitel 6Madeleine
Der Punkt war, dass ich etwas anderes fühlte, als ich mir einzureden versuchte.
Mein Kopf war überzeugt, Bail eine passende Lehre erteilt zu haben. Das Schicksal mochte so manches Mal unfair sein, doch es gab nun einmal Dinge, die man nicht ändern konnte, sondern akzeptieren musste. Das gab ihm also nicht das Recht, mich so zu behandeln.
Mein Bauch hingegen fand, dass es tatsächlich überheblich war, einem Menschen Ratschläge zu erteilen, der gefangen in einer Welt der Sprachlosigkeit war. Ich war mehr und mehr davon überzeugt, dass ich nicht besonders sensibel auf Edens Verhalten reagiert hatte, weil seine Situation für mich so neuartig und fremd war. Dabei hielt ich mich für weltoffen und aufgeschlossen. Das war ich aber offenbar nicht.
Ich hätte ihm Raum geben müssen, mir seine Lage zu erklären. Stattdessen hatte ich wie eine Besserwisserin geklungen.
Ich hatte leicht reden – im wahrsten Sinne des Wortes. Woher konnte ich wissen, dass ich mit dieser Bürde selbst nicht genauso verbittert wäre wie Bail? War man gesund, konnte man sehr viel leichter vermeintliche Ideale vertreten.
Mein Gefühl sagte mir, dass ich auch dieses Aufeinandertreffen mit Eden vergeigt hatte. Nur wusste ich diesmal nicht, wie ich die Wogen glätten sollte. Er kam nicht einmal mehr in die Bäckerei, und ich hatte wirklich nicht vor, ihn noch einmal in seinem Büro zu besuchen.
Zwei Tage, nachdem ich ihn das letzte Mal gesehen hatte, ging ich auf meinem Nachhauseweg wieder mal am Architekturbüro vorbei. Während ich die Straße überquerte, verließ Eden gerade das Gebäude. Als er mich entdeckte, blieb mir keine andere Wahl, als mich ihm erneut zu stellen.
Niemals würde ich ihm aber zeigen, wie viel Unruhe er in mir auslöste oder wie verunsichert ich war. Er war stur, aber ich wollte sturer sein.
Diesem Vorsatz folgend, setzte ich einen Fuß vor den anderen, so lange, bis ich direkt am Absatz der Sandsteintreppe angekommen war. Eden umklammerte das dunkle Metallgeländer, hatte wie üblich seine Lippen zusammengepresst und kam direkt auf mich zu. Er versperrte mir den Weg. Nicht nur das missfiel mir, sondern auch, dass ich den Kopf in den Nacken legen musste, um zu ihm aufblicken zu können. Er war groß, einschüchternd, und dennoch schlug mein Herz in seiner Nähe einen Takt schneller.
Ich musste daran denken, dass ich vor Kurzem gelesen hatte, wie sehr Pheromone unsere Wahrnehmung trüben konnten. Eden schien eine Duftnote zu verströmen, die sich perfekt an meine Rezeptoren anpasste. Mir einzureden, dass hier nichts Monumentales, sondern bloß eine chemische Reaktion stattfand, half. Ansonsten wäre ich wohl längst weggelaufen.
Schließlich zog er einen kleinen gelben Block mit blauen Linien darauf aus seiner Jackentasche. Mit dem Bleistift, der folgte, schrieb er: »Ich habe nachgedacht. Nicht du warst herablassend, sondern ich selbst.«
Ich folgte dem kräftigen Schwung jedes einzelnen Buchstabens auf dem gelben Untergrund, während ich einzuordnen versuchte, wie ich auf seine Entschuldigung – wenn es eine war – reagieren sollte.
Doch alles, was ich dann von mir gab, war ein wenig geistreiches »Okay«.
Bail leckte sich über die Lippen, und beide wichen wir einem älteren Pärchen aus, das sich an uns vorbeiquetschte. Die Dame beschwerte sich mit nasaler Stimme, dass wir im Weg stehen würden und uns einen anderen Platz für unser Geplänkel suchen sollten. Zerknirscht lächelnd blickte ich zu Boden, als Bail den Arm hob und mit dem Finger in Richtung roter Eingangstür zeigte. Ich folgte seiner Bewegung mit dem Blick und wusste genau, was er mir nonverbal vorschlug.
Wollen wir uns in meinem Büro unterhalten?
Zuerst wollte ich ihn auf die gleiche schroffe Weise abblitzen lassen, wie er es bei mir getan hatte, aber dann atmete ich durch, sah in sein schönes Gesicht mit dem traurigen Ausdruck darauf. Damit hatte er mich.
Ich nickte und stieg hinter ihm die Treppe hoch. Mein Herz schlug laut und schnell in meiner Brust. In jeder Hinsicht fühlte sich das Betreten dieses Büros verboten an. Auch deshalb, weil ich vor nicht einmal einer Stunde gegenüber Leona noch betont hatte, was für ein Arsch dieser Eden wäre. Aber ich konnte nicht anders und ließ mich von dem Geheimnis, das ihn umgab, um den Finger wickeln.
Ich wäre das ideale Opfer für einen kranken Serienmörder.
Gott, hoffentlich war Bail kein kranker Serienmörder.
Sein Büro war unverändert aufgeräumt. Er knipste eine Stehlampe in der Ecke an, während ich demonstrativ Abstand zu ihm hielt.
Er drehte sich um, lehnte sich wie beim letzten Mal gegen seinen Schreibtisch und klopfte, um Worte ringend, mit dem Bleistift unruhig auf den Block in seiner Hand. Ich stellte mir vor, dass er genauso oft an unsere Unterhaltung von neulich dachte wie ich. Denn ich hatte jedes Wort analysiert und wollte herausfinden, welchen Fehler ich gemacht hatte.
»Weil ich nicht sprechen kann, sehen sich manche Leute gezwungen, mich anzustarren, mir indiskrete Fragen zu stellen oder mich zu behandeln, als wäre ich ein kleines Kind. Verstehst du?«, schrieb er.
Ich nickte. »Das kann ich mir vorstellen. Und du denkst, ich bin einer dieser Menschen?«
»Zuerst dachte ich das, ja. Offenbar habe ich mich getäuscht. Ich glaube dir. Du wolltest bloß höflich sein, und ich habe dich eiskalt abblitzen lassen. Das tut mir leid.«
Ich schätzte seine Entschuldigung und strich nachdenklich mit den Fingerspitzen über die dünne goldene Kette um meinen Hals. Edens Blick folgte der Bewegung meiner Finger, woraufhin sich mein Innerstes sehnsüchtig zusammenzog. Dieser kurze Moment schien mir zu intim, weshalb ich meine Hand schnell sinken ließ.
»Kann sein, dass ich dich etwas angestarrt habe, das hatte aber andere Gründe«, sagte ich und fasste mir innerlich an den Kopf. Charlize und Eden Bail – klingelt es da? Soll heißen, dass dieser Mann vergeben ist.
Er fuhr sich mit der Hand durchs Haar.
»Aber deine Entschuldigung ist … akzeptiert«, stotterte ich und grinste verlegen.
»Danke.«
Ich hatte keine Ahnung, woher der plötzliche Ansturm aus Emotionen kam, doch beim Anblick dieses Wortes traten mir Tränen in die Augen. In diesem Moment fand ich das Leben schrecklich ungerecht. Dieser junge Mann, der vor Energie nur so strotzte, der sein Leben noch vor sich hatte und offensichtlich auch ehrgeizig war, konnte sich mit nicht mehr als diesen handgeschriebenen Notizen ausdrücken.
Ich zwang mich, durchzuatmen und rang um Fassung. »Danke, dass du die Sache zwischen uns nun doch klären willst.«
Er senkte den Kopf und schrieb erneut etwas auf den Block. »Der Auslöser dafür ist meiner Abhängigkeit von dem Süßkram, den ihr verkauft, zuzuschreiben. Wärst du vor zwei Tagen mit einem Lachssandwich aufgetaucht, würde es nicht so gut für dich aussehen.«
Mit Mühe unterdrückte ich ein albernes Kichern und grinste. Auch auf Edens Gesicht breitete sich ein Grinsen aus, das ihn noch hübscher aussehen ließ. Es war überraschend und neu, aber ich liebte es.
»Also, dich einen Idioten zu nennen und dann mit einem Lachssandwich hier aufzutauchen, wäre mein sicherer Tod gewesen«, meinte ich mutig.
»So was von.«
»Das werde ich mir merken, sollte ich irgendwann einmal wieder das Bedürfnis haben, dich völlig ungerechtfertigt zu beleidigen.«
Beide grinsten wir einander weiterhin zaghaft an.
Diese Begegnung war aus so vielen Gründen verändernd für mich. Ich begriff nun plötzlich, dass Edens Zurückhaltung, wann immer er in die Bäckerei gekommen war, nichts mit Geringschätzung zu tun gehabt hatte, sondern seiner Stummheit geschuldet gewesen war. Ich lernte aber auch eine neue, achtsamere Seite an mir kennen. Schließlich war ich ein Mensch, der gern mal, wie Leona häufig anmerkte, wie ein Wasserfall plapperte. Worte waren üblicherweise mein liebstes Werkzeug.
Doch hier im Büro dieses Mannes, der nicht in der Lage war, seinen Gefühlen verbalen Ausdruck zu verleihen, verstand ich, wie sorglos mein Leben eigentlich war. Eden drückte sich zwar gekonnt durch seine Mimik und Körperhaltung aus, trotzdem schaffte er es, mir seine tiefsten Gedanken zu verwehren.
Er war die Stille gewohnt. Ich nicht.
Sie machte mir zu schaffen. Verunsicherte mich.
»Tolles Büro … tolles Gemälde. Es ist … kraftvoll«, stammelte ich.
Einerseits wollte ich gehen, andererseits wollte ich bleiben, weil ich Eden als Mensch … als Mann spannend fand. Ich spürte, wie mein Körper auf seinen reagierte. Ich wollte ihm einfach nahe sein. So hatte ich mich schon lange nicht mehr gefühlt.
Eden musterte das Bild, das an der Wand links von ihm hing. Zugegeben, es war irgendwie verheißungsvoll dunkel. Schwarz, mit noch sehr viel mehr Grau und nur wenigen hellen Elementen. Man erkannte Formen, Striche, doch keine klare Gestalt. Meine plumpe Beschreibung war ganz sicherlich unwürdig für die Bedeutung dieses Bildes. Doch als Eden wieder zu mir sah, war sein Blick verändert – sanfter und offener irgendwie.
Er ließ den Stift erneut über das Papier kratzen. »Wie sieht’s mit Tee aus? Möchtest du welchen?«
Irgendetwas hinderte mich daran, seine Einladung sofort anzunehmen. Vielleicht war es meine Angst vor dieser mir bisher völlig unbekannten Welt des Schweigens. Vielleicht war es eine höhere Macht, die mich davor schützen wollte, in Edens Abgründe abtauchen zu müssen. Doch das Flehen in seinen dunklen Augen verleitete mich zu einem entschiedenen Nicken.
Eden deutete auf die schwarze Ledercouch hinter mir, ehe er zu einem Sideboard ging, auf dem ein Wasserkocher sowie Tassen und Tee standen. Ich setzte mich, musterte ihn ungeniert und fragte mich insgeheim, wo ich da nur reingeraten war.
»Wie lange arbeitest du denn bereits als Architekt?«, wollte ich wissen, obwohl mir natürlich klar war, dass seine Antwort auf sich warten lassen würde.
Erst nachdem er zwei Tassen auf dem niedrigen Tisch zwischen uns abgestellt hatte, auf dem zur Couch passenden schwarzen Sessel Platz genommen und seine Erklärung auf den Block geschrieben hatte, wurde meine Neugier besänftigt. »Seit drei Jahren.«
Ich nickte beeindruckt. »Wie alt bist du?«
»27.«
»Scheint, als hättest du einen genauen Plan, den du ehrgeizig verfolgst.« Ehrgeiz war etwas, das ich an Männern wirklich sexy fand. Und davon hatte er anscheinend eine Menge.
Als Eden die Augen zusammenkniff und den Stift zwischen zwei Fingern drehte, war ich mir plötzlich unsicher, ob ich meine Gedanken nicht versehentlich laut ausgesprochen hatte. Ich griff nach der Teetasse und fing an, stoisch mit dem Löffel darin zu rühren.