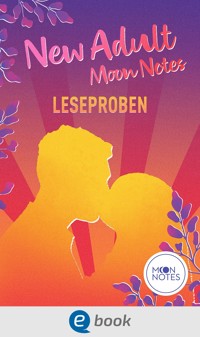
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Moon Notes
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
In unserem Sampler findet ihr Leseproben unserer schönen und romantischen Geschichten von Moon Notes. Wir haben Geschichten zum Lachen, Weinen und Mitfühlen. Frech, sexy, fantasievoll und voler Liebe. Das E-Book steht kostenlos zur Verfügung. Runterladen und loslesen! Folgende Autorinnen sind außerdem enthalten: Emma Lindberg; Sherin Nagib; Darcy Crimson; und Juli Dorne
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Sammlungen
Ähnliche
Über dieses Buch
In unserem Sampler findet ihr Leseproben unserer schönen und romantischen Geschichten von Moon Notes. Wir haben Geschichten zum Lachen, Weinen und Mitfühlen. Frech, sexy, voller Liebe und das aus der Mitte des Lebens.
Vielleicht ist hier euer nächstes Lieblingsbuch bereits dabei.
Über dieses Buch
Daphne zieht nach New York City – und damit mitten hinein in einen Krieg, der seit Jahrtausenden wütet. Sie ist die Tochter von Zeus und ihr Gesicht das berühmteste der Menschheitsgeschichte. Doch es ist gleichzeitig ein Fluch: Sie sieht aus wie Helena von Troja, Auslöserin von Krieg und Verdammnis.
Daphne tut alles, um ihr Aussehen zu verbergen. Umso gefährlicher ist es, als sie eines Tages ein Graffiti entdeckt, das ihr Antlitz zeigt und sie seltsam fasziniert. Der Künstler ist kein anderer als Ajax, der Sohn Apollos und ihr Todfeind.
Warum fühlt sie sich dennoch magisch von ihm angezogen? Ist es nur ihre Mordlust – oder steckt etwas viel Gefährlicheres dahinter?
ISBN 9783969810347
1
Ich habe erste Schultage schon immer gehasst. Natürlich kann ich nicht mit Sicherheit sagen, ob es einfacher gewesen wäre, wenn wir nicht so oft umgezogen wären. Dann hätte ich längere Zeit auf dieselbe Schule gehen können, und die anderen hätten sich vielleicht an mein Aussehen gewöhnt. Womöglich hätten sie mich sogar akzeptiert.
Aber wahrscheinlich nicht. Ist inzwischen aber auch egal. Ich bin dieses Jahr in die Oberstufe gekommen. Ich muss nur noch bis zum Schulabschluss überleben. Einen Tag nach dem anderen, richtig? Ich weiß, der Spruch kommt eigentlich von den Anonymen Alkoholikern, aber ich finde, dass man auch nach der Highschool eine zwölfstufige Therapie absolvieren sollte. Dann gäbe es später vermutlich viel weniger Alkoholiker.
Manhattan ist ganz anders als Massachusetts. Natürlich tauche ich auch hier nicht in der Menge unter, aber wenigstens falle ich nicht so auf wie in Wellesley oder davor in Duxbury oder all den anderen Orten, in denen wir im Laufe der Zeit gewohnt haben. Seit wir vor zwei Wochen hergezogen sind, bin ich mit ständig wechselnden Gesichtern durch die Stadt gewandert – Gesichtern, die keine Probleme verursachen. Ich konnte mich herumtreiben und die Stadt erforschen, ohne aufzufallen. Vorher war das unmöglich. In Kleinstädten erregen Fremde sofort Aufsehen, aber in Großstädten gibt es nur Fremde. Und eine Menge verrücktes Zeug. Und verrückte Leute. Ich habe festgestellt, dass ich das mag.
Ich finde es toll hier, auch wenn New York wahrscheinlich der gefährlichste Ort für mich ist. Ich fühle mich von allem inspiriert, was ich sehe. Selbst die schmutzigsten Wände können einen Geistesblitz in mir auslösen. Dazu gehört auch meine neueste Entdeckung, über die ich zufällig gestolpert bin: ein Graffiti-Künstler, der seine Tags – seine individuellen Signaturen – an der Mauer eines echt teuren Hochhauses hinterlassen hat. Sein Tag ist irgendwie einzigartig. Das Ganze erinnert eher an Guerilla-Kunst statt an Vandalismus. Die Bilder ziehen mich magisch an, doch den Namen des Künstlers konnte ich noch nicht erkennen. Graffiti sind halt schwer zu entziffern.
Ich gehöre nicht zu diesen Kunstverrückten, die bei jedem Bild loskreischen. Ich verstehe nichts von Malerei und habe auch kein Gefühl für Musik, aber diese Wandbilder sind anders. Ich schleiche mich raus, um sie anzusehen. Ich bin fasziniert. Es fühlt sich gut an, sich auf etwas zu freuen. Ist schon lange her, dass ich mich für irgendwas interessiert habe.
Um ein wenig Privatsphäre zu haben, verändere ich mein Gesicht auf der Suche nach den Werken des Sprayers. Ich nehme mir damit eine Auszeit von meinem eigentlichen Ich, doch die Flitterwochen sind fast vorbei. Ich kann an meinem ersten Schultag kein fremdes Gesicht tragen, obwohl es eine Menge Probleme vermeiden würde. Es ist aus zwei Gründen unmöglich. Erstens hat mein menschlicher Vater keine Ahnung, was ich bin, und es wäre ein echter Schock für ihn, ein fremdes Gesicht mit meinem Namen im Jahrbuch zu sehen. Und zweitens, was viel wichtiger ist, ist: Ich muss den Großteil jedes Tages mein eigenes Gesicht tragen, denn sonst würde Aphrodite der Welt die Liebe entziehen. Aber das erkläre ich später.
Heute und an jedem weiteren Tag muss ich in der Schule mein echtes Gesicht zur Schau stellen. Das Gesicht.
Ich sehe die Schüler und Schülerinnen in die exklusive Privatschule gegenüber vom Central Park strömen. Ich schlucke, die Hand noch am Türgriff. Ich sitze hier fest, will die Autotür nicht öffnen und hoffe wie verrückt, dass es diesmal anders sein wird. Wünsche mir, wenigstens diesmal eine Freundin zu finden.
Mein Fahrer betrachtet mich besorgt im Rückspiegel. Ich stoße die Tür der schwarzen Limousine auf, bevor er Ärger mit meinem Vater bekommt, weil er mich zu spät abgeliefert hat. Ich schaue im Gehen an mir herunter, auf das Poloshirt, den grün und blau karierten Rock, die weißen Strümpfe und die rotbraunen Schuhe. Ich überquere die Straße und betrete die Schule. Ich habe Angst, dass das Poloshirt zu eng ist und der Rock zu kurz, um meine Figur zu verbergen. Ich ziehe die Schultern hoch und setze eine mürrische Miene auf.
Sieh auf den Boden, befehle ich mir selbst. Bloß nicht lächeln.
Während ich mir einen Weg durch die übervollen Gänge bahne, spüre ich, wie Blicke mir folgen; erst wird geguckt, dann genauer hingesehen, und alle suchen nach irgendetwas an mir, das nicht perfekt ist.
Ich glaube, dass die meisten Menschen mich anstarren, weil sie es nicht glauben können. Sie tun es, weil sie sich vergewissern müssen, dass ich wirklich so makellos bin, wie sie nach ihrem ersten Blick vermutet haben, und sobald sie erkannt haben, dass es tatsächlich so ist, können sie nicht mehr aufhören zu glotzen.
Es sind überwiegend Leute mit irgendwelchen Defiziten, vor allem aber die oberflächlichsten Personen, die es nicht lassen können. Sie verfolgen mich und verehren mich wie einen Gegenstand. Und an den Schulen, auf die mein Vater mich bisher geschickt hat, herrschte kein Mangel an oberflächlichen Kids. Ich habe ihn angefleht, mich auf eine öffentliche Schule gehen zu lassen, aber er hat es nie erlaubt. Was würden seine ganzen einflussreichen Partner denken, wenn ich mich mit dem Plebs der Mittelschicht umgäbe? Vermutlich würden sie nie wieder ein Luxusgebäude mit ihm planen.
Ich versuche, mich auf den Lageplan zu konzentrieren, den ich in meiner Einführungsmappe gefunden habe. Ich merke, wie die Gespräche der anderen verstummen, sobald ich an ihnen vorbeigehe, gefolgt von Geflüster, das hinter mir aufbrandet wie eine zischende Flut. Ignorier sie einfach.
Ich betrachte die Nummern der Schließfächer an der rechten Seite, zähle abwärts und muss dann feststellen, dass vor meinem Fach eine Horde großer, lärmender Jungs herumsteht. Ganz offensichtlich Sportler, jeder von ihnen voller Testosteron und getrieben von diesem merkwürdigen ziegenartigen Drang, ständig ihren Kopf gegen irgendwas zu rammen. Ich spüre ein Kribbeln in den Fingerspitzen und verdränge meinen Kämpfe-oder-flieh!-Impuls. Am ersten Schultag jemanden aus Versehen auf dem Flur zu töten, ist etwas, das ich gar nicht brauche.
Aber als die Jungs mich entdecken, erstarre ich und wäre beinahe herumgewirbelt und geflohen.
»Ist das deins?«, fragt ein großer Typ mit sandfarbenen Haaren. Er tritt zurück und deutet auf mein Schließfach.
Ich nicke, schaue noch mürrischer drein und starre auf den Boden. Ich dränge mich an ihm und einem kleineren, dickeren Typen mit schwarzen Haaren vorbei. Ein weiterer Junge erscheint, und sie nehmen mich in die Zange.
»Du bist neu hier«, sagt der Sandfarbenhaarige. Ich merke sofort, dass er der Alpha ist und seine Ansprüche geltend machen will. So einen wie ihn gibt es an jeder Schule. »Wie heißt du?«
»Daphne«, sage ich und fummle am Zahlenschloss herum. Meine Hände zittern.
»Ich bin Flynn«, stellt er sich vor, und seine Stimme klingt jetzt viel leiser. Er kommt näher, aber ich bezweifle, dass es ihm bewusst ist. Ich glaube, diese Jungs merken gar nicht, dass sie mich eingekreist haben. Sie versperren mir den Fluchtweg. Wie ein Rudel wilder Hunde.
Blitze zucken unter meiner Haut, eine Reaktion auf die Bedrohung. Ich versuche, mich zu beruhigen. Ich sage mir, dass sie nichts dagegen tun können. Sie wollen mein Gesicht sehen – müssen es sehen –, und deshalb rücken sie mir so auf die Pelle. Ich frage mich, ob ich diesmal etwas anderes versuchen sollte. Wenn ich ihnen erlaube, mich zu betrachten, haben sie, was sie wollen, und lassen mich dann vielleicht in Ruhe. Ich streiche mir mit dem kleinen Finger das Haar hinters Ohr, richte mich zu meiner vollen Größe von eins achtundsiebzig auf und sehe Flynn direkt an.
Seine grauen Augen verlieren ihren Fokus, er schwankt auf mich zu, will zugreifen, mich besitzen, und seine Selbstbeherrschung ist wie weggeblasen. Blöde Idee. Ich hätte den Kopf unten lassen sollen.
»Flynn!«
Seine Schultern verkrampfen sich, und er dreht sich um. Hinter ihm entdecke ich eine hübsche Brünette, die uns anfunkelt. Eine schick gekleidete und mit teuren Accessoires behängte Clique von angesagten It-Girls umringt sie, und jedes von ihnen stellt verschiedene Schattierungen von Eifersucht und Empörung zur Schau. Alle außer einem Mädchen im Hintergrund, eine Afroamerikanerin mit einem Gesicht voller Sommersprossen. Sie wirkt amüsiert. Sie trägt ihre Haare in einem Stufenschnitt, und ihr Gesicht ist von Locken umrahmt. Anscheinend hat die Gehirnwäsche der blöden Highschool-Hierarchie bei ihr nicht funktioniert. Ein kleiner Hoffnungsschimmer.
»Wer ist das?«, fragt die Brünette Flynn. Als wäre ich gar nicht da. Sie nimmt besitzergreifend seine Hand.
»Ich bin Daphne«, sage ich. Ich verschwende kein Lächeln an sie. Wir werden keine Freundinnen. Ich hoffe nur, dass sie jetzt nicht diese »Ich-zeig-dir-alles«-Nummer abzieht, mich herumführt, sich hilfreich und freundlich gibt, bis sie einen guten Platz gefunden hat, mir ein Messer reinzurammen.
»Kayla«, stellt sie sich mir knapp vor. Sie mustert mich von oben bis unten und wendet sich ohne ein weiteres Wort ab. Sehr gut. Sie versucht nicht mal, höflich zu sein. Das finde ich wirklich erfrischend. Die Glocke läutet, und die Mädels ziehen die Jungs von mir weg, als müssten sie sie vor einem Pestausbruch retten.
Ich weiß, dass Kayla und ihre Oberstufen-Mafia spätestens am Ende des Schultags fiese Gerüchte über mich verbreitet haben werden, wie etwa, dass ich versucht hätte, an den Schließfächern Sex mit ihren Freunden zu haben, oder ähnlichen Quatsch, und dann wird die gesamte Schule gegen mich sein. Das wird ein neuer Rekord. Normalerweise schaffe ich eine Woche, bevor es mit den Lügen losgeht, dass ich mit Lehrern, dem Vater von irgendwem oder der halben Footballmannschaft geschlafen hätte. Es ist fast so, als steckte ich in einem Film aus den Achtzigerjahren fest, in dem die Cheerleader alle bösartige Zicken sind. Wir haben 1993. Nehmt das zur Kenntnis.
Noch ein Jahr diesen Mist, dann bin ich frei. Es sollte mir egal sein. Ich sollte nicht mal mehr die Energie besitzen, mich jetzt noch darüber zu ärgern, aber trotzdem schnüren mir die Tränen den Hals zu. Ich reiße mich zusammen. Ich habe deshalb schon mehr als genug geweint und weigere mich, es schon wieder zu tun. Ich werfe einen Blick auf die Karte, um meinen Klassenraum zu finden.
Es ist eine kleine Schule. Ich glaube, es sind höchstens siebzig oder achtzig Schüler in meinem Jahrgang, aber trotzdem sehe ich in den ersten drei Stunden keinen von den Jungs oder den angesagten It-Girls. Ich bin in einem Leistungskurs mit einem Haufen Streber.
Ich fühle mich unter Strebern und Nerds ganz wohl, vor allem denen, die auf Mathe und Naturwissenschaften stehen. Die Mädchen sind zu sehr damit beschäftigt, tiefschürfende Gedanken zu wälzen, und merken nicht, wie ich aussehe, und die Jungs haben so panische Angst vor allem, was weiblich ist, dass sie mich gar nicht beachten. Ich könnte versuchen, mich mit einem von ihnen anzufreunden, aber mir ist klar, dass sie mich ebenfalls hassen würden, sobald sie merken, dass mein Notendurchschnitt ihren um ein Vielfaches übersteigt. Was den Ehrgeiz angeht, sind Sportler und It-Girls nichts gegen Nerds.
Ich komme überpünktlich zur vierten Stunde. Sozialkunde. Ich habe das Buch vor mir auf dem Tisch und tue, als würde ich lesen, während die anderen Schüler ihre Plätze einnehmen. Ich spüre, dass jemand vor mir steht. Es ist das It-Girl mit den Sommersprossen. Sie tritt von einem Fuß auf den anderen. Es wirkt, als wollte sie mir etwas sagen.
»Hi«, sage ich zögernd. Da ist etwas in ihren Augen. Es wirkt fast wie Mitgefühl.
Sie öffnet den Mund, überlegt es sich dann aber anders und geht mit einem besorgten Stirnrunzeln zu ihrem Platz. Der Unterricht beginnt. Nach einer kurzen Einführung folgt eine lange Diskussion oder vielmehr eine Debatte. Es sind zwölf Schüler in diesem Kurs, und sie stürzen sich mit Begeisterung auf das Thema. Ich halte den Mund und höre nur zu. Ich erfahre, dass das Mädchen mit den Sommersprossen Harlow heißt. Irgendwie ist sie mir sympathisch.
In der Mittagspause sehe ich sie wieder und lächle ihr zu. Sie hätte es beinahe erwidert, aber ihr Lächeln bleibt auf halbem Weg zwischen ihren Lippen stecken.
Ich sitze allein. Ein paar Jungs kommen und fragen, ob sie sich zu mir setzen dürfen, aber ich sage Nein. Und ich sage es nicht wirklich freundlich.
An meiner letzten Schule habe ich es einmal mit einem Date versucht. Netter Junge. Er hat mich zum Unterstufenball eingeladen, und aus irgendeinem idiotischen Grund habe ich zugestimmt. Noch während des Festes war er in drei Prügeleien verwickelt gewesen und hatte eine gebrochene Nase. Während er bei der Schulschwester saß und auf den Rettungswagen wartete, bin ich zu ihm gegangen und habe ihm gesagt, dass er es vergessen soll. Es hat ihm zwar das Herz gebrochen, aber wenigstens nicht das Genick. Solange ich Nein zu allen sage, kämpft wenigstens niemand um mich. Wegen mir sind schon genug Kriege ausgebrochen.
Also, genau genommen, nicht wegen mir. Nur wegen meinem Gesicht. Meinem Fluch.
Die Mittagspause endet, und ich werfe einen Blick auf meinen Stundenplan. Sport. Na super. Ich trotte in den Umkleideraum der Mädchen und frage mich, ob die Leute, die diese Pläne machen, es absichtlich darauf anlegen, dass sich die Schüler übergeben. Wer legt denn die Sportstunde direkt hinter das Mittagessen? Nicht, dass Sportunterricht mich irgendwie anstrengen würde. Tatsächlich ist er eine Qual. Ich fürchte ständig, mich zu schnell zu bewegen oder etwas anzuheben, das zu schwer für ein Mädchen meines Alters ist, und dass ich dadurch auffliege.
Regel Nummer eins für Leute wie mich: Menschen dürfen NIEMALS herausfinden, dass Halbgötter existieren.
Ich öffne die Tür des Umkleideraums, höre ein geflüstertes »Das ist sie« und ahne Schlimmes. Ich habe Kayla unterschätzt. Ich habe nicht mit einem körperlichen Angriff gerechnet, jedenfalls noch nicht. Ich hätte es ahnen sollen, als sie nicht einmal versucht hat, diese passiv-aggressive »Ich-zeig-dir alles«-Nummer abzuziehen. Dieses Mädchen ist kein bisschen passiv. Sie ist nur aggressiv. Mein Onkel Deuce wird mich erwürgen, wenn er erfährt, dass mich ein Trupp Menschen zum Opfer gemacht hat.
Kayla und die It-Girls wissen es nicht, aber ich kann sehen, wie sie auf mich zukommen. Sie sind so langsam, dass es lachhaft ist. Bevor sie nach mir greifen, weiß ich bereits, wie ich reagieren muss. Ich muss über mich ergehen lassen, was sie vorhaben, denn andernfalls würden sie sehen, wie schnell ich sein kann, und dann wüssten sie, dass mit mir etwas nicht stimmt. Und Kayla ist der Typ, der nachbohrt. Sie wird nicht lockerlassen, bis sie herausgefunden hat, was ich bin.
Und dann muss ich sie töten.
Sie packen mich und zerren mich in den Duschraum. Ich kämpfe gegen den Instinkt an, ihnen tödliche Stromschläge zu versetzen. Ich lasse mich schlaff hängen und wehre mich nicht, denn ich darf auf keinen Fall meine Kraft falsch einschätzen und womöglich einer von ihnen aus Versehen den Arm brechen.
Ein Stuhl steht bereit und wartet auf mich. Kayla hat das Ganze offenbar gut durchdacht. Sie stoßen mich auf den Stuhl, und sie baut sich vor mir auf. Triumphierend. Da ist ein Glitzern in ihren Augen, das mir verrät, dass sie das hier ein wenig zu sehr genießt. Ich habe diesen Ausdruck schon mal gesehen. Der gestörte Typ in der sechsten Klasse hatte dasselbe Glitzern in den Augen, als er einer Kröte einen Feuerwerkskörper ins Maul gestopft und zugesehen hat, wie sie explodiert. Er war einer von diesen dürren, mickrig aussehenden Widerlingen – die Art, die andere nicht durch Körpergröße einschüchtert, sondern durch reine Grausamkeit. Mir wird klar, dass Kayla genauso ist. Sie ist nicht die Hübscheste (das ist Harlow), aber sie ist bereit, etwas zu tun, was die anderen Mädchen nicht tun würden.
Sie hat eine Schere in der Hand. Jetzt bin ich beunruhigt. Ich fürchte mich nicht vor Schmerzen – aber was, wenn sie versucht, mich damit zu schneiden, und merkt, dass sie meine Haut nicht durchdringen kann, egal, wie sehr sie sich anstrengt?
»Bitte tu das nicht«, flehe ich, und meine Unterlippe bebt. Das ist nicht vorgetäuscht. Ich will nicht töten. Nicht schon wieder.
»Ich hab noch gar nicht angefangen«, höhnt Kayla. »Harlow!«, ruft sie über ihre Schulter.
Harlow tritt vor, die Lippen angewidert zusammengekniffen. Ich schaue flehentlich zu ihr auf. Sie will mir nichts tun, und ich kann an den Gesichtern der anderen Mädchen erkennen, dass etwa die Hälfte der It-Girls es ebenfalls nicht will, aber Harlow ist die Einzige, die stark genug ist, um sich Kayla zu widersetzen. Ich schüttele den Kopf und hoffe, dass die wahre Harlow erscheint und Kayla sagt, dass sie sich zum Teufel scheren soll. Harlow greift sich eine Strähne meiner langen Haare, und Kayla reicht ihr die Schere. Sie werden mir die Haare abschneiden.
»Bitte nicht, Harlow«, bettele ich, und Tränen füllen meine Augen. Sie begreifen es nicht. Ohne meine Haare habe ich keine Möglichkeit, mein Gesicht zu verbergen. Ich werde entblößt sein, und das macht es noch schlimmer.
Harlows Stirn zuckt, sie wirkt hoffnungslos. Mir wird klar, dass sie mir in der Sozialkunde-Stunde sagen wollte, was geschehen würde. Ich frage mich, welches Druckmittel Kayla gegen sie hat.
»Tu es«, faucht Kayla sie an.
Ein finsterer Ausdruck huscht über Harlows Gesicht, ein winziger Funke der Rebellion, doch der verschwindet sofort wieder. Sie gehorcht. Während sich Harlow durch meine Haare hackt, funkle ich Kayla an. Tränen der Wut laufen mir übers Gesicht, obwohl ich versuche, sie wegzublinzeln. Es ist wirklich beschämend, vor ihnen zu weinen, aber ich kann nichts dagegen tun. Ich hasse Kayla. Ich hasse sie, weil sie mir meine Haare nimmt und mich schutzlos macht, aber ich hasse sie noch mehr für das, was sie Harlow antut. Ich habe wirklich eine Sekunde gedacht, dass Harlow und ich vielleicht Freundinnen werden könnten.
»Nicht mutig genug, es selbst zu tun, Kayla? Muss es jemand anders für dich machen, falls ich rede?«, sage ich zu ihr.
Einen Moment lang entgleist ihre zufriedene Miene. Natürlich haben das alle gehört, und sie werden es noch lange im Kopf behalten. Das wird für Unfrieden in der Truppe sorgen. Kayla hat keine Wahl. Sie nimmt Harlow die Schere weg und macht es selbst. Gut. Mach dir die Hände schmutzig, sage ich ihr mit meinen Augen. Zeig ihnen, was du bist.
»Du wirst nicht reden«, knurrt Kayla mit zusammengebissenen Zähnen. Sie nimmt die Locke, die normalerweise meine Augen verbirgt, und schneidet sie direkt über der Kopfhaut ab. »Oder ich schneide dir nächstes Mal noch mehr ab als deine hübschen blonden Haare.«
Kayla lässt meine Haare auf die schmierigen Fliesen der Dusche fallen. Sie funkeln, und es sieht aus, als würden Goldfäden aus ihrer Hand regnen.
»Lass die Finger von meinem Freund«, befiehlt sie.
Die Tränen haben mir die Brust so zugeschnürt, dass ich es nicht riskieren kann, etwas zu sagen. Als würde ich Flynn, dieses Aushängeschild für den überprivilegierten und pseudocoolen Durchschnittstypen, auch nur im Geringsten anziehend finden. Ich nicke kleinlaut, als hätte sie meinen Willen gebrochen, nur damit es endlich endet.
Kayla grinst zufrieden und bedeutet allen, sich zu verziehen. Sie schleichen wortlos davon, einige geschockt über das, was sie gerade sehen mussten. Ich schlage meine tränennassen Augen nieder. Ich will ihre Gesichter nicht sehen. Ich schäme mich zu sehr für mein Weinen.
Als alle weg sind, stehe ich auf und gehe zum Spiegel. Ich höre, wie sich die Mädchen im angrenzenden Umkleideraum für den Sportunterricht umziehen. Ich schaue in den Spiegel. An einer Seite fehlt ein großer Teil meiner Haare, und dann ist da natürlich noch der geschorene Bereich an meiner Stirn.
So kann ich unmöglich zum Unterricht gehen. Die Lehrer würden sehen, dass mir etwas Schlimmes angetan wurde, selbst wenn ich es abstreiten würde, und schließlich würden sie herausfinden, was im Duschraum der Mädchenumkleide passiert ist. Kayla würde keinen Ärger kriegen. Den kriegen diese Miststücke nie. Aber die anderen schon, und dann wären alle It-Girls meine Feindinnen, auch die netteren, die dabei waren, obwohl sie lieber ganz woanders gewesen wären. Dann bekäme Kayla, was sie wirklich will – eine Armee bösartiger kleiner Monster, die es alle darauf anlegen, mir das Leben noch mehr zur Hölle zu machen. Kayla mag nicht clever genug für die Leistungskurse sein, aber ich habe ein paar Stunden zu spät erkannt, dass sie ein Genie ist, wenn es um Gemeinheit geht.
Ich muss hier raus. Nach Hause. Versuchen, meine Haare irgendwie zu retten, bevor mich jemand sieht. Morgen kriege ich bestimmt Stress wegen des Schwänzens – ich wette, Kayla weiß das –, aber das ist nicht zu vermeiden.
Ich renne.
2
Ich bin so schnell, dass mich niemand sehen kann, allerdings würden sie den Luftstrom fühlen, wenn ich an ihnen vorbeirase. Zum Glück sind jetzt alle in ihren Klassen, und ich errege kein Aufsehen. Ich sause durch die leeren Flure, springe über den Metalldetektor am Eingang und hinaus auf die Straße.
Das ist der schwierige Teil. Central Park West ist nicht die beste Gegend, um im Scion-Tempo hindurchzurasen. Es sind zu viele Leute unterwegs, und ein Zusammenstoß ist fast unvermeidbar. Wenn ich in diesem Tempo mit einem Menschen zusammenkrache, würde er es nicht überleben. Es sind nur ein paar Blocks von der Schule bis nach Hause. Ich hechte über die Autos, die in einer unendlichen Schlange die Straße blockieren. Ich rudere mit den Armen und hole mit den Beinen aus, als würde ich in der Luft rennen, bis ich auf dem gegenüberliegenden Bürgersteig lande. Dort mache ich einen Satz über die Fußgänger und die Mauer des Parks, bevor die Menschen Zeit haben, den Blick auf mich zu richten. Ich lande auf der festgetretenen Erde des Parks.
Bäume rasen vorbei, so schnell, dass sie verschwimmen. Ich brauche nur Sekunden, den Park diagonal zu durchqueren, und verlasse ihn an der 59. Straße West am unteren Ende des Parks. Ich kann mein Gebäude sehen und wechsle ins Gehen. Den letzten Block lege ich in ganz normalem Tempo zurück.
Ich werde angestarrt. Die Leute halten den Kopf schief und versuchen, einen Blick auf mein Gesicht unter dem Vorhang meiner verbliebenen Haare zu erhaschen, wie sie es immer machen. Und natürlich bemerken sie meine zerstückelte Frisur. Ein paar sehen sogar die Tränenspuren auf meinen Wangen. Ich gehe einfach weiter, ignoriere auch die Netten, die nur helfen wollen. Aus Erfahrung weiß ich, wenn ich nachgebe und das Mitgefühl von irgendwem annehme, habe ich am Tag danach einen Stalker. Das ist das Schlimmste an meinem Fluch. Dass ich ständig so tun muss, als wäre ich das größte Miststück.
Rich, der Portier unseres Hauses, hat mich entdeckt und winkt. Jetzt kann ich mein Gesicht nicht mehr verändern, um dem Starren zu entgehen. Ich hätte daran denken sollen, es schon zu tun, bevor ich mein Tempo gedrosselt habe. Ich gehe durch die Tür, und Rich sieht meine Haare. Er macht ein entsetztes Gesicht. Ich lege den Finger an die Lippen, während ich zum Fahrstuhl eile, und meine großen Rehaugen flehen ihn an, nichts zu verraten. Das ist eigentlich nicht fair. Ich manipuliere nicht gern andere Leute, aber in diesem Moment bleibt mir keine Wahl.
Ich betrete unser riesiges Penthouse-Apartment und haste vorbei an den grässlichen vergoldeten Möbeln, den Kristall-Kronleuchtern und den mit Seide bespannten Wänden. Ich schwöre, meine Stiefmutter hält sich für Marie Antoinette oder so – falls Marie Antoinette einen texanischen Akzent und obszön große Silikonbrüste hatte. Eine Zeit lang hat sie mir leidgetan. Es ist nicht leicht, in die Fußstapfen meiner Mutter zu treten, die wie ich das Gesicht hatte. Aber dann hat mich Rebecca, meine Stiefmutter, auf diese Schule geschickt. Und mit der Nummer hat sie sich jedes Wohlwollen von meiner Seite gründlich verscherzt.
Ich gehe in mein Zimmer und von da aus gleich weiter in mein Bad. Im Schränkchen unter dem Waschbecken ist eine Schere. Ich habe keine große Wahl, weil meine Haare vorn so kurz sind. Ich werde alles bis fast auf die Kopfhaut abschneiden müssen. Einen Moment lang überlege ich, alles abzurasieren, aber das lasse ich lieber. Ein Mädchen mit Glatze erregt noch mehr Aufsehen als eins mit superkurzen Haaren. Nach meinem Kompletthaarschnitt sehe ich aus wie Mia Farrow in dem Film Rosemary’s Baby.
Es sieht gut aus. Sogar richtig toll. Ich sehe mit den kurzen Haaren vermutlich besser aus, weil man jetzt mein ganzes Gesicht und meinen grazilen Hals sieht. Ich wirke zauberhaft.
Ich bin total am Arsch.
Die Frustration schnürt mir die Kehle zu. Ich kann nicht vor mir selbst fliehen. Es kommt mir vor, als wäre ich in einem Film, und zwar in der vollkommen falschen Rolle. Ich bin kein zartes Püppchen, kein männermordendes Monster, kein Miststück, keine Verführerin und nichts von dem, was die Menschen sonst noch denken, sobald sie mich sehen.
Ich betrachte den herzförmigen Anhänger, den ich an einer Kette um den Hals trage. Es ist eine Hälfte eines machtvollen Reliktes, seit 3300 Jahren in direkter Linie weitergereicht von der Mutter an ihre Tochter. Ich habe eine Hälfte, meine Mutter Elara trägt die andere. Meine Hälfte ermöglicht mir, mein Aussehen so zu verändern, wie ich es will, mich in jede gewöhnliche Frau zu verwandeln, aber sie hilft mir nicht dabei, mich in meiner eigenen Haut wohlzufühlen.
Ich hole das Schminkset heraus, das mir meine Stiefmutter vor drei Jahren zu Weihnachten geschenkt hat. Ich reiße die Plastikverpackung herunter und öffne es. Dann trage ich schwarzen Eyeliner, Mascara und Lidschatten auf. Ich habe mich noch nie geschminkt, also muss ich improvisieren. Nachdem ich meine Augen getuscht und das Rot meiner vollen Lippen ausgeblasst habe, betrachte ich die Klamotten in meinem Kleiderschrank. Er ist voller Sachen, die schlicht wirken sollen, aber aus den feinsten Materialien bestehen – Unmengen von Schulröcken aus Merinowolle, Kaschmirpullover und maßgeschneiderte Schulblazer aus meiner Zeit an der Privatschule in Massachusetts.
Ich zerfetze den Saum von einem der Röcke, schneide den Halsausschnitt aus einem weichen T-Shirt und reiße Löcher in eine schwarze Strumpfhose. Meine Stiefmutter hat ein Paar schwarze Lederstiefel mit verwegen aussehenden Silberschnallen. Ich ziehe mich an und nehme die Stiefel aus ihrem Schrank. Und da ich gerade dabei bin, greife ich auch noch nach einer schwarzen Lederjacke und betrachte mich in ihrem großen Spiegel. Ich bin immer noch ich, aber zumindest sieht mein Äußeres jetzt genauso wütend aus, wie ich mich fühle.
Ich will mir ein paar Graffiti ansehen. Ich will etwas Cleveres und Gefährliches in meinem Leben haben. Etwas, das irgendwie schmutzig ist. Ich verlasse die Wohnung und gehe mit hocherhobenem Kopf nach draußen. Jedenfalls etwas höher.
Das letzte Mal habe ich eines dieser Spray-Kunstwerke in Greenwich Village gesehen. Also nehme ich die U-Bahn und plane, an der Spring Street auszusteigen.
Ich fahre nicht gern U-Bahn. Grundsätzlich versucht immer jemand, mir ein Gespräch aufzuzwingen oder, noch schlimmer, sich an mir zu reiben. Ich stehe mit dem Rücken zur Wand am Ende des Wagens und funkele jeden, der sich nähert, finster an. Ich glaube, Mascara und Stiefel zeigen Wirkung, denn die Leute lassen mich tatsächlich in Ruhe.
Aus dem Augenwinkel sehe ich eines von diesen besonderen Graffiti am hinteren Ende der Station Washington Square. Ich springe aus der Bahn, bevor sich die Türen schließen. Mein Herz fängt an, wie wild zu hämmern, als ich darauf zugehe.
Es ist fantastisch.
Sehr groß und mit toller Linienführung. Es ist das Porträt einer wunderschönen jungen Frau. Ich gehe jetzt langsamer darauf zu. Ihre Hände sind gefesselt und ihr Kopf rasiert wie bei einer mittelalterlichen Märtyrerin. Sie trägt sogar eine Dornenkrone, und die Dornen bohren sich grausam in ihre glatten Brauen. Sie weint schwarze Tränen. Ich starre ihr Gesicht an.
Das bin ich.
Das ist unmöglich. Dieser Künstler hat auf keinen Fall genug Zeit gehabt, dieses Graffiti zu sprühen, seit ich mir die Haare geschnitten und die Augen geschminkt habe. Ich habe unsere Wohnung erst vor zehn Minuten verlassen. Wer hat das gemacht?
Mein Blick wandert in die untere rechte Ecke, denn da befindet sich seine Signatur. Wie beim letzten Mal sind es drei Tiere in einer Reihe. Erst jetzt erkenne ich, dass es drei Yaks sind. Und vor diesen drei Yaks steht der Buchstabe A. A-Yaks.
Ajax.
Das ist ein Name aus der Ilias. Es ist ein Scion-Name. Wieso bin ich nicht längst darauf gekommen? Ich finde diese Reihe von Huftieren cool, aber ich schätze, ich habe bisher keinen Gedanken daran verschwendet. Es gibt keinen Ajax in meinem Haus. Er könnte mein Feind sein. Blitze zucken über meine Haut. Ich weiß nicht, ob es Angst ist, die ich spüre, oder etwas anderes. Vielleicht etwas wie Erwartung.
Ich kann es nicht lassen. Ich berühre ihre geschwungenen Lippen – meine Lippen –, die zu rund und echt aussehen, um nur flach zu sein. Meine Finger sind blutrot.
Die Farbe ist noch nass. Ich muss hier verschwinden, und zwar schnell.
Das Wandbild befindet sich auf dem Bahnsteig Richtung Innenstadt. Ich renne die Stufen hoch, um einen Zug zu nehmen, der mich wieder nach Hause bringt. Auf dem Weg nach oben höre ich Geflüster. Schluchzen.
Wut lässt alles verschwimmen. Keine Gereiztheit, keine Frustration, sondern weiß glühender Hass, der mir den Atem stocken lässt.
Die Furien sind da.
Ich stolpere blindlings durch das Drehkreuz, während die Furien mir ihre Rachegelüste in die Ohren kreischen.
Oh, Götter, nein.
Die anderen Häuser wissen nicht, dass meines immer noch existiert. Sie glauben, wir wären ausgestorben, und so konnten wir überleben, wenn auch nur knapp. Doch jetzt hört dieser andere Scion die Furien genauso wie ich und weiß, dass sich an dieser Station ein Scion eines verfeindeten Hauses aufhält. Allerdings weiß er oder sie nicht, von welchem Haus. Meine einzige Hoffnung ist, nicht erwischt zu werden. Ich darf nicht gefangen genommen oder getötet werden. Dann würde mein Haus entdeckt.
Zwei Züge fahren ein, gleichzeitig, aber in verschiedene Richtungen. Ich springe in den Zug, der mich nach Hause bringt, starre die Türen an und beschwöre sie, endlich zuzugehen. Aus dem Augenwinkel sehe ich die Furien. Ich will hinsehen, aber sie verschwinden immer wieder aus meinem Blickfeld. Ich habe keine Ahnung, ob sie tatsächlich in die wirkliche Welt kommen, wenn ein Scion sie fühlt, oder ob sie nur geisterhafte Erscheinungen sind, die im Kopf von Scions auftauchen.
Asche verfilzt ihre langen schwarzen Haare, und ihre Gesichter sind rot verschmiert, denn sie weinen Blut. Sie wispern die Namen der Toten und rufen nach mir, flehen mich an, meinen Feind zu töten und mein Haus zu rächen. Ich weiche zurück bis an das Fenster gegenüber der Tür und drehe mich um.
Durch das Fenster des anderen Zuges sieht mich ein junger Mann an, der schöner ist als alles, was ich bisher gesehen habe. Er hat goldene Haare und leuchtend blaue Augen. Seine Haut scheint sanft zu leuchten, als würde er ein Licht in sich tragen. Er hält eine farbfleckige Hand gegen seine Brust gepresst, als hätte ihn jemand geschlagen, die andere hat er flach gegen die Fensterscheibe gedrückt. Ich hebe meine Hand, mache es ihm nach und lege sie gegen die Scheibe meines Zuges. Er sieht verwirrt aus. Geschockt. Als hätte er denselben Geist gesehen.
Das muss er sein. Mein Feind.
»Ajax«, flüstere ich. Das Kreischen der Furien wird immer schriller.
Ich sehe zu, wie sich seine Hände zu Fäusten ballen und das Plexiglas durchschlagen. Die Bahnen setzen sich in unterschiedliche Richtungen in Bewegung, und er und ich rennen jetzt durch unsere Wagen, um auf gleicher Höhe zu bleiben. Wir halten Blickkontakt, die Absicht ist klar. Wir wollen diesen Kampf. Wir wollen ihn mehr als alles andere.
Ich erreiche das Ende meines Wagens zuerst, stoße die Tür auf, und mithilfe der Stange über dem Türrahmen schwinge ich mich auf das Dach des fahrenden Zuges. Einen Moment lang kann ich ihn nicht sehen, doch mir dämmert, dass das eine blöde Idee war. Ich habe die Wohnung unbewaffnet verlassen, aber er könnte etwas dabeihaben.
Ich renne in die andere Richtung, versuche, mein Tempo dem meines Zuges anzupassen, um von ihm wegzukommen, da höre ich hinter mir einen Aufprall. Ich wirble herum.
Ajax ist auf meinen Zug aufgesprungen und kommt auf mich zu. Offensichtlich hat er keine Angst davor abzustürzen, und er bewegt sich so leichtfüßig, dass er den Wind zu teilen scheint.
»Wer bist du?«, überschreit er das Heulen der Furien und das Donnern der U-Bahn.
Ich halte mich nicht mit Geplauder auf. Stattdessen gehe ich auf ihn los.
Er springt zurück, um meinem ersten Schlag zu entgehen, und ich kann sehen, wie überrascht er ist, dass ihm meine Faust so viel näher gekommen ist, als er erwartet hat. Er weicht so schnell zurück, dass es ihn von den Füßen reißt und er hart auf dem Hintern landet.
Als er zu mir aufschaut, durchfährt mich ein Schauer. Ich spüre, wie mir die Furien mit ihren zerfetzten Fingern über die Wirbelsäule fahren. Ihr Hass sickert in meine Nerven, weiß glühend und stechend.
Ich kann nicht sagen, wieso ich zögere. Ich weiß nicht, wieso ich mein letztes bisschen Selbstbeherrschung nutze, um einen Schritt zurückzutreten. Aber ich tue es. Ich kämpfe gegen die grässliche animalische Mordlust an, doch ich weiß nicht, warum. Vielleicht ist er zu schön, um zu sterben.
Ajax springt blitzschnell auf, und ich muss mich auf ihn stürzen. Unsere Fäuste wirbeln. Es geht so schnell, dass ich keine Zeit zum Denken habe. Ich falle einfach in den Rhythmus der Gewalt, der mir von Kindesbeinen an eingehämmert worden ist. Wir tanzen unseren brutalen Tanz, während ein anderer Zug an uns vorbeifährt. Und im flackernden Licht der beiden Züge ist Ajax plötzlich weg.
Ich drehe mich um und kann gerade noch erkennen, dass er auf den anderen Zug gesprungen ist. Er entfernt sich schnell von mir. Ich renne auf dem Dach meines Zuges hinter ihm her, bis ich das Ende erreiche. Ich könnte springen, aber es ist zu spät. Er kniet auf dem letzten Wagen seiner Bahn. Er hält sich die Brust, als schmerze sie. Ich mache genau dasselbe.
3
»Du konzentrierst dich nicht!«, brüllt Deuce mich an.
Ich betaste meine Nase und ziehe Blut hoch. Mein Onkel Polydeuces – abgekürzt Deuce – ist sechsundsechzig Jahre alt, aber er kann immer noch zuschlagen, als wären seine Fäuste aus Stein. Das liegt vermutlich daran, dass seine Hände nur aus Knöcheln bestehen und kaum aus Fingern. Tatsächlich sieht fast alles an meinem Onkel Deuce so aus. Seine Nase, seine Ohren, sogar seine Stirn hat diesen knorrigen Look. Er ist echt ramponiert. Und der beste Kampftrainer aller Zeiten.
»Wie oft soll ich dir das noch sagen? Behalt deine verdammten Ellbogen am Körper. Das ist doch kein Ballett!«
»Ach? Und wieso dann das Röckchen?«, ärgere ich ihn und deute mit einer Kopfbewegung auf seinen Chiton.
Onkel Deuce ist ein Kämpfer alter Schule, was bedeutet, dass er beim Training die griechische Version einer Toga trägt, die nur um die untere Körperhälfte geschlungen wird. Für ihn ist der Kampf heilig, und dass ich auf modernes Sportzeug bestehe, empfindet er als persönlichen Affront. Aber er gibt sich trotzdem mit mir ab, und obwohl er es nie zugeben würde, weiß ich, dass er mich mag.
Bevor Deuce auf meinen Ballettröckchen-Witz reagieren kann, täusche ich kurz an, senke den Kopf und schlage ihm beim Zurückweichen ins Gesicht – eine mutige Aktion, wenn man gerade zurückspringt, aber es funktioniert. Deuces Kopf fliegt bei meinem Treffer nach hinten, und er grinst mich an.
»Die Erbin des Hauses von Atreus hat beschlossen, heute Morgen zu erscheinen. Ich denke, ich kann jetzt aufwachen.«
Onkel Deuce springt vor, um mich auf die Matte zu werfen. Flinker alter Bussard. Ich lasse zu, dass er meinen rechten Knöchel packt, lege mein Gewicht auf seine Hand, um mehr Hebelwirkung zu bekommen, und ziele mit einem wirbelnden Rückwärtstritt auf seine Schläfe. Er kann ausweichen, aber jetzt weiß er, was Sache ist.
»Du hättest mich damit treffen müssen, aber deine Gedanken sind woanders«, stellt er fest und umkreist mich, die drahtigen Schultern gesenkt, sein Kopf bewegt sich schlangengleich hinter den geballten Fäusten.
Das ärgert mich, weil er recht hat. Ich bin wirklich nicht bei der Sache. Seit gestern kann ich nur noch an eines denken, an ihn.
Was ich nicht aus dem Kopf bekomme, sind nicht seine Muskelberge oder das hübsche Gesicht. Es sind die farbfleckigen Hände. Wenn ich an diese Hände denke, durchströmen mich die verschiedensten Emotionen. Hauptsächlich Mordlust. Aber auch etwas anderes.
»Uuund schon ist sie wieder weg«, kommentiert Deuce gedehnt. Er öffnet die Fäuste und stemmt die Hände in die Hüften. »Wieso bist du heute so abgelenkt?«
»Keine Ahnung«, lüge ich. Ich weiß genau, wieso. Weil sich meine Gedanken um das hintere Ende eines Bahnsteigs drehen, wo ein Junge eine dreckige Wand in ein Kunstwerk verwandelt hat. Seine Leinwand ist feucht und stinkt, aber er hat etwas Wunderschönes daraufgezaubert.
Er ist mein Feind. Ich hasse ihn. Ajax. Die Furien erfüllen Scions schon bei der Erwähnung eines anderen Hauses mit Wut, und nur seinen Namen zu denken, macht mich wütend. Trotzdem will ich ihn sehen. Das ergibt keinen Sinn. Es ist jetzt wichtiger denn je, dass ich mich auf mein Training konzentriere, aber ich schaffe es nicht. Ajax könnte seiner Familie erzählen, dass er einen unbekannten feindlichen Scion in der U-Bahn getroffen hat, und wenn sie auf die Suche nach mir gehen, bin ich in Gefahr, und trotzdem kann ich mich nicht konzentrieren. Ich bin besessen davon, wo er sich befindet, was er macht. Es sind ähnliche Gedanken, wie sie mir im Kopf herumgingen, als meine Mutter mich verlassen hat.
Es ist beinahe so, als würde ich ihn vermissen. Es ist – was? Sehnsucht? Das ist verrückt. Ich muss wieder einen klaren Kopf bekommen.
»Auszeit«, sage ich, nehme meine Wasserflasche und trinke.
Ich frage mich, von welchem Haus er stammt. Das Village ist das Gebiet von Theben. Dem Haus von Theben gehören die Kinder von Apollo an. Apollo – dem Gott der Künste, neben anderen Dingen. Aber Ajax ist Graffitikünstler und daran gewöhnt, das Gesetz zu brechen, also kann ich nicht hundertprozentig sicher sein, dass er Theber ist. Die Grenze zwischen den genau abgesteckten Territorien der Häuser zu überschreiten, ist für unsereins eine große Sache, aber Ajax scheint ein Rebell zu sein. Vielleicht kommt er auch von einem anderen Haus.
Zumindest hoffe ich es, obwohl ich ziemlich sicher weiß, dass es nicht so ist, denn wenn er Theber ist, kann ich mich gleich erschießen. Nicht, dass Kugeln mir etwas anhaben könnten – oder Klingen oder jede andere Waffe, solange ich den Cestus von Aphrodite um den Hals trage –, aber man braucht keine Waffe, um jemanden zu töten. Jedenfalls bin ich tot, wenn er aus dem Haus von Theben stammt. Es gibt zu viele von ihnen, und sie sind zu gut organisiert. Sie nennen sich nicht umsonst die Hundert Cousins. Die sind eine verdammte Armee. Blitze zucken unter meiner Haut. Ich will kämpfen, aber nicht mit meinem Onkel. Ich will einen richtigen Kampf mit Ajax. Bloße Haut. Schweiß. Blut.
Ich frage mich, ob er wirklich ein Sohn von Apollo ist. Er ist blond und sogar jetzt im Herbst noch sonnengebräunt, also ganz typisch für einen Nachfahren Apollos, aber manchmal vermischen sich die klassischen Typen mit anderen Häusern. Schwarze Haare und blaue Augen bedeuten nicht unbedingt, dass ein Scion ein Sohn von Poseidon aus dem Haus von Athen ist, und rotbraune Haare und grüne Augen bedeuten nicht zwangsläufig, dass jemand ein Nachkomme von Aphrodite aus dem Haus von Rom ist.
Ich drehe mich im Kreis. Er ist Künstler, er ist blond, und er war im Village. Natürlich ist er Theber.
Könnte er womöglich ein Delos sein? Ajax Delos. Weitere Blitze durchzucken meine Wirbelsäule, sobald ich nur seinen Namen denke, und ich schaudere. Die Delos sind die Herrscherfamilie in ihrem Haus. Sie werden streng bewacht und sind sehr mächtig. Gerüchten zufolge haben sie mehr Begabungen als wir anderen. Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass Apollo der vielseitigste griechische Gott war. Ihm werden ungefähr eine Million Talente zugeschrieben, und viele davon haben mit Kämpfen zu tun.
Und Schönheit. Ajax hat eindeutig sein Aussehen geerbt. Ehrlich, es ist Spätherbst – was fällt ihm ein, immer noch so braun zu sein? Als wäre seine Haut mit Goldstaub bedeckt.
Ich denke an ihn. Schlimmer noch, ich habe Tagträume, die sich nur um ihn drehen. Ich schlage mir die Wasserflasche an die Stirn, ein sinnloser Versuch, ihn aus meinem Kopf zu bekommen.
»Mir ist klar, dass du im Moment viel durchmachst, mit dem Umzug und allem«, sagt Deuce. »Ich mag auch deinen neuen Haarschnitt, sehr praktisch, aber ich weiß auch, dass Teenager so was nur machen … wenn es persönliche Gründe hat.« Ich ziehe den Kopf ein, denn mir ist klar, was jetzt kommt. »Du hast doch keine … Frauenprobleme, oder?«
Ich stöhne und schaue himmelwärts, um Kraft zu schöpfen. »Mir geht’s gut, Deuce.«
Er seufzt erleichtert. »Gott sei Dank. Ich hatte schon befürchtet, dass du reden willst.« Er schaudert, als wäre es ihm gerade kalt den Rücken heruntergelaufen.
Ich bin die Erbin des Hauses von Atreus. Die Tochter von Zeus. Deuce trägt den Aegis von Zeus. Es ist seine Pflicht, mich zu trainieren und mich mit seinem Leben zu beschützen, aber wir wissen beide, dass er es auch tun würde, wenn er den Job nicht geerbt hätte. Deuce hat schon meine Mutter trainiert und vor ihr seine Schwester – die Mutter meiner Mutter –, aber ich wusste immer, dass ich etwas Besonderes für ihn bin. Er ist der Einzige, dem ich jemals etwas bedeutet habe, auch wenn er ein echt mürrischer Kerl ist. Und mich stets auf Armeslänge von sich hält.
Schuldgefühle lassen meinen Mund trocken werden. Ich hätte ihm sagen müssen, dass ich entdeckt wurde. Ich hätte es ihm sofort sagen müssen, als ich gestern Abend nach Hause gekommen bin. Wenn Ajax seiner Familie von mir erzählt, sind Deuce und ich in ernster Gefahr. Es sind nur noch so wenige von unserem Haus übrig. Deuce und ich sind im Grunde die Letzten, abgesehen von meiner Mutter Elara, die sonst wo steckt.
In meinem Haus dürfen die Hausherrin und die Erbin aus Sicherheitsgründen niemals zusammen sein, sobald die Erbin in einem Alter ist, in dem sie Kinder kriegen kann. Das ist so was Ähnliches wie diese Regel, dass der Präsident und der Vizepräsident nie mit demselben Flugzeug fliegen dürfen.
Es muss immer mindestens eine von uns geben, die dieses verfluchte Gesicht den Großteil der Zeit trägt, egal, wie sehr wir darunter leiden, denn andernfalls würde Aphrodite der Welt die Liebe nehmen. Und das alles nur, weil Aphrodite ihre Schwester Helena so geliebt hat, dass sie es nicht ertragen konnte, ihr Gesicht nur einen Tag lang nicht zu sehen. Ich wüsste wirklich gern, wie sich so eine Liebe anfühlt. Jemanden so sehr zu lieben oder so geliebt zu werden, dass man es nicht erträgt, auch nur einen Tag von dieser Person getrennt zu sein.
Als ich meine Periode bekam, habe ich meine Mutter nie wiedergesehen. Allerdings war sie auch vorher nicht wirklich für mich da.
»Deuce?«, beginne ich.
»Ja?«
Ich verstumme. Was, wenn Ajax mich nicht an seine Familie verrät? Deuce würde ihn trotzdem jagen, den richtigen Moment abpassen, und dann müsste Ajax ihm allein gegenübertreten. Mein Onkel mag ein alter Knacker sein, aber mit dem Aegis von Zeus – einem Schild, der jeden, der ihn ansieht, in Todesangst versetzt – ist er einer der tödlichsten Scions der Welt. Im Nahkampf würde Deuce ganz sicher gewinnen.
Und wenn jemand Ajax tötet, dann bin ich das.
Er gehört mir.
»Nichts«, sage ich.
»Nimmst du Drogen?«, fragt mich Deuce ganz sachlich.
Ich lache. »Noch nicht.«
Ich schnappe mir meine Tasche und will zur Tür gehen, doch ich komme nicht weit, denn Deuce streckt den Arm aus und zieht mich in eine verlegene einarmige Umarmung. Er klopft mir sogar ein paarmal auf die Schulter.
Er muss sich echt Sorgen um mich machen.
Ich wasche mich hastig in seinem winzigen Badezimmer und ziehe meine Schuluniform wieder an.
Deuce hat sich im selben Haus eine Wohnung gemietet, in dem mein Vater uns untergebracht hat, doch er hat sie entkernt und den größten Teil davon in einen Käfig für Trainingskämpfe umgewandelt. Er schläft auf einem Feldbett. Das wäre den meisten anderen Leuten sicher zu spartanisch, aber Deuce macht sich nichts aus einem gemütlichen Heim. Da ich weiß, dass er schon vor meiner Geburt seine Schwester, seine Ehefrau und vier Kinder in den Scion-Kriegen verloren hat, wundert mich das nicht. Für ihn ist »Zuhause« nur der Ort, an dem man leben muss, nachdem die Menschen, die man geliebt hat, ermordet wurden.
All seine Angehörigen zu verlieren, hat ihn dazu gebracht, mich extrem zu beschützen, ihn aber auch auf eine Weise gebrochen, die es ihm unmöglich macht, mich wirklich zu lieben. Mein Vater hat sich damit abgefunden, dass Deuce ständig um mich ist, vor allem, weil meine Mutter darauf bestanden hat, als ich noch jung war. Und als sie uns verlassen hat, war ich es, die darauf bestand.
Deuce und mein Vater tolerieren einander, vermutlich weil mein Vater inzwischen begriffen hat, dass ihm keine andere Wahl bleibt. Er weiß nicht recht, was er von Deuce halten soll, aber da er fest daran glaubt, dass meine Familie »alter Geldadel« ist, betrachtet er Deuces Lebensweise nur als exzentrisch und nicht als verrückt. Meine Stiefmutter dagegen hasst Deuce. Sie findet ihn total peinlich.
Ich schminke mich, bevor ich gehe. Die Uniform ist Pflicht, also kann ich dieses »Verzieht-euch-ihr-blödes-Pack!«-Outfit von gestern nicht anziehen, aber ich werde auf keinen Fall mit nacktem Gesicht in die Schule gehen. Ehrlich gesagt sehe ich ohne Make-up besser aus, aber ohne meine Haare bleibt mir keine andere Wahl. Ich trage dicken Lidschatten und Mascara auf, steche mir dabei ein paarmal ins Auge und frage mich, wie andere Leute dieses Zeug aushalten.
Ich rufe Deuce einen Abschiedsgruß zu und gehe nach unten, wo schon unsere Limousine mit laufendem Motor wartet. Mein Vater steht neben dem Wagen. Er sieht nicht glücklich aus.
»Was hast du mit deinen Haaren gemacht?«, fährt er mich an, das Gesicht starr vor Ärger.
»Hab sie abgeschnitten.« Er will mir Vorwürfe machen, aber ich bin schneller. »Ich muss dich nicht fragen, bevor ich mir die Haare schneide. Es sind meine Haare. Und das war’s.«
Das lässt ihn verstummen, macht ihn aber noch gereizter. »Wo warst du?«, fragt er.
»Bei Onkel Deuce«, sage ich.
»Und wo warst du gestern, als du eigentlich in der Schule sein solltest?«
Ich mache den Mund zu und starre ihn an.
»Mit wem warst du zusammen?«, fragt er auf eine ruhige und kalte Weise.
»Mit niemandem.« Meine Stimme klingt schrill und defensiv. Beinahe wimmernd. Ich hasse das, deshalb senke ich schnell die Stimme und fahre eisig fort. »Ich war allein.«
Beinahe hätte ich es angesprochen. Dieses Ding, das zwischen uns ist, seit meine Mom uns verlassen hat und er anfing, sie in mir zu sehen. Nein. Das stimmt so nicht. Mit jedem Tag werde ich ihr nicht nur ähnlicher – ich habe genau dasselbe Gesicht, mit dem sie ihn verhext und dann abserviert hat. Das Gesicht, das er um alles in der Welt besitzen muss. Es ist übrigens das Gesicht, das tausend Schiffe in See stechen ließ. Es ist das Gesicht von Helena von Troja, der Tochter von Zeus und Aphrodites geliebter Schwester.
Niemand hat diese Frauen jemals in Ruhe gelassen, nicht mal eine Göttin. Und jetzt bin ich da, mehr als dreitausend Jahre später, und muss das Ganze ausbaden.
Ich verschränke die Arme und drehe den Kopf weg, damit er mich nicht ansehen kann.
»Du kannst nicht die Schule schwänzen, nur weil du etwas Zeit allein verbringen willst«, sagt er streng. Anscheinend ist ihm mal wieder eingefallen, dass er Dad spielen muss.
Ich funkle ihn an und hoffe, das Gespräch auf diese Weise zu beenden. Unser Fahrer starrt uns an. Er spürt, dass es Stress gibt zwischen meinem Vater und mir. Das muss aufhören. Ständig zu beteuern, dass ich niemanden leiden kann, ist furchtbar, denn genau das Gegenteil ist der Fall. Ich mag viele Leute, aber niemand mag mich. Besessenheit, Besitzergreifen, Fixierung – das ist es, was ich an guten Tagen erlebe, aber abgesehen von Deuce hat mich niemand gern. Ich denke an Harlow, die mich beinahe mochte, und muss mich räuspern. Biologisch gesehen, stoppt ein Räuspern die Tränen. Ich hasse es, so was zu wissen.
»Du kommst zu spät«, sagt mein Vater, als wäre nicht er es, der mich aufhält. Mich in die Enge treibt. Mir den Weg versperrt. Er sieht auf mich herab. Sein Blick wandert über meinen Hals und an meinem Poloshirt herunter.
»Kann ich jetzt gehen?«, frage ich. Mein Gesicht glüht.
Langsam tritt er von der Tür zurück, sodass ich einsteigen kann.
Ich hechte auf den Rücksitz und halte die Luft an, bis wir losfahren. Er kann nicht auf meine Brüste gesehen haben. Mein Dad ist kein Perverser. Das würde er nicht tun. Das ist nicht passiert.
Ich bin noch vor dem ersten Läuten in der Schule, gehe aber nicht in meine Klasse. Ich gehe direkt zur Schulleiterin.
Ich muss mir ein paar Vorwürfe anhören, aber sie klingen halbherzig. Die Schulleiterin betrachtet meinen Haarschnitt und sagt, dass der Sportlehrer einen Haufen abgeschnittener blonder Haare in der Dusche gefunden hat. Ich merke, dass sie nicht weiß, was sie davon halten soll. Sie fragt mich, wieso ich so oft die Schule gewechselt habe und nie mehr als ein oder zwei Jahre in einer davon verbracht habe. Sie weiß nicht, was sie mit mir anfangen soll. Ich sehe die Verunsicherung in ihrem Blick. Sie fragt sich: Macht dieses Mädchen immer Ärger oder ist es immer ein Opfer?
Für mich gibt es hier keine Lösung, also weiche ich ihren Fragen aus. Sie ist sehr nett, kann mir aber nicht helfen. Sie verdonnert mich nur sehr zögernd zum Nachsitzen. Ich nicke, lächle und gehe zu meiner ersten Stunde. Es ist nicht ihre Schuld.
Ich halte den Kopf hocherhoben. Halte Augenkontakt. Schluss mit Verstecken. Das hat ohnehin nie geholfen. Wo immer ich hingehe, verfolgt mich das Flüstern. Ich denke an Ajax und frage mich, ob er dasselbe durchmacht. Ich habe noch nie einen Scion in meinem Alter kennengelernt, aber zum ersten Mal möchte ich es. Ich möchte wissen, ob er weiß, wie sich das hier anfühlt.
Er hat eine Hand auf seine Brust gedrückt, genau wie ich auf dem Dach des Zuges. Vielleicht fühlt er dasselbe wie ich. Einen Moment lang tröstet mich dieser Gedanke. Dann fangen die Furien in meinem Kopf an zu wispern, und Hass flammt in mir auf. Blitze durchzucken mich, wenn ich an ihn denke, und ich muss betont langsam ein- und ausatmen, damit die Blitze nicht von meiner Haut sprühen wie Sterne.
Mich dürstet nach ihm. Ich will ihn so verzweifelt umbringen, dass ich meine Hände unter dem Tisch zu Fäusten balle.
Ich sehe Harlow in der Mittagspause. Ich spüre, dass sie mich ansieht, doch sie dreht schnell den Kopf weg. Ich beobachte sie und hoffe, dass sie noch mal zu mir herübersieht, doch dann merke ich, dass etwas nicht stimmt. Sie sitzt allein, genau wie ich. Die angesagten Mädchen sitzen ein paar Tische weiter und drehen ihr den Rücken zu.
Ich bemerke Harlows angespannte Schultern und die an den äußeren Rändern verkniffenen Lippen. Sie isst, als wäre alles in Ordnung, und für jemanden, der noch nie abserviert wurde, wirkt sie absolut cool. Aber ich weiß es besser. Ich bin mit einem großen roten A für Außenseiter auf der Brust geboren worden.
Es ist selbstsüchtig, aber ich hoffe, dass die Mädchen sie links liegen lassen, weil sie sich für mich eingesetzt hat. Vielleicht hat sie Kayla nach der Aktion gestern die Meinung gesagt. Vielleicht will sie wirklich meine Freundin sein.
Ich nehme mein Tablett und stehe auf. Es ist ein Risiko, doch das ist mir egal. Mit meinem ganzen Zeug – Bücher, Taschen, Essen und allem – werde ich zu ihr gehen und fragen, ob ich mich zu ihr setzen darf.
Ich habe gerade einen Schritt gemacht, da sehe ich, wie ein zusammengeknülltes Stück Papier Kaylas Hand verlässt und auf Harlows Kopf zufliegt.
Das könnte ich mühelos abfangen. Ich würde mit Scion-Geschwindigkeit zu Harlow rasen und mir das Wurfgeschoss schnappen, aber dann müsste ich jeden in diesem Raum töten. Natürlich hört sich das nach einer lächerlichen Überreaktion an, aber es ist das geringere von zwei Übeln. Denn wenn Menschen erfahren, dass Scions existieren, würden sie uns jagen. Und wenn es jemals dazu käme, dass nur noch ein Scion-Haus übrig bleibt, würden die Götter aus ihrem Gefängnis auf dem Olymp befreit und zurückkommen. Und dann würden sie den Krieg beenden, den sie in Troja begonnen haben, und bei dieser Gelegenheit vermutlich auch die westliche Zivilisation vernichten.
Nicht einmal ich hasse die Highschool so sehr.
Meine Schultern sinken herab, und meine Füße werden taub, als das zerknüllte Papier Harlow mitten ins Gesicht trifft. Einen Moment lang ist sie wie erstarrt. Offensichtlich ist sie noch nie mit etwas beworfen worden, aber Harlow ist eine starke Persönlichkeit. Es braucht mehr, um sie einzuschüchtern. Sie hebt das Papier vom Boden auf, öffnet es und liest. Sie wird rot. Tränen füllen ihre Augen.
Gebrüll und Gejohle erfüllen die Cafeteria. Alle verspotten Harlow und schreien etwas, das ich nicht ganz begreife. Sie springt auf und rennt zum Ausgang.
Ich haste hinter ihr her und schleppe immer noch mein Tablett mit mir herum wie ein Vollpfosten. Über jeder Schulter habe ich eine Tasche, und die Riemen bleiben an allen Stuhlrücken hängen, an denen ich vorbeikomme. Es scheppert wie verrückt, ich verwüste die halbe Cafeteria und mache mich zum Gespött. Dann läutet es, und eine Flut gackernder Gören versperrt mir den Weg. Ich kann hören, wie Harlow schluchzend den Flur entlangrennt.
Ich starre ihr hinterher und fühle mich ungeschickt und nutzlos. Ich kann mit der Hand eine Kugel fangen, aber bei einem weinenden Mädchen versage ich.
Meine letzten drei Kurse sind nur Hintergrundgeräusch. Harlow taucht in Sozialkunde nicht auf, und ich vermute, dass sie schwänzt. Dann melde ich mich zum Nachsitzen, das aus einem mir unbegreiflichen Grund im Chemieraum stattfindet (ist es eine gute Idee, die Verbrecher mit Bunsenbrennern spielen zu lassen?), und in der ersten Reihe sitzt Harlow. Ich spüre, dass sie noch nie nachsitzen musste, aber sie ist eindeutig auch noch nie mit Missachtung gestraft worden, denn wenn es so wäre, hätte sie es besser gewusst.
Ich gehe direkt auf sie zu.
»Du willst hier nicht sitzen«, flüstere ich eindringlich.
Sie schaut auf und scheint zu überlegen, ob sie mir antworten will. »Warum nicht?«, sagt sie schließlich. »Ich sitze immer hier. Das ist mein üblicher Platz im Chemieunterricht.«
»Das war dein Platz, als du noch beliebt warst«, erwidere ich leise. »Aber jetzt willst du nicht auf einem Platz sitzen, an dem die halbe Klasse irgendwas nach dir werfen kann, wenn der Lehrer nicht hinsieht.«
Einen Moment lang sieht sie verängstigt aus. Zwei Jungen kommen herein. Sie nickt und folgt mir in die letzte Reihe, bevor sich die beiden Jungs die entferntesten Plätze sichern können. Harlow und ich setzen uns nebeneinander. Ich lächle ihr kurz zu – das kann sie ignorieren, wenn sie will. Doch ihr Lächeln ist eindeutig, und ich lasse zu, dass sich meins über das ganze Gesicht ausbreitet.
Der Lehrer kommt herein und informiert uns, dass nicht gesprochen werden darf. Harlow und ich holen unsere Bücher heraus und beginnen mit den Hausaufgaben. Nach der Stunde verlassen wir gemeinsam die Schule. Ich bin nervös. Ich will nicht einfach gehen, weiß aber nicht, was ich sagen soll.
»Ich hab den Sinn des Nachsitzens nie verstanden«, sagt Harlow und bricht damit das Eis für mich. »Was ist so bedrohlich an einer weiteren Schulstunde, in der man das macht, was man zu Hause ohnehin machen müsste?«
Ich lache. »Allerdings. Wie sollen wir merken, dass wir bestraft werden, wenn die uns nicht mit einem Lineal prügeln wie an der Katholischen Schule?«
»Wow. Düster«, bemerkt Harlow. Eine Sekunde lang schäme ich mich für den blöden Witz, doch dann grinst sie mich an. »Ich steh auf düster«, bemerkt sie anerkennend.
Ich zapple herum, aber wenn man so groß ist wie ich, sieht Gezappel echt peinlich aus. Ich versuche, darauf zu achten, aufrecht zu stehen, aber Harlow ist kleiner als ich, denn sie ist normal groß, während ich die Größe einer Amazone habe. Ich spüre den Drang, mich etwas kleiner zu machen, damit ich sie nicht so weit überrage. Doch ich entscheide mich für einen Kompromiss, schiebe eine Hüfte vor und lasse die Schulter hängen. Ich bin echt jämmerlich.
»In welche Richtung gehst du?«, frage ich.
»Jedenfalls nicht nach Hause«, antwortet sie.
Da ist etwas Bedeutsames in dieser Bemerkung, und ich erstarre. Ich habe zu wenig Erfahrung im Umgang mit Mädchen in meinem Alter und weiß nicht, ob es ungehörig ist, etwas Persönliches über ihre Familie zu fragen, oder ob es erwartet wird. Ich muss wohl ein so gequältes Gesicht gemacht haben, dass Harlow spielerisch meinen Arm anstößt und fortfährt.
»Nein, so ist das nicht. Meine Eltern werden nicht ausflippen und mir Hausarrest geben, nur weil ich nachsitzen musste. Sie werden nur sehr traurig sein.«
»Das ist noch schlimmer«, stelle ich fest.
Sie schenkt mir ein kleines fragendes Lächeln. »Wollen wir shoppen gehen?«
»Jetzt?«, frage ich erstaunt.
Sie mustert mich. »Du brauchst Klamotten, die zu deinem neuen Stil passen.«
»Okay«, sage ich und versuche, nicht zu begeistert zu klingen. Ich folge ihr wie ein riesiges Hündchen, das hinter ihr herdackelt, aber ich kann nichts dagegen tun. Mich hat noch nie jemand eingeladen, etwas zu unternehmen. Jedenfalls kein Mädchen. Ohne Hintergedanken.
»Tut mir leid wegen deinen Haaren«, sagt sie und starrt beim Gehen auf den Boden.
»Das war nicht deine Schuld«, sage ich sofort.
»Ich hätte dich warnen sollen«, fährt Harlow fort. »Hat mir allerdings nicht viel gebracht, dass ich nichts gesagt habe.«
»Was hat sie gegen dich in der Hand?«
Harlow sieht verblüfft zu mir auf. »Woher weißt du das?«
Ich lächle bitter. »Glaubst du, das war das erste Mal, dass mir so was passiert ist? Ich könnte ein verdammtes Handbuch über Highschool-Zicken schreiben.«
Sie zögert und überlegt kurz. »Mein Dad ist schwul«, sagt Harlow kühn, wirft mir aber dennoch einen unsicheren Blick zu. Ich verziehe keine Miene, und sie wird mutiger. »Er hat es meiner Mom und mir vor zwei Monaten gesagt. Kayla hat gedroht, es der ganzen Schule zu verraten, wenn ich sie nicht dabei unterstütze …« Sie verstummt und deutet auf meinen Kopf.
»Sieht es so übel aus?«, scherze ich und reibe mir über die kurzen Stoppelhaare.
»Du siehst super aus. Mit oder ohne Haare«, stellt sie ohne einen Anflug von Neid fest. Mein Aussehen nimmt ihr nichts weg, und weil sie das weiß, kann ich mich zum ersten Mal über so ein Kompliment freuen.
»Kayla hat deinen Dad trotzdem geoutet.«
Harlow antwortet nicht sofort. »Ich habe mich schrecklich gefühlt. Was ich dir angetan habe.« Sie verstummt. »Ich wollte zur Schulleiterin gehen und ihr alles sagen. Aber Kayla hat es rausgefunden, und sie …«
»Hat sich gerächt«, beende ich ihren Satz. Wir gehen eine Zeit lang schweigend weiter. Jetzt begreife ich, was die anderen in der Cafeteria gerufen haben. Fag hag. Das macht mich so wütend, dass mich Blitze durchzucken. »Trotzdem danke.«
»Hör auf, mir zu danken«, sagt Harlow und rümpft ihre sommersprossige Nase. »Das ist zu – ernsthaft.«
»Total uncool«, bestätige ich nickend. »Warte kurz, während ich so tue, als wäre mir alles egal.«
Harlow mustert mich, die Augen anerkennend verengt. »Wir werden gut miteinander auskommen«, verkündet sie. »Oh, ich liebe diesen Laden!« Sie zerrt mich in eine schicke kleine Boutique. »Genau wie mein Dad, was vieles erklärt.«
Ich nehme ein Paar rote Pumps unter einem blau-weiß karierten Kleid weg und halte sie hoch. »Wie findest du die?«, frage ich und hebe vielsagend die Brauen. Sie kapiert meine Friend of Dorothy-Anspielung sofort, nickt und schmunzelt. Ich bin froh. Sie hätte ebenso gut beleidigt sein können, aber sie ist recht gut darin, Menschen zu lesen. Sie hat gemerkt, dass kein Vorurteil in meiner Stimme mitschwang.

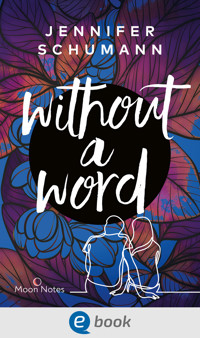













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)













