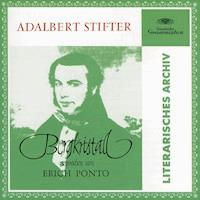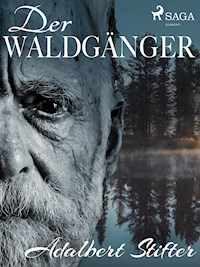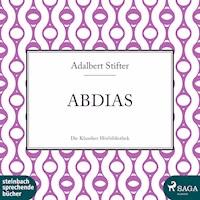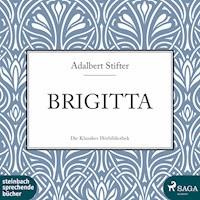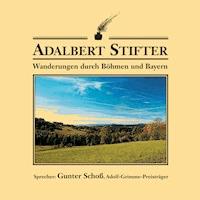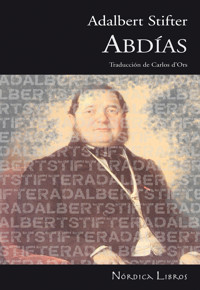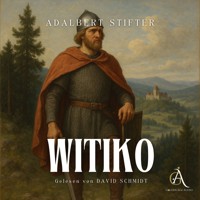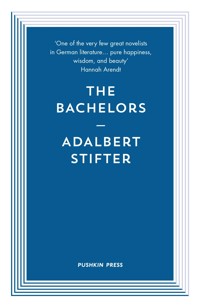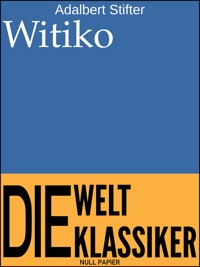
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: 99 Welt-Klassiker
- Sprache: Deutsch
Witiko ist ein historischer Roman des österreichischen Schriftstellers Adalbert Stifter. Die umfangreiche Erzählung berichtet von der Gründung des Geschlechts der Witigonen, von einer Liebesgeschichte und vom Aufstieg des jungen Adligen Witiko zum Volkshelden, indem er Herzog Wladislaw in den blutigen Kämpfen um die Macht in Böhmen unterstützt. Der Roman liefert einen historisch akkuraten Blick auf die großen politisch regionalen Umwälzungen des 12. Jahrhunderts. Stifter selbst hat erklärt, dass sein vordringliches Anliegen die gesamtgeschichtliche Darstellung war. »Ich könnte fast sagen, daß ich dieses Buch mit meinem Herzblute geschrieben habe. Und doch schwebt mir beständig vor, wie es viel besser sein sollte. Eigentlich sollte man sagen: Der Teufel hole das Dichterleben, man hat nur Kreuz und Qual dabei, und kann es nicht lassen wie geliebte Sünden.« [Adalbert Stifter] Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1386
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Adalbert Stifter
Witiko
Adalbert Stifter
Witiko
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] EV: Verl. Buch u. Volk, Leipzig, 1943 2. Auflage, ISBN 978-3-954184-07-1
null-papier.de/katalog
Inhaltsverzeichnis
Zum Buch
Vorwort
Erster Band
1. Es klang fast wie Gesang von Lerchen
2. Sie waren sorglos und fröhlich
3. Es war ein großer Saal
4. Es weheten die Banner
Zweiter Band
1. Der Schein ging über Feld und Wald
2. In einfachen Gewändern
3. Mit Waldschäften
Dritter Band
1. In Amt und Gut
2. Im hohen Walde
3. Es kamen tausend Scharen
4. Schwellende Fluten
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
99 Welt-Klassiker
Der Tee der drei alten Damen
Arme Leute und Der Doppelgänger
Der Vampir
Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde
Der Idiot
Jane Eyre
Effi Briest
Madame Bovary
Ilias & Odyssee
Geschichte des Gil Blas von Santillana
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Zum Buch
Witiko ist ein historischer Roman des österreichischen Schriftstellers Adalbert Stifter.
Die umfangreiche Erzählung berichtet von der Gründung des Geschlechts der Witigonen, von einer Liebesgeschichte und vom Aufstieg des jungen Adligen Witiko zum Volkshelden, indem er Herzog Wladislaw in den blutigen Kämpfen um die Macht in Böhmen unterstützt.
Der Roman liefert einen historisch akkuraten Blick auf die großen politisch regionalen Umwälzungen des 12. Jahrhunderts. Stifter selbst hat erklärt, dass sein vordringliches Anliegen die gesamtgeschichtliche Darstellung war.
»Ich könnte fast sagen, daß ich dieses Buch mit meinem Herzblute geschrieben habe. Und doch schwebt mir beständig vor, wie es viel besser sein sollte. Eigentlich sollte man sagen: Der Teufel hole das Dichterleben, man hat nur Kreuz und Qual dabei, und kann es nicht lassen wie geliebte Sünden.« [Adalbert Stifter]
*
Stifter schreibt für die Himmelsrichtungen konsequent Morgen, Mittag, Abend und Mitternacht und verwendet meist die germanischen Monatsnamen - wie Heumond statt Juni.
Seinen Landsleuteninsbesondereder alten ehrwürdigen Stadt Pragwidmetdiesen Dichtungsversuchaus der Geschichte seines Heimatlandesmit treuer Liebe
Der Verfasser Linz, im Christmonate 1864
Vorwort
In meiner Kindheit traten mir schon öfter Spuren eines Geschlechtes entgegen, das im mittäglichen Böhmen gehaust hat, und in der Erinnerung und in den Erzählungen des Volkes fortlebte. Als Jüngling ging ich diesen Spuren nach, und habe manchen Tag in den Trümmern der Stammburg dieses Geschlechtes zugebracht. Hierauf strebte das Ding sich in verschiedenen kindischen Versuchen dichterisch zu gestalten. Später fand sich, begleitet von mancher Unterbrechung und Wiederaufnahme, etwas Ernsteres zusammen, und ging in jüngster Zeit der Vollendung entgegen, welche Vollendung wieder durch ein langes Unwohlsein aufgeschoben wurde. Da gaben mir Freunde den Rat, vorerst den Beginn des Werkes vorzulegen, was hiemit geschieht. Wie weit dieses ersprießlich ist, sei einem glimpflichen Urteile anheim gestellt. Mögen die Männer der Geschichte, wenn einige aus ihnen die folgenden Blätter einer Durchsicht würdigen, nicht zu viel Unrichtiges in ihnen finden, und die Männer der Dichtung nicht zu viel Unkünstlerisches, und mögen, wenn mir Gott die Beendigung meines Unwohlseins und eine neue erhöhtere Kraft schenkt, die folgenden Bände besser gelingen als dieser erste.
Linz, im Christmonate 1864 Adalbert Stifter
Erster Band
1. Es klang fast wie Gesang von Lerchen
Am oberen Laufe der Donau liegt die Stadt Passau. Der Strom war eben nur aus Schwaben und Bayern gekommen, und netzt an dieser Stadt einen der mittäglichen Ausgänge des bayerischen und böhmischen Waldes. Dieser Ausgang ist ein starkes und steiles Geklippe. Die Bischöfe von Passau haben auf ihm eine feste Burg gebaut, das Oberhaus, um gelegentlich ihren Untertanen Trotz bieten zu können. Gegen Morgen von dem Oberhause liegt ein anderer Steinbühel, auf dem ein kleines Häuslein steht, welches einst den Nonnen gehörte, und daher das Nonngütlein heißt. Zwischen beiden Bergen ist eine Schlucht, durch welche ein Wasser hervorkömmt, das von oben gesehen so schwarz wie Tinte ist. Es ist die Ilz, es kömmt von dem böhmisch-bayerischen Walde, der überall die braunen und schwarzen Wässer gegen die Donau sendet, und vereinigt sich hier mit der Donau, deren mitternächtliches Ufer es weithin mit einem dunkeln Bande säumt. Das Oberhaus und das Nonngütlein sehen gegen Mittag auf die Stadt Passau hinab, die jenseits der Donau auf einem breiten Erdrücken liegt. Weiter hinter der Stadt ist wieder ein Wasser, das aus den fernen mittäglichen Hochgebirgen kömmt. Es ist der Inn, der hier ebenfalls in die Donau geht, und sie auch an ihrer Mittagsseite mit einem Bande einfaßt, das aber eine sanftgrüne Farbe hat. Die verstärkte Donau geht nun in der Richtung zwischen Morgen und Mittag fort, und hat an ihren Gestaden, vorzüglich an ihrem mitternächtigen, starke waldige Berge, welche bis an das Wasser reichende Ausgänge des böhmischen Waldes sind. Mitternachtwärts von der Gegend, die hier angeführt worden ist, steigt das Land staffelartig gegen jenen Wald empor, der der böhmisch-bayerische genannt wird. Es besteht aus vielen Berghalden, langgestreckten Rücken, manchen tiefen Rinnen und Kesseln, und obwohl es jetzt zum größten Teile mit Wiesen, Feldern und Wohnungen bedeckt ist, so gehört es doch dem Hauptwalde an, mit dem es vielleicht vor Jahren ununterbrochen überkleidet gewesen war. Es ist, je höher hinauf, immer mehr mit den Bäumen des Waldes geziert, es ist immer mehr von dem reinen Granitwasser durchrauscht, und von klareren und kühleren Lüften durchweht, bis es im Arber, im Lusen, im Hohensteine, im Berge der drei Sessel und im Blöckensteine die höchste Stelle und den dichtesten und an mehreren Orten undurchdringlichen Waldstand erreicht. Dieser auch jetzt noch große Wald hat in seinen Niederungen vornehmlich die Buche, höher hinauf das Reich der Tanne und des ganzen Geschlechtes der Nadelhölzer, und endlich auf dem Grate der Berge auch oft Knieholz, nicht der Berghöhe, sondern der kalten Winde wegen, die gerne und frei hier herrschen. Von der Schneide des Waldes sieht man in das Tal der Moldau hinab, welche in vielen Windungen und im moorigen Boden, der sich aus dem Walde herausgelöst hat, in die ferneren Gelände hinaus geht. Gegen sie steigt der Wald in breiten dichten Wogen ab, nimmt sie nicht selten in seine Schatten, und läßt sie wieder in Wiesen und Hutweiden hinaus. Und so geht er von ihr in vielen Wellen in mitternächtlicher gegen Morgen geneigter Richtung in das Land Böhmen hinein, bis er nach vielen Stunden, die ein Mann zu wandern hätte, mit der letzten der Wellen, die den Namen Blansko führt, an der Ebene steht, in welcher die Stadt Budweis liegt. Und wenn er in den Talrinnen und tellerartigen Ausbuchtungen auch viele Wiesen Felder und Ortschaften hat, so geht in der Mitte doch der ungeschwächte Waldwuchs von dem Blöckensteine in gerader morgenlicher Richtung über das Hochficht die Schönebene und den Schloßwald hinaus, und in ihm ist keine Lichtung und keine Wohnung. Die Richtung der Moldau ist auch gegen Morgen. Sie ist ganz in dem böhmischen Lande. Ihr Fließen ist in dem Tale des großen Waldes sehr langsam. Unterhalb des Jesuitenwaldes kömmt sie in die Kienberge, die an ihrer linken Seite stehen. Hinter ihnen begegnet sie dem Fels der Teufelsmauer, und ihr Lauf wird an ihm ein rauschender und tosender. Hierauf geht sie noch um schöne Waldhöhen, und noch ein Weilchen gegen Morgen. Dann ändert sie ihre Richtung, wendet sich gegen Mitternacht, und beginnt das Waldland zu verlassen. Ihr Fall bleibt da fortan ein lebendigerer und schnellerer, als er in der moorigen Talsohle des oberen Waldes gewesen war. Sie begegnet noch manchem dichten Fels, dann manchem Waldhaupte, das sie in Schlangen zu umgehen gezwungen ist, und manchem langgedehnten Hange, an dem sie in gerader Richtung hinstreichen muß, bis die Berge immer kleiner werden, die sie leichter umspringt, bis sie nach mehreren Meilen gleich dem Blansko in die Ebene kömmt, in der Budweis liegt. Die bedeutendsten Orte, denen sie in dem Laufe, der genannt worden ist, in den heutigen Tagen begegnet, sind die Flecken Oberplan und Friedberg, die Abtei Hohenfurt und die Städte Rosenberg und Krumau.
Zur Zeit, da in Deutschland der dritte Konrad, der erste aus dem Geschlechte der Hohenstaufen, herrschte, da Bayern der stolze Heinrich inne hatte, da Leopold der Freigebige Markgraf in Österreich war, da Sobeslaw der Erste auf dem Herzogstuhle der Böhmen saß, und da man das Jahr des Heiles 1138 schrieb: ritt in der Schlucht zwischen dem Berge des Oberhauses und dem des Nonngütleins -- welche Berge aber damals wild verwachsen waren -- auf einem grauen Pferde, dessen Farbe fast wie der frische Bruch eines Eisenstückes anzuschauen war, ein Mann von der Donau gegen das mitternächtige Hügelland hinaus. Der Mann war noch in jugendlichem Alter. Ein leichter Bart, welcher eher gelb als braun war, zierte die Oberlippe, und umzog das Kinn. Die Wangen waren fast rosenrot, die Augen blau. Das Haupthaar konnte nicht angegeben werden; denn es war ganz und gar von einer ledernen Kappe bedeckt, welche wie ein Becken von sehr festem und dickem Stoffe gebildet, so daß ein ziemlich starker Schwerthieb kaum durchzudringen vermochte, dergestalt auf dem Kopfe saß, daß sie alles Haar in ihrem Innern faßte, und an beiden Ohren so gegen den Rücken mit einer Verlängerung hinabging, daß sie auch einen Hieb auf den Nacken unwirksam zu machen geeignet schien. Diese Verlängerung der Hauptbedeckung aber hing nicht lose auf den Nacken herab, sondern lag ihm vielmehr dicht an, und wurde unter dem Wamse geborgen, welches von gleichem Leder den ganzen Oberkörper knapp umhüllte. In den Achselhöhlen war ein Schnitt, daß der Mann den Arm hoch heben konnte, und daß man dann das Linnen seiner innern Kleidung zu sehen vermochte. Von dem nämlichen Leder schien auch die Beinbekleidung des Reiters. All dieses Leder war ursprünglich mattgelb gewesen, und wiewohl man nicht verkennen konnte, daß große Sorgfalt auf seine Erhaltung und Reinigung angewendet worden sei, so mußte man doch zugeben, daß es nicht mehr neu sei, und Spuren von Wetterschäden und ausgetilgten Flecken zeigte. An der Hüfte hing ein Schwert. Eine Art Mantel oder Oberkleid von Tuch oder überhaupt einem Wollstoffe war zusammengeschnürt an den Sattel geschnallt, weshalb man die Gestalt und das Wesen dieses Dinges nicht zu ergründen vermochte. Nur die Farbe schien grau zu sein. Der Reiter hatte keine Feder auf dem Haupte und nirgends ein Abzeichen an sich. Die Hände waren bloß, die rechte war frei, die linke führte die Zügel. Das Pferd hatte größere Hufe und stärkere Lenden, als Kriegs- oder Reitpferde gewöhnlich zu haben pflegen. Da der Reiter die Schlucht hinaus ritt, sah er weder rechts noch links, noch nach der Stadt zurück. Es war eine frühe Stunde eines Tages des Spätsommers, der schon gegen den Herbst neigte. Der Tag war heiter, und die Sonne schien warm hernieder. Das Pferd ging durch die Schlucht in langsamem Schritte. Als es über sie hinausgekommen war, ging es wohl schneller, aber immer nur im Tritte. Es ging einen langen Berg hinan, dann eben, dann einen Berg hinab, eine Lehne empor, eine Lehne hinunter, ein Wäldchen hinein, ein Wäldchen hinaus, bis es beinahe Mittag geworden war. In dieser Zeit langte der Reiter unter einigen hölzernen Häusern an, die den Namen des Hauzenberges führten. Die Häuser lagen in Unordnung zerstreut, und der Grund, auf dem sie standen, war ungleich. Es war hier schon kühler als an der Donau; denn da in Passau viele Obstbäume standen, ragte hier nur der Waldkirschbaum empor, er stand vereinzelt, und stand in einer Gestalt, die in manchen Teilen zerstückt war, und bewies, daß viele harte Stürme in den Wintern an ihm vorübergegangen waren. In sehr schöner Bildung dagegen stand die Eberesche umher, sie stand bei vielen Häusern, und mischte das Grün ihres Laubes und das beginnende Rot ihrer Trauben zu dem Grau der Dächer. Die Herberge war ein Steinhaus, stand auch neben Ebereschen, und hatte ein flaches, weit vorspringendes Dach, auf dem große Granitstücke lagen. Die Tragebalken gingen weit hervor, und waren zierlich geschnitzt und rot bemalt. In der Gassenmauer war eine Tür, deren Pfosten rot angestrichen waren. Sie führte in die Schenkstube. Nicht weit von ihr war ein Tor, das in den Hof ging. Auf der Gasse standen mehrere steinerne Tische. Weiter zurück waren Pflöcke, die in die Erde eingerammt waren, und dazu dienten, daß man Pferde an sie anhängen konnte. Wieder weiter von diesen Pflöcken entfernt waren auch noch ein paar offene Schoppen, um Pferde unter ihr Dach führen zu können. Hinter den Schoppen stand Waldwuchs.
Der Reiter ritt, da er bei diesen Häusern angekommen war, auf dem schmalen Weglein gegen das Wirtshaus, dort hielt er an, und stieg ab. Er führte sein Pferd zu einem der Pflöcke, nahm ihm die Gebißstangen aus dem Munde, zog eine Halfter aus der Satteltasche, und band es mit derselben an den Pflock. Da dies geschehen war, nahm er Wollappen von der Größe starker Männerhände aus dem Sattel, und strich mit den Lappen wechselnd die Seiten und andere Teile des Tieres. Als er damit fertig war, und die Lappen ausgeschüttelt hatte, leitete er noch seine bloße flache Hand an den Weichen und dem Rücken des Tieres hin, welches ihn dabei anblickte. Dann breitete er den Mantel über dasselbe. Als er diesen auseinander gefaltet hatte, sah man, daß er ein sehr einfaches kunstloses Stück Stoff von grober Wolle und grauer Farbe sei. Dem Pferde gab er weder Nahrung noch Getränke, sondern ließ es stehen, und ging zu einem der steinernen Tische, an dem niemand war, und setzte sich vor demselben nieder.
Auf der Bank, die vor dem Hause hinlief, saß ein Mann, von dem Halse bis zur Sohle in das gleiche Stück groben braunen Tuches gekleidet. Das Tuch lag fest an seiner schlanken Gestalt. Um die Schultern hatte er ein sehr kurzes Mäntelchen mit Ärmeln, das von grauer Farbe war, und noch gröberes Tuch zeigte als die andere Bekleidung. Schwere Schuhe hüllten die Füße ein. Sonst hatte er nichts auf seinem Körper. Der Kopf war ohne Bedeckung, und wucherte mit dem dichtesten kurzen und so krausem schwarzen Haare, als wäre jedes einzelne Fädchen desselben zu einem Ringe gebogen worden. Um das Kinn, auf der Oberlippe und an den Seiten des Angesichtes war dasselbe kurze Haar, aber wo möglich noch krauser. Aus diesem Schwarz sah ein rotes junges Angesicht mit sehr großen schwarzen Augen heraus. Der Mann band mit seinen Händen einen festen Eisendraht gitterartig um einen geklüfteten irdenen Topf. Der Reiter saß mit seinem Angesichte dem Manne gegenüber.
Seitwärts des Reiters, etwa zehn Schritte von ihm entfernt, saßen an einem Brettertische zwei andere Männer. Sie hatten sehr beschmutzte Lederkoller an. Die untere Bekleidung konnte man der sehr breiten Tischplatte willen nicht sehen. Ihre Lederhauben lagen auf dem Tische. Der eine hatte rotbraune Haare und einen roten Bart, der andere war schwarzhaarig; aber in das Schwarz war schon sehr viel Weiß gemischt. Der Rotbart schien um die dreißig Jahre zu sein, der Graubart um die fünfzig. Beider Angesichter waren stark gebräunt. Vor ihnen stand ein großer grauer Steinkrug mit blauen Blumen. An der Bank neben dem Tische lehnte eine Armbrust, auf der Bank aber lag ein eisenspitziger Stock, den man auch einen Speer nennen konnte.
Sonst war kein Gast auf der Gasse, als an dem entferntesten kleinsten Tische ein Kärrner, der seinen Karren mit Ware, die vielleicht Töpfergeschirr sein konnte, neben sich hatte.
Ob in der Schenkstube jemand war, konnte man nicht sehen.
Nur das Federvieh des Wirtes ging in der Sonne herum, und pickte zu Zeiten ein Körnchen vom verstreuten Pferdefutter.
Da sich der Reiter an dem Tische niedergesetzt hatte, kam auch der Wirt im Bocklederwamse dunkeln Unterbeinkleidern und platter Haube aus der Tür mit den roten Pfosten. Er näherte sich dem Tische, an welchem der junge Reiter saß, und sagte: »Werdet Ihr etwas bedürfen, was unser Haus geben kann?«
»Wohl, wenn Ihr mir zu Diensten seid«, entgegnete der Reiter, »es ist nur wenig. Sendet mir ein Stückchen Fleisch, ein Brot und einen Trunk Bier. Und wenn ich gegessen habe, dann schickt mir einen Knecht heraus, daß ich ihm sage, was ich für mein Pferd brauche.«
»Ich werde nur selber Euer Pferd betreuen«, antwortete der Wirt.
»Es wäre mir lieber, wenn Ihr gerade so tätet, wie ich Euch gebeten habe«, entgegnete der Reiter.
»Es ist auch gut«, sagte der Wirt, und entfernte sich.
Sogleich kam ein Mädchen aus dem Hause, das rote Wangen hatte, und dem zwei lichtgelbe Zöpfe von dem Nacken über den roten Latz und das wollene schwarze Untergewand herab hingen. Das Mädchen deckte frisches Linnen auf den rauhen Stein des Tisches, und stellte Schüsselchen, und legte Messer und Gabel auf das Linnen. Dann brachte es dem Reiter in einem grauen Kruge, der auch blaue Blumen hatte, Bier und endlich ein Stück gebratener Rindschnitte und ein Laiblein Brot. Der Reitersmann zerschnitt das Fleisch und das Brot, verzehrte beides, und trank das Bier. Als er fertig war, kam der Wirt, und wollte den Krug wieder füllen; der Reiter aber legte die Hand auf den Rand des Gefäßes, und sagte: »Es ist genug, ich habe meinen Durst gestillt. Sendet mir jetzt den Knecht, daß mein Pferd sein Obsorge erhalte.«
Von dem Nebentische streckte der Rotbart dem Wirte den blaugeblümten Krug hin, daß er ihn wieder fülle. Der Wirt ging mit dem Kruge in das Haus.
Als der Knecht zu dem Tische des Reiters gekommen war, und nach seinem Begehr gefragt hatte, sagte dieser: »Mache, daß eine Magd mit Wasser Stroh und Sand ein wenig eine Pferdekufe reinige.«
Da der Knecht den Reitersmann ansah, als habe er ihn nicht recht verstanden, sprach dieser neuerdings: »Ich muß meinem Pferde Reinlichkeit geben, darum lasse mir eine Kufe auswaschen.«
Der Knecht holte nun eine Magd, welche in einem Kübel Wasser, dann Stroh und Sand brachte, um damit eine der hölzernen Kufen zu scheuern, die als Pferdefuttertrog vor dem Hause standen. Der Reiter war von seinem Tische aufgestanden, sah der Arbeit zu, und leitete sie. Als sie fertig war, wurde die Kufe vor sein Pferd gestellt. Der Reiter nahm nun selber den flachen länglich runden Korb, in dem der Knecht Haber gebracht hatte, in seine Hände, schüttelte den Haber, und gab dann einen Teil davon, mit seinen Händen abgemessen, dem Pferde in die Kufe. Als dieses davon fraß, und in seinem Fressen fortfuhr, ging der Reiter wieder zu seinem Tische, setzte sich dort nieder, und sah vor sich hin.
Nachdem eine gehörige Zeit vergangen war, stand der Reiter wieder auf, und ging zu seinem Pferde. Er ordnete ihm neuerdings sein Futter, und gab ihm jetzt auch Heu, welches der Knecht gebracht hatte. Er blieb nun bei dem Pferde stehen.
Da näherte sich einer der zwei Männer, welche nicht weit von dem Reiter gesessen waren. Es war der ältere, der mit den grauen Haaren. Als er nahe genug war, sagte er zu dem jungen Manne: »Das ist ein schönes Tier, ein starkes Tier, es wird auch gewiß sehr schnell sein.«
»Ja es ist ein gutes Tier, und für mich reicht seine Schnelligkeit hin«, sagte der junge Reiter.
Der andere fuhr nach einer Weile fort: »Ihr müßt es den Leuten hier nicht übel nehmen, wenn sie den Umgang mit Euch nicht verstehen, sie haben keinen Unterricht. Es kommen selten hier angesehene Reiter herauf; denn da ist kein ordnungsmäßiger Heerweg, es sind keine Orte hier, die einen vielfältigen Wandel mit einander hätten, und die Hügel und die Schluchten des Bodens sind auch nicht geeignet, daß hier Fehden ausgetragen würden. Der Gastherr ist schier nur ein Bauer, und weiter hinauf sind gar lauter Wälder, in denen kein Mensch ist. Aber dahin seid Ihr gewiß nicht gekommen, und werdet nicht kommen.«
»Ich bin mit der Nahrung, die ich in diesem Hause erhalten habe, zufrieden«, antwortete der Reiter, »der Haber ist für mein Pferd gut, und das Heu auch.«
»Ja, ja«, antwortete der andere, »aber wie man mit vornehmen Leuten auf eine höfliche Art umgehen soll, das wissen sie hier nicht.«
»Ich bin nicht vornehm«, sagte der Reiter.
»Es kann sich jetzt in diesen Kriegen viel begeben«, fing der andere wieder an, »es können Boten und Reisige unterwegs sein und Wege und Pfade einschlagen, auf die man gar nicht dächte.«
»Mir sind nur Landbewohner begegnet«, antwortete der junge Reiter.
»Dann müßt Ihr von Passau herauf gekommen sein«, sagte der andere.
»Es vereinigen sich mehrere Wege unterhalb dieser Häuser«, erwiderte der Reiter.
»Das ist wahr«, entgegnete der andere. »Es gibt schlechte Menschen, die einem Boten auflauern könnten, um Lohn zu erhalten. Da ist der Herzog Heinrich, ein edler Mann, ein reicher Mann, ein mächtiger Mann, der Schwiegersohn unsers seligen Kaisers -- Gott segne den Kaiser in der Ewigkeit -- der Herzog hat die Kleinode, und wird sie nicht herausgeben. Dann ist der König Konrad, der erlauchte Herr aus dem Hause der Staufen. Dann ist der heilige Herr, der Erzbischof von Trier, dann der Markgraf Leopold von Österreich, ein junger Herr. Er ist der Stiefbruder des neuen Königs, und wird zu ihm stehen. Der Herzog Sobeslaw in Böhmen ist schon älter, und hat Erfahrung.«
»Ich habe noch keinen dieser Herren gesehen«, antwortete der Reiter.
»Ja, Ihr seid noch jung«, sagte der andere, »und könnt Euer Glück in der Welt schon finden. Es wird Gnaden und Ehren geben. Ich bin schon alt, und kann nichts tun, als für die hohen Häupter beten. Ich wünsche Euch, daß Ihr recht viel Glück habt, junger Herr, und bringt es vorwärts.«
»Nun, da Ihr mir Gutes wollt, so werde ich Euch schon auch einmal einen Dienst erweisen, so Ihr einen von mir braucht«, erwiderte der Reiter.
»Gutes, nur lauter Gutes«, sagte der andere, und begab sich wieder zu seinem Gefährten an den Tisch.
Da nun dieser Mann von dem Reiter fortgegangen war, so war noch ein anderer da. Der Krauskopf stand in einiger Entfernung, und betrachtete das Pferd mit seinen schwarzen Augen. Er mußte mit seinem Geschäfte fertig geworden sein.
Da der Reiter seinem Pferde die Nahrung zusammengestrichen hatte, sah er auf den Krauskopf, und sagte: »Bewunderst du auch mein Pferd?«
Dieser ging nun näher, und antwortete: »Ich bewundere es schon lange, schon so lange Ihr da seid. Hat der andere es auch bewundert? Nun, ich kann es mir denken.«
»Kannst du reiten?« fragte ihn der junge Mann.
»Ja, ich kann reiten«, antwortete der andere, »und brauche keine Bügel und keine Sporen und keinen Sattel. Ich reite barfuß, mit den Knien, mit den Fersen und mit den Fäusten.«
»Das muß ein schönes Reiten sein«, sagte der junge Mann.
»Ja«, erwiderte der Krauskopf, »ein gutes ist es, sie bringen mich nicht herab, wenn sie schlagen, beißen, steigen und springen.«
»Hast du ein Pferd?« fragte der Reiter.
»Ich habe selber kein Pferd, ich habe gar nie einmal eines gehabt; aber ich reite mit den Pferden der andern.«
»Und lassen die andern dich auf ihren Pferden reiten?« fragte der junge Mann.
»Ja, von der Weide und in die Schwemme«, entgegnete der Krauskopf. »Es gehen Pferde auf dem Anger herum, und wälzen sich, oder fressen.«
»Sind es gute Pferde?« fragte der Reiter.
»Ja, gute Pferde«, antwortete der andere, »es ist ein Unterschied, einige sind stärker, andere schwächer, aber so zierlich schön und glatt wie das Eurige ist keines. Ich möchte einmal auf einem solchen Pferde sitzen, auf einem Sattel, und die Füße in diese eisernen Schlingen da stecken.«
»Dazu muß man Geschick haben«, sagte der Reiter.
»Wer schwimmt, und Rabennester abnimmt, auf Stangen über einen Bach geht, und einen Stier fängt, wird doch auch auf einem solchen Sattel sitzen können.«
»Ja, das Sitzen ist leicht«, sagte der Reiter, »aber das Pferd zu leiten, daß es vernünftig ist, und den Willen des Reiters weiß.«
»Das würde ich schon machen«, antwortete der Krauskopf. »Ich würde mein Pferd zuerst pflegen, wie Ihr tut.«
»Das ist gut«, sagte der Reiter.
»Ihr habt den eigenen Mantel darauf gelegt«, erwiderte der andere, »daß es sich nach dem scharfen Ritte nicht verkühle.«
»Siehst du, daß du die Behandlung der Pferde nicht kennst«, sagte der Reiter; »nach einem scharfen Ritte darf man die Pferde, auch wenn sie mit einem Mantel bedeckt werden, nicht stehen lassen, sondern man muß sie herum führen, erst schneller, dann langsamer, daß sie die Wärme gemach verlieren, und für Futter und Trank tauglicher werden.«
»Warum habt Ihr denn Euer Pferd dann sogleich stehen gelassen?« fragte der andere.
»Weil ich gar nicht scharf geritten bin«, antwortete der Reiter.
»Ihr seid nicht scharf geritten?« fragte der Krauskopf, und sah den Reiter starrer an.
»Wenn nicht Schnelligkeit nötig ist«, entgegnete der junge Mann, »so lasse ich das Pferd seinen langsamen Schritt gehen. Es dankt mir dann ein ander Mal, wenn ich Kraft und Schnelligkeit brauche.«
»Das ist sehr gut«, sagte der Krauskopf. »Ich würde meinem Pferde Treue erweisen, daß es mir wieder treu würde, und mir folgte.«
»Daran würdest du sehr wohl tun«, sprach der Reiter.
»Weil ich die Wege in dem Walde kenne und weiß, wie alle Menschen im Walde und ihre Hunde heißen, so würde ich auch den Willen eines Pferdes kennen«, sagte der andere.
»Kann sein«, entgegnete der Reiter.
»Ich werde aber nie ein Pferd haben«, sagte der Krauskopf.
»Warum denn nicht?« fragte der Reiter.
»Weil ich nie so viele Pfennige haben werde, mir eins zu kaufen«, entgegnete der andere.
»Ja so«, sagte der Reiter.
»Und wenn ich der erste Knecht des Waldes wäre, so könnte ich mir nie ein so ritterliches Pferd kaufen, wie das Eurige ist. Mit einem ritterlichen Pferde würde ich Erkleckliches bewirken«, sagte der Krauskopf.
»Ja, da wirst du nie eines bekommen«, entgegnete der junge Mann.
»Wenn ich im Kriege bei den Unsrigen eine Lanze ergriffe, zu den Feinden ginge, ihnen ein Pferd nähme, und darauf zu uns zurück ritte: gehörte das Pferd mir?«
»Es wäre Beute«, sagte der Reiter.
»Gehörte es mir?« fragte der andere wieder.
»Wenn du kein Wege- und Gelegenheitslagerer bist, sondern ein zugeteilter Kriegsknecht, und wenn du das Pferd nicht in der allgemeinen Schlacht oder sonst in einem Angriffe erwirbst, sondern wenn du allein hinüber gehst und es allein herüber bringst, so wird man es dir wohl lassen«, antwortete ihm der Reiter.
»So werde ich also tun«, entgegnete der Mann.
»Tu es, mein Freund«, sagte der Reiter.
Das Pferd war indessen mit seiner Nahrung lässiger geworden, und hatte öfter umgeblickt. Der Reiter ließ ihm Wasser bringen, und tränkte es, dann mischte er ihm wieder etwas Haber in seine Kufe. Während es denselben verzehrte, blieb er dabei stehen. Der Krauskopf blieb auch stehen, und sah zu. Als das Pferd fertig war, wurde es noch einmal getränkt, und der Reiter wischte ihm dann die Lippen ab, und die Kufe wurde seitwärts gestellt. Hierauf ging der junge Mann zu seinem Tische, und verlangte nach dem Wirte. Als dieser erschienen war, fragte er ihn: »Was bin ich Euch schuldig?«
»Die Zehrung macht siebenzehn Pfennige, und das Waschen des Troges macht drei Pfennige«, sagte der Wirt.
Der Reiter nestelte auf der Brust ein wenig sein Wams auf, und zog ein Beutelchen heraus. Er las aus demselben den Betrag, reichte ihn hin, zog das Beutelchen zu, und barg es wieder in seinem Wamse. Dann begab er sich zu seinem Pferde, zäumte es, schnallte den Mantel, führte es ein wenig gegen die Gasse vorwärts, und bestieg es. Der Krauskopf war mit ihm gegangen, und sah überall zu. Da der Reiter auf dem Pferde saß, richtete er sich auf demselben zurecht, ritt gegen den Wirt, und sagte: »Ich danke Euch, lieber Herr, für die Bewirtung, und wünsche, daß Euch Gott behüte, und alle, die bei Euch sind.«
»Ich danke Euch«, antwortete der Wirt, »und wünsche Euch desgleichen, und reitet glücklich.«
Der Reiter ritt nun langsam von der Gasse weg, den Krauskopf, und die ihm nachsahen, hinter sich lassend. Er ritt in der Richtung zwischen Morgen und Mitternacht fort. Er ritt wieder eine Lehne hinan, eine Lehne hinab, ein Wäldchen aus, ein Wäldchen ein, der Boden wurde immer unwirtlicher und war endlich mit Wald bedeckt. Der Weg hatte Wurzelgeflechte und Granitsteine, und das Pferd setzte behutsam seine Hufe.
Da es Abend geworden war, kam der Reiter auf der Schneide eines langen von Abend gegen Morgen gestreckten Berges an. Derselbe ging mit lauter Wald in ein enges Tal hinab, und unten blitzte ein Wässerlein. Jenseits ging wieder ein noch höherer und mächtigerer Wald empor, und auf seinem Rande ragte ein Steinblock in die Höhe. -- Der Reiter hielt ein Weilchen an, und sah auf den Steinblock hin.
Dann ritt er in dem Walde, der vor ihm lag, hinunter. Er ritt unter den Ästen der Bäume, die um ihn waren, dahin, und mußte sich vor manchem bücken, welcher zu niedrig war. Nach einer Zeit kam er bei einem roten Kreuze an. Er hielt an dem Kreuze stille, und tat ein kurzes Gebetlein. Dann ritt er wieder weiter. Als es ganz finster geworden war, stieg er vom Pferde, nahm ihm die Zügel über den Hals nach vorwärts, ging vor ihm, und führte es hinter sich her. Von dem Kreuze hatte er noch eine kurze, aber sehr steile Stelle zu dem Wasser hinunter. An dem Wasser verbreitete sich ein Feuergeruch, der Reiter ging auf eine offene Stelle hinaus, auf welcher aus mehreren dunkeln Erhöhungen Feuerzünglein empor gingen, die die nächtlichen Tannen beleuchteten, und aus denen sich ein lichter Rauch über den Wald erhob. Seitwärts dieser Erhöhungen waren mehrere Hütten, aus denen manches Lichtlein glänzte. Der Reiter führte sein Pferd zu einer der Hütten. Als er dort angekommen war, öffnete sich die Tür der Hütte, und ein Mann und ein Weib und zwei Kinder traten heraus.
»Seid Ihr da«, sagte der Mann, »wir haben Euch schier nicht mehr erwartet.«
»Sei gegrüßt, Mathias«, entgegnete der Reiter, »von Passau kann ich wohl nicht in kürzerer Zeit da sein.«
»So bringt nur Euer Pferd herein«, sagte der Mann, und öffnete nicht weit von der Tür ein Tor.
»Margaretha, leuchte mit einem Span«, sagte er.
Das Weib lief in die Hütte, und kam bald mit einem brennenden Buchenspan zurück. Sie ging mit dem Span durch das Tor ein, der Reiter mit dem Pferde folgte ihr, und hinter ihm gingen der Mann und die Kinder. Sie kamen in einen Stall. Zwei Kühe hingen in einer Ecke dicht bei einander, und für das Pferd hatte man einen freien Platz gemacht. Es wurde dort angebunden, und der Reiter und der Mann befreiten es von Zaum und Sattel. Der Reiter deckte seinen Mantel über dessen Rücken. Die Kinder schauten zu. Dann ging man von dem Stalle durch eine kleine Tür in die Stube. In der Stube stand ein hoher Pflock, der mehrere eiserne Schleifen hatte. In zweien dieser Schleifen staken brennende Buchenspäne. Die Frau steckte ihren Span in eine dritte Schleife. Der Reiter setzte sich auf einen hölzernen Stuhl. Die Frau deckte ein Linnen auf einen Tisch von weichem Holze und stellte dann eine Schüssel mit Suppe auf den Tisch. Der Reiter, der Mann, die Frau und die Kinder aßen von der Suppe. Dann sagte der Mann: »Ich werde Euch Euer Pferd besorgen, da Ihr müde sein mögt.«
»Wir werden es beide besorgen«, antwortete der Reiter.
Der Mann nahm einen Span, ging dem Reiter voran in den Stall, und dieser folgte ihm. In dem Stalle gab der Reiter dem Pferde von dem Futter, das schon vorgerichtet war. Dann ging man wieder in die Stube. Als dieses so oft geschehen war, als sich nötig zeigte, bis das Pferd seine völlige Pflege erhalten hatte, sagte der Mann: »Jetzt begeben wir uns zur Ruhe, und ruhet Euch recht gut.«
»Ihr auch«, sagte der Reiter.
Die Frau brachte die Kinder in ein Seitenkämmerlein der Stube, und der Mann folgte der Frau und den Kindern.
Der Reiter schnallte sein Schwert ab, nahm seine Haube von dem Kopfe, löschte die Späne aus, legte sich angekleidet auf ein Bett, das in einer Ecke der Stube stand, legte sein Schwert neben sich, und bereitete sich zum Schlummer.
Als des andern Tages die Sonne über den Wald empor ging, stand der Reiter wieder mit seiner Haube auf dem Kopfe und mit dem Schwerte an der Lende vor der Hütte. Es war ein Stückchen Feld und Wiese um diese wie um die anderen Hütten. Die schwarzen Erhöhungen, welche Kohlenmeiler waren, brannten und rauchten wie gestern.
Aus der Hütte kam die Frau mit den Kindern, die heute morgens schöner angekleidet waren, und sagte: »Kommt zur Suppe, lieber Herr.«
Der Reiter ging in die Stube, und alle zusammen verzehrten eine Schüssel voll warmer Milch mit Roggenbrot.
Der Reiter ging dann in den Stall, und vollendete die Morgenpflege seines Pferdes.
Als dieses vorüber war, sagte er: »Weil heute Sonntag ist, soll das Pferd ruhen. Ich werde in den Wald hinauf und zu dem Fels der drei Sessel gehen. Ich habe ihn gestern von dem Rande des breiten Berges aus betrachtet. Am Nachmittage werde ich wieder zurückkehren. Du, Mathias, besorge die Mittagpflege des Pferdes, wie du schon weißt.«
»Ich werde es betreuen, wie das schöne milchweiße Pferd in Plan, welches Ihr gehabt habt«, sagte der Mann.
»Das weiße Pferd wäre mir zu dem, was ich jetzt vorhabe, doch zu schwach«, entgegnete der Reiter.
»So steckt doch wenigstens ein Stück Brot zu Euch«, sagte die Frau.
Der Reiter nahm das dargereichte Stück Brot, und barg es in seinem Wamse.
Dann ging er gegen das Wasser, welches in der Nähe der Hütte vorüber floß. Die Bewohner der Hütte begleiteten ihn bis an das Wasser.
»Euer Mihelbach fließt recht schön an deiner Hütte vorüber«, sagte der Reiter.
»Ja«, erwiderte der Mann, »zuweilen aber nicht oft auch in dieselbe hinein.«
»Nun gehabe dich wohl, Mathias, und Ihr auch, Frau, mit Euern Kindlein«, sagte der Reiter.
»Gehabt Euch wohl, junger Herr«, antwortete der Mann.
»Erhitzt Euch nicht zu sehr, und kommt gesund wieder zurück«, sagte die Frau.
»Es wird schon so geschehen«, erwiderte der Reiter.
Dann ging er auf dem flachen Holzstege über das Wasser, die andern gingen gegen die Hütte zurück.
Jenseits des Wassers ging er in dem Walde empor. Der Himmel war ganz blau, und man konnte die Waldglocken von Rindern und manchen Schrei eines Vogels hören. Der Reiter wich zuweilen von dem Pfade ab, und ging auf eine Waldblöße hinaus.
Auf einer solchen Waldblöße, auf welcher kurzes Gras und kleine weiße Blümchen waren, und an deren Rande große Ahorne standen, lag, als die Ahorne endeten, ein sehr großer Stein, fast so groß als ein Haus, als wäre er von Menschenhänden hingelegt worden, und an dem Steine stand eine ungemein hohe Tanne. Der Reiter kniete an der Tanne nieder, und verrichtete ein Gebet. Als er gebetet hatte, stand er wieder auf, und ging am Rande der Blöße weiter. Er kam wieder zu Ahornen, unter denen abermals Steine lagen, aber kleine, als wären sie zum Sitzen hergelegt worden. Der Reiter versuchte die Steine als Sitze, und sie taugten. Da er wieder aufgestanden war, und weiter gehen wollte, hörte er plötzlich Stimmen. Es war ein Gesang so klar und schmetternd wie von Lerchen. Es waren aber nicht Lerchenstimmen, sondern Menschenstimmen, Mädchenstimmen. Sie sangen jenes Lied ohne Worte, in welchem im Walde und in Bergen das Herz sich in allerlei Schwingungen der Stimme, im Stürzen und Heben derselben, im Wandeln und Bleiben ausspricht. Es waren zwei Stimmen, die im Vereine und in Verschlingungen klangen. Sie erklangen, hoben sich, senkten sich, trugen sich, trennten sich, neckten sich, schmollten und jubelten. Es war die Lust und Freude, die sie tönten. Der Gesang schien näher zu kommen. Mit einem Male traten zwei Gestalten aus den Tannen hervor, und standen am Rande derselben Blöße wie der Reiter und in nicht großer Entfernung von ihm. Sie hielten sich mit zwei Armen die Nacken umschlungen, die anderen zwei Arme hatten sie frei. Es waren junge Mädchen mit bloßen Köpfen, von deren jedem zwei Zöpfe niedergingen. An den Armen war weißes Linnen, von den Brustlatzen, die rot waren, fiel der starkfaltige schwarze Rock hinab. Eines der Mädchen trug wilde rote Rosen, neben einander stehend, um das Haupt. Das andere hatte keine Zierde. Da sie auf die Wiese getreten waren, und den Mann sahen, hörte ihr Gesang auf. Sie blieben stehen, sahen auf ihn hin, und er stand gleichfalls, und sah auf sie. Dann begann er langsam gegen sie hin zu gehen. Sogleich trat das Mädchen, welches keine Rosen hatte, in den Wald zurück, das andere blieb stehen. Der Reiter ging zu demselben hin. Da er bei ihm angekommen war, sagte er: »Was stehst du mit deinen Rosen hier da?«
»Ich stehe hier in meiner Heimat da«, antwortete das Mädchen; »stehst du auch in derselben, daß du frägst, oder kamst du wo anders her?«
»Ich komme anders woher«, sagte der Reiter.
»Wie kannst du dann fragen?« entgegnete das Mädchen.
»Weil ich es wissen möchte«, antwortete der Reiter.
»Und wenn ich wissen möchte, was du willst«, sagte das Mädchen.
»So würde ich es dir vielleicht sagen«, antwortete der Reiter.
»Und ich würde dir vielleicht sagen, warum ich mit den Rosen hier stehe«, entgegnete das Mädchen.
»Nun, warum stehst du da?« fragte der Reiter.
»Sage zuerst, was du willst«, erwiderte das Mädchen.
»Ich weiß nicht, warum ich es nicht sagen sollte«, erwiderte der Reiter, »ich suche mein Glück.«
»Dein Glück? Hast du das verloren?« sagte das Mädchen, »oder suchst du ein anderes Glück, als man zu Hause hat?«
»Ja«, antwortete der Reiter, »ich gehe nach einem großen Schicksale, das dem rechten Manne ziemt.«
»Kennst du dieses Schicksal schon, und weißt du, wo es liegt?« fragte das Mädchen.
»Nein«, sagte der Reiter, »das wäre ja nichts Rechtes, wenn man schon wüßte, wo das Glück liegt, und nur hingehen dürfte, es aufzuheben. Ich werde mir mein Geschick erst machen.«
»Und bis du der rechte Mann, wie du sagst?« fragte das Mädchen.
»Ob ich der rechte Mann bin«, antwortete der Reiter, »siehe, das weiß ich noch nicht; aber ich will in der Welt das Ganze tun, was ich nur immer tun kann.«
»Dann bist du vielleicht der rechte«, erwiderte das Mädchen, »bei uns, sagt der Vater, tun sie immer weniger, als sie können. Du mußt aber ausführen, was du sagst, nicht bloß es sagen. Dann weiß ich aber doch noch nicht, ob du ein Schicksal machen kannst. Ich weiß auch nicht, ob du ein Schicksal machst, wenn du in unserem Walde auf der Wiese stehst.«
»Ich darf da stehen«, sagte der Reiter, »denn heute ist Sonntag, der Ruhetag für Menschen und Tiere, wenn es nicht eine Not und Notwendigkeit anders heischt. Mein Pferd habe ich eingestellt. Ich bin in den Wald herauf gegangen, zu beten. Und für den übrigen Tag will ich versuchen, ob ich nicht zu dem Steine der drei Sessel hinauf gelangen kann.«
»Das kannst du«, sagte das Mädchen, »es geht ein Pfad hinauf, den du immer wieder leicht findest, wenn du ihn einmal verlierst. Weil aber der Stein von dem Grunde, der um ihn herum ist, wie eine gerade Mauer aufsteigt, so haben sie Stämme zusammen gezimmert, haben dieselben an ihn gelehnt, und durch Hölzer eine Treppe gemacht, daß man auf seine Höhe gelangen kann. Du mußt aber oben sorgsam sein, daß dein Haupt nicht irre wird; denn du stehst in der Luft allein über allen Wipfeln.«
»Bist du schon oben gestanden?« fragte der Reiter.
»Ich werde doch, da ich so nahe bin«, antwortete das Mädchen.
»Nun«, sagte der Reiter, »wenn du schon oben gestanden bist, so werde auch ich oben stehen.«
»Und wenn du heute von den drei Sesseln herunter kommst«, sagte das Mädchen, »dann reitest du morgen nach deinem Geschicke weiter?«
»Ich werde weiter reiten«, sagte er; »warum hast du die Rosen?«
»Muß ich antworten, wenn ich gefragt werde?« sagte das Mädchen.
»Wenn die Eltern fragen, mußt du antworten«, entgegnete der Reiter, »wenn jemand anderer artig fragt, sollst du, und wenn du es versprochen hast, mußt du antworten.«
»So will ich dir so viel sagen, als du gesagt hast«, antwortete das Mädchen, »ich trage die Rosen, weil ich will.«
»Und warum willst du denn?« fragte der Reiter.
»Für den Willen gibt es keine Ursache«, sagte das Mädchen.
»Wenn man vernünftig ist, gibt es für den Willen immer eine Ursache«, erwiderte der Reiter.
»Das ist nicht wahr«, sagte das Mädchen, »denn es gibt auch Eingebungen.«
»Trägst du die Rosen aus Eingebung?« fragte der Reiter.
»Das weiß ich nicht«, entgegnete das Mädchen, »aber wenn du mir mehr von dir sagst, so sage ich dir auch mehr.«
»Ich kann dir nicht viel sagen«, antwortete der Reiter, »ich habe eine Mutter, die in Bayern wohnt, mein Vater ist gestorben, und ich reite jetzt in die Welt, um meine Lebenslaufbahn zu beginnen.«
»So will ich dir auch etwas sagen«, erwiderte das Mädchen. »Meine Eltern haben von hier weiter oben ein Haus. Wir würden es erreichen, wenn wir hier in den Wald gingen, wo ich mit meiner Gespanin herausgetreten bin, wenn wir in dem Walde nach aufwärts gingen, bis wir ein Wasser rauschen hörten, und wenn wir dann zu dem Wasser gingen, und demselben immer entgegen, dann würden endlich Wiesen und Felder kommen, und in ihnen das Haus. An dem Hause ist ein Garten, wo die Sonnenseite ist, und in dem Garten stehen viele Blumen. Und an der Hinterseite des Hauses geht ein Riegel gegen die Tannen, auf welchem viele Waldrosen stehen, und diese nehme ich oft.«
»Hast du die Rosen heute aus Eingebung genommen? Sie sind mir ein Zeichen, daß meine Fahrt gelingen wird«, sagte der Reiter.
»Ich habe einen Metallring, in welchen die Rosenstiele passen«, sagte das Mädchen, »habe heute Rosen genommen, habe sie in den Ring gesteckt, und den Ring auf das Haupt getan.«
»Weil wir noch mehr sprechen werden«, sagte der Reiter, »so gehen wir ein wenig an dem Waldsaume hin, woher du mich kommen gesehen hast. Da werden wir Steine finden, welche zu Sitzen taugen. Auf dieselben können wir uns setzen, und dort sprechen.«
»Ich weiß es nicht, ob ich noch mehreres mit dir sprechen werde«, antwortete das Mädchen, »aber ich gehe mit dir zu den Steinen, und setze mich ein wenig zu dir. Ich kenne die Steine, ich selber habe die Sitze machen lassen. Im Sommer ist es am Vormittage dort sehr heiß, am Nachmittage aber schattig. Im Herbste ist es vormittags lieblich und mild.«
Sie wandelten nun in der Richtung an dem Saume des Waldes hin, in welcher der Reiter zu den Mädchen hergekommen war. Sie hatten bald jene Steine erreicht, an denen der Reiter versucht hatte, ob sie zu Sitzen tauglich wären. Er blieb stehen, und harrte, bis das Mädchen sich gesetzt hatte. Es setzte sich auf einen glatten Stein. Der Reiter setzte sich zu ihrer Linken auf einen, der etwas niederer war, so daß nun sein Angesicht mit dem ihrigen fast in gleicher Höhe war. Das Schwert ragte zu seiner Linken in die niederen Steine hinab. Sie sprachen nun nichts.
Nach einer Weile sagte der Reiter: »So rede etwas.«
»So rede du etwas«, antwortete sie, »du hast gesagt, daß du mit mir noch sprechen willst.«
»Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich sagen wollte«, entgegnete er.
»Nun, ich auch nicht«, sagte sie.
Nach einer Zeit sagte der Reiter: »Es ist wahr, was du gesprochen hast, daß an Vormittagen die Sonne sehr mild auf diese Steine scheint.«
Sie antwortete nicht. Nach einer Weile sagte sie: »Trägst du immer diese häßliche Haube auf deinem Haupte?«
»Nein, nur wenn ich sie brauche«, sagte er, »sie ist sehr leicht herab zu nehmen.«
Bei diesen Worten nahm er die Lederhaube samt ihrem Anhange von seinem Haupte, und eine Fülle schöner blonder Haare rollte auf seinen Nacken herab. Die Haube legte er in das Gras.
»Ach, was Ihr für schöne Haare habt!« sagte das Mädchen.
»Und was du für rote Wangen hast«, erwiderte er.
»Und wie blau Eure Augen sind«, sagte sie.
»Und wie braun und groß die deinen«, antwortete er.
»Und wie Ihr freundlich sprecht«, sagte sie.
»Und wie du lieblich bist«, antwortete er.
»Sagt, wie könnt Ihr nur die Fülle dieser Haare in der ledernen Haube unterbringen?« fragte das Mädchen.
»Das mache ich so«, antwortete der Reiter, »ich fasse die Haare, halte sie mit einer Hand, und setze den Helm mit der andern darauf.«
Bei diesen Worten griff er nach dem Lederhelme, faßte mit seiner Linken die Haare, hielt sie auf dem Haupte, und setzte mit der Rechten den Helm darauf.
»Ach, das ist schön«, sagte sie.
»Nun sind sie bedeckt«, antwortete er.
»Ja, legt nur die Haube wieder weg«, sagte sie.
Er nahm den Helm von dem Haupte, und legte ihn wieder an seine vorige Stelle, und die Haare flossen wieder herab.
»Wenn Ihr wollt in den Kampf gehen«, fuhr das Mädchen fort, »wie werdet Ihr dann die Feinde schrecken können, wenn Ihr so freundlich blickt?«
»Wer sagte dir denn, daß ich in den Kampf gehen werde?« fragte der Reiter.
»Ich weiß es«, antwortete das Mädchen.
»Nun, in meinem Geschicke werden wohl Kämpfe sein«, sagte der Reiter.
»Der Kampf ist eine Ehre«, antwortete das Mädchen.
»Wenn er nicht Raub und Gewalt ist, ehret der Kampf«, sagte der Reiter, »wenn man gegen feindselige Menschen den Vater, die Mutter, den Bruder, die Schwester, den Nachbar und das Volk verteidigt, ehret er noch mehr, und muß mit dem ganzen Leben geführt werden. Dazu muß man sich vorbereiten.«
»Ihr habt eines vergessen, das man noch verteidigen muß«, sagte sie.
»Was?« fragte er.
»Sein Weib«, antwortete sie.
»Ich habe kein Weib, und habe darauf nicht gedacht«, erwiderte er; »aber wenn man schon das ganze Volk verteidigt, so verteidigt man sein Weib mit.«
»Nein, dasselbe muß man am meisten verteidigen«, sagte das Mädchen.
»Nun, so verteidigt man es am meisten«, entgegnete der Reiter.
»Und wie werdet Ihr dann blicken, daß der Feind weniger Herz hat?« fragte sie wieder.
»Das weiß ich nicht«, antwortete er; »aber ich werde blicken, wie mir’s ist, und das wird der Feind verstehen. Dich blicke ich freundlich an, weil ich freundlich gegen dich bin.«
»Und da Ihr sagt, daß man sich zur Verteidigung vorbereiten muß, so habt Ihr Euch vorbereitet?« fragte das Mädchen.
»Weil ich will ein Reiter sein«, antwortete er, »so habe ich gelernt, ein Pferd zu pflegen, und darauf zu reiten; ich habe mich im Angriff und im Schutz geübt, werde im Kriege lernen, und werde einsehen, wie man eine Schar von andern anzuführen hat.«
»Wollt Ihr ein Anführer werden?« fragte sie.
»Wenn es sein kann, ja«, antwortete er.
»Habt Ihr ein schönes Pferd?« fragte das Mädchen.
»Es ist nicht ein schönes, es ist nicht ein häßliches«, erwiderte der Reiter, »aber unter den guten ist es eines der besten. Es ist gesund und stark, witzig und treu. Ich liebe es, und es liebt mich wieder, und folgt mir.«
»Was hat es denn für eine Farbe?« fragte das Mädchen.
»Es ist ein eisengraues Pferd«, entgegnete der Reiter.
»Und warum tragt Ihr denn nicht eine Kopfzier, wie die andern hohen Männer?« fragte das Mädchen.
»Ich bin kein hoher Mann«, antwortete der Reiter, »und die Haube ist mir sehr wert. Sieh her, sie ist von der Haut des Elentieres, das weit von hier lebt. Ein Schwerthieb geht nicht durch.«
Bei diesen Worten hatte er den Helm aufgehoben, und ihn dem Mädchen gezeigt. Das Mädchen sah ihn an, und befühlte sein weiches Leder mit den Fingern.
»Und ist es denn nicht sehr heiß, wenn Ihr die langen Haare in der Haube tragt?« fragte sie.
»Es ist heißer, als wenn die Haare kurz sind«, antwortete er, »aber Hitze und Kälte muß dem Manne gleich sein. Bei allen alten Völkern hat man lange Haare geliebt, und sie schützen auch gegen Hiebe.«
»Sind Eure andern Kleider ebenfalls von der Haut dieses Tieres?« fragte das Mädchen.
»Der Panzer; das übrige ist geringer«, antwortete der Reiter. »Sie haben sonst auch Schienen, ich habe das Leder.«
»Ihr habt Euer Schwert in den Wald mitgenommen«, sagte das Mädchen.
»Ich habe es immer bei mir«, entgegnete der Reiter, »außer wenn ich zu Hause in sicherer Kammer schlafe. Schwert ist zugleich Schwert und Schild.«
»Ist es schön?« fragte das Mädchen.
»Siehe«, sagte der Reiter.
Er wendete die Scheide gegen sich, zog das Schwert daraus hervor, und reichte es ihr dar. Sie nahm es so, daß einen Teil der bloßen Klinge sie hielt, den andern er.
»Ach, welche Zeichen!« rief sie aus.
»Das ist Sankt Peter mit der Kette«, sagte er, »wir haben ihn zu unserm Schutzheiligen, weil wir aus Rom stammen. Was du um ihn herum siehst, das ist Zierat.«
»Und was ist denn das andere?« fragte das Mädchen.
»Das ist auch Zierat«, entgegnete der Reiter.
»Das Bild ist ein schönes Bild«, sagte sie.
»Es muß schön gemacht sein«, antwortete er, »und das Schwert muß gegen Hiebe und Gewalt gut gestärkt sein. Das wirst du nicht erkennen.«
»Nein«, sagte sie.
Er nahm die Scheide, hielt sie, und steckte das Schwert wieder in dieselbe.
»Und nun, Mädchen, wie heißest du denn?« fragte er.
»Bertha«, antwortete sie, »und wie heißt denn Ihr?«
»Witiko«, entgegnete er, »und wie alt bist du denn?«
»Sechzehn Jahre«, sagte sie, »und wie alt seid denn Ihr?«
»Zwanzig«, erwiderte er, »ich bin neun Jahre nach der Zeit geboren worden, da der Herzog Swatopluk von Böhmen erschlagen worden ist.«
»Ich habe mir gedacht, daß Ihr sehr jung seid«, entgegnete sie.
»Und lebst du im Walde, Bertha?« fragte er.
»Im Walde und auch anderswo«, antwortete sie; »ich habe Euch ja schon gesagt, daß wir weiter aufwärts von hier ein Haus haben. Dann ist noch das Häuschen des Vaters meiner Singgespanin, sonst ist nichts.«
»Habt Ihr eine Kirche?« fragte er.
»Sie steht fünf Stunden von hier in der Freiung«, antwortete sie, »wenn man dann hundert Schritte von unserm Hause abwärts geht, und noch eine halbe Stunde zur Mihel zu gehen hätte, wo die Köhler sind, steht ein dunkelrotes hohes Hüttlein aus Holz, und in dem Hüttlein ist die heilige Mutter mit dem Jesuskinde aus Holz. Der Bischof hat sie geweiht. Vor dem Hüttlein stehen kleine Bänklein, daran man knien und beten kann. Wir beten da. Hinter dem Hüttlein stehen Ebereschenbäume, und Ebereschenbäume gehen bis zu unserem Hause. Jetzt sagt mir aber auch etwas von Euch.«
»Mein Geschlecht ist dunkel«, antwortete er, »es ist aber nicht immer so gewesen.«
»Und wo werdet Ihr dann hingehen, wenn Ihr morgen von hier fortreitet?« fragte sie.
»In das Land Böhmen«, antwortete er.
»In das Land Böhmen?« fragte sie, »warum geht Ihr denn nicht zu dem neuen Könige Konrad oder zu unserem Herzoge Heinrich?«
»Das ist so«, entgegnete er: »im Mittage des Landes Böhmen haben meine Vorfahren im Walde gelebt. In alten Zeiten vor vielen hundert Jahren, da es noch gar kein deutsches Reich gegeben hat, da in dem Lande der Franken, das sehr groß war, die tapfern Hausmeier der alten Könige geherrscht haben, ist ein Mann aus dem Stamme der Fürsten Ursini in Rom, der auch Witiko wie ich geheißen hat, wegen Verfolgung eingedrungener Feinde mit seinem Weibe, mit seinen Kindern, mit seinen Anverwandten und mit einem kriegerischen Gefolge in das Land gegen Mitternacht gegangen, und bis an die Donau gekommen. Von dort wollte er in das Land Böhmen einbrechen. Aber Woyen, der Herzog Böhmens, der erstgeborne Sohn des Herzogs Mnata, der noch heidnisch war, und die Christen haßte, zog ihm mit einem Heere entgegen, und tötete in einer Niederlage, die Witiko erlitt, fast alle seine Leute. Da trug Witiko dem Herzoge Woyen ein Bündnis an, er wollte sich ihm unterwerfen, und die Marken Böhmens gegen die Fremden verteidigen, wenn ihm der Herzog in den waldigen Bergen, in welche er eingedrungen war, eine Wohnung geben wolle. Der Herzog gab sie ihm, und nun wohnte er an einem Berge in dem Walde. Sie breiteten sich aus, wurden mächtig, und gründeten das Christentum, daß sich vierzehn Lechen vom Mittage Böhmens lange vor der Zeit, da Boriwoy der erste christliche Herzog Böhmens war, in Regensburg taufen ließen. Dann nahm das Geschlecht wieder ab, wurde unbekannt, und ich bin der letzte davon. Witiko hatte auf dem Berge an seiner Wohnung Waldrosen gepflanzt, wie auf einem Berge neben seiner Wohnung in Rom Waldrosen gestanden sind. Alle Vorgänger des alten Witiko, welche in die Zeiten hinauf reichten, da noch gar kein Christ auf der ganzen Welt war, hatten Waldrosen gepflanzt, weil noch keine anderen waren, und alle Nachfolger haben Waldrosen gepflanzt.«
»Es wird doch eine Eingebung gewesen sein, daß ich die Rosen genommen habe«, sagte Bertha.
»Nimmst du oft Rosen?« fragte Witiko.
»Ich nehme sie zuweilen«, sagte Bertha.
»Und daß es in dieser Jahreszeit noch Rosen gibt, ist schon ein Wunder«, sagte Witiko.
»Ich habe diese auch nur heute im Waldschatten gefunden, und in meinen Ring gesteckt«, entgegnete Bertha.
»Siehst du«, sagte Witiko.
»So mögen sie Euch ein Zeichen sein«, erwiderte Bertha, »und möget Ihr recht viel Glück haben. Ich werde Euch zu meinem Vater führen, daß er Euch einen Mann zu den drei Sesseln mitgibt, der Euch den kürzesten Pfad weist.«
»So führe mich zu deinem Vater, Bertha«, sagte Witiko.
»Wollt Ihr?« fragte sie.
»Ich will«, antwortete er.
»So kommt«, sagte sie.
Bei diesen Worten erhob sie sich, der Reiter setzte seine Lederhaube auf den Kopf, und stand gleichfalls auf.
Sie gingen nun an dem Waldsaume bis zu der Stelle, an welcher die Mädchen herausgekommen waren. Dort traten sie unter die Stämme, und in kleiner Tiefe des Waldes stand das andere Mädchen, das mit Bertha gesungen hatte. Als Bertha und Witiko sich ihr näherten, nahm sie die Flucht, und lief vor ihnen her. Witiko sah nun, daß ihre Zöpfe, die auf das dunkle Kleid hinab gingen, eine lichte fast weißgelbe Farbe hatten, während die Berthas braun wären. Sie lief aber so, daß sie bald nicht mehr gesehen werden konnte. Witiko und Bertha gingen unter den hohen Tannen des Waldes und zwischen bemoosten Steinen dahin. Sie gingen aufwärts.
Nach einer Weile hörten sie ein Wasser rauschen, welches in der Gegend zu ihrer linken Hand fließen mußte. Bertha wendete sich nun links, und ging zu dem Wasser, das man fast durch die Stämme aber tief unten in einer Schlucht sehen konnte. Bertha ging an dem Wasser in der früheren Richtung wieder fort, aber immer oben am Rande der Senkung. Sie gingen immer aufwärts. Nach einer Zeit wurde der Wald dünner, und sie traten endlich in das Freie. Da lag eine Wiese vor ihnen, hinter der Wiese waren Felder, und dann stand ein großes weißes Haus. Hinter dem Hause stieg der Wald empor, und war ein breites mächtiges Band. Seinen Sesselfes konnte man wegen der Nähe nicht sehen, gegen Morgen aber waren andere starke Steinrippen im Bande. Die Wiese war von Gestrippe und Steinen gereinigt. Bertha lenkte nun auf einen Pfad ein, der in der Wiese auf das Haus zuging. Der Pfad war geordnet und so breit, daß selbst ein Wagen auf ihm hätte fahren können. Als sie auf dem Pfade so weit fortgegangen waren, daß sie noch einige hundert Schritte zu dem Hause gehabt hätten, kamen sie zu der Betstelle des roten Hüttchens. Es stand an dem Wege, mit seiner Öffnung gegen Morgen dem Pfade zugekehrt. Unten war es geschlossen, oben hatte es eine Öffnung, in welcher das Bild der heiligen Mutter stand, es war in Gold in roten blauen und anderen Farben. Vier Ebereschenbäume hinter dem Hüttchen waren hoch empor gewachsen. Bertha kniete an einem Bänklein nieder, und tat ein Gebet. Witiko kniete neben sie, und betete auch. Dann standen sie auf, und gingen weiter. Das Rauschen des Wassers tönte aus der Schlucht herauf, und auch nicht weit vor dem Hüttchen kam ein Wasser aus dem Grase der Wiese, und schoß flüchtig nach abwärts.
»Ihr habt hier klare fröhliche Quellen«, sagte Witiko.
»Es sind noch mehrere, rechts und links«, antwortete Bertha, »sie kommen von den drei Sesseln und von dem Blöckensteine.«
»Und das ist euer Bild, von dem Ihr mir gesagt habt?« fragte er.
»Das ist das Bild«, antwortete sie.
»Und dort ist euer Haus?« sagte er.
»Dort ist das Haus«, erwiderte sie.
Nach kurzem Wandeln an den Reihen der Ebereschen kamen sie an das Haus.
An demselben war gegen Morgen ein Sandplatz, gegen Mittag ein Garten. Das Haus war sehr lang. Es war aus Stein gebaut, und weiß übertüncht. Die Fenster, welche in einer geordneten Reihe hingingen, waren mit eisernen Stäben verwahrt. Es hatte nur ein Erdgeschoß, welches aber hoch war, und auf welchem sich ein flaches Dach befand, das viele und große Steine deckten. Die schmale Seite des Hauses, welche dem Sandplatze zugekehrt war, hatte eine eisenbeschlagene Tür. Durch die Tür, welche nicht geschlossen war, sondern einem leichten Drucke wich, führte Bertha Witiko in das Haus. Sie kamen hinter der Tür in einen geräumigen Vorsaal, von dem ein Gang durch die Länge des Hauses fort lief, und von dem Vorsaale traten sie links wieder in einen Saal. Derselbe war groß, und hatte gegen die Schmalseite des Hauses vier, gegen dessen Langseite sechs Fenster. Der Fußboden war von Tannenbrettern, die Wände waren weiß getüncht, und die Decke war eine starkbalkige Diele von braungebeiztem Tannenholze, an den Wänden hingen Waffen, und in den Ecken lehnten auch einige. In der Mitte des Saales stand ein sehr langer Buchentisch.
An dem oberen Ende des Buchentisches saß ein Mann von etwa vierzig bis fünfzig Jahren. Er hatte ein weitfaltiges schwarzes Oberkleid an, von dem die lichtbraune Unterbekleidung hinab ging. Auf das Oberkleid fielen lange braune Locken hinab. Vor ihm standen zwei andere Männer, mit denen er sprach.
»In die Glurwiese geht ihr um fünf Uhr«, sagte er, »dann könnt ihr mit der Hälfte fertig werden.«
»Ja«, sagte einer der Männer.
»Ihr müßt im Scherholze an der Sonnenseite schlichten, und die Eckstöße fest machen«, sprach er weiter.
»Ja«, sagte der andere der Männer.
»So, jetzt geht, und berichtet mir, wenn es geschehen ist«, sagte er.
Die Männer entfernten sich, und gingen zur Tür hinaus.
Der Mann an dem Buchentische sah nun mit zwei großen blauen Augen auf Bertha und Witiko.
Bertha ging einige Schritte gegen den Mann und sagte: »Vater, da ist einer in den Wald gekommen, der nach seinem Glücke geht, und sich ein Schicksal machen will. Weil heute Sonntag ist, so ruhet er, und hat in dem Walde gebetet. Ich habe auf der Sperwiese mit ihm gesprochen, und bringe ihn dir.«
Der Mann mit den braunen Locken stand auf, ging gegen Witiko, und sagte: »Seid mir willkommen.«
»Ich nehme das Willkommen an«, sagte Witiko, »und wollet mein Eindringen entschuldigen.«
»Meine Tochter hat Euch gebracht, und Ihr seid willkommen«, sagte der Mann, »und Ihr wäret auch willkommen, wenn Ihr allein gekommen wäret; denn mein Haus ist gastlich.«
»Ich heiße Witiko von Pric«, sagte Witiko.
»Ich Heinrich«, antwortete der Mann.
»Der Reiter will heute auf die drei Sessel steigen«, sagte Bertha.
»Weil Ihr auf dem Wege nach gutem Dienste in mein Haus gekommen seid, Witiko«, sagte Heinrich, »so nehmet ein Mittagessen bei mir, ich werde Euch dann einen Mann geben, der Euch zu den Sesseln geleiten soll. Jetzt biete ich Euch einen Stuhl, und wenn es nicht gegen Eure Sitte ist, so schnallt Euer Schwert ab, daß Ihr ungehinderter seid.«
»Ich nehme die Einladung zum Mittagessen und zu einem Stuhle dankbar an, das Schwert kann ich aber nicht abschnallen, weil ich mir den Brauch auferlegt habe, es immer, wo es tunlich ist, zu tragen, daß es mir nicht einmal fehlt, wenn ich es brauche«, sagte Witiko.
»Daran tut Ihr nicht unrecht«, sage Heinrich, »und wenn Ihr von den drei Sesseln zurückkommt, werdet Ihr die Nachtherberge bei uns nehmen?«
»Ich reite morgen wieder weiter«, entgegnete Witiko, »habe mein Pferd bei den Köhlern an der Mihel, und muß heute wieder dahin zurückkommen.«
»So werden wir die Zeit so einrichten, daß Ihr es könnt«, sagte Heinrich.
Nach diesen Worten wendete er sich gegen den Tisch, rückte zwei Stühle zurecht, wies auf einen, und er und Witiko setzten sich nieder.
Dann sagte er zu Bertha: »Gehe zur Mutter, und verkündige ihr, daß wir einen Gast haben.«
Bertha ging gegen einen Fensterpfeiler, und hing ihren Kranz mit Rosen an einen Nagel.
»Warum hängst du denn dein Goldreiflein zu den Waffen?« fragte der Vater.
»Lasse die Rosen heute bei den Waffen hängen«, antwortete Bertha.
Dann ging sie durch eine Tür in das weitere Innere des Hauses.
Nach einigen Augenblicken kam sie mit der Mutter bei dieser Tür wieder heraus. Die Mutter hatte wie Bertha braune Haare und Augen. Sie hatte feine Hände und Glieder. An ihrem Körper war ein enges blaues Wams mit Silberrändern, die Vorderärmel und das weite Unterkleid waren aus blaßgelber Wolle. Die Haare deckte ein weites Netz mit Goldfädlein.
»Wiulfhilt«, sagte Heinrich, »der junge Reiter Witiko von Pric, der Sohn Woks und Wentilas, ist unser Gast.«