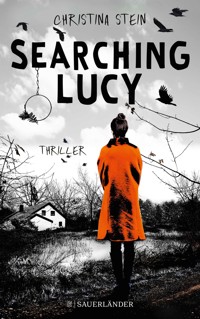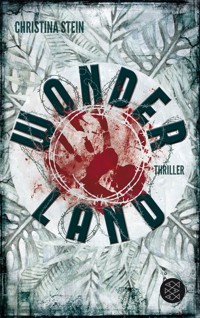
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Sie machen eine Reise ins Paradies. Und landen in der Hölle auf Erden. Thailand. Sonne, Palmen, eine Villa direkt am Strand. Der perfekte Urlaub! Doch als Lizzy am Morgen nach einer Strandparty aufwacht, ist sie gefangen. Mitten im Dschungel, mit ihren besten Freunden – und mit Jacob. Jacob, den keiner von ihnen richtig kennt, und der sie auf diese verdammte Strandparty eingeladen hat. Nur wegen ihm sind sie in einem Reality Game gelandet, in dem es nur schwarz oder weiß gibt, verlieren oder gewinnen, opfern oder geopfert werden. Wer sind die Player in diesem Spiel? Was haben sie vor? Und welche Rolle spielt eigentlich Jacob? Lizzy hat keine Ahnung. Sie weiß auch nicht, wie lange sie ohne ihre Herzmedikamente überleben kann. Sie weiß nur eines: Die Gruppe muss bis morgen entscheiden, wer von ihnen das nächste Opfer sein wird … ›Wonderland‹ ist ein atemlos spannender und beängstigend realistischer Thriller über menschliche Abgründe und das Einzige, was uns davor retten kann: Liebe und Freundschaft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 444
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Christina Stein
Wonderland
Über dieses Buch
Wir machen eine Reise ins Paradies.
Und landen in der Hölle auf Erden.
Wir sind Freunde.
Und werden zu Gegnern gemacht.
Wir müssen entscheiden,
wer das nächste Opfer ist.
Wonderland ist ein Ort,
den du nur ein einziges Mal betrittst.
Thailand. Sonne, Palmen, eine Villa direkt am Strand. Der perfekte Urlaub! Doch als Liz am Morgen nach einer Strandparty aufwacht, ist sie gefangen. Mitten im Dschungel, mit ihren besten Freunden – und mit Jacob. Jacob, den keiner von ihnen richtig kennt, und der sie auf diese verdammte Strandparty eingeladen hat. Nur wegen ihm sind sie in einem Reality Game gelandet, in dem es nur schwarz oder weiß gibt, verlieren oder gewinnen, opfern oder geopfert werden.
Wer sind die Player in diesem Spiel? Was haben sie vor? Und welche Rolle spielt eigentlich Jacob? Liz hat keine Ahnung. Sie weiß auch nicht, wie lange sie ohne ihre Herzmedikamente überleben kann. Sie weiß nur eines: Die Gruppe muss sich bis morgen entscheiden, wer von ihnen das nächste Opfer sein wird …
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Covergestaltung: Claudia Toman
© 2016 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-7336-4931-9
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Widmung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
Epilog
Dank
Für Juan
Liz
1
Es ist ein Ort, den man nur einmal im Leben betritt. In den man hineinfällt wie Alice ins Wunderland, aus Versehen und unvermittelt, auf diese seltsame und wundersame Art und Weise.
Ich selbst bin klein, der Ort sehr groß. Alles in diesem Haus ist warm und hell. Der Boden unter den nackten Füßen glattes Teakholz, gebohnert, nicht einmal Staubkörner, selbst in der Luft nicht, wo man sie eigentlich sehen müsste, jetzt, wo die Sonne den Raum in Streifen schneidet und auf diese besondere Art so golden scheint, dass Amelies Haare aussehen wie ein rotes Flammenmeer.
Also merken: keine Staubkörner im Wunderland.
Im Hintergrund Amelies Lachen, aus den Augenwinkeln sehe ich, wie sie sich rücklings auf das riesige Sofa fallen lässt und mit den Füßen in die weißen Kissen trommelt. »Hammer! Hammer! Hammer!«
»Und das Haus gehört deinem Onkel?«
Meine eigene Stimme klingt seltsam, ein fremder, belegter Laut hier drinnen im Wunderland.
»Ja, hab ich doch gesagt.«
Seine Antwort: einsilbig, wie immer. Sein Blick: ausweichend, auch wie immer, so als hätte er aus Versehen was fallen gelassen und würde auf dem Boden danach suchen. Nur dass Jacob gar nichts fallen gelassen hat. Dass er einfach stehenbleibt und in eine andere Richtung schaut. Aber dann geht er weg, irgendwohin, während ich noch dastehe und glotze: Hinter dem Wohnzimmer öffnen sich Flügeltüren in Richtung Meer, der Raum ist geschlossen und doch offen, weiße Vorhänge bauschen sich in der Brise, wie in einem Kitschfilm von Rosamunde Pilcher.
Jetzt müsste er eigentlich Arzt sein und blond und ganz weiße Zähne haben. Und ich müsste eine junge Frau im Blümchenkleid sein, die gerade mit dem Fahrrad angefahren kam und es draußen an die Mauer eines alten Cottage gelehnt hat. Nicht dass ich jemals einen Rosamunde-Pilcher-Film gesehen hätte. Nicht vollständig jedenfalls.
Das hier ist nicht Rosamunde Pilcher. Es ist alles andere, aber kein Cottage. Keine Südküste Englands, keine Steilfelsen, sondern Strand, Palmen, und eine Hitze, die sich auf die Haut legt wie ein nasser Waschlappen.
Im Hintergrund seine Stimme: »Will jemand Bier? Oder doch lieber einen Cocktail?«
Ich bezweifele, dass ihn jemand gehört hat. Alles, was ich höre, ist wildes Kreischen und Lachen und Wortbrocken wie »Waaaaahhhhnsin!« und »Megageil!«
Von irgendwoher helles Johlen und das Klatschen eines Körpers auf Wasser: Ich wette alles darauf, dass es Nelli ist, die als Erste in den Pool gesprungen ist, egal, was sie gerade anhat, vielleicht hat sie sich auch einfach ausgezogen und einen oder zwei der Jungs mit sich gezogen.
»Lizzy!«, kreischt sie, nachdem sie wieder aufgetaucht ist. »Liz, schau dir das an!«
Ich trete durch die Vorhänge auf die weitläufige Terrasse und stelle wieder fest: Der Übergang von drinnen nach draußen ist fließend, auch die Terrasse ist eigentlich ein Wohnzimmer: Liegen so breit wie Kingsizebetten, mit Kissen und Handtüchern zu Tieren geformt, kleinen Kunstwerken, Vögeln, Schmetterlingen. Orchideenzweige in Vasen, die Statuette einer abstrakten Frauenfigur. Alles minimalistisch, aber doch gemütlich, das riesige Bett von einem Baldachin umgeben, wieder diese bauschigen Vorhänge. Einige Bäume und Pflanzen wachsen direkt durch die Terrasse hindurch, durch sauber ausgeschnittene kreisrunde Aussparungen, meine Hand gleitet über den gebogenen Stamm einer Palme, die sich der Sonne entgegenstreckt. Dann weiter in den Garten, der eigentlich keiner ist, sondern ein Park, der Rasen ein flauschiger Teppich.
Zuletzt der Pool. In irgendeinem Prospekt habe ich mal gelesen, wie man so was nennt: Infinity-Pool. Endlos-Pool. Steht man davor, erstreckt sich das Wasser bis zum Horizont. Man weiß nicht, wo der Pool aufhört und das Meer beginnt. Auch so eine Wunderland-Sache.
Alles ist endlos groß, hell und schön.
Nelli paddelt im Wasser wie ein glücklicher Delphin. Das gleiche Lachen auf dem Gesicht, die gleichen fröhlichen Pfeiflaute. Selbst mit nassen Haaren sitzt ihre Frisur, umrahmt ihr brauner Pagenschnitt mit dem geradegeschnittenen Pony das ebenmäßige Gesicht perfekt.
»Komm endlich rein, Liz, das ist mega!«, trillert sie und taucht wieder unter, dicht gefolgt von Colin, der sie garantiert unter Wasser anfummelt.
Irgendwo im Pool auch Freckles, beide Arme und Beine weit ausgestreckt, toter Mann im Wasser. Ich lasse mein Kleid fallen, trage darunter gleich den Bikini, den ich so gut wie nicht ausgezogen habe, seitdem ich in Thailand aus dem Flieger gestiegen bin.
Das Wasser ist eine lauwarme, erfrischende Badewanne, und ich mache es wie Freckles: mich einfach auf den Rücken legen und treiben lassen. Doch natürlich geht das nicht lange, natürlich kommt Nelli und taucht mich unter, zwickt mich in den Bauch; ihr Lachen steckt an, ich höre mich kreischen wie sie, nur unter Wasser ist es ruhig, und alles, was ich dort hören mag, ist das beruhigende Hämmern meines Herzschlages, badambadam.
Meine Gedanken an Deutschland, wie ich eine Zeitlang in das Hallenbad der Stadt ging: hinein in das kalte, gechlorte Wasser, jeden Tag, nur um dieses Geräusch zu hören: badambadam. Oder es sich zumindest einzubilden, sich darauf zu konzentrieren, dem Herzen ein wenig näher zu sein.
Aber das alles fühlt sich weit weg an, ziemlich weit weg, und wenn ich die Augen öffne, sehe ich keine alten Omas, die ihre Bahnen ziehen und unter Wasser strampeln wie runzelige, dicke Frösche.
Was ich sehe, ist Amelie, untergetaucht wie ich, sie schafft es sogar, mich unter Wasser anzulachen, ihre weißen Zähne blitzen mir entgegen, sie sieht atemberaubend schön aus: ihre langen rotbraunen Haare ein fließender Kranz um den Kopf, ihre Gliedmaßen athletisch und schlank, im Wunderland ist sie eine Meerjungfrau.
Als ich wieder auftauche, grölen alle Jacob entgegen, feuern ihn an, das Bier schneller zu bringen, sie behandeln ihn, als wäre er irgendein Kellner und nicht der Herr des Wunderlandes.
Musik klingt jetzt von irgendwoher, rhythmisch und beruhigend, Moby, wenn ich tippen müsste. Nelli beginnt leise eine Sequenz mitzusingen, und alle halten inne, um ihre Stimme auf sich wirken zu lassen, diese rauchige, unverwechselbare Nelli-Stimme, die so hypnotisch wirkt wie die Augen von Kaa aus dem Dschungelbuch.
Jacob nähert sich über den Rasen, der eigentlich ein Teppich ist, die Sonne im Rücken, die Arme voller Bierflaschen, und ich wünschte, auch er würde endlich mal lachen. Stattdessen aber wieder ernst, und plötzlich muss ich blinzeln, zum einen, weil ich gegen die Sonne schaue, zum anderen, und das scheint der eigentliche Grund zu sein, weil er sein T-Shirt ausgezogen hat, weil ich ihn noch nie ohne T-Shirt gesehen habe und kaum glauben kann, was ich da sehe.
»Hey, und ich dachte, Colin hätte ein Sixpack!«, ruft Nelli und spricht damit aus, was alle denken.
Ich schaue Jacob wieder an, ziemlich verstohlen, nur um sicherzugehen, dass er wirklich so aussieht, was er auch tut, und plötzlich zieht sich mein ganzer Bauchraum zusammen. Was ich kaum fassen kann, denn ich bin davon ausgegangen, dieses Gefühl ziemlich gut weggeschlossen zu haben, seit Adrián.
Adrián. Bei dem Gedanken an ihn tauche ich wieder unter, will es gleich loswerden, dieses Bild von seinem Gesicht, dieses unverstellte und in jeglicher Form ansteckende Lachen. Aber so leicht lassen sie sich nicht abschütteln, diese Erinnerungen, dieses Gefühl, federleicht zu sein und genauso in die Luft gehoben zu werden, einmal, zweimal, dreimal, die perfekte Arabesque, nur fast zwei Meter über dem Boden, das perfekte pas des deux, schaut mal her, Leute, wie die das machen!
Sich daran zu erinnern ist wie ein Bein spüren zu wollen, das man verloren hat. Phantomschmerz.
Stattdessen versuche ich mich wieder auf meinen Herzschlag zu konzentrieren, badambadam, doch wirklich hilfreich ist das nicht, da komme ich vom Regen gleich in die Traufe.
Außerdem – wie soll man das eigene Herz schlagen hören, wenn oben alle kreischen und lachen und sich gegenseitig untertauchen. Und jetzt springt auch noch einer rein, es muss Jacob sein, Jacob mit seinem erstaunlichen Sixpack, ich weiß gar nicht, warum mich das so aus der Fassung bringen sollte, mich, die in ihrem Leben unzählige Sixpacks gesehen hat: auf der Bühne und dahinter, in den Umkleidekabinen. Also tauche ich wieder auf und halte das Gesicht in die letzten Sonnenstrahlen, blicke auf den Strand gleich hinter dem Pool, der genauso ist, wie man ihn sich im Wunderland vorstellt: schneeweiß und sauber und infinity-lang.
Nelli ruft euphorisch: »Hey, lasst uns im Meer schwimmen!«, und alle klettern aus dem Pool, kippen hastig ihr Bier runter, bevor sie über den Strand rennen, wer ist zuerst in den Wellen, wer am schnellsten, und natürlich musste es so sein, Nelli trägt keinen Bikini, sondern nur ihre normale Unterwäsche, ihren türkisfarbenen Push-up-BH, weil sie tatsächlich meint, ihre perfekten kleinen Brüste würden der Welt nicht gerecht werden.
Mitten auf dem Weg zu den Wellen bekomme ich einen Lachkrampf, weil Nelli wieder den gleichen Fehler macht, weil sie wieder im Push-up ins Meer rennt, obwohl ihn die Wellen beim letzten Mal weggerissen haben und sie plötzlich oben ohne dastand und versuchte so zu tun, als würden ihr die Blicke der Kerle nichts ausmachen. Ich kann einfach nicht weiterlaufen, weil sie noch dazu ihre tausend Ketten und Armbänder trägt, ein geschmückter Weihnachtsbaum im Meer, nach dessen BH wir gleich tauchen müssen.
Einer läuft an mir vorbei und dreht sich unvermittelt um, blickt mir direkt ins Gesicht, es ist Jacob, und ich weiß nicht, was mich mehr überrascht, dass er mich so direkt anschaut oder dass er mich dabei anlacht, mich tatsächlich anlacht, etwas, das ich noch nie bei ihm erlebt habe. Und noch dazu dieses Grübchen auf seinem Kinn, diese tiefe Grube genau in der Mitte, die dabei mitlacht; es gibt Männer mit solchen Grübchengruben, die man sofort berühren möchte.
Und prompt muss es wieder kommen: dieses verfluchte Ziehen im Bauch, ich will das wirklich nicht spüren, muss das viel tiefer begraben oder einfach die Location wechseln: Los, Mädels, lasst uns weiterfliegen, warum nicht nach Australien, Hawaii, wozu haben wir dieses verdammte Around-the-world-Ticket?
Jetzt hält er mir auch noch seine Hand hin, zieht mich aus dem Sand hoch, und ich höre auf zu lachen, weil mich das fast erschreckt: diese Geste und seine ausgelassene Art, als wäre ihm plötzlich eingefallen, dass er doch ein Rosamunde-Pilcher-Arzt ist. Seine gesamte Erscheinung erinnert mich tatsächlich an Adrián – Jacob hat zwar nicht dessen schwarzes Haar, aber genauso dichte Locken, in denen man garantiert mit den Finger hängen bleiben würde.
Seine Hand ist warm und lässt mich nicht los, er zieht mich mit, lachend, schubst mich in die Wellen und lässt sich selbst reinfallen.
Wir springen den Wellen entgegen, den perfekten Wellen, und wie zu erwarten höre ich Nelli kreischen: »Mein BH! Mein BH!«, woraufhin ich wieder einen Lachkrampf bekomme, sollen die Jungs ihn suchen oder zumindest so tun, mit Sicherheit werden sie sich Zeit lassen.
Mein Herz klopft gegen den Brustkorb, schnell, hämmernd, doch nicht so schnell und hämmernd, wie es sollte, und ich finde: Ich brauche eine Pause vom Hüpfen und Schreien.
Der Sand in meinem Rücken ist ein warmes, sauberes Bett, ich halte meine Hände in den Himmel und beschließe, dass mir nicht lange schwindelig sein wird.
Die Dämmerung kommt schnell und unvermittelt, das goldene Licht ein Chamäleon: erst rot, dann rosa, schließlich alle möglichen Graustufen. Die Silhouetten meiner Freundinnen im Meer, ihr Lachen ist ansteckend, hüpft wie ein Floh von ihnen zu mir, und ich wünschte, ich könnte ihn anhalten, diesen Moment, Pause, und ihn abspielen, sobald ich ihn brauche, mich wieder hereinbeamen in genau diesen Augenblick, in dieses Gefühl, jetzt, wo alles gut ist.
Amelies schlanke Silhouette springt aus dem Meer, leichtfüßig läuft sie in meine Richtung, ihre nassen Haare reichen ihr fast bis zum Po.
»Alles in Ordnung, Liz?«
Sie legt sich neben mich auf den Rücken, greift nach meiner Hand, und wir blicken hoch in die Dämmerung, in ein paar Stunden kann man versuchen die Sterne zu zählen, aber dafür würde man lang brauchen, infinity-lang.
»Wir sollten ein Lagerfeuer machen, was meinst du?«
»Klar. Geht es dir gut?«
»Ja, ja.«
»Sicher?«
Ich drehe mich auf die Seite und gebe ihr einen Kuss auf die Stirn, die genauso ist, wie der Himmel gleich sein wird: voll mit tausend kleinen Punkten, Sommersprossen.
Als wäre dies ein Stichwort, lässt Ben sich neben Amelie in den Sand fallen, noch so ein Rotschopf, dem bestimmt hundert Sommersprossen im Gesicht kleben, ein Freckles, und von allen auch so genannt. Jetzt, nach dem Schwimmen, setzt er als Erstes seine große schwarze Brille zurück auf die Nase, mit der er wirkt, als wäre er einer Werbeagentur entsprungen.
»Wahnsinn«, meint er. »Das ist tatsächlich ein Privatstrand, Leute! Ein perfektes Stück weißer Sandstrand, eine natürliche Lagune. Man kann von außen gar nicht hierherkommen, ist euch das aufgefallen? Felsen schirmen die Bucht ab. Mehr privat geht nicht!«
Alle scheinen erschöpft zu sein, bis auf Nelli und Colin, die irgendwo im Meer knutschen und es mit Sicherheit aufgegeben haben, nach ihrem BH zu suchen.
»Hast du hier schon mal ein Lagerfeuer gemacht?«, frage ich Jacob, der neben mir im Sand sitzt und wirkt, das hätte er den Arzt vorhin im Meer ertränkt. Vielleicht gibt es bei ihm ja eine Art Schalter, der sich umlegt, eine Leuchtreklame, die vorne an seiner Praxis blinkt:
The doctor is in.
The doctor is out.
Now, the doctor is out, definitely.
»Nein. Können wir aber machen. Müssen halt nur schauen, dass wir genug Treibholz finden.«
»Bist du oft hier?«
»Zweimal die Woche mindestens. Schaue nach dem Haus, dem Garten.«
»Dem Park, meinst du wohl.«
»Ja. Es sind aber noch zwei Gärtner angestellt, alleine würde ich das gar nicht schaffen.«
»Ich frage mich nur, warum du im Hostel wohnst und arbeitest, wenn du hier schlafen könntest?«
»Weil im Hostel was los ist. Was soll ich hier alleine abhängen?«
Okay, einen Punkt für ihn. Vielleicht wird das Wunderland öde, wenn man alleine drin wohnen muss.
»Und was ist mit den anderen? Die, die du noch eingeladen hast?«
Immerhin hat er das groß angekündigt: eine Riesen-Party im Haus seines Onkels. Hey, People, kommt einfach dahin, das Hostel ist eh ausgebucht. Riesiger Pool, das Haus ist der Brüller, die Party steigt heute Abend!
Sein Onkel muss unbeschreiblich viel Kohle haben. Alleine das Haus in Schuss zu halten, er muss Angestellte haben, und das, obwohl er wahrscheinlich nur ein paarmal im Jahr hierherkommt. Also merken: Jacobs Onkel ist Millionär.
Und wenn ich es richtig bedenke, scheint auch Jacob der ganze Luxus nicht fremd zu sein. Er wirkt so gelassen, als wäre es eine Selbstverständlichkeit, das Wunderland.
Normale Menschen leben halt anders: zum Beispiel in einem Haus am Stadtrand von Mainz, mit einem winzigen Garten. Das ist etwas, das man kennt: Reihenhaus, eine Familie mit zwei Kindern, vollgestopfte Garage. Das Haus zwar sauber und gemütlich, an den Wänden allerdings eine Tapete, die nach all den Jahren mal wieder gestrichen werden könnte.
Das Wunderland bislang nicht bekannt, allenfalls das Taunus-Wunderland, in das Benno unbedingt fahren wollte, wie er mich anflehte: »Bitte, Lizzy, bitte, Biiiiiiittte!«, bis ich irgendwann nachgab und dann rein in die Wasserbahn, immer und immer wieder, und dann noch ein Eis, sein zweites, obwohl die Hände noch ganz klebrig waren vom ersten. Aber was man nicht alles tut für den kleinen Bruder, der erst sechs ist und einen so anschaut, dass man ihm die ganze Zeit bloß über den Kopf streichen mag.
»Ich weiß nicht, wann die kommen«, beantwortet Jacob meine Frage jetzt. »Vielleicht haben die sich auch für was anderes entschieden.«
»Und dein Onkel? Was macht der beruflich?«
Jetzt grinst er plötzlich oder versucht es zumindest, seine Zähne blitzen in der Dämmerung auf.
»Mach doch mal eine Liste mit Dingen, die du wissen willst, Liz«, lautet seine Antwort, und genauso gut hätte er mir den Mund verbieten können, so sehr fühle ich mich vor den Kopf gestoßen.
Ich schaue ihn an, aber er blickt in eine andere Richtung, rüber zu Nelli und Colin, und eigentlich kann er mich auch mal, bei mir ist der Doktor jetzt auch out, aber so was von.
»Hey!«, ruft er jetzt in Richtung Meer. »Ihr habt den Pool auf der anderen Hausseite noch nicht gesehen!«
Amelie schnappt neben mir nach Luft. »Was?!? Hier gibt es noch einen Pool?«
Wieder versucht Jacob zu lächeln, sein seltsames Lächeln, das so anders ist als das von Adrián, genau genommen um hundertachtzig Grad anders. Und plötzlich ist da wieder das Ziehen, dieses Gefühl, dass irgendwas passiert, aber das Gefühl beherrscht einen ganz anderen Teil des Bauches, und ich finde: Irgendwas stimmt hier nicht.
Vielleicht ist das gar kein Wunderland, this could be hell, warum nicht raus hier und zurück zu dem, was man kennt: Reihenhaus oder ein normal schönes Hostel mit normal schönen Zimmern, die man sich teilt, und Duschen, in denen normal viele Haare kleben.
Warum muss diese verdammte Villa jetzt noch einen Pool haben? Noch mehr Unendlichkeit braucht dieser Ort wahrhaftig nicht.
Und doch ist sie da, diese Unendlichkeit: Gleich vom Schlafzimmer aus kann man in sie hineinspringen, barrierefrei, es gibt keinen Übergang vom Zimmer zum Pool, man braucht nur eine der riesigen Schiebetüren zu öffnen und direkt ins Wasser zu fallen.
Nelli und Amelie kreischen schon wieder, ziemlich hysterisch, wahrscheinlich auch betrunken, Jacob hat noch mehr Bier gebracht, steht da und sagt stoisch: »Sucht euch ein Zimmer aus.«
Ich versuche, ein kleines zu finden, definitiv eins ohne Zugang zum Pool. Letzteres gelingt mir sogar, Ersteres allerdings nicht. Und irgendwie verschwinde ich auf dem Bett, bin eine ziemlich kleine Elisabeth Groß auf einer XXL-Doppel-Matratze.
Im Zimmer ist es viel zu still. Aber immerhin, auf dem Tisch neben dem Bett befindet sich der erste wirklich persönliche Gegenstand in diesem Haus – das gerahmte Bild eines braungebrannten Mannes mit gepflegtem weißem Bart, stehend an einem Fluss. In seinen Händen ein riesiger Fisch
Dem Alter nach könnte es Jacobs Onkel sein, dieser unglaublich reiche Onkel, der wahrscheinlich Millionär ist. Ganz offensichtlich zieht er auch beim Angeln die dicksten Fische an Land.
Meine Gedanken streifen Amelie, die sich mit Freckles ein Zimmer teilt, genau wie Nelli mit Colin, wie schon seit den ganzen zehn Tagen, seit wir die beiden aufgegabelt haben.
Ich könnte jetzt Jacob aufgabeln, theoretisch, immerhin kann auch ich ein Sixpack aufweisen oder zumindest noch einen Hauch davon, aber praktisch: nein, wie soll das gehen, the doctor is out.
Das wird also nichts mit Mond meines Lebens, in den zwei anderen Zimmern, da schon.
Immerhin bleiben mir die Tiere. Vögel, aus Handtüchern gezaubert, zwei Stück, die mich anschauen und frische Orchideenzweige im Schnabel tragen. Und genau das ist der Moment, in dem ich beschließe, hier abzuhauen. Oder zumindest meine Familie anzurufen, ihnen zu sagen, alles ist okay, ja wirklich, alles ist gut, macht euch keine Sorgen, erzählt mir lieber, wie der Sommer in Deutschland ist, Benno, wie oft du beim Spielen hingefallen bist und wie viele Pflaster du auf den Knien kleben hast.
Frische Orchideenzweige auf den Betten, das ist wirklich unmöglich! Wie soll ich da jemals eine passende Location für meine Hochzeitsreise finden, das hat das Wunderland mir jetzt kaputtgemacht, denn nichts, rein gar nichts wird jemals an diesen Ort heranreichen!
Dass ich überhaupt keine Hochzeit in Erwägung ziehe, steht dabei nicht zur Debatte, genauso wenig wie die Frage, ob ich es jemals bis zu einer schaffe, irgendeiner, sagen wir mal bis zu der von Amelie, die heiraten will und Kinder haben und all das, aber okay, alle wissen, das ist ein ganz eigenes Thema.
Eigentlich würde ich ihn schon jetzt gerne abspielen, diesen kleinen Film, den ich eben am Strand gedreht habe, diese Sequenz mit dem warmen Sand und der untergehenden Sonne. Hauptsache, Kitsch, Hauptsache, Jacob ist noch der Doktor und erwähnte noch nicht diese Liste. Aber was soll’s, erst mal ab unter die Dusche und runter mit allem: dem Meerwasser und den Gedanken an die Hochzeiten, die ich mit ziemlicher Sicherheit verpassen werde. Und auch runter mit den Tränen, die ständig laufen, eine Art Eigenleben führen, da kann ich machen, was ich will und das, obwohl ich eigentlich gar keine Heulsuse bin, zumindest nicht mehr seit der Grundschule, wo einen die Sprechgesänge der Jungen verfolgten: Heulsuse, Pampelmuse!
Immerhin fallen die Tränen unter der Dusche nicht weiter auf, landen sogleich im Ausguss, wo sie hingehören, im Wunderland ist Weinen verboten, Schluchzen sowieso, und überhaupt: Was soll das auch für ein Grund sein, wegen ein paar verdammter Orchideenzweige mit dem Heulen anzufangen?
Auf dem Flur schnappe ich mir Nelli, die quirlig durch den Gang trudelt in Hotpants und rotem Top mit Spaghetti-Trägern. Direkt neben ihr befindet sich eine schmale Holzanrichte mit einem gläsernen Kasten, der eine kleine, schlafende Frauenfigur aus Elfenbein preisgibt.
»Nelli, warte mal.«
Ihr Lachen ist so strahlend, dass ich fast nicht weitersprechen kann, ihr doch nicht sagen kann: Ich will raus aus dem Wunderland, diese Orchideenzweige machen mich fertig, you know.
Stattdessen stammele ich: »Lass uns morgen weiter nach Phi Phi Island, ich will ihn endlich sehen, den schönsten und geheimsten Strand der Welt.«
Sie umarmt mich, zwickt mich in den Bauch. Ihr Lachen hat etwas Berührendes, genau wie ihre ganze Erscheinung: Ihr Mund ist zu groß, aber die Zähne darin perfekt bis auf die kleine Lücke zwischen den Schneidezähnen. Als hätte einer ihre Gene so zusammengewürfelt, dass sie nicht nur schön, sondern besonders wird.
»Du solltest dir Jacob krallen. Hast du seinen Body gesehen?«
»Ich würde wirklich gern weiter, gleich morgen früh.«
Ihr Gesicht zwischen dem gerade geschnittenen Pagenkopf wird plötzlich ernst, in all ihrem Übermut hat sie dennoch diese Sensoren, die alles aufspüren, vor allem Kummer.
»Liz, was ist los?«
»Ich weiß nicht. Ich finde das hier alles too much. Welcome to the Hotel California!«
Jetzt prustet sie los, streichelt meine Wange.
»Such a lovely place«, singt sie. »Such a lovely face!«
»Mal im Ernst: Mir ist das hier zu viel.«
Sie nickt, pustet ihre Ponyfransen aus der Stirn.
»Okay. Wir hauen morgen ab.«
»Okay.«
»Soll ich bei dir im Zimmer schlafen, Babe?«
Jetzt pruste ich los, und sie fällt ein, zieht mich weiter, ihre Stimme erfüllt den Raum:
»Welcome to the Hotel California! Such a lovely place, such a lovely face. Plenty of room at the Hotel California! Any time of the year you can find it here!«
Ich spüre, wie eine Welle der Entspannung über mich hinweggleitet, plötzlich hat Nellis Stimme alle Bedenken weggespült – wobei, vielleicht doch nicht alle. Wie war das beim Hotel California? Ja, genau: You can checkout any time you like, but you can never leave.
Am Strand haben die Jungs ein Feuer entfacht, und irgendwer hat sogar was zu essen gezaubert, Reis, Gemüse und Hühnchen, das in einer großen Schüssel umhergereicht wird.
»Hey, Leo, morgen geht’s weiter nach Koh Phi Phi!«, quasselt Nelli mit vollem Mund und zwinkert mir über das Feuer hinweg zu. Colin hingegen verdreht die Augen, obwohl es ihm eigentlich schmeichelt, dass ihn alle Leo nennen, manchmal auch Leonardo, weil er genauso aussieht wie DiCaprio und noch dazu ständig von diesem Strand faselt, wegen dem er extra nach Thailand gekommen ist, dem geheimen Strand aus The Beach.
»Morgen schon? Ich dachte eigentlich, wir nutzen die Gastfreundschaft von Jacobs Onkel noch was aus.«
»Ihr seid wahnsinnig, wenn ihr hier wegwollt, Leute«, grunzt Freckles und ist kaum zu verstehen, so voll ist sein Mund.
»Koh Phi Phi ist ziemlich überlaufen«, wendet Jacob ein, langsam, fast nachdenklich, und irgendwie beengen mich seine Worte, schnüren mir die Kehle zu.
»Kommst du mit?«, will Nelli wissen.
Jacob zuckt mit den Schultern. »Mal sehen. Kommt darauf an, ob die mich im Hostel noch weiter brauchen.«
»Bist du eigentlich ganz alleine nach Thailand gekommen? Ohne eine Freundin oder so?«
»Ich … ja. Bin alleine hier.«
»Ohne Freundin?«
Dass Nelli so nachhakt, ist wieder typisch, nie lässt sie sich abwimmeln, würde Jacob ihr jetzt das mit der Liste vor den Kopf knallen, würde sie glatt alle Fragen aufschreiben.
Er starrt sie an, und für einen Moment halten alle die Luft an, beobachten dieses Spiel zwischen ihnen: Schau zuerst weg, und du hast verloren. Und natürlich ist es Jacob, der verliert, ins Feuer starrt und nicht aufschaut, während er weiterspricht.
»Meine Freundin ist weg. Und um das zu vergessen, bin ich hierhergekommen.«
»Weg?«, krächzt Amelie, als wäre sie gerade aus einer Trance erwacht und hätte vergessen, sich vor dem Sprechen zu räuspern. »Was heißt denn das?«
Er blickt weiter ins Feuer.
»Das heißt, dass sie gestorben ist. Und jetzt trinkt mal euer Bier, people!«
Alle sitzen erstarrt, sechs Salzsäulen im Schneidersitz um das Lagerfeuer herum, keiner traut sich weiterzukauen, selbst Freckles nicht, der schluckt einfach die ganzen Brocken runter, und sagt dann: »Sorry, Alter. Komm einfach mit nach Ko Phi Phi. Wenn du noch ein bisschen mehr vergessen willst.«
Erstaunt werfe ich ihm einem Blick zu, Freckles mit seinen grünen Augen und den rotbraunen Haaren, der glatt als Bruder von Amelie durchgehen könnte, so sehr ähneln sich die beiden. Und nicht zum ersten Mal denke ich: Die sind echt süß, die Jungs, Freckles mit den Sommersprossen im Gesicht und Leonardo, der trotz seines braungebrannten Gesichts und der strohblonden Haare fast aussieht wie DiCaprio und den sich Nelli gleich geschnappt hat, klar, weil sie sich immer gleich den am offensichtlich Schönsten von allen schnappt. Aber es ist nicht nur das, die haben auch was im Kopf, die Jungs. Zumindest bei Amelie könnte ich mir vorstellen, dass sie sich ernsthaft verliebt.
»Wisst ihr was?«, frage ich schließlich, weil immer noch alle so still sind, »mir ist gerade aufgefallen, dass wir alle, bis auf Freckles, blaue Augen haben.«
Rundum löst sich die Anspannung, alle bewegen sich wieder, strecken plötzlich die Beine aus oder schieben das Essen auf den Tellern zurecht.
»Allez les bleus!«, ruft Nelli und schnappt sich ihre Gitarre, spielt ein paar leise Takte, bevor ihre Stimme erklingt, ihre märchenhafte Nelli-Stimme:
»No one knows what it’s like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. No one knows what it’s like to be hated, to be fated to telling only lies.«
Ich lasse mich rücklings in den Sand fallen und schließe die Augen, Nellis Stimme erfüllt mich, uns alle, wie hat sie das jetzt wieder geschafft, gleich ein Lied aus dem Ärmel zu schütteln, in dem blaue Augen eine zentrale Rolle spielen?
Als ich meine Augen wieder öffne, zwinkern sie mich alle an, die tausend Freckles im Himmel, man kann sogar die Milchstraße erkennen, ein wenig, wenn man sich anstrengt. Offenbar strenge ich mich aber etwas zu sehr an, denn irgendwie werden die einzelnen Punkte undeutlich, verschwimmen zu einem undefinierbaren Freckles-Brei, plötzlich wird mir schwindelig. Ich setze mich auf und werfe einen Blick auf Amelie, die neben mir im Sand liegt, in Freckles Armen, die zwei sehen aus, als wären sie eingeschlafen.
Okay, dann einfach zum Wasser laufen und die Füße in die Wellen stecken, mal schauen, ob das hilft. Zu spät bemerke ich, dass Jacob die gleiche Idee hatte, dass er bereits da steht, eingetaucht in die Dunkelheit, ein bisschen geschrumpft, weil seine Füße im Sand versunken sind. Ich stelle mich neben ihn, wortlos, weil ich jetzt wirklich nicht sprechen kann, weil mir gerade in den Sinn gekommen ist, dass ich mich eigentlich gerne übergeben würde.
Ich atme tief ein und dann wieder aus, und im selben Moment fällt mir auf, dass Nelli mitten im Song abrupt aufgehört hat, zu singen und zu spielen. Ich werfe einen Blick in Richtung Lagerfeuer, wo keiner mehr sitzt, sondern alle bloß rumliegen, wie kann man nur so schnell einschlafen, mitten im Song, das geht doch gar nicht, was soll das jetzt?
Tastend suche ich Jacobs Blick, der mir ausnahmsweise mal nicht ausweicht, der mir begegnet, was aber fast noch schlimmer ist, denn irgendwas darin stimmt nicht, stimmt ganz und gar nicht, the doctor is in und sieht irgendwie so aus: schuldbewusst.
Er macht einen kleinen Schritt auf mich zu, dieser geschrumpfte Dämon in der Dunkelheit, und plötzlich kriege ich richtig Angst, obwohl oder gerade weil er in diesem Moment so aussieht, als wollte er mich küssen. Dann aber begreife ich: Er will mich bloß auffangen, bevor ich falle, bevor ich weg bin, und ausgerechnet jetzt fällt mir dieser verdammte Song wieder ein: You can checkout. But you can never leave.
Liz
2
Zuerst die Stimmen. Schreiende, sich überschlagende Stimmen, das Flackern meiner Augen und schließlich Amelies Gesicht, ihre blauen Augen, rotgeädert und nass, genau wie die Nase. Und ihre Haare, die mich umgeben, als sie sich vorbeugt, ein dichter roter Schleier, uns beide verbergend.
Ihr Flüstern: »Ich hatte Angst, Liz. Ich hatte solche Angst um dich.«
»Was …?«
Meine Stimme: Eine zerkratzte Schallplatte, total hinüber, ein Brennen im Hals, als wäre Spiritus da runtergelaufen, ich muss was trinken. Amelie hält mir eine Flasche an die Lippen, ihre Hände zittern, sie verschüttet die Hälfte, am liebsten würde ich sagen: Reiß dich zusammen, ich hatte noch nie im Leben so einen verdammten Durst!
Das Wasser schmeckt abgestanden und faulig, erinnert an die Pfütze eines alten, moderigen Kellers. Aber ich trinke es trotzdem, die ganze Flasche in einem Zug leer, würden Amelies Hände nur nicht so zittern!
Danach versuche ich, mich aufzusetzen, und stelle fest: Arme und Beine sind aus Gummi, hängen schlapp runter, und während Amelie mir hilft, versuche ich, mich zu konzentrieren, nachzudenken, aber wie soll das gehen, wenn die immer noch so schreien, irgendwo draußen.
Dann, plötzlich die Erkenntnis, diese Erinnerungen, die alle gleichzeitig auf mich einprasseln, mitten im Hagelsturm sitze ich da mit all diesen Bildern vor Augen: das Lagerfeuer und meine schlafenden Freunde, das Wunderland, die Orchideenzweige, Jacob, mit den Füßen im Sand versunken.
Mein Blick gleitet von Amelies Gesicht in den Hintergrund, und ich begreife: Das ist nicht das Wunderland, das ist alles andere, nur das nicht.
Das ist ein leerer, ausgehöhlter Raum, ähnlich wie eine Garage, ganz aus Beton gegossen: die Wände kahl, der Boden nackt, genau wie das Bett, weder Laken noch Kissen, nur eine Matratze, von der ich sofort runtermuss, wieder dieser Gedanke an den schimmligen Keller.
Taumelnd setze ich mich auf, will endlich wissen, was da draußen los ist, warum die so schreien, der Boden unter meinen nackten Füßen fühlt sich rau an, aber auch krümelig, und ich wünschte, ich hätte da nicht so genau hingeschaut, er starrt vor Dreck, dieser Boden, ist voll mit schwarzen Erdklumpen und trockenem Laub und irgendwelchem Zeug, von dem ich nicht so genau wissen will, was das eigentlich ist.
Jetzt verstehe ich Amelies Gesicht: ihre verrotzte Nase, die rotgeweinten Augen.
»Wie fühlst du dich, Lizzy? Kannst du laufen?«
Ich nicke und werde den Schwindel auf keinen Fall zulassen, halte mich an Amelie fest, die mich stützt, eine Gummipuppe versucht zu laufen. Trotzdem strenge ich mich an, will unbedingt raus aus diesem Betonloch, wie eine Motte kämpfe ich mich zum Licht, ins Grüne zu meinen Freunden, die sich gegenseitig anschreien.
Draußen knicken mir die Gummibeine aber doch weg, und Amelie setzt mich auf dem dichtbewachsenen Untergrund ab, der ein Rasen sein soll, aber eigentlich keiner ist; jedenfalls ist es nicht der flauschige, akkurat gepflegte Teppich aus dem Wunderland.
Sie stehen dicht voreinander, der blonde Leonardo DiCaprio und der braunhaarige Grübchengrubenmann, und nach ihren roten Gesichtern zu schließen, muss das schon eine Weile so gehen, das Brüllen, wobei Jacob, der hat eigentlich kein rotes Gesicht, sondern eines aus Stein gehauen.
»Zum letzten Mal: Sag mir endlich, was diese verfickte Scheiße soll!«
»Ich weiß es nicht, Colin. Ich habe keine Ahnung. Reg dich ab.«
»Du hast keine Ahnung? Was ist das für ein Bullshit? Du lockst uns in das Haus irgendeines beschissenen Onkels, schüttest uns Drogen ins Bier und hast dann keine Ahnung?«
»Ich hab dir nichts ins Bier geschüttet. Das Letzte, an das ich mich erinnere, ist, dass ich selbst umgekippt bin, am Strand, mit Lizzy auf den Armen.«
»Du willst mir also erzählen, dass das alles nur Zufall ist? Dass du absolut keine Ahnung hast?«
Jacob starrt Colin bloß an, und plötzlich wollen Leonardo keine Worte mehr einfallen, bloß noch die Fäuste lässt er sprechen, doch sie erreichen Jacob nicht, er bleibt einfach stehen, zu Stein geworden, vielleicht auch wie ein Baum, der sich im Sturm zur Seite neigt.
Dass Jacob so unbeteiligt wirkt, dass er einfach nicht umfällt, regt Colin noch mehr auf, und obwohl Nelli und Amelie versuchen, die beiden auseinanderzubringen, dreht Colin weiter durch, tobt und tritt mit den Füßen.
Und dann etwas, das ich lange nicht gesehen habe: eine kraftvolle Bewegung, so sicher und fließend ausgeführt, dass mir klar wird: Jacob hat sie schon tausendmal zuvor gemacht, beherrscht sie im Schlaf, kann sie mühelos auf den Punkt bringen, genau wie ich meinen Spagat auf der Spitze, Développé à la Seconde, zwei oder drei Sekunden kann ich das Bein oben halten, spüre ich meine Wade neben dem Ohr: halten, halten, halten und dann weich absetzen, ganz, ganz federleicht.
Genauso führt Jacob seine Bewegung aus: Man sieht nicht die Kraft, die in ihr steckt, man kann sie nur erahnen.
Colin liegt unter Jacob am Boden. Colin mit seinem braungebrannten, durchtrainierten Körper, der fast jeden Tag zum Kickboxen rennt oder mal eben so einen Marathon läuft. Colin, von dem ich immer gedacht habe: Den haut so schnell nichts um.
»Mach das nicht noch mal, Alter«, sagt Jacob. »Sonst renke ich dir die Schulter aus.«
Jacobs ruhige Stimme will nicht zu seinen harten Worten passen, und während DiCaprio am Boden liegt, richtet er sich auf und starrt uns in die Augen, sagt damit sehr deutlich: Ihr könnt mich alle mal.
Und dann stapft er davon, in irgendeine Richtung, Hauptsache, raus aus unserem Blickfeld. Gleich danach fangen alle an zu sprudeln, und ich begreife: Sie sind längst einen Schritt weiter als ich, einen ziemlich großen Schritt weiter, denn sie haben die Gesamtsituation schon begriffen, sie bereits gesehen, diese Betonmauer, drei oder vier Meter hoch und oben Stacheldraht zu einer Art Tunnel gerollt, was lächerlich ist, denn kein Schwein kann jemals da hochklettern, schließlich sind wir keine Riesen, bloß eine Gruppe ziemlich verlassener Studenten.
Sofort schaue ich in alle Richtungen, überall das Gleiche: Ein dichter, hoher und dschungelartiger Wald ragt hinter einer Betonmauer auf, die uns mit dieser Stacheldrahtrolle von vier Seiten umschließt. Alle paar Meter schaut eine Kamera auf uns herab.
Erster wahnwitziger Gedanke: Wir sind im Knast gelandet, im thailändischen Open-Air-Knast, irgendeiner der Jungs hat Drogen geschmuggelt, was für eine Erleichterung!
Würde nur die Erkenntnis nicht so hart ausfallen, mein Verstand sagt sofort NEIN, das hier ist etwas anderes, etwas ganz, ganz anderes. Deswegen fangen sie auch gleich an zu zittern, die Hände der Gummipuppe. Dass Amelie die Wasserflasche vorhin überhaupt halten konnte, grenzt an ein Wunder, denn was ich als Nächstes begreife, will ich nun gar nicht sehen, ganz und gar nicht.
Wir alle tragen die gleichen Sachen: einfache Stoffschuhe, kurze schwarze Hosen und weiße Trikots mit einer Nummer hintendrauf, einer Nummer und unseren Namen.
8 Jacob
9 Nelli
10 Colin
11 Amelie
12 Benjamin
Ich mache die Augen lieber mal zu und lasse mich rückwärts auf den nicht flauschigen Teppich fallen.
Und dann mal schauen, was meine Playlist so zu bieten hat: Ich könnte die kitschige Sequenz vom Strand nehmen, wobei nein, alle Gedanken an das Wunderland sollen weg, weit weg, da muss schon etwas von früher her, etwas, das ich schon ewig nicht mehr abgespielt habe, ein Joker gewissermaßen.
Also lasse ich ihn zu, diesen Moment, den ich ziemlich lange weggesperrt habe, wie ich auf der Bühne stand, einer New Yorker Bühne, beim Youth America Grand Prix, dem besten Wettbewerb für Nachwuchsballetttänzer auf der ganzen Welt.
Einfach die Augen geschlossen halten und sie noch mal durchgehen, meine Performance, jede einzelne Bewegung, Ravel klingt in den Ohren, Bolero natürlich, die Musik trägt mich, macht mich leicht, Adrenalin pumpt durch meinen Körper, das ist wie fliegen, nur etwas besser, denn bereits während ich tanze, fühle ich: Du machst es perfekt, rockst das Ding, landest ganz oben auf dem Siegertreppchen.
Ich würde die Erinnerung gerne bis zum Ende abspielen, aber die Mädchen fallen über mich her, Jacob hat nicht genug Ablenkung geboten, anscheinend denken sie, ich wäre ohnmächtig geworden.
»O Gott, Lizzy, bist du okay? Liz? Liz?«
Ich öffne die Augen und betrachte Nellis Gesicht, ihr schönes Gesicht, aus dem ich die Angst herauswischen möchte.
»Wie lange war ich weg?«
»Das wissen wir nicht so genau. Ein paar Stunden länger als wir.«
»Ich brauche meine Medikamente, Nelli.«
»Ja, ich weiß«, antwortet sie hastig und starrt auf die Betonmauer. So viel also zu meinen Medikamenten.
Sofort schießen mir Tränen in die Augen, aber ich versuche, erst mal dagegen anzukommen, gegen diese aufwallende Panik und diesen absurden Gedanken: Jetzt hast du jahrelang durchgehalten, nur um in diesem Knast zu verrecken.
Meine Hände zittern, und ich würde gerne sprechen, irgendwas sagen, das die Situation entschärft, aber ich weiß: Meine Stimme wird so brüchig sein wie trockenes Laub.
Also passiert das, was meistens geschieht, wenn die Panik zu akut wird, sich zu nah an das bewegt, was man Todesangst nennen könnte. Atemnot, Schwindel, der Hals geht zu, von jetzt auf gleich, als würde einer neben mir stehen und zudrücken.
Nelli, die das schon kennt, reißt mich sofort an sich, wiegt mich wie ein kleines Kind und murmelt leise, ruhig, Schätzchen, ganz ruhig, sie streichelt meinen Kopf, während die Tränen laufen, Rotz und Wasser, die Pampelmuse wird ausgequetscht.
Mir bleibt nichts anderes übrig, als mich ganz und gar auf Nellis Stimme zu konzentrieren, mich genau an ihre Anweisungen zu halten: Einatmen, ausatmen, und zu versuchen, wirklich zu glauben, was sie da sagt: Alles wird gut, Liz. Du wirst sehen. Alles, alles wird gut. Versuch, ruhig zu atmen, ein, aus.
Der Anfall ebbt ab, langsam, aber konstant. Was zurückbleibt, fühlt sich leer und schwindelig an.
Nelli richtet meine langen Haare, versucht, sie zu entwirren, wischt mit ihren Händen alles Klebrige aus meinem Gesicht fort. Meine Stimme klingt immer noch brüchig.
»Was ist das hier, Nelli?«
»Das wissen wir nicht. Nur, dass wir eingesperrt sind.«
»Es gibt keinen Ausgang?«
»Nein.«
»Habt ihr das genau geprüft? Seid ihr schon alles abgelaufen?«
Sie nickt und ihre blauen Augen beginnen zu schwimmen.
»Aber warum …«, beginne ich, doch Leonardo unterbricht mich sofort, sagt mit scharfer Stimme: »Das wissen wir nicht, verdammt! Wir haben keine Ahnung, was diese Scheiße soll!«
»Wie groß ist denn das Areal?«
Leonardo fährt sich mit der Hand durch die strohblonden Haare.
»Nicht viel größer als ein Fußballfeld. Und die Garagenbunker stehen mittendrin.«
»Gibt es denn irgendeine Nachricht? Eine Forderung?«
Nun ist es Amelie, die antwortet, mit dünner Stimme sagt: »Nein, Lizzy. Nichts. Wir wissen auch nicht viel mehr als das, was du jetzt siehst.«
Mein Blick wandert von den blassen Gesichtern meiner Freundinnen hinüber zu der großen, glatten Mauer.
»Wisst ihr«, sage ich mit zittriger Stimme. »Ich musste gerade an Shaun das Schaf denken. Da stellen sich die Schafe einfach übereinander, wenn sie irgendwo hochklettern wollen. Wir stellen uns aufeinander, wie eine Gruppe Artisten, und einer klettert über die Mauer und holt Hilfe.«
»O Liz.«
Ich kann mich nicht daran erinnern, Nelli jemals weinen gesehen zu haben, selbst im Krankenhaus nicht, als sie den einen oder anderen Grund gehabt hätte. Dass es jetzt aus ihrer Nase tropft, kann ich also nicht fassen, das ist vielleicht nicht das Gleiche wie Weinen, aber es kommt ziemlich nahe ans Heulen heran, deswegen meine ich: »Wenn du anfängst zu flennen, klatsch ich dir eine!«
Sie nickt und zieht ruckartig die Nase hoch, genau wie die Schultern, macht aus der eingesunkenen Nelli eine etwas größere, zwar keine Riesin, aber immerhin. Nelli hat, obwohl sie die Kleinste von uns allen ist, das Potential, ziemlich groß zu sein.
»Also. Welche Nummer bin ich?«
»Sieben.«
»Großartig. Meine Glückszahl.«
Sie macht etwas mit ihrem großen Mund, das wie ein Lachen aussehen soll, aber es gelingt ihr nicht, es endet als Grimasse.
»Kannst du aufstehen?«
»Ich weiß nicht, ich versuch’s mal.«
Tatsächlich geht es etwas besser als vorhin, meine Beine sind nicht mehr ganz Gummipuppe, was will man mehr, und während ich vor mich hin wackele, betrachte ich das Entsetzen in den Gesichtern meiner Freunde und finde: Ich will das nicht sehen. Ich hab einfach schon zu viel durchgemacht, um mir das jetzt anzuschauen.
»Wenigstens brauchen wir uns nicht zu entscheiden, was wir morgens anziehen«, meint Nelli und noch während Amelie sie anstarrt, höre ich Freckles ganz seltsam lachen, ein Kratzgeräusch macht er, als hätte er seit Ewigkeiten nichts mehr getrunken.
»Das ist außerdem ein großartiges Setting«, sagt er und rückt seine schwarze Brille zurecht. »Besser kriegst du das in keinem Horrorstreifen hin!«
Amelie versteckt ihr Gesicht hinter den Händen und fängt an zu weinen, lautlos, aber mit zitternden Schultern.
Leonardo wuchtet sich wieder auf die Füße, ziemlich grimmiger Gesichtsausdruck, es könnte Wut sein, ist aber wohl eher verletzter Stolz.
»Ich bring den um!«
Seine Worte machen alle stumm, selbst Amelies Schultern halten inne, ich starre auf Colins Hände, die wieder zu Fäusten geballt sind, und finde: Die haben jetzt alles kaputtgemacht, diese vier knappen Worte, ich bring den um, was soll das jetzt?
»Hör auf so zu reden. Du hast überhaupt keinen Plan, was hier abgeht, und bis du es nicht besser weißt, will ich diese Scheiße nicht hören!«
Er dreht den Kopf in meine Richtung und blickt mich an, überrascht, mit einem Contra hat er nicht gerechnet, zumindest nicht von dem dünnen blonden Mädchen mit den verheulten Augen.
»Jacob ist Nummer acht. Also sitzt er erst mal im selben Boot wie wir!«
Leonardo löst die Fäuste und betrachtet seine Hände, bevor er sich die fransigen Haare aus der Stirn streicht und mir den Rücken zudreht, Nummer zehn.
Die Nummern sind das, was mich an der ganzen Sache am meisten fertigmacht: nicht die Betonmauer, auch nicht die schimmlige Matratze oder die Kameras – nein, diese Nummern und diese verdammten Trikots.
7 Elisabeth
Alle haben wir sie an, diese weißen T-Shirts, sind also eine halbe Fußball-Nationalmannschaft, und vornedrauf ein Schriftzug, der sich auch nicht länger leugnen lässt: Ein Opfer macht frei. Großartig.
Die Trikots zeugen von Vorbereitung, Recherche, von einer Systematik, zu der es hinreichend Parallelen gibt, an die ich jetzt aber nicht denken mag, ganz und gar nicht. Und dann noch diese Zutat, Ein Opfer macht frei, das wirft ebenfalls Bilder auf, jede Menge Bilder, und ich habe sie sofort vor Augen, die großen Tore aus Metall mitsamt den metallenen Schriftzügen.
Und weil ich mich gerade so wunderbar darauf eingestimmt habe, brauche ich nur etwas umherzugehen und sehe es auch hier: ein großes verschlossenes Tor, bestehend aus zwei Flügeln, vier Meter hoch wie der Rest der Mauer, und den metallenen Schriftzug haben die sich nicht nehmen lassen, Ein Opfer macht frei, ziemlich runde Sache das Ganze.
Nun ist es an mir, das Gesicht hinter den Händen zu verbergen und wieder zu versuchen, sie abzuschmettern, diese aufwallende Panik, aber mach das mal, wenn plötzlich drei Tonnen Adrenalin durch deine Adern gepumpt werden.
Aber ausgerechnet das Pumpen funktioniert bei mir halt nicht optimal, mir wird schwindelig, und wieder fange ich mit den Gummipuppenbeinen an. Schlimmer ist jedoch die Atemnot. Dieses verdammt unangenehme Gefühl, nicht richtig tief einatmen zu können.
Macht aber nichts, denn gerade, als ich anfange zu taumeln, kommt der Doktor aus einem Gebüsch und fängt mich auf, darin hat er ja schon Routine, der Rosamunde-Pilcher-Arzt. Und jetzt schaut er mich auch wirklich an wie ein Arzt, vielleicht sogar wie ein Freund: »Was hat die denn die ganze Zeit?«, will er von Nelli wissen, die neben ihm steht und mich gleichfalls stützt.
»Sie braucht ihre Medikamente.«
Auf seinem Gesicht ein großes Fragezeichen, wieder der besorgte Ausdruck, the doctor is in, aber bevor er was entgegen kann, plötzlich dieses Dröhnen, unvermittelt, krachend, bis ich begreife, dass es sich um Musik handelt, eine Art vergessener Musik, die so klingt, als wäre sie vor hundert Jahren auf einem Grammophon abgespielt worden.
Der Krach entpuppt sich schließlich als Marschmusik, und ich muss das mit den hundert Jahren gleich korrigieren: Mir kommen eher die Roten oder die Braunen in den Sinn, also ganz passend zu unserem Tor.
Im Vergleich zu der Stimme, die jetzt aus dem Lautsprecher bellt, klang der Marsch aber geradezu harmlos.
»Alle Mann in einer Reihe vor dem Tor aufstellen!«Es ist weniger der Inhalt, der mir den Boden unter den Füßen wegzieht, als die Stimme selbst, künstlich verzerrt, eine Monsterstimme aus einem Horrorstreifen.
Man kennt das einfach nicht aus dem echten Leben. Man kennt das aus Filmen, die man sich an Halloween anschaut, dicht in die Lieblingsdecke gekuschelt. In der Realität will man von solchen Sachen nichts wissen. Die will man nicht spüren, die sollen einen nicht so erschüttern, nicht bis ins Mark treffen.
Alle starren bloß, und plötzlich fällt mir ein, dass ich dringend pinkeln muss. Und dass mir außerdem ziemlich schlecht ist – das faulige Pfützenwasser, warum hab ich das nur getrunken?
Fast im selben Moment kotze ich alles raus, aber die können mich mal, die Braunen, außerdem ist es wahrscheinlich sogar das, was die wollen: junge Frauen kotzen sehen. Nur dass es jetzt der Doktor ist, der mir die Stirn hält, hätte nicht sein müssen. Nelli startet immerhin einen Versuch: »Ich helf dir, Liz«, aber da schmettert das Monster schon wieder, dieses Mal ziemlich verärgert:
»Verdammt nochmal! In einer Reihe aufstellen, egal wer gerade kotzt!«
Die Stimme jagt mir eine Heidenangst ein, eine Heidenübelkeit, und ich scheine nicht die Einzige zu sein, denn obwohl ich noch würge, hebt mich der Doktor hoch und beeilt sich, mich in Richtung Tor zu tragen, wo alle schon stehen, damit hätte ich nun nicht gerechnet, dass alle sofort gehorchen und in einer militärisch geraden Reihe dastehen.
Jacob hält mich erst auf den Armen und stellt mich dann behutsam ab, aber ich beschließe, mich einfach weiter an ihn zu lehnen, und dabei fällt mir zum ersten Mal sein Geruch auf. Und damit meine ich nicht den Duft irgendeines Deos, sondern seinen körpereigenen Geruch. Und ich beschließe, mich einfach darauf zu konzentrieren, auf diesen Geruch von dem Mann mit den braunen Locken und dem Grübchen am Kinn. Nichts wie weg mit dem Gedanken an das Pfützenwasser, ich lege stattdessen meinen Kopf auf seine Schulter und versuche, so gut es geht zu atmen.
Das ist der Monsterstimme nun aber gar nicht recht, ganz und gar nicht, die dröhnt gleich: »Gerade hinstellen!«, und ich bin so erschrocken, dass ich zusammenzucke, es sogar tue, dass ich mich sogar halten kann auf den Gummibeinen.
Erst als alle ruhig stehen, legt das Monster wieder los.
»Willkommen bei unserem Opferspiel! Ihr alle seid etwas Besonderes: jung, gesund, gutaussehend. Wir wollen herausfinden, wer von euch am stärksten ist. Ab sofort muss jeden zweiten Tag einer von euch geopfert werden. Entscheidet euch bis morgen früh, wer als Erster geopfert wird. Solltet ihr bis zur Mittagszeit keine Entscheidung treffen, nehmen wir euch diese ab. Der Gewinner des Spiels wird reich belohnt!«
Danach ist es so, dass selbst die Tiere schweigen. Diese Stille fällt dir auf, wenn sie plötzlich da ist und dich schwer und drückend umgibt, wie die Hitze, die du beinahe schon anfassen kannst, die zu einer Art Gegenstand wird, der alles umfasst.
Zuvor waren sie eben die ganze Zeit da: Irgendwelche Hintergrundgeräusche, sagen wir mal, das Geschrei der Papageien oder der Gibbons, das Summen von Insekten oder der Wind, der in den Palmen raschelt. Und dann, plötzlich, nichts mehr.
Nelli kann das nicht aushalten, diese absurde Stille, deswegen tritt sie aus der Reihe und brüllt: »Hey, Liz ist überhaupt nicht gesund! Sie braucht ihre Scheißmedikamente!«
Und während ich noch überlege, ob ich meine Freundin für diese zwei Sätze umarmen oder lieber ohrfeigen soll, wimmert Amelie: »Nelli, hör auf!«, und dann ist es wieder still, gespenstisch still, eine gefühlte Ewigkeit geht das so, bis du plötzlich das Geräusch einer sich öffnenden Tür hörst. Dieses leise Knarzen von Metall, die Schritte eines Menschen.
Und während du diese Abfolge wahrnimmst, kannst du gar nichts machen, rein gar nichts, allenfalls noch die Metallbuchstaben über dem Tor anstarren: Ein Opfer macht frei, wir sollen alle zwei Tage einen von uns opfern, uns überlegen, wer das sein soll, was soll diese Scheiße, wie soll das gehen, ich will keinen opfern, meine Freundinnen schon gar nicht, das macht alles Mögliche mit mir, nur frei macht es nicht.
Nelli bleibt in ihrer kleinen, schlanken Gestalt einfach stehen, aus der Reihe getreten, das Gesicht ihres Pagenkopfes in die Luft gereckt, bis oben auf der Mauer eine vermummte Gestalt auftaucht, die aussieht, als würde sie eine weiße Mönchskutte tragen. Also sind das da oben nicht die Braunen. Es sind die Weißen auf einer Empore.
Der Kuttenmensch macht eine Bewegung mit den Armen, ganz schnell, ganz gezielt, und dann die Schüsse, genauso gezielt, während ich auf die Knie falle und mir die Ohren zuhalte. Dieser ohrenbetäubende Krach ist im Vergleich zu der vorherigen Stille kaum zu ertragen, schlimmer ist jedoch die Angst, die Panik, immerzu dieser Adrenalinrausch.
Auf der Bühne war er berauschend, hier ist er einfach nur beschissen.
Ich reiße den Kopf herum und starre zu meinen Freunden, die auf die Knie gesunken sind wie ich, aber unverletzt wirken.
In der Ferne ein leises Klacken, als würde die Tür wieder zufallen, mein Blick hoch zur Empore: Der Weiße ist weg und mit ihm die Warnschüsse.
Danach fangen die meisten an zu heulen, sogar die Jungs, genau genommen alle, bis auf Nelli und Jacob. Wobei auch er ein bisschen zu blinzeln scheint, aber heulen, nein, davon ist er weit entfernt, vielmehr lässt er seine Wangenknochen mahlen, die Fingerknöchel knacken, the doctor is out.
Dass er nun partout nicht heulen mag, finde ich befremdlich, beinahe unmenschlich, dass Nelli nicht heult, okay, sie hat ihre Geschichte, eine Geschichte, in der man die meisten Tränen für ein ganzes Leben verbraucht hat.
Also gehe ich davon aus, dass auch Jacob seine Geschichte haben wird, irgendetwas, das ihn davon abhält, zu heulen, etwas, von dem wir keinen blassen Schimmer haben.
Irgendwann fangen die Ersten wieder an zu sprechen, Fetzen wie »Wir sind total am Sack« fallen aus Freckles Mund. Er nimmt seine schwarze Designer-Brille ab und reibt sich die Augen. Amelie weint leise, bis Nelli zu ihr hinübergeht und sie in den Arm nimmt, ihr über die langen roten Haare streicht.
Würde die Gruppe sich nur endlich beruhigen, wir alle wieder einen klaren Kopf bekommen, würde nur Leonardo nicht über Durst klagen und Amelie endlich mit dem Schluchzen aufhören.
Über ihre Köpfe hinweg blicke ich Jacob in die Augen, der Doktor hat aufgehört, mit den Wangenknochen zu mahlen, und sagt sehr laut und deutlich: