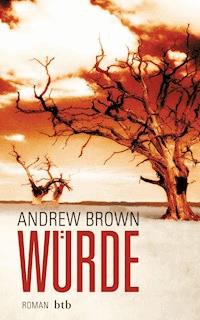Inhaltsverzeichnis
Widmung
Kapitel 1
Kapitel 2
Copyright
Die südafrikanische Originalausgabe erschien 2009 unter dem Titel »Refuge« bei Zebra Press, Kapstadt.
Ein Glossar mit Erklärungen zu fremdsprachigen Begriffen findet sich im Anhang.
Für meine Kinder Kayla, Kieran und Jaimen - mögt ihr niemals ein anderes Zuhause kennenlernen als den liebevollen Ort, den ihr gewählt habt.
Werewere lewe nbo lara igiGbebe nii ro koko lagbalaA taboyun a ti kokoYio ryin lorunGbedemukeGbedemuke
Ein reifes Blatt fällt leichtDer Kakaobaum im Hof ist immer grünFür die schwangere Mutter und das bald geborene KindWird es leicht seinSanftSanft
Traditionelles Yoruba-Gedicht für die Namensgebungszeremonie eines Kindes in Nigeria (von Abiodun Adepoju)
»Hallo. Ich heiße Abayomi. Bitte treten Sie ein.«
Diese wenigen Worte werden sein Leben für immer verändern. Der Klang ihrer Stimme, so nah an seinem Ohr, macht eine Veränderung fast unabdingbar. Wie bei jedem ersten Mal geht auch hier etwas Wesentliches verloren, und zugleich wird eine neue Erkenntnis gewonnen.
Er kann sie noch nicht sehen. Sie steht im Schatten der Eingangstür, geblendet vom Sonnenlicht, das grell auf die weißen Wände fällt. Um ihre Gestalt auszumachen, kneift er die Augen zusammen. Aber bereits ihre Stimme lässt erahnen, dass er mit diesem Schritt einen Weg einschlägt, der in starkem Widerspruch zu seinem bisherigen Leben stehen wird. Der sinnliche Singsang, der Klang ihres fremdländischen Akzents, die erotische Atmosphäre - all das verbindet sich im Bruchteil eines Augenblicks zu einem Ganzen, das ihn beinahe das Gleichgewicht verlieren lässt. Alles trägt eine Frische in sich, die ihn aufrüttelt und aus seiner trägen Gesetztheit reißt.
Selbst wenn er sich jetzt umdrehte und wieder ginge, bliebe ihm etwas Reines und Ergreifendes im Gedächtnis. Er könnte sich irgendwo hinsetzen, umgeben von Betriebsamkeit und Lärm, und sich diese Erinnerung vor Augen führen. Er könnte sie wie einen kleinen Kieselstein in die Tasche stecken und mit dem Daumen immer wieder über die glatte Oberfläche streichen. Oder er könnte sie in einer samtgefütterten Schatulle aufbewahren und manchmal, wenn er allein wäre, herausholen und betrachten.
Es sind nur wenige Schritte, die ihn zu dieser Tür geführt haben. Gewöhnliche Entscheidungen, die großenteils spontan getroffen wurden, kaum merklich - und doch alle auf diesen einen Punkt zulaufend, auf diese Initiation. Das Ziel seiner halbbewussten Handlungen liegt hinter dieser Tür, in dem dämmerigen Raum, zu dem sie führt. Verlockend und doch heimtückisch. Vielleicht könnte er dem Sog jetzt noch Einhalt gebieten. Er könnte sich zurückziehen, sich entschuldigen und gehen. Oder er könnte einen Schritt nach vorn tun und eintreten.
Ein Schritt zurück - die Tür würde sich wieder schließen, und er würde sich später nur noch an einen kurzen Blick in eine andere Welt erinnern.
Ein Schritt nach vorn - und die Tür würde hinter ihm zufallen. Er würde in einen tosenden Sturm treten, der ihn auf einen wilden Pfad aus Tod und Wiedergeburt triebe. Einmal im Inneren des Hauses wäre für ihn die Straße vor der Tür für immer verschwunden.
Eines weiß er: Über die gleiche Schwelle wird er kein zweites Mal als derselbe Mann treten.
Seine Freunde kennen ihn als zuverlässig und integer. Er jedoch vermutet, dass dies in Wahrheit nur höfliche Umschreibungen für »langweilig« sind. In den Augen seiner Mitmenschen bleibt er stets der Gleiche: alltäglich, konturenlos. Keiner ahnt, wie kurz er davorsteht, die Kontrolle zu verlieren. Er malt sich immer wieder aus, wie er loslässt, wie er seinen Gefühlen freien Lauf lässt - wie einer, der im türkisgrünen Wasser einer Bucht treibt, Arme und Beine gespreizt, weit vom Ufer entfernt.
Einmal träumte er, ein Astronaut zu sein und mit schweren Stiefeln auf sein Raumschiff zu klettern. Er blickte in die Gischt aus Sternen hinauf. Dort oben war es vollkommen still. Dann ging er in die Hocke und sprang. Sein Körper schwebte davon, in den grenzenlosen Weltraum hinaus. Als er aufwachte, lastete eine schwere Traurigkeit auf ihm.
Sein Leben wurde im Lauf der Jahre zu einer Anhäufung aus Bedauern und Reue - der Möglichkeiten wegen, die sich ihm boten und nicht ergriffen wurden, der Chancen wegen, die er nicht zu nutzen wagte. Voll Missmut blickt er zurück. Und trotzdem: Panik erfüllt ihn bei der Vorstellung, seinen bisherigen Weg zu verlassen. Er fühlt sich wie ein Fliesenleger, der während der Arbeit auf einmal merkt, dass sein Muster asymmetrisch verläuft, aber nichts mehr dagegen tun kann. Verbissen fährt er mit seiner Tätigkeit fort, wobei er mit jeder neuen Fliese weiter von seiner ursprünglichen Linienführung abkommt.
Es erscheint ihm, als hätte er sich sein ganzes Erwachsenenleben lang auf einer Verkehrsinsel befunden, umgeben von vielbefahrenen Straßen und Erwartungen. An manchen Tagen trottet er wie ein Zugpferd mit Scheuklappen dahin. An anderen stolpert er verwundet auf einem schmalen Grünstreifen entlang, während große Lastwagen an ihm vorbeidonnern. Keiner bemerkt sein Bluten, sein unsicheres Wanken. Für die anderen verfolgt er entschlossen seinen Weg.
Täglich tauchen kleine Abzweigungen auf, es werden scheinbar unwichtige Entscheidungen gefällt, die ihn jedoch immer weiterführen. Die Gabelungen sind so unmerklich, dass er auf derselben Insel zu bleiben scheint und lange nicht einmal bezweifelt, dass diese Insel seine Bestimmung ist.
Angst, Bequemlichkeit, Ekel - das sind die Zäune, die ihn eingrenzen. Sie mögen kaum zu erkennen sein, und doch sind sie stärker als jede Fessel. Wenn er die Insel jetzt verlässt, wird er mit anderen Welten zusammenstoßen - Welten, die nur wenige Zentimeter entfernt an ihm vorbeirauschen. Etwas Unbekanntes wird ihn ergreifen, und diese Möglichkeit jagt ihm Furcht ein. Die Vorstellung ängstigt ihn, frei dahinzulaufen, hin- und hergeschleudert zu werden durch den Zusammenprall mit fremden Menschen. Aber zugleich weiß er, dass er das Ende seines bisherigen Weges erreicht hat und sich jetzt entscheiden muss: Entweder überwindet er die Grenze, oder er schreckt vor ihr zurück und erstarrt für immer.
Sie steht hinter der offenen Tür, vor den neugierigen Blicken der Vorübergehenden verborgen, und wartet darauf, dass er eintritt. Er holt tief Luft und macht einen Schritt in den Gang hinein. Sie weicht nicht zurück. Jetzt ist er ihr ganz nah. Der Hausflur liegt im Dämmerlicht, das nach der grellen Sonne auf der Straße angenehm ist. Es riecht nach Sandelholz, Zedern und Palmöl.
Der Duft erinnert ihn an ein Strandhaus am Meer von Inhambane, wo er als Kind gewesen war. Er saß dort auf einer Holzveranda und bohrte die Zehen in den warmen Sand, während über ihm im nachmittäglichen Wind Palmwedel rauschten. Neugierig beobachtete er Fischer mit entblößten Oberkörpern, die ihre Boote an den kleinen Strand zogen. Die abblätternden Farben der Planken leuchteten rot, grün und gelb. Das nach Teeröl riechende Holz lief zu einem Kiel zusammen, der eine tiefe Spur im Sand hinterließ. Kleine Fische waren an zusammengeknüpfte Schnüre gebunden, das Salzwasser tropfte von den muskulösen Rücken der Männer. Dem Jungen stieg der Vanilleduft der Kastanien und der Cashewnüsse in die Nase, die auf einem Feuer in der Nähe rösteten. Hinter ihm auf der Veranda zerstampfte eine junge Hausangestellte Maiskörner für das Abendessen. Den Rock hatte sie sich bis zu den Hüften hochgeschoben. Sie roch nach Kernseife und Haaröl.
Die Tür fällt leise hinter ihm ins Schloss.
»Willkommen im Touch of Africa. Ich bin Abayomi. Deine Freude.«
1
Stefan Svritsky war ein Mann, der schon vor langer Zeit seine Angst gemeistert hatte. Sein Sieg über die Angst erlaubte es ihm, die Furcht anderer gnadenlos auszunutzen. Er entstammte einer armen Familie aus Murmansk, einer Stadt auf der Halbinsel Kola im äußersten Nordwesten Russlands. Obwohl der Hafen das ganze Jahr über eisfrei war und deshalb historisch als wichtiger Marinestützpunkt galt, lag Murmansk doch nördlich des Polarkreises, und das Leben in dem verschmutzten Sozialwohnungsblock war hart. Sein Vater hatte sich als Deckhelfer auf einem Flottenversorgungsschiff verdingt und zu Hause dieselbe militärische Disziplin verlangt, die er selbst bei der Arbeit ertragen musste. Er terrorisierte seine kleine Familie mit harschen Befehlen und einem aufbrausenden Gemüt. Sein Tod, die Folge eines Unfalls auf See, wurde von allen als Atempause erlebt, auch wenn das niemand laut aussprach. Gleichzeitig mussten sich die Zurückgebliebenen nun mit einer dürftigen Witwenrente über Wasser halten. Um über die Runden zu kommen, verließ Svritsky schon früh die Schule und arbeitete ebenso wie sein älterer Bruder als Schiffsbelader im Handelshafen.
Sein Bruder schien mit der harten Knochenarbeit auf den beißend kalten Piers zufrieden zu sein, aber Stefan wartete bald sehnsüchtig darauf zu entkommen. Nach einer Weile bemerkte er, dass bestimmte Ladungen anders behandelt wurden als der Rest. Während die meiste eingehende Fracht einen gnadenlosen sowjetischen Verwaltungsaufwand durchlaufen musste, wurden die Holzkisten, die für die Dienststellen der örtlichen Miliz bestimmt waren, unter den wachsamen Augen des Polizeioberkommissars auf einen gesonderten Lastwagen verladen und weggebracht. Svritsky stellte sicher, dass er beim Entladen dieser Güter stets anwesend war, und er nickte dem Kommissar ehrerbietig zu, ehe die Kisten abtransportiert wurden.
Nach ein oder zwei Monaten begann der Mann, ihn ebenfalls zu grüßen, indem er den Kopf ein wenig zur Seite legte, um zu bedeuten, dass er die Aufmerksamkeitsbekundungen des jungen Burschen bemerkt hatte. Eines Morgens, als sie wieder einmal eine neue Ladung löschten, kam einer der Hafenarbeiter ins Stolpern. Die Kiste, die er gerade trug, glitt ihm aus den Händen, und mit einem lauten Knall fiel sie mit der Ecke auf den harten Betonboden. Das Geräusch des berstenden Holzes und die wütenden Rufe des Kommissars brachten den ganzen Pier vorübergehend zum Stillstand. Svritsky stürmte auf den Kollegen zu und brüllte ihn an, um ihn so von den Flaschen mit teurem Whisky abzulenken, die zwischen den zerbrochenen Holzlatten hervorblitzten. Dann warf er hastig eine Plane darüber.
Der Polizeioberkommissar musterte ihn, sagte aber nichts. Als die nächste Ladung eintraf, befahl er dem Kontrolleur mit harscher Stimme, von nun an solle Svritsky die Löschung der Fracht beaufsichtigen. Schon bald machte sich der Kommissar nicht länger die Mühe, selbst zu den Docks herunterzukommen, sondern ließ Svritsky die illegalen Waren direkt zur Miliz bringen. Am Ende des Jahres hatte der junge Mann die Piers hinter sich gelassen und begonnen, ausschließlich für die Miliz zu arbeiten, indem er ihr bei verschiedenen zwielichtigen Aufgaben zur Hand ging.
Sein Aufstieg in der sowjetischen Unterwelt vollzog sich rasch und problemlos. Er wusste, wie man Loyalität mit ausgeprägter Selbstsucht verband. Jahrelang hielt er den Schwarzmarkt im nördlichen Russland unter seiner brutalen Kontrolle und belieferte die gesamte politische Elite mit verbotenen Luxusgütern.
Das Monopol der Miliz fand mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion ein jähes Ende. Importkontrollen brachen zusammen, und so mancher Gangster ergriff die Gelegenheit, gewaltsam sein Territorium auszuweiten. Russland wurde für einen früheren Milizganoven immer gefährlicher, so dass sich Svritsky schon bald gezwungen sah, das Land zu verlassen. Nach einem zweijährigen Aufenthalt in Westafrika kam er ohne Freunde oder Familie nach Kapstadt. Es gelang ihm recht schnell, diese fehlenden emotionalen Bindungen zu seinem Vorteil zu nutzen. Durch seine unerschrockene, eigenständige Art wusste er selbst die geringste Schwäche seiner Mitmenschen auszunutzen. Die Entschlossenheit und Bereitschaft des Russen, Menschen auszubeuten, um sein Ziel zu erreichen, machte ihn zu einem gefürchteten Konkurrenten der örtlichen Verbrecher. Mit seiner Mischung aus Intelligenz und Skrupellosigkeit war er ihnen sogar deutlich überlegen. Während sie noch versuchten, mit Drohungen und Beschimpfungen weiterzukommen, führte Svritsky seine Pläne bereits aus. Schon bald hatte er seine Macht in den Nachtclubs und Geschäften der Innenstadt gefestigt.
Sein schwerer Körper und sein fleischig rundes Gesicht, das oft feucht glänzte, unterstrichen noch seinen Ruf als knallharter Gangster. Sein rasierter Kopf und die knopfartige Nase erinnerten an ein Stachelschwein. Als Jugendlicher hatte er unter schwerer Akne gelitten, wodurch seine Haut auch jetzt noch wie die unebene Oberfläche eines Haferbreis aussah. Weißgraue Bartstoppeln verbargen die schlimmsten Narben. Doch wenn er wütend war, rötete sich sein Nacken, als wäre er mit heißem Wasser verbrüht worden, und die Pockennarben schienen sich wie Wunden zu entzünden. Seinen rechten Unterarm zierte die Tätowierung einer nackten Frau, die versuchte, eine Schlange in Schach zu halten. Der dicke Leib des Tieres hatte sich um einen Schenkel der Frau gewickelt und zwischen die Beine gedrängt, wobei es sich vor den zusammengezogenen roten Brustwarzen aufbäumte.
Svritsky trug gern locker geschnittene Shorts, die seine stämmigen Oberschenkel gerade einmal zur Hälfte bedeckten. Dazu hatte er meist weiße Socken und Turnschuhe an. Kurzärmlige Polohemden betonten seine fassförmige Brust und die kraftvollen, behaarten Arme. In einer solchen Aufmachung hätten die meisten Geschäftsmänner lächerlich gewirkt, doch in seinem Fall hob sie die bedrohliche Ausstrahlung noch hervor. In seinen Augen zeigte sich gnadenlose Entschlossenheit. Die Iris wirkte manchmal beinahe opak - ein lebloses Grau wie die Farbe des Meeres seiner Heimatstadt -, nur um sich dann blitzschnell in ein gefährliches Grün zu verwandeln, die schillernde Farbe brennenden Bariums. Am erschreckendsten wirkte er, wenn er sein Gegenüber regungslos anstarrte.
Richard Calloway beobachtete, wie sein Mandant jetzt den zornig funkelnden Blick auf die zierliche Gestalt von Cerissa du Toit richtete, die Behördenleiterin der Generalstaatsanwaltschaft. Du Toit hatte Svritskys Verbrecherlaufbahn in Südafrika verfolgt und ihn immer wieder wegen verschiedener Delikte wie versuchter Mord, Betrug, Korruption, Drogenhandel und Steuerhinterziehung angeklagt. Sie war bisher jedoch stets erfolglos gewesen, was großenteils auf Richards Bemühungen als Svritskys Anwalt zurückzuführen war. Einmal war es ihr mehr oder weniger zufällig gelungen, ihn wegen unversteuerten Einkommens und eines tätlichen Angriffs zu einer unbedeutenden Geldstrafe zu verurteilen. Es war ein ausgesprochen unbefriedigender Fall gewesen, wobei ihre Enttäuschung auch nicht durch den Tobsuchtsanfall gemildert wurde, den Svritsky während seiner Anhörung vor Gericht bekam.
Der Russe war vor zwölf Jahren zum ersten Mal in Richards Kanzlei aufgetaucht. Damals hatte man ihn wegen Kokainbesitzes angeklagt. Sich ganz auf die Unfähigkeit des zuständigen Polizeikommissars und des Staatsanwalts verlassend, war es Richard problemlos gelungen, für seinen Mandanten einen Freispruch zu erlangen. Als Nächstes wurde einer der Handlanger des Russen wegen Erpressung vor Gericht gestellt. Der Fall gab Richard einen ersten Einblick in die gnadenlose Welt des Stefan Svritsky. Eine mittelmäßig geführte Untersuchung und der Widerwille eingeschüchterter Zeugen zu einer klaren Aussage ermöglichten es ihm, die Argumente der Staatsanwaltschaft zu untergraben, auch wenn sich die Angelegenheit monatelang hinzog. Es folgte eine Reihe von Fällen, die einige Beachtung fanden und Svritsky zu Richards profitabelstem Mandanten machten.
Dieser Erfolg stellte sich für Richard als zweischneidiges Schwert heraus, denn er fand Svritsky sowohl körperlich als auch seiner zwielichtigen Geschäfte wegen mehr als abstoßend. Er begann sich zu fragen, warum das organisierte Verbrechen oftmals so glorifiziert und in Filmen und Büchern als geradezu nobel dargestellt wurde, da die Männer angeblich noch wussten, was Treue und Mut waren. Die Realität sah ganz anders aus.
Trotz seiner Vorbehalte hatte es Richard anfangs amüsiert, bei Essenseinladungen wie nebenbei den Namen seines Mandanten fallen zu lassen und so die gesetzten Mittelschichtpaare aus seinem Bekanntenkreis aufzuschrecken. Eine Weile hatte er sie mit schockierenden Geschichten aus der Unterwelt unterhalten. Doch diese Gelegenheiten ergaben sich nicht allzu oft und wogen kaum die vielen Stunden auf, die er damit verbrachte, neben seinem Mandanten zu sitzen und dessen schmierige Boshaftigkeit ertragen zu müssen. Manchmal hatte er sogar das Bedürfnis, sich nach einem solchen Treffen zu duschen, seinen feuchten Nacken zu waschen und seine Haare mit heißem Wasser zu übergießen. Er hatte die unaufhörliche Selbstdarstellung des Russen satt, und gleichzeitig langweilte sie ihn fast tödlich.
Als er drei Tage zuvor die neue Anklage gelesen hatte, waren ihm die Anschuldigungen mehr als vertraut vorgekommen. Während er die Zeugenaussagen überflog, konnte er sich das bevorstehende Kreuzverhör vorstellen, die wiederholten Einsprüche, die Vorwürfe der Täuschung und all die anderen üblichen Possen vor Gericht. Sobald er die Akte zusammengeklappt hatte, beschlich ihn das Gefühl, die Verhandlung wäre bereits vorüber. Er hatte keine Lust mehr, sich mit den Einzelheiten dieses Falls auseinanderzusetzen, widersprüchliche Aussagen zu hinterfragen und sich auf die Schwächen der Anklage zu stürzen.
Hinter den langweiligen Aktenseiten lauerte jedoch auch seine versteckte Angst, was eine Niederlage für ihn bedeuten könnte. Svritsky erwartete Erfolg, und allein die Vorstellung zu verlieren ließ Richards Herzschlag ansteigen. Einmal hatte er versucht, sich zu weigern, einen Fall zu übernehmen. Doch die zornigen Augen seines Mandanten hatten ihn schnell eines Besseren belehrt.
Svritskys kaum unterdrückte Aggression hinsichtlich Du Toit machte Richard nervös. Ursprünglich hatte er es für taktisch geschickt gehalten, seinen Mandanten zu der Besprechung mitzubringen. Er wollte seine Gegnerin verunsichern, wenn nicht sogar einschüchtern. Doch als er jetzt beobachtete, wie sich Svritskys Körper einem Ringkämpfer gleich anspannte, als würde er jeden Augenblick losschlagen, fragte er sich, ob diese Strategie nicht doch etwas kühn gewesen war. Er legte seine Hand auf den Arm des Russen. Dieser fuhr jedoch ungerührt fort, Du Toit anzustarren.
Die Staatsanwältin ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Sie ignorierte den wütend schnaubenden Mann und wandte sich an Richard. »Mr Calloway, ich möchte Ihren Mandanten nicht sehen«, wies sie ihn zurecht. »Um genau zu sein - eigentlich möchte ich auch Sie nicht sehen. Doch da Sie mich um einen Termin gebeten haben, werde ich Ihnen den Gefallen tun und mir anhören, was Sie mir zu sagen haben. Aber ich habe nicht viel Zeit, ja?«
Du Toit hatte kurz geschnittenes Haar mit Strähnen vor den Ohren. Sie trug fast keinen Schmuck und war unauffällig in unifarbenen Hosen und locker sitzenden Blazern gekleidet. Ihr Gesicht war schmal und spitz, und ihre Stimme klang schrill und raspelnd. Dennoch wirkte ihre Körpersprache auffallend selbstbewusst. Ihre Gegenwart machte Richard stets ein wenig nervös. Oft kam er sich wie ein gescholtenes Kind vor, obwohl sie in Wahrheit genauso alt war wie er. Um nicht unsicher zu wirken, rief er sich die Tatsache ins Gedächtnis, dass er ihre juristischen Angriffe wiederholt erfolgreich abgewehrt hatte. Doch mit jeder neuen Herausforderung, jedem neuen Fall, wurde das unangenehme Gefühl stärker, dass ihre hartnäckige Verfolgung seines Mandanten eines Tages doch noch Früchte tragen würde.
Dieses Mal lautete die Anklage auf fahrlässige Tötung. Angeblich hatte Svritsky kurz nach Neujahr hinter dem Steuer eines Ford V8 Coupés gesessen und einen jungen Mann beim Überqueren einer fast menschenleeren Straße in der Nähe des Stadtzentrums überfahren und getötet. Die Staatsanwaltschaft behauptete, der Russe habe angehalten und sei ausgestiegen. Nachdem er festgestellt habe, dass der Mann tot war, sei er vom Unfallort geflohen. Die Sachlage wurde noch durch die Tatsache verschlimmert, dass der Unfall weder der Polizei gemeldet noch ein Krankenwagen gerufen worden war. Stattdessen sei Svritsky - so die Staatsanwaltschaft - am Morgen nach dem Unfall zur Polizei gegangen und habe den Wagen dort als gestohlen gemeldet.
Die Anklage war ungewöhnlich. Sie hatte nichts mit den üblichen geschäftlichen Machenschaften seines Mandanten zu tun, weshalb der Russe das Ganze auch nicht ernst zu nehmen schien. Doch Richard war auf der Hut. Gerade weil es sich um fahrlässige Tötung und nicht um vorsätzlichen Mord handelte, konnte es sich als ein schwieriger und damit gefährlicher Fall herausstellen.
»Cerissa«, sagte er jetzt und zwang sich dazu, herzlich zu klingen. »Ich weiß, dass bereits Februar ist, aber ich möchte dennoch nicht versäumen, Ihnen noch ein gutes neues Jahr zu wünschen. Hoffen wir, dass es für uns alle glücklich verläuft.«
»Mr Calloway, versuchen Sie es bloß nicht auf diese Tour. Wir wissen beide nur allzu genau, dass ein gutes Jahr für mich nur ein schlechtes für Sie und Ihren Mandanten bedeuten kann. Also bitte keine Schmeicheleien. Ihr Mandant soll draußen warten, und Sie können mit mir in mein Büro kommen - auch wenn ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann, was Sie damit erreichen wollen.« Sie drehte sich auf dem Absatz um und eilte in ihr Zimmer. Die Tür ließ sie offen stehen, damit Richard ihr folgen konnte.
»Ein wenig empfindlich heute, die Gute«, meinte er leichthin.
Der Russe kochte vor Zorn. »Ich werde ihr das Herz ausreißen und es ihr unter die hässliche Nase halten. Diese Schlampe!«
Richard zuckte zusammen. Svritsky spannte den Kiefer so stark an, dass er bebte. Auch die Tätowierung auf seinem Arm fing zu zittern an. Die Schlange und die nackte Frau schienen lasziv miteinander zu tanzen.
»Beruhigen Sie sich, Stefan. Sie markiert nur die Harte. Das ist ihr Job. Vielleicht war es doch keine so gute Idee, Sie heute mitzunehmen. Lassen Sie mich mit ihr reden, und wir treffen uns dann draußen. Rauchen Sie eine Zigarette. Ich berichte Ihnen, was sie gesagt hat.«
Svritsky würdigte ihn keines Blickes, gab aber nach. Mit großen Schritten ging er den Korridor entlang zur Treppe. Seine Tennisschuhe quietschten auf dem gebohnerten Boden, und er murmelte etwas vor sich hin. Richard blickte dem breiten Rücken seines Mandanten mit einer Mischung aus Abscheu und Furcht hinterher. Dann betrat er das Büro.
Du Toits Arbeitsplatz war bis oben hin vollgestellt. Sie saß hinter ihrem zerkratzten Schreibtisch und zog gerade einen Packen Unterlagen aus einem braunen Umschlag. Richard war schon oft hier gewesen, aber trotzdem überraschte es ihn immer wieder, wie karg und ärmlich das Büro der Leiterin der Generalstaatsanwaltschaft ausgestattet war. Akten und Urteilsregister stapelten sich auf Schreibtisch und Boden, und die jeweiligen Inhalte quollen wie Eingeweide aus einem aufgeschlitzten Bauch hervor. Es gab weder Aktenschränke noch Regale, um das Chaos zu bändigen. Er fragte sich, wie sie ohne Registrator und Assistent den Überblick behielt.
Ein winziger Bereich des Schreibtisches war von Unterlagen frei geblieben, um in der Nähe der Wand einen fleckig braunen Wasserkessel und einen Becher unterzubringen. Richard las die Schrift auf dem Becher - »Deine Probleme sind nicht meine« - und schnitt innerlich eine Grimasse. Pulverkaffeegranulat vermischt mit Wasser bildete um den Fuß des Bechers eine klebrig braune Pfütze. Die Fenster aus Aluminium blickten auf einige graue Gebäude hinaus, während die Zimmerwände bis auf wenige eingerissene und verblichene Behördenposter von traurigen Kindern und Frauen mit misshandelten Handgelenken kahl waren. Richard vermochte sich nicht vorzustellen, wie man an einem solchen Ort arbeiten konnte, und doch besaß diese eindringliche Echtheit auch etwas Faszinierendes.
Er dachte an die Räume seiner eigenen Kanzlei, die sich in einem neu renovierten Gebäude in De Waterkant befand. Die offene Bauweise des Hauses nutzte das Tageslicht durch mehrere geschickt konzipierte Portale, ohne dabei Hitze oder grelle Sonnenstrahlen hereinzulassen. Das Dach war in ein Sonnendeck samt Schirmen, Ruhesesseln und einer Bar aus dunklem Holz umgebaut worden. Von dort oben hatte man einen herrlichen Blick auf ganz Kapstadt - vom Fuß des Signal Hill über das Stadtbecken bis hin zum Hafen und der funkelnden Bucht vor Robben Island. Die Büroeinrichtung mit ihren Couchtischen aus Glas und Chrom, den Ledersofas, den breiten Konferenztischen und den Stühlen mit hohen Lehnen wirkte funktional und einladend. Eiswürfel klirrten in Wasserkrügen, in denen Zweige frischer Minze schwammen.
Die Innenarchitektin, mit einer der Firmenpartner verheiratet, hatte die hellen Räume durch zurückhaltend farbenfrohe Kunstwerke noch freundlicher gestaltet. Im Foyer wurde der Besucher von einer Reihe von Leinwänden begrüßt, deren Struktur an Baumrinden erinnerte. Die Naturthematik wurde außerdem durch einen kleinen japanischen Garten und einen Bonsai auf jedem Couchtisch fortgesetzt, während Palmfarne und Bambus bis ins Dachgeschoss mit seinen Holzträgern hinaufreichten. Einer der Partner hatte einmal vorgeschlagen, in der Kanzlei eine Taubenfamilie frei fliegen zu lassen. Aber die Vorstellung, ihren Klienten die Verträge mit Vogelexkrementen präsentieren zu müssen, hatte die anfängliche Begeisterung der Kollegen im Keim erstickt.
Jetzt sehnte sich Richard fast nach seinem Büro. Er malte sich aus, wie er mit einem Schokoladen-Biscotto den Milchschaum seines Cappuccinos auftunkte. Nomphula, die geschäftige Tea Lady, legte ihm immer einen Keks auf seine Untertasse, obwohl die Kekse eigentlich den Klienten vorbehalten waren, die im Foyer auf ihre teuren Beratungsgespräche warteten. Der Büroleiter setzte auf »kleine Aufmerksamkeiten und tiefe Dekolletés«, wie er das nannte, um von dem schwindelerregenden Stundensatz der Seniorpartner abzulenken. Der Ausschnitt der Empfangsdame war tatsächlich atemberaubend.
Doch trotz dieser hübschen kleinen Details besaß der schmuddelige Raum der Staatsanwältin mehr Leidenschaft und Charakter als Richards vornehme Kanzlei. Die wenigen Hilfsmittel unterstrichen für ihn nur noch ihre Entschlossenheit, ihren Einsatz - und seine fehlende Begeisterung für seinen Beruf. Du Toit bedurfte keiner Effekthascherei, da war er sich sicher. Sie musste zu gesellschaftlichen Anlässen keine amüsanten Geschichten erzählen. Er konnte sie sich nicht einmal als Gastgeberin vorstellen. Sie besaß weder die Leichtigkeit noch die Verlogenheit für solche Dinge. Abends im Bett, wenn sie mit ihren müden Gedanken allein war, wusste sie jedoch, was sie erreicht hatte. So abgedroschen es auch sein mochte - Richard verspürte auf einmal einen nagenden Zweifel an seinem Erfolg, seinen Mandanten bisher immer wieder frei bekommen zu haben. Geld und eitle Genugtuung reichten ihm plötzlich nicht mehr.
»Mr Calloway.« Du Toit kam gleich zur Sache. »Wenn Sie mit Ihrem Mandanten noch mal unangekündigt hier auftauchen, werde ich Sie der Anwaltskammer melden. Sie wissen genau, dass Sie mir sein Kommen verschwiegen haben. Ich habe Ihnen keine Genehmigung erteilt.«
»Tut mir leid«, erwiderte er ein wenig zu widerstandslos, wie er fand. »Ich habe wohl vergessen, Sie rechtzeitig darüber zu informieren. Verzeihen Sie. Er raucht jetzt draußen eine Zigarette.«
Richard ärgerte sich über seine eigene Taktik. Er hatte die Staatsanwältin damit keineswegs eingeschüchtert, sondern nur gegen sich aufgebracht. Das Ekzem in seinen Kniekehlen fühlte sich trocken an und juckte. Er sehnte sich danach, die Salbe, die ihm der Dermatologe verschrieben hatte, aufzutragen, um die Reizung zu lindern.
Du Toit schnaubte und zog ein zerknittertes Päckchen Zigaretten aus der Jackentasche. Sie öffnete das Schiebefenster und runzelte die Stirn, als eine staubige Brise ins Zimmer wehte. Das Plastikfeuerzeug wirkte billig, erzeugte aber eine große blaue Flamme. Sie zog an der Zigarette und blies den Rauch in den warmen Wind hinaus. Richard ekelte sich auf einmal vor dem Qualm, der über ihre Haut und ihre Haare strich, als er ins Zimmer zurückgeweht wurde. Er stellte sich den rauchig beißenden Geruch ihres Körpers am Ende eines Tages vor.
»Nicht mal im eigenen Büro darf man heutzutage noch rauchen«, meinte sie wehmütig und ein wenig weicher.
Richard nutzte die Gelegenheit und trat näher an den Tisch heran. »Cerissa, hören Sie«, sagte er. »Will die Generalstaatsanwaltschaft diesen Fall wirklich verfolgen?« Er versuchte, seine Stimme zu senken, um ernster zu klingen. »Ich habe mir die Unterlagen und Zeugenaussagen genau angesehen, und meiner Meinung nach liegt für eine Anklage überhaupt nicht genug vor … Natürlich nur, soweit ich das beurteilen kann«, fügte er hinzu, als er sah, wie sich ihre Miene verfinsterte. »Diese Zeugenaussage … Die Aussage des einzigen Zeugen … Meiner Ansicht nach ist sie völlig unbrauchbar. Daraus lässt sich keine Anklage machen. Sie ist nicht einmal richtig unterschrieben. Wir wissen doch alle, dass es sich um einen falschen Namen handelt, und außerdem erfahren wir kaum etwas darüber, was der Zeuge gesehen haben will.« Er merkte, dass er zu weit gegangen war, und hielt inne, um auf ihre Reaktion zu warten.
»Stimmt. Wir wissen, dass es sich um einen falschen Namen handelt«, erwiderte Du Toit kühl. »Das macht aber die Aussage noch lange nicht falsch, Mr Calloway.«
»Verzeihen Sie, soll das heißen, dass Sie diesen Zeugen tatsächlich aufgetrieben haben? Haben Sie mit ihm persönlich gesprochen?«
»Nein, das soll es nicht heißen. Ich will damit sagen, dass Ihnen eines bestimmt nicht entgangen wäre, wenn Sie die Akten tatsächlich so genau angesehen hätten, wie Sie behaupten: Wir haben einen Zeugen, der beobachtet hat, dass Ihr Mandant wenige Minuten vor dem Unfall vor seinem Club in das betreffende Fahrzeug gestiegen ist. Und wir haben einen weiteren Zeugen, der am Unfallort selbst war und gesehen hat, wie jemand, dessen Beschreibung eindeutig auf Ihren Mandanten zutrifft, aus seinem Wagen gestiegen ist und den sterbenden Fußgänger kurz in Augenschein genommen hat. Das klingt in meinen Ohren nach einem klaren Fall. Wenn Sie also wirklich die Unterlagen gelesen hätten, Mr Calloway, dann würden Sie das wissen. Also - was wollen Sie mir eigentlich sagen?«
Richard errötete und wechselte dann die Taktik, indem er seiner Stimme einen festeren Ausdruck verlieh. »Ms du Toit, solange Sie diesen angeblichen zweiten Zeugen nicht auftreiben, identifizieren und uns seine konkrete Aussage vorlegen, werde ich beantragen, das Verfahren einzustellen. Mit Verlaub, aber man kann nicht von mir verlangen, einen Mann zu verteidigen, dem fahrlässige Tötung vorgeworfen wird, wenn der wichtigste Augenzeuge nicht identifiziert ist und nichts weiter ausgesagt hat, als dass er gesehen haben will, wie der Wagen das Unfallopfer überfahren hat. Ich glaube nicht, dass mich der Richter dazu zwingen würde, unter diesen Umständen weiterzumachen. Bestimmt nicht.«
»Das ist also die Version, die Ihnen Ihr Mandant aufgetischt hat, Mr Calloway?« Du Toit verschränkte die Arme, die Zigarette noch immer zwischen den Fingern. »Dass er nicht dort war? Dass er nicht hinterm Steuer saß? Dass er keine Fahrerflucht begangen hat?«
Sie hatte Stefan Svritsky lange genug verfolgt, um zu wissen, dass dies stets die Schwachstelle der Verteidigung war: Svritsky verteidigte sich vor Gericht mit keinem einzigen Wort. Richard riet ihm immer das Gleiche. Er durfte kein Geständnis, keine Aussage und keine Erklärung abgeben. Die Staatsanwaltschaft musste somit alles selbst beweisen, angefangen mit den banalsten Fakten bis hin zu den wesentlichen Punkten der Anklage. Das bedeutete aber auch, dass Richard aufgrund dieser Taktik nie in der Lage war, der Staatsanwaltschaft eine eigene Version des jeweiligen Vorfalls zu liefern. Er konnte weder strafmildernde Umstände geltend machen oder Einspruch erheben noch dem Gericht irgendwelche Hinweise hinsichtlich der jeweiligen Anklage geben.
Mit dieser Strategie war Svritsky bisher immer gut gefahren, hatte aber seinen Anwalt gleichzeitig in eine undankbare Position gebracht. Eigentlich war Richard von Natur aus entgegenkommend. Er genoss Fälle, bei denen er Teil eines Teams sein und mit mehreren Kollegen zusammenarbeiten konnte, um sich etwa mit Auseinandersetzungen zwischen Laien zu beschäftigen, die das Gesetz nicht kannten und rechtlichen Beistand brauchten. Zugegebenermaßen war diese Art der Beratung vielleicht etwas patriarchalisch, aber er schätzte es, wenn jemand von einer solchen Gemeinschaftsarbeit ebenso wie von seiner fachlichen Expertise profitierte.
Doch bei Svritsky kam das nicht in Frage. Richard sah sich dazu gezwungen, in die Rolle des schwierigen, abwehrenden Strafverteidigers zu schlüpfen, der die Staatsanwaltschaft ständig in Zugzwang brachte.
»Cerissa, Sie kennen Svritsky. Ich kann Ihnen die Angelegenheit nicht aus seiner Sicht schildern.«
»Dann haben wir uns nichts weiter zu sagen, Mr Calloway. Auf Wiedersehen.« Sie wandte sich von ihm ab, um ihre Zigarette auf der äußeren Fensterbank auszudrücken und sie dann treffsicher in den Abfalleimer zu werfen. Richard nickte. Da er nichts mehr hinzuzufügen hatte, verließ er ihr Büro.
Auch wenn die flüchtige Zusammenkunft auf den ersten Blick fruchtlos geblieben war, wussten doch sowohl Du Toit als auch Richard, dass er sein eigentliches Ziel erreicht hatte: Die Staatsanwältin hatte zugegeben, dass der Augenzeuge des Unfalls noch nicht ausfindig gemacht worden war und wohl auch in nächster Zeit nicht gefunden werden würde. Sie wussten zudem beide, dass die Anklage ohne diesen Zeugen sehr dürftig ausfiel. Es gab die Aussagen der Polizisten vor Ort, des Pathologen, der die Leiche obduziert hatte, und eines Kriminalinspektors, der ein paar hundert Meter entfernt das Nummernschild des Unfallwagens entdeckt hatte. Offensichtlich hatte es sich bei dem Aufprall gelockert und war dann abgefallen. Es war gerichtsmedizinisch belegt worden, dass das Blut auf dem Nummernschild mit dem des Verstorbenen identisch war. Außerdem gab es Aufnahmen des entstellten Leichnams, und den Unterlagen der Kfz-Zulassungsstelle zufolge gehörte das Nummernschild zu dem grünen Ford und somit zu Svritskys Flotte von Geschäftsfahrzeugen. Das reichte zwar für einen Indizienprozess gegen den Wagen aus, nicht aber, um Stefan Svritsky selbst vor Gericht zu bringen.
Um den Russen anzuklagen, musste die Staatsanwaltschaft ihren Fall auf eine hastig hingekritzelte Aussage aufbauen, die vor Ort von einem jungen Polizeibeamten aufgenommen und mit einem unleserlichen Gekrakel unterschrieben worden war. Der Zeuge wurde als »Samora Machel« aufgelistet und hatte als Adresse »Maputo Street, Kapstadt« angegeben. Beide Angaben stellten sich als falsch heraus, und es war allein der miserablen Allgemeinbildung des Polizisten zu verdanken, dass er das nicht sofort bemerkte.
Die kaum lesbare Aussage ließ vermuten, dass der Zeuge den Unfall mit dem auffallenden Coupé mit angesehen hatte und den Fahrer wiedererkennen würde. Obwohl genaue Einzelheiten fehlten, traf die Beschreibung erschreckend genau auf Svritsky zu. Die Staatsanwaltschaft erwartete, dass der Zeuge, wenn er erst einmal gefunden war, Svritsky bei einer Gegenüberstellung problemlos identifizieren würde.
Richard vermutete allerdings, dass der Mann ausgesprochen schwer aufzuspüren sein würde. Falls man ihn aber doch ausfindig machte, wäre er wohl kaum bereit, seine Aussage vor Gericht zu wiederholen.
Mit diesen neuen Informationen trat Richard gequält lächelnd zu seinem Mandanten. »Ich habe gute Nachrichten, Stefan. Die Staatsanwaltschaft konnte den Zeugen bisher nicht finden. Sie will zwar trotzdem Anklage erheben, aber ohne den Mann hat sie nichts in der Hand. Außerdem bin ich mir ziemlich sicher, dass Du Toit nur blufft. Vermutlich wird sie einen außergerichtlichen Vergleich vorschlagen. Wenn wir ihr zu verstehen geben, dass sie sich das sonst wo hinstecken kann, wird sie ganz schnell den Schwanz einziehen.« Richard neigte in Svritskys Gegenwart zu einer roheren Umgangssprache, auch wenn ihm diese Tatsache missfiel. »Sie wird die Anklage bestimmt fallen lassen. Die Frau hat keine Beweise, ihr bleibt gar keine andere Wahl.«
Svritsky strich sich mit der feisten Hand imaginäre Haare aus dem Gesicht. »Bis dahin muss ich Sie aber trotzdem bezahlen, oder?«, sagte er mürrisch und reichte Richard wie zum Beweis einen Umschlag mit Geld. »Verflucht, dieser ganze Scheiß kostet mich jeden Tag mehr. Ich sollte dieser Tante einfach zeigen, wer hier das Sagen hat. Dann hab ich endlich meine Ruhe. Ohne diesen ganzen Mist. Warum belästigt man mich ständig mit dieser Kacke, die Sie nicht in den Griff bekommen? Können Sie mir das mal verraten?«
Richard hatte schon vor langem gelernt, dass es besser war, auf Fragen, die der Russe derart herausfordernd mit erhobenem Kinn und zornigem Blick stellte, keine Antwort zu geben.
»Und dann dieser kleine Scheißer … Er hat mein Auto kaputt gemacht«, fuhr der Russe fort, der sich allmählich in die Rolle des Empörten hineinredete. »Ich mochte dieses Auto. Es war zwar alt, aber der V8-Motor war noch verdammt gut. Richtig geschnurrt hat er … Ein schöner Wagen. Ich bin gern mit ihm gefahren. Und dann läuft mir dieser Bursche vor die Räder. Taucht plötzlich aus dem Nichts auf … vor meinen schönen Wagen und … Knall!« Svritsky schlug die beiden Handballen aufeinander. »Jetzt kann ich ihn natürlich verschrotten, als wäre er ein Stück Müll … Noch mehr Scheiße … Und nun behaupten die, das alles wäre meine Schuld gewesen!« Er schüttelte empört den Kopf und warf die brennende Zigarette in den Rinnstein.
Richard hob die Hand, um seinen Mandanten zu beruhigen. Aber Svritsky kam jetzt erst so richtig in Fahrt. »Ich hatte nur ein paar Gläser im Club, mehr nicht. Dann bin ich still und leise nach Hause gefahren. Jedenfalls war das der Plan. Verstehen Sie? Allein. Plötzlich springt mir dieser Junge vor die Windschutzscheibe. Als ob er absichtlich mit mir zusammenstoßen wollte. So was von Scheiße! Sie hätten mal die Kühlerhaube sehen sollen. Ich hatte gerade viel Geld dafür gezahlt, sie frisch lackieren zu lassen. Ein kleines Vermögen hat mich das gekostet. Und jetzt die ganzen Kratzer und Dellen und die kaputte Windschutzscheibe. Dann auch noch das Dach, ganz verschmiert … Echte Scheiße. Ich hab noch gehofft, dass man das vielleicht noch mal reparieren kann, aber dann fiel mir auf: Das Nummernschild war weg. Also mussten wir den ganzen Wagen loswerden. Das hat mir fast das Herz gebrochen, ehrlich. Den ganzen Wagen! Wegen irgendeines Idioten, der nicht aufpassen konnte, wohin er läuft. Das bricht mir echt das Herz. Dieser ganze Scheiß. Ständig dieser Scheiß.«
Richard murmelte etwas Unverständliches. Er überlegte, wie er an die Sache herangehen sollte, ohne gegen sein Berufsethos zu verstoßen. Zu wissen, dass sein Mandant tatsächlich hinter dem Steuer des Wagens gesessen hatte und wahrscheinlich zur Zeit des Unfalls betrunken gewesen war und dass er obendrein fälschlich behauptet hatte, sein Auto wäre gestohlen worden, stellte keine unüberwindlichen Probleme dar - vorausgesetzt, er machte vor Gericht keine bewusste Falschaussage. Er würde jede Zeugenaussage in Frage stellen müssen, ohne selbst eine Version des Vorfalls liefern zu können. Er würde die Verhandlung in kleine, voneinander getrennte Einzelteile zerlegen müssen, die in keinerlei Verbindung mehr zueinander stehen durften. Wenn die Staatsanwaltschaft die Details schließlich wieder zusammenbringen wollte, würde nur noch eine bruchstückhafte, unzusammenhängende Kette von Ereignissen vorhanden sein. Er musste den Fall durch hartnäckiges Hinterfragen der Hauptbelastungszeugen gewinnen und sicherstellen, dass er die kleinsten Unstimmigkeiten aufgriff, bis schließlich die ganze Anklage in sich zusammenfiel.
Das war keine Vorgehensweise, die er genoss, und sie kam ihm weit entfernt vom eigentlichen Sinn eines Gerichts und den Gesetzen vor. Er seufzte ergeben, während er sich den dicken Umschlag mit Geldscheinen in die Jackentasche schob. Seine Kniekehlen juckten unerträglich.
In diesem Moment vibrierte das Handy in seiner Brusttasche. Eine neue SMS war eingetroffen - eine Mitteilung seiner Frau Amanda. Er blieb im Schatten einer verkrüppelten Platane stehen und las die ausführliche Nachricht. Amanda teilte ihm mit, dass sie an diesem Abend ein Treffen mit ihrem Lesezirkel habe. Raine müsse unbedingt rechtzeitig im Bett sein, sein Essen sei im Kühlschrank, und die Hunde müssten noch gefüttert werden.
Richard merkte, wie er gereizt wurde. Die Mitteilung kam ihm wie ein Eindringen in seine exklusive Geschäftswelt vor, als würde sein Status als Ernährer durch unbedeutende häusliche Anweisungen in Frage gestellt. Die Nachricht seiner Frau legte nahe, dass er eine Anleitung brauchte, um sich angemessen um die Bedürfnisse seiner Familie zu kümmern. Oder vielleicht hatte Amanda auch einfach nichts Besseres zu tun, als derartige Belehrungen in ihr Handy zu tippen?
Während er durch die Nachricht scrollte, stieg ihm ein unangenehmer Geruch in die Nase. Er steckte das Handy ein und warf einen Blick auf den Fuß des Baumstammes. Unter den leeren Chipstüten und den Zigarettenstummeln entdeckte er ein halb eingetrocknetes menschliches Exkrement, nur Zentimeter von seinem Fuß entfernt. »Igitt«, murmelte er und trat aus dem Schatten des Baumes zurück ins Sonnenlicht. Er blickte sich um, als ob er erwartete, den Schuldigen noch zu entdecken, wie er hastig die Hose hochzog und davonlief. Ein alter Bergie saß auf einer niedrigen Mauer, die Arme wie welker Seetang über seine Knie hängend. Er riss den Mund auf, als wollte er gähnen, und entblößte eine Reihe angebrochener Zähne.
Richard wartete nicht darauf, was der Mann sagen wollte, sondern eilte hastig Svritsky hinterher, um dem Geruch zu entkommen, der ihn zu verfolgen schien.
Die Voranhörung fand zwei Tage später vor dem Landgericht statt. Die Vorsitzende Richterin, Mrs Shirley Abrahams, war eine Frau mittleren Alters und galt als erfahrene Strafjuristin, die einige der wichtigsten und schwersten Fälle vor dem Landgericht verhandelt hatte. Sie stellte hohe Anforderungen und weigerte sich, dieselbe Laxheit an den Tag zu legen, was die Prozessformalitäten betraf, wie das einige ihrer Kollegen taten. Zudem war sie dafür bekannt, Verbrechen nicht auf die leichte Schulter zu nehmen und gleichzeitig unabhängig und objektiv zu sein. Einige Jahre zuvor, als sie noch für das Amtsgericht tätig gewesen war, hatte sie bereits einmal einer Kautionsanhörung vorgesessen, als Svritsky wegen versuchten Mordes angeklagt worden war. Wie Richard erwartet hatte, erwähnte sie diese Anhörung gleich als Erstes.
»Mr Calloway«, sagte sie. »Wie Sie sicher wissen, ist Ihr Mandant für mich kein unbeschriebenes Blatt. Ich habe vor einiger Zeit einmal eine Kautionsanhörung im Amtsgericht geleitet. Gerichtsentscheidung 1043/06. Hält mich Ihr Mandant für befangen, oder hat er nichts dagegen einzuwenden, wenn ich auch dieser Angelegenheit vorsitze?«
»Nein, Euer Ehren. Danke der Nachfrage. Ich habe bereits vorsorglich mit meinem Mandanten gesprochen, und wir sind beide mehr als einverstanden, dass Sie dieser Verhandlung vorsitzen.«
Abrahams nickte. »Gut. Ehe wir fortfahren, wollten Sie mir noch etwas mitteilen, wenn ich richtig informiert bin?«
Richard schob seine Papiere zusammen. »Ja, das möchte ich, Euer Ehren.«
Er warf einen Blick auf seinen Gegner. Die Generalstaatsanwaltschaft hatte den Fall einem vergleichsweise jungen Anwalt namens Bradley Dumbela übertragen. Dumbela hatte in kürzester Zeit die Karriereleiter des Landgerichts erklommen, da er mit seinen genauen Fallvorbereitungen, seinen Umgangsformen vor Gericht und seiner Effizienz meist einen sehr guten Eindruck hinterließ. Er war ein schlanker, gepflegter junger Mann und stets makellos gekleidet. Es kam niemals vor, dass er sich seines schwarzen Sakkos entledigte, und er hatte nur eine kleine Auswahl an Krawatten, die er vor Gericht trug. Jetzt beobachtete er Richard aufmerksam, den offenen Füller über einem weißen Blatt Papier gezückt.
»Ja, Euer Ehren«, sagte Richard noch einmal und blickte zum Richterstuhl. Er hielt einen Moment lang inne, um sich zu sammeln. Sobald er glaubte, konzentriert genug zu sein, fuhr er fort: »Wir befürchten, dass sich mein Mandant weder angemessen auf diesen Gerichtstermin noch auf das bevorstehende Verfahren vorbereiten konnte und sich somit im Nachteil befindet. Wir wissen nämlich nicht, wer der Mann ist, den die Staatsanwaltschaft als ihren Augenzeugen bezeichnet, noch haben wir eine Ahnung, wie dessen Aussage genau aussehen wird. Euer Ehren, wenn ich Ihnen eine Kopie dieser Aufzeichnungen hier geben dürfte, dann werden Euer Ehren mit eigenen Augen sehen, was ich meine …«
»Nein, Mr Calloway«, unterbrach ihn die Richterin scharf. »Sie dürfen mir zu diesem Zeitpunkt weder Aufzeichnungen noch Aussagen oder sonstige Beweisstücke überreichen. Die eigentliche Verhandlung hat noch nicht begonnen. Die Staatsanwaltschaft ist noch Herr des Verfahrens und kann entscheiden, welche Beweise sie vorlegt und welche nicht. Wenn die Staatsanwaltschaft also einen Zeugen aufrufen möchte, der zuvor nicht identifiziert worden ist oder dessen Aussage Ihrer Meinung nach ungenügend ist, können Sie zum gegebenen Zeitpunkt dagegen Einspruch erheben. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, möchten Sie die Fortsetzung des Verfahrens verhindern. Aus welchen Gründen? Könnte es nicht sein, dass sich die Staatsanwaltschaft im Laufe der Verhandlung doch noch gegen diesen Zeugen beziehungsweise seine Aussage entscheidet? Dann wäre Ihr Problem gelöst. Oder sehen Sie das anders, Mr Calloway?«
»Nun, Euer Ehren - ja und nein«, erwiderte Richard. »Wenn die Staatsanwaltschaft den Zeugen letztendlich nicht in den Zeugenstand ruft, dann hat sich die Sache erledigt. Aber wenn sie sich doch dazu entschließt und Euer Ehren unseren Einspruch ablehnen? Dann würde die Basis, auf der wir diese Verhandlung führen - nämlich dass ein Aufrufen des Zeugen unfair wäre -, untergraben, was meinem Mandanten natürlich zu großem Nachteil gereichen könnte. Und das ist ein Nachteil, den wir von vornherein haben und nicht erst, wenn sich die Staatsanwaltschaft entscheidet, den Zeugen aufzurufen.« Richard hatte das Gefühl, dass er sein Argument gut formuliert hatte. Doch Richterin Abrahams schüttelte den Kopf.
»Mr Calloway, wollen Sie damit etwa andeuten, ehe wir in dieser Angelegenheit auch nur einen ersten Schritt unternommen haben, dass ich höchstwahrscheinlich zu einem bestimmten Zeitpunkt eine unfaire Entscheidung treffen werde, weshalb die Verhandlung vorsichtshalber besser gar nicht erst stattfinden sollte?«
Richard wurde blass. Seine Argumentation kam ihm auf einmal wackelig vor. Er wollte gerade etwas erwidern, als die Richterin fortfuhr.
»Tatsächlich behaupten Sie Folgendes«, erklärte sie mit einem kalten Lächeln auf den Lippen. »Wenn ich zu irgendeinem Zeitpunkt der Verhandlung ein unfaires Urteil fälle, würde das Ihrem Mandanten zum Nachteil gereichen, weshalb das Verfahren am besten überhaupt nicht erst stattfinden sollte. Wenn ich diese Argumentationsweise akzeptieren würde, dann käme es nie zu irgendeiner Gerichtsverhandlung, Mr Calloway. Das sollten Sie doch wissen.«
»Mit Verlaub, Euer Ehren«, erwiderte er im Bemühen, die Streitfrage zu seinen Gunsten zu entscheiden, »mein Mandant hat das im Grundgesetz verankerte Recht zu erfahren, welche Beweise gegen ihn vorliegen, was auch im Fall Der Staat gegen Mentoor bestätigt wurde. Das Verhalten der Staatsanwaltschaft leistet diesem Recht in keiner Weise Genüge.«
»Gerade Sie, Mr Calloway, sollten die Bedeutung des Mentoor-Falles nicht überschätzen. Nach Mentoor ist Ihr Mandant zwar dazu berechtigt, die Beweise einzusehen, die der Staat gegen ihn zusammengetragen hat, aber er kann keinerlei Einspruch erheben, wenn diese Beweise nicht eindeutig sind oder nicht auszureichen scheinen. Eigentlich sollte er sich sogar freuen, wenn die Staatsanwaltschaft nur schwache Beweise gegen ihn in der Hand hat. Wenn er allerdings der Ansicht ist, das Aufrufen eines Zeugen sei für ihn überraschend oder dass die Beweisführung der Staatsanwaltschaft zu seinem Nachteil gereicht, weil er sich eines bestimmten Beweises nicht bewusst war, dann wäre es meiner Meinung nach am geschicktesten, zu dem Zeitpunkt Einspruch zu erheben, wenn dieser Beweis vorgelegt wird. Zum jetzigen Zeitpunkt hingegen sehe ich keinerlei Veranlassung, einen solchen Einspruch anzuerkennen, Mr Calloway. Ihr Antrag - wenn es denn einer gewesen sein soll - wird hiermit abgelehnt.«
»Wie es Euer Ehren für richtig halten«, murmelte Richard und ließ sich auf seinen Stuhl fallen. Die letzte Bemerkung der Richterin kam ihm unnötig vor. Er drehte sich zu Svritsky um, der hinter ihm auf der Anklagebank saß. Die Pupillen des Russen hatten sich bedrohlich verdunkelt.
Hinter ihm befand sich der zuständige Polizeibeamte, Captain Riedwaan Faizal. Er hatte die Arme verschränkt und verzog die Lippen zu einem kaum merklichen Lächeln. Faizals Image als harter Cop ließ es selten zu, dass er Emotionen zeigte - von aggressiven Wutanfällen einmal abgesehen. Er und Richard hatten sich lange nicht gesehen, doch ihre gegenseitige Abneigung war in dieser Zeit nicht kleiner geworden.
»Mr Dumbela, die Anklage, bitte.«
Richterin Abrahams klickte erwartungsvoll mit ihrem Kuli. Richard erhob sich wieder und klopfte dabei gegen die Anklagebank, um Svritsky zu bedeuten, ebenfalls aufzustehen. Der Russe hievte sich schwerfällig hoch, wobei er theatralisch seufzte. Richterin Abrahams blickte auf und starrte ihn aus schmalen Augen kritisch an.
Dumbela las die Anklage wegen fahrlässiger Tötung vor.
»Bekennt sich Ihr Mandant schuldig oder nicht schuldig, Mr Calloway?«, fragte die Richterin.
»Nicht schuldig, Euer Ehren. Kein Vergleich und keine Schuldanerkenntnis nach Paragraf 220.«
»Mh … nicht weiter überraschend. Können Sie das bestätigen, Mr Svritsky?« Abrahams gehörte zu den wenigen ihres Amtes, die noch darauf bestanden, dass der Beschuldigte für das Protokoll versicherte, sein Anwalt habe das Bekenntnis richtig vorgetragen. Sie sprach seinen Namen so korrekt aus, als ob sie eine Weile geübt hätte. »Für das Protokoll, Mr Svritsky. Bitte noch einmal schön laut und deutlich«, fügte sie hinzu, als spräche sie mit einem Kind.
»Ja«, knurrte er. »Das stimmt so.«
»Sehr gut«, erwiderte sie etwas freundlicher und wandte ihre Aufmerksamkeit wieder Richard zu. »Die Verhandlung wird auf den fünften März festgesetzt, also in drei Wochen. Mr Dumbela, ich hoffe, dass Sie bis dahin Ihre Zeugen beisammen haben, bereit zur Aussage. Mr Calloway, ich bewillige grundsätzlich keinen Aufschub, wie Sie inzwischen wissen sollten, sondern erwarte, dass Sie dann ebenfalls so weit sind. Lassen Sie uns versuchen, diesen Fall in einer Sitzung abzuschließen, ja?« Sie wartete die Antwort nicht ab, sondern erhob sich, sobald sie die letzten Worte gesprochen hatte, und ging zu der Tür, die zu ihrem Amtszimmer führte.
»Die Anwesenden mögen sich erheben«, rief der Gerichtsdiener verspätet und versuchte, sich aus dem kaputten Stuhl hochzukämpfen, auf dem er sich den Vormittag über gefläzt hatte.
Nachdem die Richterin verschwunden war, trat Richard zu Dumbela. Der Staatsanwalt rückte gerade seinen exakt geschlungenen Krawattenknoten zurecht. »Bradley, wir wissen beide, dass Sie mit Ihrem Augenzeugen nicht weit kommen werden. Was tut sich in dieser Hinsicht?«
Ein schmales Lächeln zeigte sich auf Dumbelas Lippen. »Mr Calloway, ich habe bereits mit Ms du Toit gesprochen. Sie hat mir erzählt, dass Sie bei ihr waren.« Er hielt inne, als würde ihm erst jetzt die ganze Tragweite dieser Handlung bewusst. »Machen Sie sich keine Sorgen. Wir werden ihn finden. Wir haben einige gute Anhaltspunkte, die uns sicher weiterhelfen. Der Zeuge ist zwar vom Unfallort verschwunden, nachdem er mit dem Polizisten, der seine Aussage zu Protokoll nahm, gesprochen hatte. Aber ich bin mir sicher, dass wir ihn bald wieder haben werden. Uns liegen einige gute Anhaltspunkte vor«, betonte er noch einmal. »Sie können also ganz beruhigt sein, Mr Calloway.«
Dumbelas gespielte Höflichkeit klang höhnisch. Er schien auf Richard herabzublicken. Vielleicht ein unausgesprochener Rassismus, dachte Richard und sah Dumbela hinterher, der den Gerichtssaal verließ.
»Und? Was hat er gesagt?«, wollte Svritsky von hinten wissen.
»Er meint, sie würden den Zeugen auftreiben.« Richard stieg ein ranziger Geruch in die Nase, und er wich einen Schritt zurück. »Er scheint sich seiner Sache sehr sicher zu sein«, fügte er gedankenverloren hinzu.
»Wirklich? Das werden wir ja sehen«, erwiderte der Russe. Seine hellen Augen funkelten im kalten Licht des Gerichtssaals.
2
Ifasen konnte den köchelnden Pfeffersuppeneintopf bereits riechen, noch ehe er die Tür erreicht hatte - das typische süß-säuerliche Aroma des obe ata, gekocht aus reifen Tomaten, Paprikaschoten, rotem Palmöl und einem billigen Stück Hammel oder Ziege, falls man es sich gerade leisten konnte. Der Duft verscheuchte den Gestank von Urin und Zigarettenrauch, der den Hausgang durchzog. Heute Abend würden sie den Eintopf auf ihre Teller geben, die Sauce in den dampfenden Reis einziehen lassen und sich das Ganze dann in kleinen Stückchen in den Mund schieben. Ihre Finger und Münder würden dabei rot wie von Lippenstift werden.
Der Duft ließ in Ifasen Bilder aus der Kindheit aufsteigen. Er sah Abeni vor sich, das Hausmädchen seiner Eltern, wie sie in der Küche Okra schnitt, mit flinken Fingern gesprenkelte Bohnen schälte und ihn wegscheuchte, wenn er versuchte, eine der abgekühlten Paprikaschoten zu stibitzen. Sie kochte stets mit weit geöffneter Hoftür, so dass eine kühle Brise in die Küche wehte, während sie vor einem Tisch stand und die durchsichtigen Bohnenhäute nach draußen zu den wartenden Hennen schnippte. Manchmal landete eine solche Haut auf dem Rücken einer Henne, und sie mussten beide lachen, wenn sie beobachteten, wie die anderen danach pickten und so das Tier dazu brachten, panisch durch den Hof zu rennen. »Siehst du, mein Kleiner«, hatte sie ihm einmal voller Zuneigung erklärt, »in Nigeria ist es nicht immer gut, etwas zu haben, was alle haben wollen.«
Abeni war eine schwergliedrige Yoruba-Frau gewesen, mit kräftigen Beinen und einem weichen Bauch. Ihr breites Gesicht schien immer von einem Lächeln zerknittert zu werden - fast so, als bestünde das Leben aus einem ständigen Kitzeln. Wenn sie einmal die Stirn runzelte, dann geschah das nur in freundlichem Spott, indem sie für einen Moment ein langes Gesicht zog, um es sogleich wieder in einem schallenden Lachen aufzulösen. Das Leben mit Abeni stellte eine Reihe wunderbarer Mahlzeiten dar. Sie kochte Ifasen seinen geliebten adalu, einen gelben Maisbrei mit Bohnen, bedeckt mit Pfeffersuppe. Fürsorglich stellte sie stets eine Kanne mit Wasser, Zitronenscheiben und Eis neben seinen Teller, falls er sich an dem Pfeffer verschluckte. Zwischendurch versorgte sie ihn mit kleinen chin-chin, Schottischen Eiern und schmackhaften Fleischpasteten.
Ehe er an seinem Geburtstag erwachte, bereitete sie bereits moyin für ihn vor. Sie mahlte die Bohnen zu einem Brei und mischte ihn mit Tomaten, Paprika, dünnen Fleischstücken, verschiedenem anderem Gemüse, Ei und Gewürzen, bevor sie alles, in eine Folie gewickelt, langsam dünstete. Wenn Ifasen erwachte, erfüllte der herrliche Duft schon das große Haus. Seine Geschenke mussten warten. Er gab sich die größte Mühe, seine Aufregung zu beherrschen, um als Erstes ein Stück seines Geburtstagsfrühstücks zu sich zu nehmen, zusammen mit einem frisch gepressten Obstsaft. Seine Familie schüttelte über seinen großen Appetit stets lachend den Kopf, während sich Abeni im Hintergrund hielt und ihn lächelnd beobachtete, die Arme stolz vor der Brust verschränkt.
Ifasen sehnte sich nach der Schlichtheit eines vertrauten Geschmacks und nach den regelmäßigen Mahlzeiten, die sein Leben zu Hause bestimmt hatten. Die Erinnerungen an seine Kindheit schaukelten wie aufgehängte Wäsche vor seinem inneren Auge hin und her, jedes Stück durch einen Geschmack oder einen Duft in seinem Gedächtnis festgezurrt. Manchmal vermutete er, dass seine Familie allein durch Abenis Kochkünste zusammengehalten wurde und alles bereits viel früher zerbrochen wäre, hätte es sie nicht gegeben.
Er wünschte sich, seinem eigenen Sohn eine solch kulinarische Erfahrung mit auf den Weg geben zu können. Doch in einem fremden Land war es schwierig, die richtigen Zutaten zu finden. Es gab keine Yamswurzel für ikokore oder iyan, keinen Maniok für gari, keine Kolanüsse zum Kauen, keine oro-Samen für ogbono-Suppe, ja nicht einmal richtige Kochbananen für dodo oder im Ganzen geröstet als bole. Zum Trinken gab es keinen Vanille-zobo, keinen Palmwein, kein Selbstgebrautes. Hier gab es nur Bier mit vielen verschiedenen Etiketten, aber immer demselben wässrigen Geschmack. In den südafrikanischen Restaurants wurden ausländische Gerichte serviert: Pasta, Pizza, Curry oder scharf mariniertes Hühnchen, dessen Haut durch die Gewürze orangefarben war. In den Geschäften konnte man vakuumverpacktes Essen aus langen Kühlregalen nehmen, zwischen denen einsame Menschen ihre Einkaufswagen aus Metall hin und her schoben.
Ifasen sehnte sich danach, seine Hände in einen Rupfensack voller Trockenbohnen zu tauchen, braunen Reis über seine Finger in eine Papiertüte rieseln zu lassen und dabei die Rufe und das Gelächter der Händler zu hören. Manchmal hatte er das Gefühl, dass dieses Fegefeuer, in dem er wartete und das er nicht verlassen konnte, in Wahrheit gar nicht mehr in Afrika war.
Er öffnete die Wohnungstür und blieb einen Moment lang auf der Schwelle stehen. Sehnsüchtig blickte er sich in der vollgestopften Wohnung um und sog gierig den Duft der Pfeffersuppe in sich auf. Seine Füße schmerzten von einem langen Tag
1. Auflage
Copyright © 2009 by Andrew Brown und Zebra Press,
Random House Struik (Pty) Ltd
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2010 by btb Verlag in der Verlagsgruppe
Random House GmbH, München
eISBN : 978-3-641-04733-7
www.btb-verlag.de
Leseprobe
www.randomhouse.de