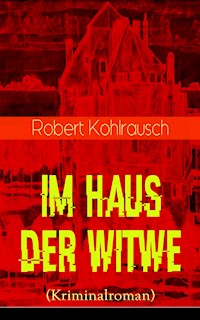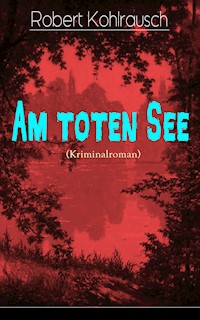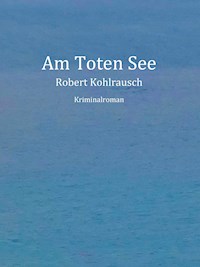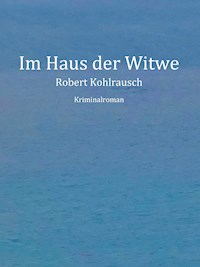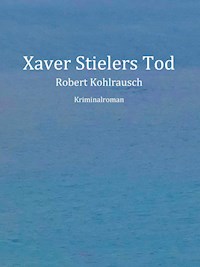
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
... »Na, da bin ich neugierig, was bei der Geschichte herauskommt. Ich neige mich vorläufig zu der Diagnose von Doktor Glaritz, der auf Schlaganfall schließt. Solch ein Giftmord auf offener Bühne, - die Geschichte sieht mir doch etwas allzu theatralisch aus. Aber wir wollen jedenfalls nichts versäumen. Schießen Sie los und berichten Sie mir, was Ihre Recherchen ergeben haben. Los, - wer nicht anfängt, wird auch nicht fertig.« ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 273
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Xaver Stielers Tod
Xaver Stielers TodErstes KapitelZweites KapitelDrittes KapitelViertes KapitelFünftes KapitelSechstes KapitelSiebentes KapitelAchtes KapitelNeuntes KapitelZehntes KapitelElftes KapitelZwölftes KapitelDreizehntes KapitelVierzehntes KapitelFünfzehntes KapitelSechzehntes KapitelImpressumXaver Stielers Tod
Robert Kohlrausch
Kriminalroman
Erstes Kapitel
Eine Flut von Licht, ein Vielklang von Farben breitete sich über den schönen Platz. Mit weißem Leuchten stand auf hohem, vielstufigem Unterbau das Museumsgebäude. Rein und blau wölbte sich der Himmel über seinem statuengeschmückten, von ionischen Säulen getragenen Giebel. In weichem Grün lag eine Rasenfläche zu Füßen des hellen Bauwerks, drei schlanke Pappeln standen vor einem ferneren Baumhintergrund auf jeder Seite von ihm in den schlank nach oben weisenden Formen der südlich-klassischen Zypresse, während ihr Laub vom deutschen Herbst in blankes Gold verwandelt worden war.
Auf dem Stufenunterbau vor den Säulen war ein Gedränge von bunten Theaterkostümen, fremdartig-seltsam im vollen Tageslicht. Ein Herrscher in antiker Gewandung saß dort, von einem goldgesäumten Purpurmantel umwallt, auf goldenem Thron; Krieger, Diener, Beamte scharten sich um ihn her. Gerade vor ihm stand eine Frauengestalt mit einem Gesicht von geheimnisvoller, bösartiger Schönheit, ihr Haar fiel gleich einem schwarzen Schleier über ihr schillernd vielfarbiges, gleich einer blanken Schlangenhaut sie umkleidendes Gewand. Sie sah nicht auf den Herrscher, ihr Blick und ihre Hand wiesen hinunter nach einer kreisrunden Brunnenumfassung, die sich aus dem grünen Rasen erhob.
Es war die Kinoprobe für eine »Salome«-Vorstellung, die den Ort mit all den bunten, ungewohnten Gestalten bevölkerte. Ringsum aber hatte sich ein großes, neugieriges Publikum versammelt; obwohl der Platz von der Polizei gesperrt worden war, hatten doch viele Bevorzugte Zutritt erhalten, und so gesellten sich den antiken Gestalten die Menschen des gegenwärtigen Jahrhunderts. Da schimmerten sommerlich helle Damenkleider, dem schönen Oktobertag zu Ehren einmal noch hervorgeholt, rote, blaue, grüne Sonnenschirme fügten in das wechselnde Gemisch matterer Töne kraftvolle Farbenflecke, das Metall an den Uniformen der Schutzleute blitzte hell auf im grellen Sonnenlicht. Es war ein Bild von starkem, sonderbarem Reiz, ein leise bewegtes Meer von Glanz und Farbe.
Der abgesperrte Platz war groß genug, dass die Zugelassenen sich frei bewegen, sich in Gruppen zwanglos unterhalten konnten. Gerade gegenüber von der ins Tageslicht herausversetzten Bühne stand eine Gruppe von vier Personen. Drei davon waren jung – zwei der Damen und ein Herr – die dritte Dame war der Mitte des Lebens bereits nahe. Das war eine sehr starke Dame mit rundem, rotem Gesichte, deren Atem hörbar kam und ging. Sie hatte den unbewegten Ausdruck sehr phlegmatischer Menschen und sprach nur, wenn es nicht anders ging. Zuweilen brachte sie die langstielige Lorgnette mit müder Bewegung an die Augen, um irgendetwas besser sehen zu können, doch sank ihr die Hand immer bald wieder herab.
Neben ihr stand ihre Tochter, das Gegenspiel ihrer schweren Langsamkeit. Zierlich, pikant, mit einem neugierig-klugen Kindergesichtchen, war sie stets in Bewegung. Ihr Mund wenigstens ruhte kaum einen Augenblick. Sie redete lebhaft ein auf den Herrn, der seine schlanke, feingegliederte Gestalt ein wenig niederbeugen musste bei der Unterhaltung mit dem kleinen Persönchen. Dabei trat sein weich und vornehm gemeißeltes Profil schön hervor. Den leicht geöffneten Mund unter kleinem, braunem Schnurrbart umspielte beständig ein halb spöttisches, halb fröhliches Lächeln. Manche der Damen auf dem Platze suchte mit ihren Blicken diese harmonisch, mit lässiger Eleganz bewegte Gestalt. Auch in der Nähe waren ein paar Augen, die von dem bunten Bilde ringsum stets wieder heimkehrten zu diesem Anblick. Sie gehörten der dritten Dame der kleinen Gruppe. Sie war auffallend groß, beinahe so groß wie der schlanke Herr selbst, ihm auch verwandt an vollendetem Ebenmaß der Körperbildung. Aber auf ihren Lippen wohnte kein Lächeln. Beinahe düster war das Gesicht mit seinen tiefschwarzen Augen, deren Farbe sich von der einer schweren Haarlast über der schön gemeißelten Stirn allein durch den stärkeren Glanz unterschied. Selten leuchteten sie plötzlich auf, und immer nur über irgendein heiteres Wort von den Lippen des Herrn; dann aber war in ihnen das Feuer einer glühenden Seele.
Die kleine Liselotte, bewegliche Tochter der unbeweglichen Frau Kommerzienrat Hell, schwatzte ununterbrochen. »Großartig ist sie doch, diese Baratta. Sieht sie nicht aus, als wenn die Salome von Stuck lebendig geworden wäre? Das Bild kennen Sie doch, Graf? Ach, Stuck ist süß! Ich habe sein Selbstbildnis über meinem Schreibtisch hängen. Das ist noch ein Mann! Ich ginge gern einmal nach München, allein um ihn zu sehen. Der müsste die Baratta malen. Kennen Sie den Film: ›Verbrechen aus Liebe‹? Ach, darin ist sie wunder-, wundervoll! Und was diese Filmpersonen für Geld verdienen! Jetzt ist sie nach Petersburg engagiert für eine Aufnahme von dem Film ›Katharina die Große‹. Das heute hier ist nur eine Arrangierprobe, wie das genannt wird. Erst wenn die Baratta zurück ist, wird wirklich gefilmt. Haben Sie das mit Petersburg nicht gelesen? Dafür allein bekommt sie dreißigtausend Rubel, denken Sie nur!«
»Ich denke, wir streichen eine Null davon«, sagte Graf Hersberg mit seinem weichen, ein wenig trägen Lächeln.
»Aber nein«, rief Liselotte, die kecke Stumpfnase hoch in die Luft reckend. »Ich weiß es diesmal ganz, ganz, ganz bestimmt. Eine Tante von unserer Köchin ist Cousine von einer Waschfrau beim Direktor vom Edenfilm, – die hat es gesagt.«
»Eine Waschfrau? Dann bin ich geschlagen.«
»Sehen Sie, Graf, sehen Sie hin: Da kommt Johannes aus dem Brunnen heraus.«
»Ach, das geht mir zu langsam.«
»Wieso zu langsam?«
»Das müsste gehen wie bei den Spielschachteln, aus denen die kleinen Teufel herausspringen, wenn man sie aufmacht. Immer wieder mit ›Perlippe – perlappe‹, wie der geistvolle Zauberspruch heißt.«
»Sie müssten einmal solch eine Vorstellung dirigieren, Graf, da würden schöne Dinge herauskommen.«
»Ist mir selbst sehr wahrscheinlich. Aber wissen Sie, was mir am allerbesten gefällt am Kino?«
»Was denn, was denn?«
»Dass die Leute nicht reden dürfen.«
»Graf, ich glaube –«
»Nicht einmal die Damen. In schönen Träumen kommt mir manchmal der Gedanke, dass dies nur der Anfang von einer großen Reform der menschlichen Gesellschaft ist.«
»Graf, Sie sind schrecklich!«
»Dabei kann ich nichts machen. Das wäre gegen meine Naturgeschichte. Bedenken Sie doch: der tolle Graf, der unverbesserliche Leichtsinn, der Nagel zu seinem Sarge, wie mein hochwürdiger Vater mich mit Vorliebe tituliert, – wie soll der sich auf einmal ändern?«
»Malen Sie sich nicht schwärzer als nötig.« Es war das erste Mal, dass die hochgewachsene Dame das Wort nahm. Sie sprach mit einer wundervoll tiefen Stimme, deren Klang weichen Orgeltönen verwandt war.
Graf Hersberg wandte sich nach ihr hin. Er änderte auch dabei nichts an seiner vornehmen Lässigkeit, aber in seine braunen Augen kam ein besonderes Licht, indem sie den beiden tiefschwarzen begegneten. Seine Lippen öffneten sich zum Reden, doch fuhr Liselotte mit einem Aufschrei dazwischen. Den Arm der Dame, zu der Hersberg hatte sprechen wollen, mit einer Hand fest umklammernd, machte sie mit ihrem Kopf eine lebhaft deutende Bewegung nach einer bestimmten Richtung hin.
»Ach, Hanna, Hanna, sieh doch nur. Da kommt er, da kommt er!«
»Ja, wer denn?« Ein leichtes Lächeln, das über Hannas ruhiges Gesicht ging, schien es von innen her zu erleuchten.
»Aber so frag doch nicht. Es gibt ja doch jetzt nur den Einen in unserer Stadt. Solch einen süßen, süßen, himmlischen Menschen? Von wem soll ich denn so sprechen als von Xaver Stieler?«
»Ach, der«, antwortete Hanna mit einer etwas gekünstelten Gleichgültigkeit, wobei sie die Blicke nicht abwandte vom Gesichte des Grafen Hersberg. Verständnisvoll vertiefte sich sein Lächeln.
»Ja, der! Mein Gott, wie kann man von solch einem Menschen in solch einem Tone reden! Mutter, so sieh doch hin, – da kommt er ja, da kommt Xaver Stieler.«
»Ja, Kind.« Ganz langsam hatte die starke Frau sich ein wenig zur Seite gewandt und hob die Lorgnette, wie wenn sie zu schwer in ihrer Hand wäre.
»Siehst du ihn denn auch wirklich, Mutter?«
»Ja, Kind.«
»Wie sein grauer Anzug ihm steht! Herr Gott, ist es ein himmlischer Mensch! Diese süßen, süßen blauen Augen. Und welche Vornehmheit in der Haltung. Mutter, das musst du, musst du, musst du doch auch finden.«
»Ja, Kind.«
»Wisst ihr, was Henny Brausewetter gesagt hat? Dieser Stieler wäre in Wirklichkeit ein Graf. Stieler wäre nur sein Theatername. Gott, wenn ich das glauben könnte! Wissen Sie nichts darüber, Graf?«
»Ich halte die Sache nicht für ganz unglaublich.«
»Ach sprechen Sie doch nicht so grässlich diplomatisch, auch außer Dienst. Ich rede mit Ihnen frei von der Leber weg, tun Sie das doch auch. Ja, Henny Brausewetter behauptet steif und fest, er wäre ein Graf. Das wäre ja kolossal romantisch: ein Graf als erster Variété-Künstler der Welt. Und heimlich verheiratet soll er auch sein. Aber ganz, ganz heimlich. Nicht einmal zusammen wohnen soll er mit seiner Frau.«
»Das klingt mir wieder nicht so ganz unglaublich. Ein verheirateter Künstler hat für die Theaterkasse nur den halben Wert. Jede liebebedürftige Zuschauerin im Hause muss denken können: Der süße Junge kann mein werden.«
»Wenn ich nur herausbringen könnte, wer diese heimliche Frau von ihm ist. Eine Göttin müsste sie sein, wenn ich ihr den gönnen sollte. Sie kommen doch auch ins Theater heute, Graf? Es ist ja schon sein drittletztes Auftreten, – das drittletzte für immer. Ist es menschenmöglich, dass ein solcher Künstler sich von der Bühne zurückzieht auf der Höhe seines Erfolges? Glauben Sie daran, Graf?«
»Sie müssten einmal Ihre Waschfrau fragen.«
»Ach, Sie sind scheußlich und bleiben scheußlich. Nein, ein Mensch, der sechzigtausend Mark in einem einzigen Monat an Gage bezieht, muss ja doch toll sein, wenn er das aufgibt. Er kann freilich nur ein paar Monate im Jahre arbeiten, – sie nennen das nämlich arbeiten beim Theater, das weiß ich, – weil die Sache so kolossal anstrengend ist. Er vereinigt in seiner einzigen Person ja das ganze Programm einer Variété-Bühne. Kunstschütze, Kraftmensch, Zauberkünstler, Kunstreiter, Jongleur –«
»Jonglieren kann ich auch. Sehen Sie her, – glauben Sie, dass ich daraufhin engagiert werde, wenn ich meinen Diplomatenfrack ausziehe?«
Graf Hersberg ballte mit ein paar seiner lässigen Bewegungen jeden von seinen Handschuhen in einen kleinen Ball zusammen und begann mit ihnen und seinem Spazierstock sehr geschickt zu jonglieren.
»Aber, Graf!« Es war die tiefe, warme Stimme Hannas, die sein Spiel unterbrach.
Er endete damit sofort und sah mit gerötetem, lachendem Gesichte nach ihr hin. »Heißt auf deutsch: Lieber Stefan, Sie betragen sich unpassend. Ich bekenne mich schuldig, meine verehrte Mentorin, und sage nur wie die Kinder: ›Ich will es nicht wieder tun‹.«
Liselotte ließ Hanna keine Zeit für eine Antwort. »Er kommt hierher, er kommt hier vorüber. Mutter, du versperrst mir die Aussicht. Ich muss ihn ganz, ganz genau sehen.«
Die vier Menschen waren es keineswegs allein, die mit neugierigen Blicken auf Stieler schauten. Seit er auf dem Platz erschienen war, hatte die »Salome«-Probe nur noch die Hälfte von ihrer Anziehungskraft. Langsam, von vielen gegrüßt, ging er durch die locker verteilten Gruppen dahin und kam wirklich, wie Liselotte vorhergesehen hatte, ganz dicht an der ihren vorüber. Das aber hatte sie nicht erwartet, was nun geschah. Sobald er den Grafen Hersberg und Hanna bemerkte, zog er den Hut und grüßte mit einer gewinnend-vornehmen, der des Grafen selbst ähnlichen Liebenswürdigkeit. Er hatte wohl Stefans Jongleurkünste gesehen; ein freundliches Lächeln lag auf seinem Gesichte. Liselotte nahm teil an der Gunst seines Grußes, indem sie mit einer Verbeugung antwortete, die fast ein Hofknicks war.
Sobald sich aber Stieler kaum außer Hörweite befand, fasste sie Hannas Arm und sagte mit einem heiseren Flüstern: »Ihr kennt ihn, ihr kennt ihn, diesen Göttermenschen, und sagt es mir nicht. Hanna, das kann ich dir nicht verzeihen bis an mein Lebensende.«
»Graf Hersberg hat ihn früher gut gekannt«, antwortete Hanna ganz ruhig, um sich dann mit einem Blick nach der natürlichen Bühne hin zu unterbrechen. »Aber was mag der Baratta fehlen?«
Dort oben war eine Stockung, eine Störung entstanden. Und es war seltsam: Während sich Hannas Augen auf die Heldin der Salome-Tragödie richteten, begegneten die Blicke der Verderberin dort oben diesen sie suchenden Augen, hafteten in ihnen, ließen sie nicht los. Einen Augenblick standen die beiden Frauen schweigend und schauten einander an über die Köpfe der Menschen hinweg. In Hannas Blicken war nur neugieriges Erstaunen, in denen der Baratta glimmte das Hassesfeuer der Salome.
Nun klang die harte, schneidende Stimme des Regisseurs über den Platz hinweg: »Baratta, Sie verpatzen ja die Scene. Was ist mit Ihnen los? Noch einmal von vorn.«
Gewaltsam nahm die Künstlerin sich zusammen. Ihre Lippen bewegten sich, doch wurden ihre Worte nicht verständlich. Dann begann sie die Scene noch einmal.
Viele der Zuschauer hatten sich neugierig weiter nach vorn gedrängt, unter ihnen auch Liselotte, die Mutter nach sich ziehend. Ein kleiner freier Raum war um Hanna und Stefan entstanden. Sie hatte die Blicke jetzt von der Baratta gelöst und sie dem Grafen zugewandt. Sobald sie sah, dass niemand mehr in ihrer Nähe war, sagte sie leise, mit behutsam bewegten Lippen: »Also heute Abend. Nicht vergessen. Um halb sieben Uhr.«
»Ich komme«, gab Stefan ebenso vorsichtig zurück.
Nun war auch Liselotte schon wieder da; langsam folgte die Kommerzienrätin ihr nach. »Was war da nur los?«, rief die Kleine. »Die Baratta war ja wie versteinert. Ob sie krank war? Aber wundervoll sah sie aus in dem Augenblick. Ach, jetzt ist sie abgegangen; sie macht sich gewiss zurecht für den Schleiertanz. Wo mag nur Stieler geblieben sein? Ach, man möchte sich in zwei Stücke schneiden, um jeden von diesen beiden wundervollen Menschen immerfort anschauen zu können. Den Tag muss ich rot anstreichen in meinem Kalender, an dem ich die beiden hier auf demselben Platze gesehen habe. Hat Euer Diener denn die Billetts für heute Abend schon besorgt, Hanna? Haben wir gute Plätze?«
»Sehr gute. In der Mittelloge, der Bühne gerade gegenüber. Es ist natürlich schon alles ausverkauft.«
»Aber natürlich, wo doch Stieler zum drittletztenmal auftritt. Wissen Sie, was meine Großtante gesagt hat, Graf, als ich sie beredet hatte, sich eine seiner Vorstellungen anzusehen? Es ist eine alte Frau von achtzig Jahren und sie geht sonst niemals mehr ins Theater. Sie hat gesagt, es wäre der schönste Abend ihres Lebens gewesen. Ach, er ist ja so wunderbar vornehm in allem, was er tut. Ich glaube wirklich, dass er ein Graf ist. Aber jetzt müssen wir aufpassen, jetzt kommt ja der Schleiertanz.«
Wirklich rüstete sich die Baratta zum großen Verführungstanz, dessen Preis ein Menschenleben war. Zuerst stand sie sekundenlang regungslos, ganz eingehüllt in dichte, weiße Gewebe, Kopf und Gesicht selbst umwunden, sodass nur die brennenden Augen dunkel daraus hervorleuchteten wie Blitze durch dichtes Gewölk. Dann begann sie sich langsam zu bewegen, wie gezogen von den Tönen einer gleichmäßigen, aufregenden Musik. Ihre Bewegungen wurden schneller, leidenschaftlicher, der herrliche, schlangengleich biegsame Körper neigte sich in wundervollen Windungen. Der erste der Schleier sank zu Boden gleich einer weißen leichten Wolke, bald folgte der zweite. Immer wilder wurde die Musik, immer wilder wurden die Bewegungen. Jetzt umhüllte nur noch einer der Schleier den Oberkörper, das weiche, rosenfarbige Fleisch leuchtete hindurch, das Fleisch dieses von Leidenschaft gepeitschten, von Vernichtungswut in rasendem Taumel fortgerissenen Frauenkörpers.
»Jetzt müssen kleine Mädchen sich umdrehen«, sagte Stefan gemächlich, sich zu Liselotte niederbeugend.
»Ach was. Warum denn? Das weiß ich doch so, wie wir Frauenzimmer aussehen. Wenn es ein Mann wäre, dann vielleicht.«
»Ich fürchte, dann würde das kleine Mädchen sich erst recht nicht umdrehen.«
»Sie könnten recht haben, Graf. Ich glaube, Sie sind ein Menschenkenner.«
»Wenn das Handwerk nur einträglicher wäre. Schulden kann man damit nicht bezahlen.«
»Sie haben Schulden, Graf? Ach, das ist ja riesig interessant.«
»Interessant vielleicht, aber wenig angenehm.« Er sprach lässig wie stets, das behagliche Lächeln blieb auch bei diesen Worten auf seinen Lippen.
Ein jubelnd ausbrechender Beifall unterbrach das Gespräch. Die Baratta hatte mit ihrem Schleiertanz das Publikum wie den Herodes besiegt.
Nun eilte die Probe rasch dem Ende zu. Johannes der Täufer war dem Tode verfallen, sein abgeschlagenes Haupt erschien auf der großen goldenen Schüssel in Salomes Händen. Unvergesslich blieb allen der Ausdruck steinernen Grausens in der Baratta Gesicht.
Jetzt war es vorüber. Ein buntes Gewimmel von fantastischen Gestalten strömte die Stufen herab, das Publikum zerstreute sich langsam, die Postenkette der Polizei löste sich auf. Nüchternmodern kam ein Auto herangerollt in die farbige Theaterwelt. Es hielt unten an der Treppe, die Baratta stieg herab und ging darauf zu. Doch bevor sie zur untersten Stufe gelangt war, blieb sie noch einmal stehen und ließ von ihrem erhöhten Platz aus die Blicke dahingehen über die sich allmählich zerstreuende Menge.
Sie blieb ruhen auf dem Gesichte Xaver Stielers, der noch dastand und hinüberschaute zu der flimmernden Salomegestalt. Ein anderer Ausdruck war jetzt in den Augen der Frau als zuvor bei der Begegnung mit Hannas Blicken. Etwas Weiches, Hingebendes war in sie hineingekommen.
Dies Duell der Augen dauerte ein paar Sekunden. Dann ging die Baratta schnell die letzten Stufen hinunter und bestieg das Auto, das gleich darauf eilig davonrollte. Stielers Brust hob sich mit einem unwilligen Seufzer. Langsam schlug er die Richtung ein, die der Wagen genommen hatte, jetzt schon weit entfernt von ihm in seiner blauen Benzinwolke dahinjagend.
Zweites Kapitel
Tief in Gedanken, den Kopf zur Erde gebeugt, ein paar müde Falten um den festgeschlossenen Mund, schritt Xaver Stieler dahin, so ganz unähnlich in seiner Haltung dem von der Menge vergötterten Künstler, dass manch einer stehen blieb und ihm verwundert nachschaute. Wo waren die Kraft, Elastizität, Beweglichkeit geblieben, die den Besitzer dieses ebenmäßig schönen Körpers berühmt gemacht hatten auf beiden Hälften der Erdkugel? Welche Gedankenlast lag so schwer auf seinem Haupte, dass unter ihr das gewohnte Siegerlächeln von seinen Lippen verschwunden war?
Ganz langsam, widerwillig ging er dahin. Einmal blieb er vor einer großen Anschlagtafel stehen, auf der in Riesenbuchstaben sein drittletztes Auftreten im Edentheater angekündigt wurde. Sein Bild prangte darüber, eindringliche Reklame sprach von ihm als erstem Universalkünstler der Welt, von dessen Leistungen die ganze zweite Hälfte des Programms ausgefüllt wurde. »Schwerer wird es mir doch, als ich gedacht hatte«, sagte Stieler leise vor sich hin. Dann aber hob er den Kopf, seine Gestalt straffte sich; jetzt erkannten die Vorübergehenden wieder in ihm den Mann unerreichter Kraft und Energie. Die »Carmen«-Melodie vor sich hinsummend: »Auf in den Kampf, Torero«, ging er in der wachsenden Dämmerung nun mit festen, raschen Schritten dahin. Das Pflaster klang unter seinem Fuß.
Er machte Halt in einer Straße mit gleichmäßigen Fronten von dicht aneinandergebauten Häusern ohne Vorgarten- oder Baumesgrün. Das Haus, an dem Stieler für einen Augenblick in die Höhe schaute, bevor er eintrat, war mit allerhand Ornament von Stuck beklebt, worunter ein grinsender Frauenkopf über jedem der Bogenfenster wiederkehrte. »Zur lachenden Maske« hatten die Nachbarn es darum getauft, ohne daran zu denken, wie sehr dieser Name für manche Bewohnerin dieses Hauses passte.
Mit neuerdings verdüstertem Gesichte stieg Stieler die schon hellerleuchtete, breite Treppe zu dem ersten Stockwerk hinan. Hier war an der Tür eine blanke Messingtafel, auf der in großen Buchstaben »Rosa d'Otranto« zu lesen war, darunter hielt ein Reißnagel eine gesucht kleine Visitenkarte fest, worauf »Afra Baratta« geschrieben stand. Stieler drückte den weißen Knopf der elektrischen Glocke, die mit ungewöhnlich starkem, tiefem Klang ertönte.
Gleich darauf ließen kurze, rasche Schritte sich drinnen vernehmen, und in der geöffneten Tür erschien Rosa d'Otranto in eigener, ältlicher Person mit einem zusammengeschrumpften Gesichte, das einem zu weit ins neue Jahr hinübergenommenen Apfel ähnlich war. Man sah es ihr nicht an, dass auch sie vor langer Zeit einmal vom Glanze der Variété-Bühne verklärt gewesen war. Aber sie hatte sich wirklich zehn Jahre lang, ihre damals mollig-hübschen Glieder in rosenfarbiges Tricot gekleidet und ein krampfhaftes Maskenlächeln wie hineingemeißelt im runden Gesichte, von einem Kunstschützen allabendlich Glaskugeln, Tonpfeifen und Brillantsterne vom Kopf und aus den Händen schießen lassen. Durch einen Unglücksfall Mutter geworden, hatte sie dieser Kunst Lebewohl sagen müssen, weil ihre Figur sich nicht mehr für das rosenfarbige Tricot eignete. Nach einem gescheiterten Versuch mit abgerichteten Schildkröten hatte die Not sie zur Entdeckung einer kleinen, angenehmen Stimme in ihrer Kehle geführt, und sie hatte sich tapfer von Café chantant zu Café chantant durchgesungen, bis ihre Tochter herangewachsen war. Die bildete nun, zur Abwechslung in blaues Tricot gekleidet, mit einer bunten Schar von dressierten Papageien und weißen Kakadus eine gesuchte Nummer der bunten Bretterwelt. Rosa d'Otranto selbst aber vermietete Zimmer an Größen des Variétés, neuerdings auch des Kinos und sonnte sich im Abglanz ihres Ruhmes. Aus ihrer eigenen Glanzzeit hatte sie nur den schön klingenden Künstlernamen gerettet; sie hieß in Wahrheit Josefine Fengefisch.
Die Vergangenheit der Besitzerin hatte den Räumen der Wohnung auch ihren Stempel aufgedrückt. Es gab da gleich beim Eintritt viel roten, unechten Samt mit breiten Goldfransen und viele Spiegel mit glatten, dicken Goldrahmen. Die waren über Marmortischchen mit künstlichen Rosensträußen in Alabastervasen einander gegenüber aufgehangen, sodass endlose Perspektiven von Rosensträußen entstanden. Blitzende Wandleuchter waren durch bogenförmig niederhängende Ketten von glitzernden Glasprismen miteinander verbunden. So wirkte der Korridor, breit und hell beleuchtet wie die Treppe, beinahe wie die Dekoration einer Variété-Bühne.
Rosa d'Otranto zwinkerte Stieler freundlich mit ihren matten Augen an. Durch das jahrelange Masken-Lächeln oder durch das Hineinstarren in elektrisches Licht hatte sie sich eine Schwäche der Gesichtsmuskeln zugezogen und zwinkerte beständig mit den Augen, wobei ganze Strahlenkränze von kleinen, scharfen Falten aufzuckten. Aber in dem verschrumpften Apfelgesicht war viel gutmütige Freundlichkeit, als die kleine Dame Stieler begrüßend bei der Hand nahm und ihm leise zuflüsterte: »Unser Barattchen ist heute wieder furchtbar schlechter Laune.«
»Nichts Neues in ihrem Repertoire«, sagte der Künstler, ihr weiteres Reden, wozu sie sehr bereit war, kurz abschneidend, und ging ohne Weiteres auf eine Tür zu, die mit roten Samtbehängen verziert war. Nach einem ganz kurzen Anklopfen trat er ein, ohne zu beachten, ob ein »Herein!« von drinnen ihn einlud.
Auch in diesem Zimmer war viel Rot, Gold und Glas, aber Afra Barattas Gestalt beherrschte den Raum so sehr, dass alles andere daneben verschwand. Noch im schlangenschillernden Kostüm der Salome lag sie langausgestreckt auf einem Diwan, den ein Tigerfell von ungewöhnlicher Größe bedeckte. Sie hatte die linke Hand unter den Kopf gelegt, in der rechten hielt sie eine Zigarette, die das Gemach schon mit einem weichen Dufte von türkischem Tabak erfüllt hatte. Das warmgoldene Licht einer großen elektrischen Hängelampe mit gelbseidenem Schleier fiel auf sie herab und streute glitzernden Schimmer auf ihr Kostüm.
Sobald Stieler eintrat, warf die Baratta die Zigarette rasch in ein Messingbecken auf einem runden Rauchtischchen und sprang empor mit einer aufschnellenden Bewegung, durch die sie berühmt war in leidenschaftlichen Kinoszenen.
»Endlich!«, sagte sie, mit ausgestreckten Händen ihm entgegengehend. Als er aber, ihre Begrüßung nicht beachtend, an ihr vorüber sah, verdüsterte sich ihr Gesicht, und ihre Hände sanken schwer herab. »Ich habe dich erwartet«, sagte sie mit einer dumpfen, von Leidenschaft rauen Stimme. »Heute, gestern, vorgestern. Ich habe gewartet und gehorcht, ob du nicht kämest. Aber es war vergeblich, immer vergeblich.«
»Es ist recht, ich hätte schon vorgestern kommen können und kommen sollen. Aber ich war feige.« Wie wenn er dem Zorn über sich selbst Ausdruck leihen müsste, stieß er einen Stuhl, den er für sich herbeigezogen hatte, fest auf den Boden. »Jawohl, ich war feige.«
»Wieso, – warum?«
»Weil ich mich vor dir fürchtete. Vor deinen Szenen. Vor einer Wiederholung alles dessen, was ich hundertfach, tausendfach durchgemacht habe mit dir, und was mich endlich dahin getrieben hat, jetzt ein Ende zu machen um jeden Preis.«
Mit einem dumpfen Schmerzenslaut sank sie, wie wenn die Knie sie nicht mehr trügen, auf den Diwan und krampfte die Finger in das Tigerfell. »Töte mich!«, schrie sie laut auf. »Töte mich wenigstens gleich, – martere mich nicht langsam zu Tode. Wenn du von mir gehst, wenn du mich wirklich verlässt, will ich und kann ich nicht mehr leben. Ohne dich ist mir das Dasein eine Qual. –«
»Schreib es dir selber zu, wenn es das ist«, fiel ihr Stieler mit einer lebhaft abwehrenden Bewegung seiner linken Hand ins Wort. »Ich tue das, was geschehen muss und geschehen wird, weil mir mein Dasein durch dich nun schon jahrelang zur Qual geworden ist. Ich habe dich geliebt, niemand weiß es besser als du, so toll und widerstandslos, wie nur ein Mensch überhaupt lieben kann. Aber du hast – –«
»Höre mich doch, Xaver. Ich liebe dich heute wie nur jemals in unserer glücklichsten Zeit. Stoß mich nicht von dir, verlass mich nicht – –«
»Lass uns ruhig und vernünftig miteinander sprechen. Ich kann sie nicht mehr ertragen, diese Theaterszenen. Sie sind es ja hauptsächlich, die mir das Leben an deiner Seite verleidet haben. Wenn ein Mensch dir jemals Beweise von seiner Liebe gegeben hat, bin ich es gewesen. Ich habe meinen Stand, meine Heimat, meine Familie, meine gesicherte Zukunft aufgegeben um deinetwillen. Ich habe den deutschen Standesherrn gegen den internationalen Variétékünstler vertauscht, nur um dich besitzen zu können. Mein Vater hat mich enterbt, weil ich dich geheiratet habe –«
»Ja, ja, ja, das weiß ich und habe dir dafür gedankt mit meiner ganzen wahnsinnigen Liebe.«
»Du hast recht, wenn du sie wahnsinnig nennst. Was dir Liebe heißt, ist ein wildes Feuer, in dem alles verbrennt: Vertrauen, Ruhe, Frieden und Glück. Ich schelte dich nicht, mache dir keine Vorwürfe. Du bist, wie du bist, kein ganzer Mensch kann gegen seine Natur. Aber neben dir leben kann und will ich nicht länger.«
Mit einer ihrer schnellenden Bewegungen fuhr sie herum, beugte den Kopf gegen ihn vor. »Wer ist es, die dich mir nimmt?« In ihren Worten war jetzt ein zischender Ton.
»Du selbst tust es, niemand sonst auf der Welt. Wir haben gute, glückliche Zeiten gehabt am Anfang unserer Ehe, doch waren sie leider nur allzu kurz durch deine Schuld. Unsere besten Stunden wurden mir schon damals getrübt von deiner wilden, wahnsinnigen Eifersucht. Ihr allein gib die Schuld an allem, was geschehen ist und geschieht. Auch der geduldigste Mensch erträgt nicht solche täglich sich wiederholende Qual.«
Sie hatte die Ellenbogen auf die Knie gestützt und ihren vorgeschobenen Kopf in die Hände gepresst. Ihre Lippen bewegten sich, als wenn sie lautlos redete; seine Worte klangen ungehört an ihrem Ohr vorüber.
Gleich einem schwirrenden Pfeil kam es jetzt von ihren Lippen: »Wer war die Dame, die du heute gegrüßt hast?«
»Wo? Welche Dame?«
»Verstell dich nicht. Auf dem Platz dort, bei der Salome-Probe.«
»Du gibst mir den Beweis für das, was ich gesagt habe, wenn ein Beweis noch nötig war. Aus jeder noch so harmlosen Begegnung –«
»Harmlos? Du meinst wohl, ich hätte die Dame nicht erkannt? Aber ich habe meine guten Augen, auf die kann ich mich verlassen. Es war die Dame, die vorige Woche bei dir war in deiner Wohnung. Der ich dort begegnet bin, die so verlegen und eilig war, weil ich sie bei dir überrascht hatte –«
»Und wenn sie es war –«
»Sie war es, – ich sage dir's ja, dass ich es weiß. Also war die heutige Begegnung nicht so harmlos, wie du behauptest: Nicht umsonst hat es mir einen Stich gegeben, dass ich meinte, laut aufschreien zu müssen, als ich sah, wie du sie dort grüßtest –«
»Also das war der Grund, weshalb du die Probe störtest. Fehlt es dir denn wirklich an jedem Gefühl dafür, wie grenzenlos lächerlich du dich machst?«
»Weiche mir nicht aus. Wer war es, ich will es wissen? Aber ich kann es jetzt auch erfahren ohne dich; seit heute weiß ich, wer es mir sagen kann. Und ich ginge gleich morgen, um zu hören, was ich wissen will, wenn ich nicht abreisen müsste nach Petersburg, – heute noch. Aber wenn ich wiederkomme, dann sei gewiss –«
»Dass du dich lächerlich machen wirst, wie du es heute tust und hundertmal vorher getan hast. Ich zweifle daran keinen Augenblick. Aber ich bitte dich, lass diese Dame aus dem Spiel. Sie will mir nur Gutes –«
»Gutes? Jawohl! Das Gute, das die Frauen den Männern tun, das die Frauen allein den Männern tun können, das will sie dir. O ja, das war endlich einmal ein wahres Wort von dir nach allen deinen Lügen.«
»Mach mich nicht wild. Ich lüge nicht, ich bin zum Lügen zu stolz. Und ich bin hergekommen, um dir die volle Wahrheit über meine Zukunftspläne zu sagen. Du hast immer noch nicht glauben wollen, dass ich wirklich und ernsthaft an den Abschied von der Bühne dachte, hast es für einen Reklame-Trick angesehen, der allerdings keineswegs den Reiz der Neuheit mehr hätte. Wie du selbst einmal vorgeschlagen hast, wir sollten der größeren Zugkraft wegen für unverheiratet gelten, demnach also auch keine gemeinsame Wohnung haben, so schien dir mein Plan von der gleichen Rücksicht eingegeben. Die Künstlereitelkeit und Leidenschaft für den Erfolg ist ja mitunter in dir sogar noch größer als die Eifersucht. Ich aber – du hast mich auch in diesem Punkte nie verstanden – habe die Künstlereitelkeit in solchem Sinne niemals gefühlt. Ich habe mein Leben aus Liebe zu dir auf einem neuen, eigenen Boden aufgebaut; nun du meine Liebe getötet hast, verliert auch dieser Bau seinen Zweck. Mein Leben soll sich wieder zurückwenden in die verlassene Bahn. Ich habe die Hoffnung, dass mein Vater sich mit mir versöhnt, und ich verlange von dir, dass du mir die volle Freiheit wiedergibst, – ich verlange von dir die Zustimmung zur Scheidung oder Trennung.«
»Das ist ja wunderhübsch alles ausgedacht und geordnet«, sagte die Baratta mit erzwungener Kälte. »Wunderhübsch! Nur eins fehlt noch in deiner Darstellung. Zufällig die Hauptsache. Der Grund nämlich, weshalb das alles geschehen soll, weshalb du wieder frei werden möchtest von mir. Aber ich kenne den Grund, habe diesen Grund heute lebendig mit Augen gesehen in Fleisch und Blut. Ein Weib ist es, dem ich Platz machen soll. Diese Dame, die bei dir war in deiner Wohnung, die du heute gegrüßt hast mit leuchtenden Augen.«
Sie war aufgestanden, während sie sprach, und langsam auf ihn zugekommen, bis jetzt auch in der Bewegung noch beherrscht und erzwungen ruhig. Aber nun packte die Leidenschaft sie gleich einem Wirbelsturm, in dem ihre Glieder zitterten wie gepeitscht. Ihre Stimme klang hoch und schrill, gleich zersplittertem Glas. »Du hast nur die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Ich gebe dich niemals frei, will nichts wissen von Scheidung oder Trennung. Und bevor ich es mit ansehe, dass dieses Weib an meine Stelle kommt, – verlass dich darauf, – ich töte vorher sie, dich und mich selbst!«
Sein Mund verzog sich mit einem Ausdruck bitteren Ekels. Er antwortete nicht, sondern ging ruhig nach einer Ecke des Raumes und nahm von einer dort stehenden Etagère eine kleine Schachtel. Die warf er mit verächtlicher Bewegung auf den Tisch neben dem Diwan und sagte: »Da, nimm eins von deinen berühmten Beruhigungspulvern. Die haben schon öfter geholfen, wenn du mit Selbstmord und Massenmord gedroht hast.«
»Ich will keine Beruhigung. Ich lebe nur in der Leidenschaft, in dieser einen, mein ganzes Wesen erfüllenden Leidenschaft für dich. Du sollst mein sein, und ich will nichts weiter auf der Welt. Selbst meine Kunst ist mir nichts im Vergleich zu dir. Wenn ich dich sehe, wenn ich deinen geliebten Körper fühle –«
Sie hatte seinen Arm erfasst, um ihn an sich zu ziehen, er aber schüttelte sie von sich ab mit einer heftigen Bewegung des Widerwillens. »Lass mich los. Das ist vorbei. Totes macht niemand wieder lebendig. Du hast getötet, was uns verband, nun trage die Folgen. Aber ich sehe, dass es unmöglich ist, vernünftig mit dir zu reden, ich werde mich von jetzt ab auf schriftlichen Verkehr beschränken. Ein Anwalt wird mir dabei behilflich sein. Leb wohl.«
»Xaver!« Es war ein Schrei haltloser Verzweiflung, womit sie jetzt an ihm vorüber zur Tür stürzte, beflügelt von ihrer Leidenschaft. Sie warf sich dort vor ihm auf die Knie, hob die Hände mit ineinander gekrampften Fingern flehend und beschwörend empor. In ihrem gleißenden Schlangengewande, vom dunklen Haar wie von einem zerrissenen, durchsichtigen Mantel umhüllt, Hals, Kopf und Hände funkelnd von schwerem, Blitze streuendem Geschmeide, war sie berauschend schön in diesem Augenblick, und auch ihre Stimme wurde weich und voll durch die Wärme des Gefühls. »Verlass mich nicht, geh nicht von mir fort. Sieh, du bist mir notwendig zum Leben wie Licht und Luft. Misshandle mich, schlag mich, tritt mich mit Füßen, aber verlass mich nicht. Ich will ja nur dich auf der Welt. Alle die Huldigungen, womit mich die Menschen überschütten, sind mir nichts gegen ein Wort von dir. –«
»Quäle mich nicht so bis aufs Blut. Ich habe dir nachgegeben, hundertmal, tausendmal, weil ich Frieden und Eintracht wollte, – du bist aber stets geblieben, die du warst. Jetzt ist es aus. Ich will und kann und mag nicht mehr. Ich habe nur einen Wunsch noch: still unter Menschen zu leben, die mich nicht quälen, in einem friedlichen, behaglichen Heim –«
Gleich einer zum Biss sich aufrichtenden Schlange schnellte sie bei seinen Worten empor. »Ein Heim, das diese Dame dir bereiten soll! Jetzt ist es klar, jetzt ist es heraus –«
»Weib, mache mich nicht rasend. Ein Engel an Geduld müsste toll werden durch dich. O, wenn ich doch nicht hergekommen wäre! Hier bei dir lebt alles wieder auf an Schmerz und Gram, was ich neben dir durchgemacht habe. So fest war mein Vorsatz, ruhig und gleichmütig zu bleiben, aber du machst es mir immer wieder unmöglich, zerrst an meinen Nerven, dass ich meine, sie reißen. Alles an mir zittert und bebt, und gerade jetzt vor meinem Auftreten, wofür ich immer die Kraft von zehn Menschen gebrauche. Wenn ich doch nicht hergekommen wäre zu dir!«
Er ging ein paarmal hin und her in heißer, zorniger Aufregung, zerrte mit seiner Hand am Hemdkragen, als wenn er ihn erstickte. Seine Frau stand einen Augenblick schweigend, starr auf ihn hinschauend; widerstreitende Gefühle schienen in ihr zu kämpfen. Dann kam ein Schluchzen aus ihrer Brust. »Werde mir nicht krank! Stirb mir nicht! Verlass mich nicht, Xaver!«
Stieler bewegte Kopf und Oberkörper hin und her in ärgerlicher Abwehr. »Lass die schönen Worte. Hilf mir lieber, dass ich ruhig werde für mein Auftreten. Ich darf nicht absagen, darf dem Direktor keine Schwierigkeiten machen, gerade vor dem Schlusse der Vorstellungen.«
Er war stehen geblieben, sein Blick war auf die Schachtel gefallen, die seine Hand vorhin auf den kleinen Tisch geworfen hatte. Jetzt hob er sie auf. »Gib mir davon. Du behauptest ja, dass es beruhigt. Ich muss ruhig werden.«
Nun kam lebhafte Bewegung in ihre Gestalt. »Ja, ja, das hilft. Ich gebe dir davon, – leg dich nieder, dann wirkt es umso besser.«
Eilig ging sie nach einer Kommode hinten im Zimmer, und ein leises Klirren von Glas und Wasserflasche klang von dort herüber. Abgewandt von Xaver, der sich auf den Diwan geworfen hatte, bereitete sie den Trank, dann trug sie die weißlich schimmernde Flüssigkeit hinüber zu seinem Platze.
»Nimm, trink, – in einem Zuge trink es hinunter.«
Er tat, wie sie geheißen hatte, nahm und leerte das Glas.
Die Baratta trat an sein Lager und schaute gespannt nieder auf ihn mit einem Gesicht, in dem noch wacher Zorn, Liebe, Spannung und Mitleid miteinander kämpften. In tiefem Schweigen vergingen wohl fünf Minuten. Dann sagte Stieler: »Ein wenig ruhen will ich noch, dann muss ich fort.«
»Fort, warum? Es ist noch nicht halb sieben, du hast noch beinahe zwei Stunden Zeit, bis du zum Theater musst. Solange bleib ruhig hier bei mir.«
»Das ist nicht möglich, weil ich noch eine Verabredung habe vor dem Theater.«
»Eine Verabredung? Mit wem? Was für eine Verabredung?«
»Du weißt, solche Fragen sind mir unangenehm. Ich will Herr bleiben über mein Tun und Lassen. Also, – noch ein paar Minuten, dann muss ich gehen.«
Sie presste die Lippen gewaltsam aufeinander und schwieg. Aber ihr vom raschen, heftigen Atem bewegter Körper zeigte, dass neue Leidenschaft in ihr aufgewacht war. Ein Entschluss arbeitete sichtlich in ihr und gab ihr zum Schweigen die Kraft. Auch als Xaver nach einer Weile sich erhob und zum Fortgehen rüstete mit einem freundlichen Dankeswort für ihre Bemühungen um ihn, blieb sie gehalten und wortkarg.
Sobald er jedoch die Tür hinter sich geschlossen hatte, stürzte sie nebenan in ihr Schlafzimmer und kam ein paar Augenblicke später wieder heraus in verwandelter Gestalt. Ein langer, dunkelbrauner Lodenmantel, dessen Kapuze sie sich über den Kopf gezogen hatte, hüllte sie völlig ein, verbarg ihre flimmernde Salome-Tracht und ließ die Theaterfürstin zur nonnenhaft finsteren Erscheinung werden. Mit hastigen, leisen Schritten durcheilte sie des Korridors billige Pracht und schlüpfte, von ihrer Quartiergeberin ungesehen und ungehört, aus der Tür hinaus und über die Treppe zur Straße hinunter.