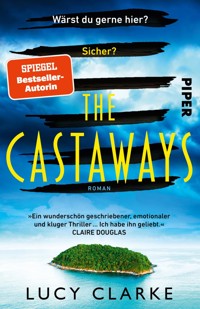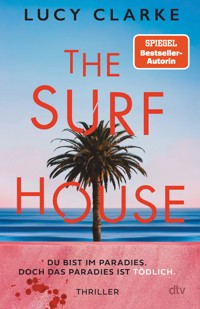3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sie muss ihre Vergangenheit um jeden Preis schützen Nichts fühlt sich richtig an, seit Elle in ihr spektakuläres Haus an Cornwalls Küste für eine Woche an Fremde vermietet hat. Sie hört Geräusche in der Nacht, Dinge wurden bewegt, jemand war in ihrem abgeschlossenen Schreibzimmer, und in ein Tischbein ist »Lügnerin« eingeritzt. Ihr wahrgewordener Traum von einem Platz zum Schreiben am Meer, den sie sich nach dem überwältigenden Erfolg ihres ersten Romans geschaffen hat, wird zum Albtraum. Bildet Elle sich alles nur ein, wie ihre Schwester Fiona meint, oder hat es wirklich jemand auf sie abgesehen? Und kennt nun ihr dunkelstes Geheimnis … »Das Buch ist fesselnd, weil sich die Angst, die Ungewissheit und die Beklemmung auf den Leser überträgt – beste Unterhaltung!« ― Radio Euroherz
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Thriller gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels » You Let Me In« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
Wiederveröffentlichung
© Lucy Clarke 2018
Titel der englischen Originalausgabe:
»You let me in«, HarperCollinsPublishers, London 2018
© der deutschsprachigen Ausgabe:
Piper Verlag GmbH München 2019
Die deutsche Erstausgabe erschien 2019 als unter dem Titel
»Das Haus am Rand der Klippen« im Piper-Verlag.
Redaktion: Ilse Wagner
Covergestaltung: FAVORITBUERO, München, nach einem Entwurf von Simeon Greenaway © HarperCollinsPublishers
Covermotiv: Roderick Field / Trevillion Images
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence, München mit abavo vlow, Buchloe
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem E-Book hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen und übernimmt dafür keine Haftung. Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Prolog
1
Elle
Vorher
2
Elle
Vorher
3
Elle
2003
4
Elle
Vorher
5
Elle
2003
6
Elle
2003
7
Elle
Vorher
8
Elle
Vorher
9
Elle
2003
10
Elle
11
Elle
2004
12
Elle
Vorher
13
Elle
Vorher
14
Elle
Vorher
15
Elle
2003
16
Elle
Vorher
17
Elle
Vorher
18
Elle
2004
19
Elle
20
Elle
2004
21
Elle
Vorher
22
Elle
2004
23
Elle
24
Elle
Vorher
25
Elle
2004
26
Elle
2004
27
Elle
28
Elle
29
Elle
2004
30 Elle
31
Elle
32
Elle
33
Elle
34
Elle
35
Elle
36
Elle
37
Elle
Epilog
Ein Jahr später
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Prolog
Ich möchte Ihnen einen Rat geben. Es handelt sich um eine Kleinigkeit. Viele von Ihnen wird es gar nicht betreffen – aber es ist wichtig.
In meinem Fall hat es alles verändert.
Es geht um Folgendes: Wenn Sie in Erwägung ziehen, jemandem Ihr Haus zu überlassen, halten Sie kurz inne. Denken Sie nach.
Denken Sie darüber nach, was es bedeutet, einem Fremden – oder mehreren – Ihren Hausschlüssel anzuvertrauen.
Denken Sie darüber nach, dass diese Fremden durch Ihr Haus wandern und die Hand in eine Schublade stecken könnten; Finger könnten über die Kleider in Ihrem Schrank streichen; man könnte Ihren Badezimmerschrank öffnen und seinen Inhalt begutachten.
Denken Sie darüber nach, woran der Blick hängen bleiben könnte: an den Fotos von Ihnen und Ihrer Familie, die an den Wänden hängen. An dem Küchenkalender, der Ihre Pläne preisgibt. An der Mappe, die Sie auf dem Boden einer Truhe verwahren.
Denken Sie daran, dass diese Personen in Ihrem Bett liegen werden; die Matratze wird sich ihren warmen Körpern anpassen; winzige Hautpartikel werden an Ihren Laken hängen bleiben; feuchter Atem wird über Ihr Kopfkissen streichen.
Was werden die Fremden noch hinterlassen?
Was werden sie noch entdecken?
1
Elle
Was im ersten Kapitel deines Romans geschieht, sollte wie ein Pfeil auf das letzte zielen.
Die Schriftstellerin Elle Fielding
In der Kurve der schmalen Straße verlangsame ich das Tempo und spüre, wie der Wagen über Furchen und Rinnen holpert; unter den Rädern spritzt Kies auf.
Während die Straße immer weiter ansteigt, recke ich mich und versuche, über die Hecke hinweg einen Blick aufs Meer zu erhaschen. Im gedämpften Licht der Abenddämmerung sehe ich die Schaumkronen auf dem Wasser, sehe, wie sich das Meer im Wind kräuselt. Mein Atem beruhigt sich allmählich.
Ich schalte das Radio aus, weil ich nicht möchte, dass mir die Stimme des Moderators den nächsten Moment verdirbt. Den gesamten Weg von London nach Cornwall über habe ich mich darauf gefreut.
Als ich um die Ecke biege, liegt es vor mir: das Haus am Rand der Klippen, das wie ein Versprechen am Ende des Weges auf mich wartet.
Nachdem ich in die Einfahrt gebogen bin, drehe ich den Zündschlüssel um und bleibe einen Moment sitzen, lausche dem Geräusch des tickenden Motors.
Es fühlt sich immer noch vollkommen unwirklich an, dass dies der Ort sein soll, an dem ich leben werde.
Bei meinem ersten Treffen mit dem Architekten hatte ich keinerlei konkrete Vorstellungen von dem Haus, abgesehen von der Anzahl der Zimmer und meinem Wunsch nach einem Platz zum Schreiben. In den darauffolgenden Monaten verwoben sich die unzusammenhängenden Ideen zu der Vision, die nun mit ihren drei Stockwerken auf die windgepeitschte Bucht hinabschaut.
Das Haus ist taubengrau gestrichen und hat große Fenster mit Naturholzrahmen. »Modern interpretierte Küstenarchitektur«, hat der Architekt gesagt. Ich bin froh, dass die Holzverschalung schon ein wenig von ihrer kruden Neuheit verliert und die salzige Luft an den Fenstern nagt. Die Strenge der Fassade muss allerdings noch ein wenig abgemildert werden. Vielleicht sollte ich eine Glyzinie um den Eingang ranken lassen – falls sie den kräftigen Seewind verträgt.
Ich habe noch nie in einem eigenen Haus gelebt. Oder in einer eigenen Wohnung. Mit meiner Mutter und meiner Schwester habe ich immer zur Miete gewohnt. Wörter wie »Haus« oder »Hypothek« waren etwas für andere, nicht für uns.
Der Seewind reißt die Wagentür auf, als ich aussteige. Mein Kleid bläht sich und bleibt an meinen Oberschenkeln kleben.
Unter meinen Füßen knirscht der Kies, als ich die Einfahrt überquere. Nachdem ich den Koffer auf die steinerne Türschwelle gehievt habe, krame ich in den Tiefen meiner Handtasche nach dem Hausschlüssel. Ich gehöre zu den Leuten, die immer zu viel mit sich herumschleppen: Portemonnaie, Handy, Stifte, einen Roman, mein Notizbuch.
Ein Notizbuch ist immer dabei.
Als ich den Schlüssel ins Schloss stecke, zögere ich.
Es hat etwas Beklemmendes, nach Hause zu kommen, wenn Fremde dort gewohnt haben. Meine Entscheidung, das Haus über Airbnb zu vermieten, hat mir in den zwei Wochen in Frankreich keine Ruhe gelassen; gleich zwei Mal bin ich auf der Suche nach einem Funknetz auf die Dachterrasse des Bauernhauses gestiegen. Gott sei Dank haben die Mieter keinerlei Hilferufe ausgesandt, und meine Schwester auch nicht.
Als ich auf der Schwelle stehe, beschleicht mich das ungute Gefühl, dass ich die Mieter noch antreffen könnte. Die Mutter – eine attraktive Frau mit einer teuren Frisur, wie ich dem Airbnb-Profil entnehmen konnte – könnte an meinem eckigen Spülbecken stehen und mit ihren blassen Händen einen Plastikbecher unter das fließende Wasser halten. Hinter ihr sehe ich ein Kind in einem Kinderstühlchen sitzen und sich mit pummeligen Fingern Erdbeeren in den Mund stopfen. Am Küchentresen steht der Vater und schneidet Toastbrot in kleine Stücke; er wird sie auf einer meiner Steingutplatten anrichten, bevor er sie zu einem drei-, vierjährigen Mädchen trägt, das sie sorgsam mit der Fingerspitze abzählen wird.
Musik ist zu hören. Stimmen und Gelächter. Der Ausfallschritt von Eltern, die über ein Spielzeugauto herumgehen. All der Lärm und die Energie und die Bewegung, die von einer Familie ausgehen, erfüllen mein Haus.
Mein Herz zieht sich zusammen: Es sollte meine Familie sein.
Als ich die Haustür öffne, bemerke ich sofort, dass es anders riecht. Erdig, feucht, vermischt mit den Gerüchen einer anderen Küche.
Der Wind zerrt an der Tür und lässt sie mit einem bedrohlichen Knall hinter mir ins Schloss krachen.
Dann Stille.
Niemand, dem ich etwas zurufen könnte. Niemand, der mich begrüßt.
Ich lege meine Handtasche auf die Eichenbank neben die ordentlich aufgestapelte Post. Als mein Blick auf die Rechnung ganz oben fällt, schaue ich schnell weg. Ich schlüpfe aus den Schuhen und gehe barfuß in die Küche.
Meer und Himmel füllen die Fenster. Selbst in der Abenddämmerung ist das Licht unglaublich. Zwei Möwen lassen sich sorglos in der Brise treiben, über der schäumenden See. Das ist der Grund, warum ich mich in dieses Haus verliebt habe, ursprünglich ein Fischerhaus, das seit den Sechzigerjahren nicht mehr renoviert wurde.
Irgendwo habe ich mal gelesen, die Schönheit des Meerblicks bestehe darin, dass das Meer sich unentwegt verändert und niemals gleich ist. Ich weiß noch, dass ich den Satz für übertrieben hielt. Dabei ist er wahr.
Ich reiße den Blick vom Wasser los und schaue mich in der Küche um. Die lange Granitplatte ist geputzt und aufgeräumt. Unter einem Tontopf mit Basilikum steckt ein Zettel. Die Handschrift meiner Schwester. Ich lese:
Willkommen daheim! Alles lief bestens mit Airbnb. Komm auf ein Glas Wein rйber, wenn du dich wieder eingelebt hast. Fiona x
Ich habe sie vermisst. Und Drake auch. Ich werde sie morgen besuchen, dann können wir am Strand spazieren gehen oder irgendwo zu Mittag essen, in einem Pub mit Spielecke, damit Drake herumlaufen kann.
Im Moment reichen meine Kräfte nur noch aus, um mir ein Buch zu schnappen und ein langes Bad zu nehmen.
Ich hole ein Glas aus dem Regal. Als ich es unter den Wasserhahn halten will, bewegt sich etwas an meinen Fingerspitzen, und ich lasse es in die Spüle fallen. Eine Spinne mit dicken Beinen krabbelt zwischen den Scherben hervor und hockt sich in den Ausguss.
Mich fröstelt. Spinnen bewegen sich so eigentümlich ruckartig mit den vielgliedrigen Beinen. Mit einem Seufzer mache ich mich daran, die Spinne aus dem Haus zu entfernen. Ich fange sie mit einem anderen Glas ein und gehe zur Haustür.
Ich steige barfuß die Treppe hinunter. Die Steinplatten sind eiskalt. Als ich auf den Kies trete, zucke ich zusammen, gehe aber die Einfahrt bis zum Ende. Dieses Mistvieh wird nicht in mein Haus zurückkehren. Ich stelle das Glas hin, stoße es mit dem Fuß um und springe schnell zurück. Ein paar Sekunden lang verharrt die Spinne reglos, dann eilt sie in einem Gewirr schwarzer Beine davon.
Ich mache gerade rechtzeitig kehrt, um noch zu sehen, wie die Haustür von einer Böe zugeknallt wird.
»Nein!« Ich laufe den Weg zurück, packe den Türgriff und rüttele vergeblich daran, schlage mit den Händen gegen die Tür. Ich bin wütend auf mich selbst.
Meine Handtasche steht auf der Eichenbank, Schlüssel und Handy befinden sich im Reißverschlussfach. Meine Jacke hängt am Haken. Idiotin!
Fiona hat einen Ersatzschlüssel, aber ihr Haus liegt einen Fußmarsch von einer halben Stunde entfernt. Barfuß und ohne Jacke kann ich den Weg im November nicht bewältigen; vermutlich wäre ich erfroren, bevor ich dort ankäme.
Ich schaue über die Schulter zu dem Bungalow, der hinter meinem Haus auf der Klippe kauert, dem einzigen anderen Haus hier. Es gehört Frank und Enid, einem Paar im Ruhestand, das seit dreißig Jahren dort lebt.
Ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal auf ihre Haustür zugegangen bin, Hand in Hand mit Flynn, erfüllt von der Vorfreude, dass wir, die frischgebackenen Hausbesitzer, nun unsere Nachbarn treffen sollten. Das fühlte sich so unfassbar erwachsen an, dass ich mir wie im Theater vorkam. Frank empfing uns ziemlich barsch und betrachtete uns prüfend. Enid wiederum verbreitete Hektik, weil sie unsicher war, ob ihr der Tee gelungen war, und weil das Geschirr vom Frühstück noch in der Spüle stand. Da Flynn ein Talent dafür hat, locker und entspannt auf Menschen zuzugehen, hatten wir aber am Ende des Besuchs Freundschaft geschlossen.
Mit den Besuchen ist es mittlerweile vorbei. Ich bin schon seit Monaten nicht mehr bei den beiden gewesen. Wenn wir uns auf der einspurigen Straße begegnen, sorgt Frank dafür, dass immer ich es bin, die in eine Ausweichbucht zurücksetzen muss; und wenn er mich beim Herausrollen der Mülltonnen sieht, wendet er demonstrativ den Blick ab.
Voller Unbehagen überquere ich die Straße und lege mir die Worte für mein Anliegen zurecht.
Die Haare wehen mir ins Gesicht, und ich versuche sie mit einer Hand festzuhalten. Als ich gerade auf den Klingelknopf drücken will, öffnet sich die Haustür, ein Mann tritt heraus und wirft sich eine schwarze Lederjacke über die Schulter.
Er bleibt wie angewurzelt stehen und starrt mich mit tief liegenden Augen an.
»Oh, hallo«, sage ich überrascht. »Ich bin Elle, Ihre Nachbarin.«
Durch einen Vorhang dichter, dunkler Haare huscht sein Blick zu meinem Haus hinüber. Seine Gesichtszüge verändern sich, spannen sich an. Er dürfte ein paar Jahre jünger sein als ich, Ende zwanzig vielleicht; an seinen Augenwinkeln bilden sich die ersten feinen Fältchen, und sein Kinn ist mit Stoppeln übersät.
»Die Schriftstellerin.« Irgendetwas an seinem Tonfall lässt es wie einen Vorwurf klingen.
»Genau. Und Sie müssen Franks und Enids Sohn sein.«
»Mark.«
Richtig. Die beiden hatten mal einen Sohn erwähnt – als wir uns noch alle gut verstanden haben. Ich glaube, Enid sagte, dass er Cornwall wegen der Arbeit verlassen habe, aber an weitere Details kann ich mich nicht erinnern.
»Es geht um Folgendes, Mark. Ich hatte ein Problem mit einer Spinne … Ich wollte sie von meinem Grundstück verscheuchen, als überraschend Wind aufkam und meine Haustür zugeknallt hat. Dummerweise sind mein Schlüssel und mein Handy im Haus.«
Sein Blick wandert über meinen Körper, über das blassblaue Sommerkleid und die braun gebrannten Beine, um dann auf meinen nackten Füßen mit den perlmuttfarben lackierten Nägeln liegen zu bleiben. Unwillkürlich möchte ich mich rechtfertigen: Normalerweise trage ich im November nicht solche Kleider. Ich bin gerade erst vom Flughafen gekommen. Ich …
»Ihre Schuhe.«
Ich blinzle.
»Ihre Schuhe sind auch im Haus.«
»Ach so, klar. In der Tat.« Ich verschränke die Arme vor der Brust. »Würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn ich meine Schwester von Ihrem Telefon aus anrufe? Sie hat den Ersatzschlüssel.«
Er zögert einen Moment, dann tritt er zur Seite und hält mir die Tür auf. Ich gehe an ihm vorbei in den schmalen Flur.
Der Geruch von gebratenen Zwiebeln hängt in der Luft, außerdem etwas Beißendes. Gras, registriere ich und verspüre eine warme Welle der Erinnerung.
»Sind Enid oder Frank zu Hause?«
»Nein.« Mit einem dumpfen Geräusch schließt Mark die Tür und bleibt davor stehen.
Unruhe befällt mich. Ich muss immer wissen, wo ein Ausgang ist, muss ständig darüber nachdenken, wie ich einen Raum oder ein Gebäude verlassen kann, ein offenbar unauslöschlicher Zwang, der während meines Studiums ausgelöst wurde. Mein Blick wandert zum Schloss: ein Yale-Schloss. Kein Schlüssel an der Innenseite der Tür.
»Sind Sie für ein paar Tage zu Besuch? Sie leben in London, nicht wahr?«, frage ich und gebe mir Mühe, mit einem freundlichen Tonfall das erste Zittern der Angst zu überspielen. »Was tun Sie eigentlich dort? Ich glaube, Ihre Mutter hat mal etwas von Computern gesagt, oder bilde ich mir das nur ein?«
»Warum sollten Sie sich das einbilden?«
Ich spüre, dass ich mich unter seinem Blick unbehaglich winde. Mit meinen dreiunddreißig Jahren habe ich es nicht nötig, ihm zu gefallen. Ich brauche einfach nur sein Telefon.
Es steht auf einem altmodischen Telefontischchen unter einem Spiegel mit Messingrahmen. »Dürfte ich wohl?«
»Funktioniert nicht.«
»Haben Sie ein Handy?«
Er zögert, bevor er in seine Tasche greift und es herausholt. Nachdem er den Code eingetippt hat, hält er es mir hin. Es gibt einen kurzen Moment des Widerstands, nicht länger als eine halbe Sekunde, in dem er es festhält, als ich es entgegennehmen will.
Ich krame in meinem Gedächtnis nach Fionas Nummer. Ich möchte nicht aufschauen, aber ich bin mir sicher, dass Mark mich beobachtet. Meine Wangen werden heiß.
»Jetzt fällt mir doch glatt ihre Nummer nicht ein. Früher kannte ich sämtliche Telefonnummern auswendig, aber mittlerweile sind sie ja alle im Handy gespeichert, nicht wahr?«
Er schweigt.
Ich räuspere mich und beginne zu tippen, und plötzlich ist der Rhythmus der Nummer wieder da. Erleichtert halte ich das Handy ans Ohr und höre es klingeln. Ich bete stumm, dass Fiona da sein möge.
Das Leder von Marks Jacke knarrt, als er sich an die Tür lehnt und auf die Uhr schaut.
»Ja?«, flüstert Fiona. Vermutlich schläft Drake in der Nähe.
»Ah, Gott sei Dank, dass du rangehst! Ich rufe von einem fremden Handy aus an. Hör zu, ich habe mich ausgesperrt. Sag bitte, dass du den Ersatzschlüssel hast. Und dass du zu Hause bist.«
»Ich bin zu Hause. Und ich habe den Ersatzschlüssel.«
»Kannst du kommen? Ich könnte mich aber auch in ein Taxi setzen, wenn Drake schon im Bett ist.«
»Bill ist da, also kann ich kommen. Dann erspare ich mir auch das Theater im Badezimmer.«
»Super. Perfekt. Danke.«
»Von wessen Handy rufst du denn an?«
»Das erzähle ich dir später.«
Ich kann mir vorstellen, was für eine Miene Fiona zieht, wenn sie Bill mitteilt, dass sie sofort losfahren muss, um ihrer Schwester zu helfen – wieder einmal. Fiona würde sich niemals aussperren. Zweifellos hat sie Vorkehrungen getroffen, indem sie Ersatzschlüssel versteckt oder an ein ganzes Netz von Nachbarn verteilt hat.
Ich gebe Mark das Handy zurück. »Meine Schwester ist auf dem Weg. Es wird nur zehn Minuten dauern.«
Einen Moment lang herrscht Schweigen, dann sagt Mark: »Ich bin schon spät dran.«
»Sie … Sie wollen, dass ich draußen warte?«
Statt zu antworten, öffnet er den Einbauschrank unter der Treppe und kramt eine Weile darin herum. Schließlich dreht er sich wieder um und hält mir eine violette Damen-Fleecejacke hin.
Dann öffnet er die Haustür. Die Idee, dass ich vielleicht auch gerne Schuhe hätte, kommt ihm nicht in den Sinn. Ich trete auf die eiskalte Betonschwelle und stelle fest, dass sich mittlerweile die Nacht herabgesenkt hat.
Als ich in die Ärmel schlüpfe, steigt mir ein muffiger Lavendelgeruch in die Nase. »Ich bringe sie später zurück.«
Mit einem Schulterzucken tritt er an mir vorbei und zieht die Tür hinter sich zu.
Ein schwarzes Motorrad parkt am Rand des Grundstücks. Fast muss ich lachen. Natürlich fährt er Motorrad! Ich schaue zu, wie er den Helm aufsetzt, in den Sattel steigt und den Motor hochjagt.
Als ich durch die Einfahrt gehe, bin ich dankbar, dass der Bewegungsmelder anspringt. Ich setze mich auf die Vortreppe und spüre, wie die Eiseskälte der Steinplatte in meine Knochen dringt.
»Beeil dich«, murmle ich und sehe es förmlich vor mir, wie meine Schwester steif hinter dem Lenkrad hockt und sich strikt an die Geschwindigkeitsbegrenzungen hält.
Ich wickle mich enger in die Fleecejacke und ziehe die Schultern bis an die Ohren hoch.
Hinter mir spüre ich das Haus, lauernd, leer. Unwillkürlich frage ich mich, ob es mich dafür bestrafen will, dass ich es alleingelassen habe – wie Hunde, die ihre Besitzer einfach ignorieren, wenn die sie aus dem Tierheim wieder abholen wollen.
Das Licht des Bewegungsmelders erlischt, und ich sitze zitternd in der Dunkelheit.
Vorher
Ein einspuriges Sträßchen gräbt sich zwischen den hohen Hecken hindurch und windet sich zu den Klippen hinauf.
»Es liegt ganz am Ende«, teile ich dem Taxifahrer mit.
Die Einfahrt ist mit grau-weißen Kieselsteinen bedeckt, die zweifellos auf den Außenanstrich und die Naturholzverschalung abgestimmt sind.
Das Haus liegt eindrucksvoll hoch oben auf den Klippen. Stahlträger sind in den Felsen getrieben, sodass die dem Meer zugewandte Seite frei über dem Abgrund zu hängen scheint. Der Kontrast zwischen der einladenden Schlichtheit des Hauses und den dunklen Schatten der zerklüfteten Felsen ist eine kaum zu überbietende architektonische Attraktion.
»Hübsches Plätzchen haben Sie hier«, sagt der Taxifahrer, als der Wagen mit knirschenden Reifen zum Stehen kommt.
»Das kann man wohl sagen«, antworte ich mit einem verstohlenen Lächeln.
Ich zahle und gebe mehr Trinkgeld als nötig.
Ich trage meine Reisetasche zur Haustür, stelle sie auf die steinerne Schwelle und warte, bis der Taxifahrer auf dem Kiesweg gewendet hat und wieder im Tunnel der Hecken verschwunden ist. Dann begebe ich mich zum Rand des Grundstücks, wo sich, wie in der Mail beschrieben, in einem diskret eingezäunten Bereich die Mülltonnen befinden.
Ich ziehe die grüne Altglastonne zur Seite und höre das Klirren der Flaschen darin. Unter der Tonne liegt ein großer Kieselstein. Vorsichtig hebe ich ihn an wie ein Kind, das jeden Stein umdreht, um vielleicht Asseln oder Käfer darunter hervorhuschen zu sehen.
Da ist er: der Hausschlüssel.
Ich stelle die Mülltonne wieder zurück und gehe über die Einfahrt zum Haus. Meine Fingerspitzen berühren die solide Holztür, deren graugrüne Farbe dem Meer abgeschaut ist. Kurz halte ich inne. Mir ist bewusst, was für ein bedeutender Moment dies ist; er umfängt mich und lässt mein Herz schneller schlagen.
Ich schaue über die Schulter, um sicherzugehen, dass mich niemand beobachtet. Dann hole ich tief Luft und stecke den Schlüssel ins Schloss.
2
Elle
»Gott sei Dank, dass du da warst«, sage ich und schenke Fiona Wein nach, bevor ich mich aufs Sofa zurücksinken lasse.
»Was, wenn ich nicht da gewesen wäre?«
»Sonst hat nur Flynn einen Schlüssel.«
»Er hat immer noch einen Schlüssel?«
Ich zucke mit den Schultern. »Es käme mir kleinlich vor, ihn zurückzufordern.«
Fiona sagt nichts, das muss sie auch nicht. Ihre Augenbrauen – dunkel und stark gewölbt – sprechen für sie.
»Wie hat es Drake bei Bills Eltern gefallen?«, erkundige ich mich. »Ich habe ihn vermisst. Vielleicht kann er ja dieses Wochenende zu mir kommen. Ich habe ihm auch etwas Leckeres mitgebracht.«
»Er braucht erst einmal Entzug von allem, was schön und lecker ist. Bills Eltern haben ihn jeden Tag zwei Stunden lang Zeichentrickfilme schauen lassen – und sind jeden Nachmittag mit ihm in die Eisdiele gegangen. Ich bin fast überrascht, dass er sich nicht adoptieren lassen wollte.«
»Du musst ihn vermisst haben.«
»Soll das ein Witz sein? Ich hab ausgeschlafen. Ich musste nicht kochen. Ich hab mehr Arbeit erledigen können als in den ganzen letzten Monaten zusammen. Ich hab mich schon erkundigt, ob wir das nicht jedes Jahr so machen können.«
»Wirklich?« Nun ziehe ich meinerseits eine Augenbraue hoch. Drake ist gerade erst zwei Jahre alt geworden, und es war das erste Mal, dass er länger als eine Nacht von zu Hause fort war. Bill hat die Woche bei seinen Eltern in Norfolk in monatelangen Verhandlungen vorbereitet.
»Und wie war es bei dir? Wie war es in Frankreich?«
»Oh, gut.« Man hat mich als Gastrednerin zu einem Schreibseminar eingeladen. Ich habe lang hin und her überlegt, ob ich die Einladung annehmen soll, da der Abgabetermin für mein eigenes Buch näher rückt. Andererseits war das Seminar so gut bezahlt, dass ich es kaum ausschlagen konnte. »Wir waren in einem überwältigenden Bauernhaus mitten in der Pampa untergebracht. Es gab sogar einen Swimmingpool. Ich bin jeden Morgen geschwommen.«
»Wenn du weniger wiegst als vorher, hast du nicht genug Käse gegessen.«
»Ich habe schon zum Frühstück Käse gegessen.«
»Brav«, sagt Fiona und trinkt einen Schluck Wein. »Und wie waren die anderen so?«
»Interessant, intelligent, leidenschaftliche Leseratten. Manche vielleicht ein wenig verbissen. Gnadenlose Wortklauber. Und pünktlich um zehn im Bett.« Ich halte kurz inne. »Die hätten dir gefallen.«
Fiona lacht – dieses Lachen, das ich so sehr liebe, laut und unbekümmert.
»Möglich. Haben sie auch Merkzettel mit unter die Dusche genommen?«
Als sich Fiona auf die Schulprüfungen vorbereitete, hat sie ihre Merkzettel immer in Plastikhüllen gesteckt, damit sie unter der Dusche weiterlernen konnte. Sie ist schon immer diejenige gewesen, die ihr Ziel klar vor Augen hatte und gnadenlos verfolgte.
»Dabei habe ich niemanden ertappt.«
»Und was ist mit deinem« – Fiona legt eine Kunstpause ein – »nie enden wollenden Meisterwerk?«
Ich schaue zum Fenster. In der dunklen Scheibe spiegelt sich das Licht der Lampe. Allein bei dem Gedanken an meinen zweiten Roman krampft sich mein Magen zusammen.
»Das quält sich immer noch mühselig voran.«
»Wirst du den Abgabetermin einhalten können?«
Ich ziehe die Schultern hoch. »Der ist in sechs Wochen.«
Fiona mustert mich eindringlich. »Was passiert, wenn du es nicht schaffst?«
»Dann verliere ich den Vertrag.«
Und damit dieses Haus, denke ich und spüre, wie die Panik in meinem Brustkorb aufflattert. Das kann ich nicht zulassen.
Fiona weiß, wie viel Energie ich in dieses Haus gesteckt habe, in den langen Prozess von den Bauzeichnungen bis hin zu den Bauanträgen; dann all die Monate mit den Bauarbeitern, die über das Gerüst gepoltert sind, die großen Glasscheiben eingesetzt haben und in den Felsen bohren mussten, um sperrige Stahlträger einzupassen; dann die Stunden, die ich über Badezimmerarmaturen, Fußbodenbelägen und Farbtafeln gebrütet habe.
Dabei passt das überhaupt nicht zu mir – zu diesem »mir«, das im ersten Erwachsenenalter kaum mehr besaß, als man in einen Rucksack stopfen kann. Aber dieses Haus wollte ich mehr als alles auf der Welt. Fiona lebt in Cornwall. Ein Haus, das aufs Meer blickt, das war der Traum unserer Mutter. Es bedeutet Wurzeln, Stabilität.
Eines Abends während der Bauzeit, als ich in unsere Mietwohnung in Bristol zurückgekehrt war, stand Flynn am Kamin, den Rücken mir zugewandt, und starrte in die lodernden Flammen. »Ich frage mich, ob du nicht zu viel Energie in dieses Haus steckst«, sagte er.
Dieses Haus. Nie unser Haus.
Ich wünschte, ich hätte den feinen Unterschied damals bemerkt.
Meine Antwort lautete: »Ich möchte, dass alles perfekt wird, damit wir das Haus nie wieder verlassen müssen.«
»Danke, dass du dich in meiner Abwesenheit um alles gekümmert hast«, sage ich zu Fiona. »Das Haus ist ja tadellos in Schuss.«
»Überrascht dich das?«
»Natürlich.«
»Ich muss zugeben, dass ich kaum etwas zu tun hatte. Es war makellos sauber.«
»Tatsächlich? Ich habe mir durchaus Sorgen gemacht. Es war schon ein eigenartiges Gefühl, dass hier jemand anders wohnt.«
»Ich hätte dir vorher sagen können, dass du das so siehst.«
Tatsächlich war es Bill gewesen, der den Vorschlag mit der Vermietung gemacht hatte.
»Sollte das Geld mal knapp werden«, begann er, als sie eines Abends am Strand grillten, »kannst du ja darüber nachdenken, das Haus für den Sommer bei Airbnb anzubieten.«
»Erinnerst du dich noch an meine Studienfreundin Kirsty?«, fragte Fiona.
Ich muss wohl ratlos ausgesehen haben.
»Die Englischlehrerin. Die, die mit dem Schuldirektor gevögelt hat, als plötzlich eine Mutter in sein Büro platzte.«
»Ach, die Kirsty!«
»Sie hat ein Haus mit drei Schlafzimmern in Twickenham. In den Schulferien fährt sie immer weg und vermietet es. Zweitausend Pfund kassiert sie pro Woche.«
»Zweitausend Pfund?« Ich ging in die Hocke, um eine Muschel zu begutachten, die Drake mir hinhielt. »Die ist wunderschön, mein Schatz«, sagte ich, küsste ihn auf die sanfte Wölbung seiner Stirn und schloss die Finger um die Muschel. Er trollte sich, um weitere Muscheln zu suchen.
»Alle tun das«, sagte Bill. »Das ist leicht verdientes Geld.«
»Klar, aber Elle ist anders.« Fiona warf mir einen Blick zu. »Sie hat drei Tage gebraucht, um die Türklinken auszusuchen.«
»Ich klinke schon nicht aus«, sagte ich mit einem Grinsen.
»Egal, du darfst sie nicht auf solche Ideen bringen, Bill. Du weißt doch, wer die Scherereien hat, wenn während ihrer nächsten Lesereise ihr Haus für einen Pornodreh benutzt wird …«
»O Gott, sag nicht so etwas!« Ich lachte.
»Eine Reinigungsfirma vielleicht?«, sagte Bill.
»Kirsty räumt alle wertvollen Gegenstände in ihr Arbeitszimmer und schließt die Tür ab, ganz einfach.« Fiona fischte ein Minzblatt aus ihrem Pimm’s und zerriss es mit den Zähnen. »Erinnerst du dich an das Haus, in dem Bill und ich in Pembrokeshire gewohnt haben? Das haben wir über Airbnb entdeckt. Die Besitzer haben einfach alles gelassen, wie es war. Die Schränke waren voll mit Kleidern. Ich glaube, die Frau war Tänzerin.«
»Jetzt erzähl mir nicht, du hättest Paillettenkleider anprobiert.«
»Sie hatte eher Bills Größe.«
»Ein hautenges Oberteil steht mir gut zu Gesicht«, sagte Bill und klopfte sich zufrieden auf den Bauch. »Aber mal im Ernst, du könntest ein Vermögen mit deinem Haus machen. Denk einfach mal darüber nach.«
Und das tat ich auch. Ich tat es, als ich auf die Abschlussrechnung für die Bauarbeiten starrte und mit zitternden Fingern Zahlen in meinen Taschenrechner tippte. Fiona und Bill wussten nicht – wissen es bis heute nicht –, dass ich eine Hypothek aufnehmen musste, um die Bauarbeiter bezahlen zu können.
Die Airbnb-Vermietung war also nur ein erster Versuch, ein Testlauf. Mein Plan lautet, dass ich das Haus im Sommer wieder vermiete und irgendwohin abdampfe. Meine beiden besten Freundinnen leben am anderen Ende der Welt: Nadia ist als Englischlehrerin nach Dubai gezogen, und Sadie wohnt bei der Familie ihres Mannes auf einer Farm in Tasmanien.
Ich wende mich an Fiona. »Wie war die Familie denn so, die es gemietet hat?«
»In Ordnung«, antwortet sie und stellt ihr Weinglas auf den Couchtisch.
»Wirkten sie nett?«
»Ich bin ihnen ja nur kurz begegnet.«
Ich nehme eine Anspannung in ihrer Stimme wahr, die mich veranlasst, noch einmal nachzuhaken. »Ist wirklich alles in Ordnung?«
»Ja, absolut. Nichts zu Bruch gegangen. Die Kaution habe ich bereits zurückgezahlt. Sie haben nur ein bisschen Zeug hinterlassen.« Als sich Fiona vom Sofa erhebt, fällt mir auf, dass sie abgenommen hat. Wir beide waren immer schlank, aber ihre Schultern wirken plötzlich knochig, und ihr Brustbein zeichnet sich im Ausschnitt ihrer Bluse deutlich ab.
Fiona geht zur Anrichte und holt ein Döschen Wundschutzcreme für Babys und eine zerkaute Plastikgiraffe heraus.
»Das ist das Einzige, was ich gefunden habe«, sagt sie und drückt auf die Giraffe, die ein Quieken von sich gibt.
Unvermittelt verspüre ich eine große Traurigkeit.
»Die Bettwäsche habe ich komplett gewaschen – Kochwäsche«, fügt sie mit einem Augenzwinkern hinzu. »Drakes Kinderstühlchen habe ich wieder mit nach Hause genommen.«
»Ach ja. Danke, dass du ihn mir geliehen hast.«
»Ich habe ihn am Abend vor dem Eintreffen der Gäste vorbeigebracht und fast einen Herzinfarkt bekommen, als die Alarmanlage ansprang. Ich hatte ganz vergessen, dass du gesagt hast, sie sei eingeschaltet.«
»Hast du sie denn ausstellen können?«
»Erst beim sechsten Versuch. Mein Trommelfell ist fast geplatzt. Okay«, erklärt Fiona und marschiert zur Wohnzimmertür, »ich geh dann mal. Ich hatte Bill gesagt, dass ich nur eine halbe Stunde fortbleibe.«
»Tut mir leid, dass ich dich hierher beordert habe.«
»Kein Problem. Bill hat ja seinen Fernseher. Dritte stören da nur.«
Als ich aufstehe und meiner Schwester einen Kuss gebe, stoßen unsere Wangenknochen aneinander.
Nachdem ich hinter Fiona abgeschlossen habe, begebe ich mich in die Küche und schalte sämtliche Lichter und das Radio an.
Ich hole mein Notizbuch aus der Handtasche und lege einen Bleistift daneben. Dann trete ich zurück und betrachte das Arrangement auf meinem Handybildschirm. Ich mache ein Foto, lade es auf Facebook hoch und füge einen Text hinzu:
Nachdem ich zwei wunderbare Wochen als Dozentin bei einem Schreibseminar verbracht habe, bin ich wieder daheim und freue mich WAHNSINNIG, in meinen Roman einzutauchen – der sich bereits auf der Zielgeraden befindet! #IchSchreibe #Autorenleben
Dann räume ich die Requisiten wieder weg.
In der Hoffnung, Fiona könne einen Liter Milch oder ein Brot hinterlassen haben, öffne ich den Kühlschrank – aber er ist leer.
Zu müde, um auch nur daran zu denken, wieder ins Auto zu steigen, blicke ich mich in der Speisekammer um. Schließlich finde ich eine Packung vorgekochten Quinoa, den ich mit Sesampaste und Zitronensaft vermenge. Ich esse im Stehen und sehe dabei die Post durch.
Auf die Rechnungen werfe ich nur einen flüchtigen Blick und versuche die Wörter »letzte Mahnung« zu ignorieren, die quer über meine Stromrechnung gedruckt sind. Als Nächstes finde ich ein paar Päckchen von meiner Agentur; sie enthalten Bücher anderer Autoren, Vorabdrucke, die vor dem Erscheinen hochgejubelt werden müssen. Ansonsten finde ich Spendenaufrufe für wohltätige Zwecke, zwei Briefe von Fans, weitergeleitet von meinem Verleger, und eine Geburtstagseinladung von einem Freund. Als ich mich dem Boden des Stapels nähere, greifen meine Finger nach einem dicken cremefarbenen Kuvert mit aufgeprägtem Goldemblem. Es stammt von Flynns Anwalt.
In Frankreich musste ich an unsere erste gemeinsame Reise denken, die wir mit Mitte zwanzig gemacht haben. Wir hatten die Fähre nach Bilbao genommen und waren dann mit Flynns zerbeultem Seat Ibiza Richtung Norden nach Hossegor gefahren, ein Skateboard aufs Dach geschnallt, ein Zelt im Kofferraum. Im Schatten einer dicken Pinie campend, haben wir uns von Nudeln und warmem Baguette ernährt und dazu billiges Bier aus kleinen Fläschchen und Wein aus Pappkartons getrunken. Abends spielten wir im Licht unserer Stirnlampen Karten oder lagen im offenen Zelt, die ineinander verschlungenen Glieder von Salz und Sonnencreme glänzend.
Auf dieser Reise hat Flynn davon gesprochen, an welche Orte er reisen wollte – und ich habe stets zugestimmt, weil ich überall sein wollte, nur nicht zu Hause. In seiner Gegenwart kam es mir so vor, als hätte eine andere Person mein bisheriges Leben erlebt, eine Person, die von mir aus gerne in der Universitätsstadt bleiben konnte, in die ich nie wieder zurückkehren würde.
Ich kratze den restlichen Quinoa in den Mülleimer, nehme meinen Koffer und gehe die Treppe hinauf. Nachdem ich das Licht im Schlafzimmer angeschaltet habe, bleibe ich im Türrahmen stehen und betrachte das Bett.
Fiona hat sich natürlich alle Mühe gegeben, es ordentlich zu machen. Die Kissen sind aufgeschüttelt, und die weiche olivgrüne Decke ist über das gesamte Bett gelegt, nicht nur über den Fußteil. Die winzigen Details machen mir bewusst, dass ich nicht die letzte Person war, die in diesem Bett geschlafen hat, sondern eine andere Frau mit ihrem Ehemann.
Ich stelle den Koffer ab, schreite durch den Raum und lasse den Blick über die sauberen Oberflächen gleiten. Dann öffne ich die Tür meines Kleiderschranks; meine Kleider hängen noch auf der Seite, wo ich sie hingeschoben habe, damit die Gäste Platz an der Stange haben. Ich gehe zu meinem Nachtschränkchen und ziehe die Schublade heraus. Leer, so wie ich sie hinterlassen habe – oh, außer einem kleinen Döschen Männer-Haarwachs ganz hinten. Ich schraube den Deckel ab. Als ich sehe, dass es fast leer ist, werfe ich es in den Mülleimer.
Ich hole meine Kulturtasche heraus, gehe zu dem großen, frei stehenden Spiegel am Fußende des Betts, gebe Reinigungsmilch auf ein Baumwollpad und reibe mir damit sanft über das Gesicht. In Frankreich habe ich ein bisschen Farbe bekommen, und mein Haar hat in der Sonne einen warmen Karamellton angenommen.
Als ich mich vorbeuge, entdecke ich sie: Fingerabdrücke. Größer als meine. Ich sehe genauer hin. Jemand hat seine Hand flach an den Spiegel gelegt; die Spuren fremder Haut haben sich auf dem Glas abgelagert.
Während ich noch dastehe und das Spiegelbild des leeren Zimmers hinter mir sehe, fängt meine Haut zu kribbeln an. Jemand war in diesem Raum. In meinem Haus. Die Frau, die es gemietet hat – Joanna –, muss genau an der Stelle gestanden haben, an der ich jetzt stehe. Der Spiegel hat ihr Ebenbild eingefangen. Es fühlt sich an, als sei der Blick der Fremden auf mich gerichtet.
Als ich zurückweiche, fährt mir ein scharfer Schmerz in die Ferse.
Ich stütze mich an der Wand ab, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren, und untersuche meinen Fuß. Mitten in meiner Ferse befindet sich ein tiefes Loch, aus dem ein Blutstropfen hervorquillt. Auf was, zum Teufel, bin ich getreten? Ich bücke mich, betrachte den Teppich und streiche mit der freien Hand darüber, bis ich auf etwas unangenehm Spitzes stoße.
Eine Glasscherbe, messerscharf, steckt tief im Flor. Vorsichtig ziehe ich sie heraus. Die Deckenstrahler fallen auf einen wunderschönen bläulichen Zapfen; das schillernde Glas kommt mir seltsam bekannt vor.
Ist irgendetwas zerbrochen? In meinem Schlafzimmer fällt mir nichts ein, von dem die Scherbe abgeplatzt sein könnte. Auf meinem Nachtschränkchen stehen nur wenige Dinge: eine Lampe mit Stativfuß, eine Blumenvase, drei Bücher hiesiger Schriftsteller. Meine Parfumflakons habe ich mit den anderen zerbrechlichen Gegenständen und den Wertsachen in meinem Schreibzimmer eingeschlossen. Dass ich diesen Glasdolch nicht zuordnen kann, hat etwas Beunruhigendes.
Ich wickle ihn in ein Taschentuch. Als ich es in den Mülleimer werfe, fällt mein Blick auf den cremefarbenen Teppich – mein Blut hat eine purpurfarbene Markierung hinterlassen.
Vorher
Eiche, Jasmin und Zitrusdüfte – das sind die Gerüche, die mich beim Eintreten empfangen. Die Luft hat etwas Reines, Frisches, das ich von mir zu Hause nicht kenne; sie ist trocken und frei von Küchendünsten oder dieser erdigen Feuchtigkeit, die daher rührt, dass man seine Wäsche zum Trocknen auf die Heizkörper hängt.
Ich kann nicht anders. »Hallo?«
Natürlich antwortet niemand. Ich lächle. Diese Stille ist wunderbar und wird nur vom fernen Rauschen des Meeres abgemildert.
Auf dem robusten Eichenboden wirkt meine schwarze Reisetasche wie ein Fremdkörper. Ich schüttle meine Schuhe ab und lasse sie einfach liegen. Deine stehen, wie ich sehe, ordentlich neben der Eichenbank.
Ich schreite durch den Eingangsbereich, der direkt in die geräumige Küche führt. Die Wände sind in einem warmen Weißton gestrichen, vermutlich eine Farbe mit lichtstreuenden Teilchen, damit es sich so anfühlt, als würden die Wände Luft ausströmen. Vereinzelte Farbakzente – kreidige Pastellfarben – werden mit den lasierten Holzschränken, den sorgfältig ausgewählten Bildern und der kunstvoll verteilten Keramik gesetzt.
Der Stil ist zauberhaft und beruhigend, als habe man am Meer ausgebleichte Kiesel gesammelt und der Farbpalette zugrunde gelegt. Die klare moderne Linie der grifflosen Schränke und die granitene Arbeitsplatte kontrastieren mit dem wunderschönen alten Bauerntisch aus unbehandeltem Holz, auf welchem Trinkgefäße ihre ringförmigen Spuren hinterlassen haben. An der Wand steht eine lange Sitzbank mit Kissen aus Sackleinen. Es ist ein Tisch für eine Familie oder für Abendgesellschaften, nicht für eine einzelne Person.
Ich lächle, als ich das gewünschte Kinderstühlchen betrachte, das natürlich niemand benutzen wird. Auf dem Küchentresen steht in einem alten Honigtopf, zusammengebunden mit einer braunen Schnur, ein Wildblumensträußchen. Eine handgeschriebene Karte für »Joanna und ihre Familie« lehnt daran.
Eine nette Geste.
Ich nehme die Karte, lasse den Finger über die elegante Handschrift gleiten, klappe sie aber nicht auf.
Nachdem ich sie zurückgestellt habe, gehe ich zu einer alten, eierschalenblau gestrichenen Anrichte mit elegant geschwungenen Eisenhaken, an denen Steingutkrüge hängen. Gesprenkelte Schalen mit Seegrasmuster stapeln sich dekorativ zwischen Schraubgläsern mit Nüssen, Hülsenfrüchten und kunstvoll gestalteten Nudeln in Spiral- und Bandform. Ich ziehe eine Schublade auf, aber als ich hineingreifen will, packt mich die Angst, dass jemand die Schublade zuknallen und meine Finger einklemmen könnte – als wäre ich ein neugieriges Kind, das man ertappt hat.
Ich komme mir wie ein Eindringling vor. Dabei spüre ich, wie der kleine, harte Hausschlüssel in meiner Hosentasche gegen meinen Oberschenkel drückt.
Ich bin kein Eindringling, rufe ich mir in Erinnerung. Du hast mich hereingelassen.
3
Elle
Wenn du eine Zeitbombe in die Geschichte werfen willst, stell den Zeitzünder gleich zu Beginn und lass uns das Ticken hören.
Die Schriftstellerin Elle Fielding
In der holzkohleschwarzen Hülle der dritten nächtlichen Stunde liege ich wach und spüre das Pochen in meiner Ferse. Mein Puls scheint dort zu klopfen.
Über die Jahre hinweg habe ich tausend Tipps und Tricks ausprobiert, um gegen die Schlaflosigkeit anzukämpfen: Ich habe ausgedehnte Lavendelbäder genommen, Hörbücher gehört, Verdunkelungsrollos angebracht und vor dem Zubettgehen warme Milchgetränke getrunken; die dämliche Meditations-App, die ich zunächst für den Durchbruch hielt, verlor bald ihre Wirkung; Bildschirmabstinenz, Verzicht auf Zucker beim Abendbrot, Schlaftabletten, homöopathische Mittel, Akupunktur, alles habe ich ausprobiert.
Die Leute begreifen nicht, dass die Herausforderung nicht im Einschlafen besteht. Durchschlafen ist das Problem.
Wenn mein Geist nur einen Schalter hätte, irgendeine Vorrichtung, mit der man ihn ausstellen oder wenigstens den Ton herunterdrehen könnte. Stattdessen regen sich, je tiefer die Nacht herabsinkt, alle meine Sorgen, recken sich, wachen auf. Harmlose, belanglose Ereignisse verändern die Gestalt, und ihre Schatten wachsen ins Unermessliche.
Der Chef der Bar, in der ich gekellnert habe, pflegte über diese Angstzustände zu sagen: »Trau keinem Gedanken, den du zwischen zwei und fünf Uhr nachts hast. Das wäre, als würdest du auf dein betrunkenes Selbst hören.«
Heute Nacht hilft mir die Erinnerung an diesen Kommentar nicht. Ich atme langsam ein und aus und spüre meinem Atem nach.
Aber ich fühle sie immer noch: die eisig scharfe Spitze der Scherbe, die meine Haut durchbohrt.
Ich lehne am Küchentresen und lausche auf das Gurgeln der Espressokanne, als das kochende Wasser aufzusteigen beginnt. Was täte ich nur ohne Kaffee? Gegen fünf Uhr morgens bin ich endlich in einen tiefen, traumlosen Schlaf gefallen. Jetzt habe ich einen dicken Kopf, und meine Glieder fühlen sich taub an.
Jenseits der Fenster hängen samtig weiße Wolken am Himmel; Fetzen von Blau blitzen dazwischen hervor. Ein Kajakfahrer kämpft sich durch die Bucht, das Paddel mit bewundernswerter Eleganz hebend und senkend.
Am Ufer steht ein einsamer Vogelbeobachter, den Kragen bis zum Kinn hochgezogen. Er hat den Kopf in den Nacken gelegt und das Fernglas auf die Klippe gerichtet. Die Ruhe, die er ausstrahlt, hat etwas Bewundernswertes. Es muss schön sein, wenn einen das Leben eines Vogels derart fasziniert, dass man viele Stunden des Tages damit zubringt, ihn einfach nur zu beobachten.
Ich folge seiner Blickrichtung, um zu sehen, was er entdeckt hat.
Als ich den Winkel des Fernglases einzuschätzen versuche, läuft mir ein leiser Schauer über den Rücken. Der Blick richtet sich gar nicht auf die Klippen. Er richtet sich auf eine Stelle darüber.
Auf mein Haus.
Die Erinnerung flammt wie ein Streichholz in mir auf: ein träges Lächeln; dunkle, wissende Augen, die mir folgen und mich wie die eines Falken ins Visier nehmen; die Lust in dieser Stimme, als sie meinen Namen ausspricht.
Mit einem Blinzeln jage ich den Gedanken fort, aber der Schauer bleibt.
Natürlich beobachtet die Person nicht mein Haus, sage ich mir. Das Fernglas muss auf einen Vogel gerichtet sein. In der Nähe nisten Uferschwalben, und gelegentlich sieht man auch ein Wanderfalkenpärchen.
Das Haar des Fremden ist mit einer Mütze bedeckt, die tief über die Ohren herabgezogen ist. Irgendetwas an der Art und Weise, wie er dasteht – die aufrechte Haltung, die schmalen Schultern –, bringt mich auf den Gedanken, dass es sich auch um eine Frau handeln könnte.
Die Person scheint mich am Fenster entdeckt zu haben, denn sie senkt das Fernglas. Unsere Blicke begegnen sich. Für einen Moment – nur wenige Sekunden lang – schauen wir uns an. Dann wendet sich die Person ab und geht weiter.
Als ich mein Handy zu mir herüberziehe, sehe ich den Namen meiner Lektorin aufblinken.
Ich bemühe mich um ein Lächeln. »Jane, hallo.«
Wir tauschen ein paar Artigkeiten über mein Schreibseminar und Janes Besuch bei der Frankfurter Buchmesse aus. Schließlich holt Jane Luft, was den unvermeidlichen Übergang vom Small Talk zum Geschäftlichen markiert.
»Also, eigentlich wollte ich mich nur mal melden und sicherstellen, dass wir den Abgabetermin nächsten Monat einhalten können.«
Meine Schultern versteifen sich. Das Buch ist bereits viele Monate überfällig. Ich habe Renovierungsmaßnahmen und Eheprobleme angeführt, und der Gerechtigkeit halber muss man sagen, dass Jane viel Verständnis gezeigt und den Termin zweimal verschoben hat. Mittlerweile ist sie aber mit der Geduld am Ende, was ich ihr nicht verübeln kann. Der endgültige Abgabetermin wurde für den zehnten Dezember festgesetzt; wenn der neue Roman dann nicht auf dem Tisch liegt, mache ich mich des Vertragsbruchs schuldig.
Während des Schreibseminars habe ich sogar ein bisschen über den Roman, den ich schreibe, nachdenken können – den ich nicht schreibe, besser gesagt. Seit Monaten schiebe ich Ideen hin und her und bin schon in so viele Sackgassen geraten, dass ich vollkommen das Selbstvertrauen verloren habe. Den richtigen Instinkt. Die Ideen sind nicht gut und nicht spannend genug, um die Handlung tragen zu können. Und wenn ich selbst nicht inspiriert bin und keine Begeisterung für die Geschichte aufbringen kann, wieso sollten die Leser es dann tun?
Das Zweiter-Roman-Syndrom, hat David, einer der Tutoren des Schreibseminars, das genannt.
»Hat man einen großen Erfolg gelandet«, hat er gesagt und sich in der Sonne geschmolzenen Brie auf einen Cracker geschmiert, »dann türmen sich all die Lobhudeleien der Kritiker und Leser vor dir auf. Dein Debüt war ein internationaler Bestseller und hat alle erdenklichen Preise eingeheimst. Die Leser warten sehnsüchtig auf deinen nächsten Coup. Da ist es kaum verwunderlich, dass du dich jedes Mal, wenn du dich über die Seiten beugst, mit tausend Erwartungen konfrontiert siehst. Du schreibst im Schatten eines Buchs.«
Im Schatten eines Buchs. Die Worte hallten in meinem Kopf wider, als ich, etwas benommen vom Rotwein, in meinem kühlen Raum lag, die Fensterläden weit geöffnet, damit ich die Vögel zwitschern hören konnte.
»Das Buch kommt gut voran«, sage ich jetzt zu Jane, während sich die Steifheit zwischen meinen Schulterblättern in die Wirbelsäule fortsetzt.
»Wir sind alle ganz wild darauf, es zu lesen«, sagt Jane aufgekratzt. »Könntest du dir vorstellen, mir schon einmal einen Teil zu schicken, damit ich mir einen Eindruck verschaffen kann? Ich würde den Designern gerne ein paar Anregungen für das Cover geben.«
Ich denke an das schlichte schwarze Notizbuch, das Gewirr von Wörtern, die mühselig zu Absätzen zusammengefasst wurden, die hingekritzelten Sätze, dann all die Seiten, die mit einer einzigen harten Linie durchgestrichen sind.
»Eigentlich bin ich gerade dabei, einen ganzen Handlungsfaden umzuschreiben. Wenn du nichts dagegen hast, würde ich es lieber beim zehnten Dezember belassen.«
Jane hat nichts dagegen – was bleibt ihr schon anderes übrig? Wir reden noch eine Weile über ein Interview, das mein Verleger mit der Zeitschrift Red ausgehandelt hat, wobei der Termin noch bestätigt werden muss. Bevor Jane auflegt, sagt sie: »Ich freue mich schon auf deine Liveschaltung auf Facebook.«
Ich schaue auf die Uhr. Noch eine Stunde.
Vor meinem Aufbruch nach Frankreich hat Jane mich dazu überredet, eine Reihe von Livevideos zu streamen, weil man auf diese Weise massenhaft Leser erreicht und schon vor der Veröffentlichung des Buchs die Werbetrommel rühren kann.
Als ich erklärte, ich wisse gar nicht, worüber ich reden solle, klang sie aufrichtig überrascht.
»Elle, du bist doch eine selbstbewusste, eloquente junge Frau. Du wirst das toll machen. Die Leser möchten einfach mehr über dich wissen – woher du deine Ideen hast, wie du schreibst, solche Sachen. Gib dich ganz locker. Vielleicht könntest du jede Woche mit einem Schreibtipp beginnen, du weißt schon: ›Was ich beim Schreiben gelernt habe‹ und solche Dinge. Und dann beantwortest du ein paar Fragen.«
Mir ist kein hinreichend guter Grund eingefallen, um mich zu weigern.
Jetzt teilt sie mir mit: »Wir haben es über unsere Social-Media-Kanäle gepusht, daher hoffen wir, dass viele Tausend Leute live dabei sind. Wir werden alle im Büro sitzen und die Daumen drücken.«
Alle diese Menschen werden mich anschauen. Mir Fragen stellen. Live. Kein Platz für Fehler. Keine Möglichkeit, etwas zu revidieren. Keine Möglichkeit, sich zu verstecken. Nur ich – die Schriftstellerin Elle Fielding – in meinem Schreibzimmer.
Ich lege das Handy hin und bemerke, dass ich schwitze.
Die Luft wird kühler, als ich die Treppe ins Obergeschoss hinaufsteige.
Für die Dauer der Airbnb-Vermietung habe ich mein Schreibzimmer abgeschlossen. Ich brauchte einen Ort, an dem ich meine Wertsachen verwahren konnte. Außerdem missfiel mir die Vorstellung, dass eine fremde Person an meinem Schreibtisch sitzen könnte. Komisch, ich weiß.
Ich ziehe den Schlüssel aus der Tasche und mühe mich eine Weile mit dem Schloss ab. Mehrfach drehe ich den Schlüssel hin und her, bis ich spüre, dass der Bolzen nachgibt. Dann öffne ich die Tür weit.
Licht durchflutet den Raum; die schimmernden Schattierungen des Meeres strömen durch die Glaswand und ergießen sich über die Holzdielen und die weißen Wände. Beim Entwurf diesen Raums wollte ich eine Umgebung schaffen, in der mein Geist über den Schreibtisch fliegen kann, über den Computerbildschirm und durch die Wände hindurch, um auf das endlose Versprechen des Horizonts zuzusegeln.
Auf überflüssigen Krempel habe ich bewusst verzichtet. Die einzigen Möbel sind ein alter Eichenschreibtisch und ein schlichtes Bücherregal aus aufgearbeiteten Gerüstplanken, in dem ein paar meiner Lieblingsromane und eine tönerne Öllampe stehen. In der Zimmerecke, mit Blick aufs Meer, steht noch ein Ohrensessel neben einer Truhe mit Notizbüchern, Fotos und Tagebüchern.
Als ich durch den Raum gehe, registriere ich überrascht den Salzgeruch in der Luft. Ich hätte eher erwartet, dass es stickig sein würde, nachdem der Raum zwei Wochen lang abgeschlossen war.
Und dann sehe ich es: Das kleine Fenster in der Ecke der Glaswand ist geöffnet. Ich bin überrascht. Normalerweise kontrolliere ich mehrfach, ob Türen und Fenster verriegelt sind. Dieses muss ich irgendwie übersehen haben. Während der Airbnb-Vermietung kann niemand in dem Raum gewesen sein, da ich ihn abgeschlossen und den einzigen Schlüssel mitgenommen habe.
Als ich mich an den Schreibtisch setze, habe ich die Sache bereits vergessen. Ich liebe diesen Schreibtisch. Vor vier Jahren habe ich ihn auf dem Kempton Market entdeckt. Damals wohnten Flynn und ich in einer Mietwohnung in Bristol, und ich hatte gerade mit der Arbeit an meinem ersten Roman begonnen. Die Zeit zum Schreiben musste ich mir von den Mittagspausen und von meinem Feierabend nach dem Schichtdienst abzwacken. Außer Flynn erzählte ich niemandem von meinen hochtrabenden Plänen, weil dieser Traum noch zu frisch war, zu zerbrechlich – als könne ein falscher Kommentar zerstörerische Kraft entwickeln. Als wir den Kempton Market verließen, sagte ich zu Flynn: »Sollte ich je einen Buchvertrag bekommen, werde ich mir als Allererstes einen solchen Schreibtisch kaufen.«
Ohne mein Wissen nahm Flynn Kontakt zu dem Verkäufer auf und ließ den alten Schreibtisch in die Garage seiner Mutter liefern. An den Wochenenden, an denen er dort zu Besuch war, verbrachte er Stunden damit, den Tisch herzurichten. Er bekämpfte den Holzwurm und schliff die Oberflächen ab, bis unter den Lackschichten das nackte Holz wieder zum Vorschein kam, selbst in den Rillen der gedrechselten Beine. Er tauschte Knäufe aus, wachste Führungsschienen und versiegelte Risse.
Ein Jahr später, als mein Roman endlich fertig war, druckte ich ihn sechs Mal aus, um ihn an Literaturagenturen zu schicken. Damals nahm Flynn mich mit und zeigte mir den Schreibtisch.
»Eigentlich wollte ich bis zu deinem ersten Buchvertrag warten«, begann er, als wir in der Garage seiner Mutter standen, mitten im beißenden Terpentingestank, »aber ich glaube, dieser Tag ist wichtiger. Du hast dein Buch vollendet, Elle. Egal, ob es nun veröffentlicht wird – oder vielleicht erst das nächste oder übernächste –, du bist jetzt eine Schriftstellerin.«
Der Timer an meinem Handy piepst.
Noch eine Minute.
Mein Magen revoltiert. Viele Tausend Leute werden live dabei sein.
Ich setze mich aufrecht hin und straffe die Schultern. Mir ist klar, was ich zu tun habe. Was alle von mir erwarten.
Konzentriert blicke ich auf den Laptop. Mein eigenes Gesicht erscheint auf dem Bildschirm, erfasst von der Computerkamera. Vielleicht liegt es am Neigungswinkel des Bildschirms oder daran, wie das Licht in den Raum strömt, aber im ersten Moment erkenne ich mich selbst nicht wieder.
Ich greife nach der Maus und lasse den Cursor über der Schaltfläche für die Liveschaltung schweben.
Klick.
Auf meinem Gesicht macht sich ein Lächeln breit. Ich höre es auch in meiner Stimme mitschwingen, als ich sage: »Hallo, alle miteinander. Ich bin die Schriftstellerin Elle Fielding und sende heute live aus meinem Schreibzimmer hier in Cornwall. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle dabei seid. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, möchte ich hinzufügen, dass ich Wilde Angst geschrieben habe, einen Psychothriller, der letztes Jahr veröffentlicht wurde. In den nächsten Wochen möchte ich euch von meiner langen Reise in die Literatur erzählen. Ich möchte euch an allem teilhaben lassen, was ich bislang gelernt habe, und eure Fragen beantworten. Also, vielleicht ist dies ein guter Moment, um meinen heutigen Schreibtipp loszuwerden. Es geht um etwas ganz Simples, das ihr alle tun könnt: Kauft euch ein Notizbuch. Nehmt es überallhin mit. Unser Kurzzeitgedächtnis kann Informationen nur drei Minuten lang speichern. Wenn man Ideen nicht sofort aufschreibt, gehen sie leicht verloren. Dies hier ist mein aktuelles Notizbuch«, sage ich und halte ein schlichtes schwarzes Heft hoch. »Ich trage es in meiner Handtasche mit mir herum und lege es nachts neben mein Bett und habe es auch sonst überall dabei. Dieses Heft erinnert mich daran, dass ich nie aufhöre, Schriftstellerin zu sein, egal, wo ich bin und was ich tue.«
Ich hüte mich davor, es aufzuklappen.
Einen Blick auf die Seiten zu gewähren.
Ich hole Luft. »Okay, jetzt könnt ihr mir Fragen stellen.« Ich schaue auf die linke Bildschirmseite, wo Zuschauer ihre Fragen in Echtzeit tippen. »Ich werde mein Bestes tun, so viele wie möglich zu beantworten. Die erste Frage stammt von Cheryl Down. Sie will wissen: ›Dein Debütroman war ein internationaler Bestseller. Setzt dich das beim Schreiben deines zweiten Romans unter Druck?‹«
Mir ist bewusst, dass Jane und ihre Kollegen zuschauen. »Ja, dieser Druck besteht natürlich. Das Gute ist aber, dass ich mit meinem zweiten Roman bereits vor der Veröffentlichung von Wilde Angst begonnen habe, als ich noch keine großen Erwartungen hatte. Ich muss zwar zugeben, dass ich mit der Fertigstellung ein wenig im Verzug bin – ich bin umgezogen und habe eine große Lesereise hinter mir –, aber die Dinge beruhigen sich allmählich. Jetzt werde ich mich ranhalten.«
Abgehakt.