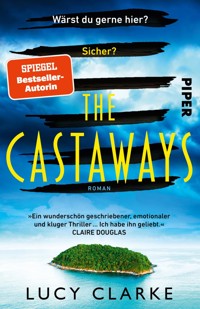Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: USM Audio
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Von diesem Ort hast du immer geträumt. Doch jetzt willst du nur noch weg. Mit einer Auszeit in Marokko will Bea ihr Leben neu sortieren. Doch nach einer gefährlichen Begegnung in den engen Gassen Marrakeschs sind Geld und Ausweis weg. Dass sie trotzdem einen Job ergattert, scheint wie ein Wink des Schicksals: Die Belegschaft eines Surfhotels an den endlosen, goldenen Sandstränden des Landes nimmt sie mit offenen Armen auf. Das Meer ist kristallklar, am Abend taucht die Sonne die roten Klippen in ein magisches Licht. Surfer und Yogis gehen ein und aus. Doch es dauert nicht lange, bis die Idylle Risse zeigt. Bea kommen Gerüchte über eine spurlos verschwundene Urlauberin zu Ohren. Dann spült die Brandung die Leiche eines Gastes an. Und Bea muss sich fragen, wem sie noch trauen kann …
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Zeit:9 Std. 53 min
Veröffentlichungsjahr: 2025
Sprecher:Julian HoreyseckJulia von TettenbornPia-Rhona SaxeHenrike TönnesJános Jung
Ähnliche
Über das Buch
Mit einer Auszeit in Marokko will Bea ihr Leben neu sortieren. Aber nach einer gefährlichen Begegnung in den engen Gassen Marrakeschs steht sie ohne Reisepass und Wertsachen da. Dass sie trotzdem einen Job ergattert, scheint wie ein Wink des Schicksals: Die Belegschaft eines Surfhotels an den endlosen goldenen Sandstränden des Landes nimmt sie mit offenen Armen auf. Doch es dauert nicht lange, bis die Idylle Risse zeigt. Bea kommen Gerüchte über eine spurlos verschwundene Urlauberin zu Ohren. Dann spült die Brandung die Leiche eines Gastes an. Und Bea beginnt sich zu fragen, wem sie noch trauen kann …
Von Lucy Clarke sind bei dtv außerdem erschienen:
One of the Girls
The Hike
Lucy Clarke
The Surf House
Du bist im Paradies. Doch das Paradies ist tödlich.
Thriller
Für die nächste Generation Surfer in der Familie … Cash, Theo, Maggie, Sienna, Lucia, Benji, Noah, Tommy und Darcy
Prolog
In brütender, dieselgeschwängerter Hitze fuhren wir die klappernde Rampe der Autofähre hinunter. Die Reifen berührten marokkanischen Beton. Der Geruch von Fisch und Gewürzen wehte durch unsere offenen Fenster herein.
Unser Konvoi bestand aus zwei Fahrzeugen mit Surfbrettern auf den Dächern. Fast so etwas wie eine Familie. In der Stadt, die einem Backofen glich, wollten wir nicht bleiben. Also fuhren wir stattdessen mit Vollgas zur Küste.
Wir alle hatten von den marokkanischen Wellen geträumt, die wir von Fotos und aus den Geschichten anderer Surfer kannten. Und wir werden nie den Moment vergessen, als wir sie das erste Mal vor dem afrikanischen Kontinent am Horizont aufsteigen sahen – tosende Wasserwände, die sich in die Bucht schoben und entlang der Riffkante in perfekten, vollkommen geraden Linien brachen.
Wir waren zu sehr mit Adrenalin vollgepumpt, um zu erkunden, wo die Strömungen verliefen und wie steil die Wellen bei Flut wurden. Wir wollten uns so schnell wie möglich in diesen blauen Wahnsinn stürzen.
Und so paddelten wir zu den ersten Wellen, mit Sonnenlicht in den Augen und dem Rauschen unseres Blutes in den Ohren, und bejubelten die Kunststücke der anderen. Erst als die Ebbe einsetzte, kehrten wir erschöpft und mit brennenden Nebenhöhlen, aber lachend, zum Ufer zurück.
Während der ersten Wochen surften wir nonstop. Marokko bestand für uns ausschließlich aus dem blauen Himmel, der weiß glühenden Hitze und der eiskalten Dünung des Atlantiks. Aus leeren Feldwegen, auf denen wir Staubwolken hinter uns aufwirbelten, während wir nach neuen Wellen suchten. Aus zerpflückten Fladenbroten, die wir mit den Händen aßen. Aus den zum Meer hin offenen Schiebetüren unserer Campingbusse. Aus Haschrauch, der uns in den Augen brannte, während wir uns im Schneidersitz am Feuer wärmten.
Es war ein pures und unbeschwertes Glück – ein Haufen Freunde, Wellen und Sonnenschein. Es fällt uns schwer zu akzeptieren, dass es vorbei ist.
Und noch schwerer zu glauben, was wir getan haben.
Nun müssen wir mit diesen Erinnerungen leben. Ein krachender Schuss in einer mondbeschienenen Wüste. Der Kupfergeruch einer Blutlache, die sich im Sand ausbreitet. Ein Leichnam, gehüllt in ein Strandtuch, der in finsterer marokkanischer Nacht erstarrt.
Die Wellen branden weiter heran, doch mit dem Traum ist es aus.
Wir haben ihn zerstört.
1
Bea verriegelt die Badezimmertür und lehnt sich mit dem Rücken daran. Die Hitze steht im Raum. Unter der dicken Make-up-Schicht kribbeln Schweißperlen auf ihrer Stirn.
Sie konzentriert sich auf ihre Atmung und versucht, tief Luft zu holen – doch das geht nicht, weil das bodenlange Corsagenkleid zu eng sitzt. Sie sehnt sich nach ihrem weiten T-Shirt und den Jeansshorts, die draußen an einer Kleiderstange hängen. Wie gerne würde sie jetzt ihre eigenen Sachen anziehen und sich in das Gewühl von Marrakesch stürzen.
Doch am Set warten alle auf sie – die anderen Models, der Fotograf, dessen Assistent, die Artdirektorin, das Beleuchtungsteam, die Stylistin und der Make-up-Artist. Bea ist seit vierundzwanzig Stunden in Marokko und bislang nur vom Flughafen zum Hotel und von dort zum Shooting gefahren. Sie hatte keine Zeit, über die malerischen Märkte zu spazieren, und auch noch nicht gelernt, die Einheimischen in deren eigener Sprache zu begrüßen. Sie ist hier – aber nicht hier.
Das Handy in ihrer verschwitzten Hand hört nicht auf zu piepen. Sie lässt sich auf den geschlossenen Klodeckel sinken und entsperrt es.
Das Display ist voller Nachrichten von ihrer Agentin. Darunter ein Terminplan für Castings und Anproben, wenn sie nächste Woche wieder in London ist. Sie stellt sich vor, wie sie kreuz und quer durch die Stadt fährt, mit anderen nervösen Models darauf wartet, beurteilt zu werden, und mit einem Maßband um die Hüften in kühlen Umkleidekabinen bibbert. Daten, Uhrzeiten und Orte verschwimmen vor ihren Augen. Sie fühlt sich, als würde sie auf einem Karussell fahren, das sich immer schneller dreht, die schrille Musik so laut, dass niemand hören kann, wie sie darum fleht, aussteigen zu dürfen.
Eine WhatsApp-Nachricht ihrer Mum poppt auf. Einen kurzen Moment lang regt sich leise Hoffnung in ihr – wie der Flügelschlag eines Schmetterlings. Seit ihre Mutter vor ein paar Wochen nach Spanien umgezogen ist, hat sie fast gar nichts mehr von ihr gehört.
Hallo aus Málaga! Könntest du mir einen Tausender paypalen, Süße? Nur sicherheitshalber. Bis wir uns hier eingerichtet haben, werden wir ein bisschen knapp bei Kasse sein. Du bist ein Schatz!
Bea starrt die Nachricht an und spürt Tränen in sich aufsteigen. Mit zusammengebissenen Zähnen lässt sie den Daumen über dem Handy schweben und überlegt, was sie darauf antworten soll, doch es fällt ihr nichts ein.
Schließlich löscht sie seufzend die Nachricht und schaltet ihr Handy aus.
Als sie aufsteht, tanzen schwarze Punkte vor ihren Augen und der Boden scheint zu schwanken. Bea streckt die Hand aus und stützt sich ein paar Sekunden lang an der Kabinentür ab, bis der Schwindel wieder verfliegt. Sie hat heute noch nichts gegessen.
Draußen nähern sich schnelle, klackernde Schritte. Sie verharren vor der Tür, und jemand klopft fest dagegen, das Klirren von Armbändern ist zu hören. »Bea? Alle warten auf dich.«
Bea ruft sich in Erinnerung, wie sie zu sein hat: strahlend, gefällig und fügsam.
Sie atmet so tief durch, wie es ihr mit dem Kleid möglich ist, richtet sich auf und entriegelt die Tür.
Der Fotograf geht in die Hocke. Die Linse ist fest auf Bea gerichtet. »Und los!«
Die beiden russischen Models, mit denen sie zusammenarbeitet, gehen auf die Kamera zu. Bea setzt sich eine Sekunde zu spät in Bewegung. Sie überquert mit ihren zehn Zentimeter hohen Absätzen den kunstvoll gefliesten Boden und versucht, ein Lächeln aufzusetzen. Klick. Schwingt übertrieben mit den Hüften. Klick. Hebt das Kinn. Klick. Klick.
Der Fotograf runzelt hinter seiner Kamera die Stirn. »Noch mal!«
Auf dem Rückweg zum Ausgangspunkt fühlt Bea einen stechenden Schmerz. Sie hat sich eine Blase gelaufen. Das Shooting findet in einem Riad in Marrakesch statt. Die Hitze hüllt alles ein und pulsiert zwischen den Wänden. Schweiß rinnt ihr an den Kniekehlen herab.
Der Fotograf schaut auf den Monitor und sieht Bea an. »Mehr Sex.«
Ihr Nacken wird heiß. Die anderen beiden Models werfen ihr einen Blick zu und wenden sich gleich wieder ab.
Mehr Sex, sagt Bea sich, als der Fotograf sie erneut anweist loszugehen.
Die russischen Models stolzieren mit wiegenden Schritten, werfen die Haare zurück und lächeln mit ihren strahlend weißen Zähnen. Bea will es ihnen nachmachen. Sie hebt die Mundwinkel und versucht, sich beschwingter zu bewegen, aber sie fühlt sich ungelenk, steif und verkopft. Normalerweise ist sie gut darin, den Vorstellungen eines Fotografen, Kunden oder Castingagenten zu entsprechen. Heute nicht.
Die Artdirektorin sieht verunsichert zum Fotografen. Der schüttelt den Kopf, und die beiden beginnen, miteinander zu flüstern.
Alle sind bereits seit Tagesanbruch am Set. Inzwischen ist es fast Mittag. Die Hitze ist gnadenlos, und sie hinken dem Zeitplan hinterher.
»Wir machen fünf Minuten Pause«, sagt die Artdirektorin mit angespanntem Lächeln. »Sacha, du musst Beas Make-up auffrischen.«
Sacha erhebt sich seufzend und deutet ungeduldig auf seinen Stuhl.
Bea geht zu ihm und nimmt Platz. Das Kleid spannt über ihren Rippen und zwingt sie dazu, kerzengerade zu sitzen. Sacha sagt kein Wort, während er ihr mit verschiedenen Pinseln über das Gesicht streicht.
Bea ist einen Moment lang nicht auf der Hut und sieht sich im Spiegel an. Das Make-up ist dick aufgetragen. Ihre Wangenknochen sind konturiert, der rote Lippenstift lässt ihren Mund breiter erscheinen. Ihr Blick fällt auf ihre vorstehenden Schlüsselbeine und die spitzen Schultern. Die Haare sind ihr aus der Stirn gekämmt und zu einem hohen Dutt zusammengefasst, der an ihren Schläfen ziept. Ihre dichten Augenbrauen wurden noch mal extra betont und so gebürstet, dass Beas Gesicht nur aus Ecken und Kanten zu bestehen scheint.
Sie starrt ihr Spiegelbild an und kann sich nicht darin erkennen. Ihre Gesichtszüge scheinen sich zu verzerren und zu verschwimmen. »Wer bist du?«
Sacha zieht die Hand mit dem Rougepinsel zurück. »Was?«
Bea blinzelt. Anscheinend hat sie den Gedanken laut ausgesprochen. »Nichts.«
Nun macht sich die Hairstylistin an ihr zu schaffen und zieht mit schwitzigen Händen lose Strähnen straff. Bea bemüht sich, nicht zusammenzuzucken.
Hinter ihr, in der Mitte des Riad, plätschert leise der Springbrunnen. Bea fragt sich, wie kühl das Wasser wohl sein mag und wie es sich auf ihren Schlüsselbeinen anfühlen würde. Sie will unbedingt einen Blick darauf werfen und lugt an Sachas Make-up-Pinsel vorbei.
Ein winziger Vogel landet im Brunnen und putzt sich. Von seinen zarten Flügeln spritzen Tropfen. Bea betrachtet seine zerbrechlich wirkenden Beine, den Miniaturschnabel und die schwarzen Knopfaugen. Er wirkt fröhlich, als er sich noch einmal schüttelt, die Flügel ausbreitet und diesen unerträglich stickigen Ort wieder verlässt.
Ich muss hier weg, flüstert eine Stimme in ihrem Hinterkopf.
Der Fotograf, sein Assistent und die Artdirektorin drängen sich um den Monitor und mustern Beas vergrößertes Abbild.
»Mach irgendwas mit den Augenbrauen«, schnauzt der Fotograf den Make-up-Artist an. »Bändige sie.«
Die Artdirektorin deutet auf das Display. »Das hier macht mir mehr Sorgen.«
Sie deutet auf die Taille von Beas Kleid, wo sich der Stoff spannt.
Bea weiß, was sie denken: dass sie seit der Anprobe letzte Woche zugenommen hat. Aber wie kann das sein? Sie hat doch kaum etwas gegessen. Gestern hatte sie nur ein leichtes Abendessen – ohne Kohlenhydrate. Und heute Morgen hat sie extra das Frühstück im Hotel ausfallen lassen, obwohl ihr vom Geruch des frischen, butterzarten Gebäcks der Magen geknurrt hat.
Sie vergräbt die Fingernägel in ihre Handflächen. Sacha weist sie an, die Augen zu schließen, und sie spürt, wie er den Eyeliner druckvoll über die Wurzeln ihrer Wimpern zieht.
Die Luft füllt sich mit einem süßlichen, chemisch riechenden Haarspraynebel. Bea merkt, dass sie nicht atmen kann. Sie bekommt einfach nicht genügend Luft. Ihre Haut fühlt sich heiß an, und ihr Kleid sitzt zu eng. Schweiß sammelt sich unter ihren Armen.
Sie will sich Sacha entwinden und davonlaufen. Diesen Stuhl verlassen. Diesen Riad verlassen. Dieses Shooting verlassen.
In Gedanken hört sie die Stimme ihrer Mutter: Wir geben niemals auf.
Und die Stimme ihrer Agentin: Hunderte von Mädchen warten nur darauf, an deine Stelle zu treten.
Sie lauscht auf ihre eigene innere Stimme und hört ein leises Flüstern: Verschwinde …
»Es sind ihre Augen«, sagt der Fotograf. »Es ist überhaupt kein Leuchten in ihnen.«
Bea versucht, ihren Körper zu verlassen und sich neben sich zu stellen – ein Trick, den sie sich vor Jahren ausgedacht hat, um ihren Job besser ertragen zu können. Denn dann ist es nicht mehr sie – Bea –, in deren Augen kein Leuchten ist, deren Brauen zu männlich wirken, die Taille zu umfangreich und der Körper nicht sexy genug. Die Hände, die sie überall anfassen, werden sich nicht mehr so übergriffig anfühlen, wenn sie woanders ist.
Doch heute schafft sie es nicht. Die Stimmen, die Hände, die Blicke, die Hitze und der Hunger sind überwältigend.
»Ich muss …« Sie stemmt sich vom Stuhl hoch und setzt sich auf ihren Absätzen unsicher in Bewegung, um einen kühleren und ruhigeren Ort zu suchen. Doch den gibt es nicht. In dem Riad wimmelt es von Leuten. Sie geht an den schmallippig lächelnden russischen Models vorbei zu dem Marmorspringbrunnen, der von bunten Kletterpflanzen umrankt ist.
Bea taucht die Hände in das kühle Wasser und seufzt erleichtert.
Irgendwo hinter ihr ruft der Fotograf, dass die Pause beendet sei. Doch sie rührt sich nicht und lässt mit langsamen Atemzügen die Finger durchs Wasser kreisen.
Unmittelbar hinter ihrer Schulter sagt jemand: »Wir fangen wieder an.«
»Okay«, gibt sie zurück, und die Schritte entfernen sich wieder. Sie zieht die Hände aus dem Wasser und öffnet ihren linken Schuh. Danach den rechten. Vom Druck befreit, wackelt sie mit den Zehen. Dann rafft sie ihr Kleid und steigt ins Becken.
Kaltes Wasser umschmeichelt ihre geschwollenen, blasigen Füße. Sie spürt glitschige Algen zwischen den Zehen und kneift sie zusammen. Ihr ist klar, dass der Selbstbräuner, den Sacha am Morgen großzügig auf ihre blasse Haut aufgetragen hat, im Wasser abgehen wird.
Es fühlt sich sehr gut an, inmitten von lebenden, atmenden Pflanzen in diesem kühlen, dunklen Wasser zu stehen. Sie beugt sich vor und hält das Gesicht unter einen der Strahlen. Das Wasser prasselt ihr auf die Stirn, rinnt seitlich an ihrer Nase herab und läuft ihr in den Mund. Sie neigt den Kopf zurück, und es fließt ihr in die Haare, den Nacken hinunter und über die Schulterblätter.
Bea lässt sich komplett ins Wasser sinken. Der Stoff des Kleides wird dunkel und bauscht sich.
Am Rande nimmt sie wahr, wie jemand nach Luft schnappt.
Irgendwer kreischt: »Das Kleid!«
Doch die Worte perlen an Bea ab. Endlich hat sie es geschafft, aus sich hinauszutreten. Ihr Körper liegt in dem kühlen ruhigen Wasser, ihre Haut saugt es dankbar auf. Doch sie selbst schwebt irgendwo darüber, in dem weiten blauen Himmel, zusammen mit dem winzigen Vogel. Sie lächelt und ist sicher, dass ihre Augen endlich zu leuchten beginnen.
2
»Weißt du eigentlich, wie viele Mädchen jemanden umbringen würden, um für diesen Kunden modeln zu können?«, fragt Madeline.
Bea sitzt auf dem Boden ihres Hotelzimmers. Das Handy fühlt sich an ihrer Wange heiß an. Sie hat sich das Make-up von der Haut geschrubbt und das Stylingprodukt aus den Haaren gewaschen. Nun hängen sie nass auf ihrem Rücken und durchtränken ihr Baumwoll-T-Shirt.
»Wenn du mit irgendetwas ein Problem hast – dann sprichst du mit mir. Wir finden eine Lösung, und ich erkläre es dem Kunden.« Einen Moment lang herrscht Schweigen. »Aber du steigst nicht in einem neuntausend Pfund teuren Couture-Kleid in einen Brunnen.«
So etwas hat Bea noch nie getan. Sie kommt immer pünktlich. Sie ist höflich zu den Kunden und beschwert sich nicht, wenn sie sich nicht ungestört umziehen kann oder in einem Outfit noch Nadeln stecken. Sie akzeptiert die Shootings, die Madeline für sie bucht. Sie schreitet über die Laufstege, lächelt und wiegt sich für die Kameras in den Hüften.
»Dein Portfolio wird immer umfangreicher«, fährt Madeline fort. »Du wirst für großartige Jobs gebucht. Du könntest echt ein Star werden.« Wieder macht sie eine kurze Pause. »Aber nicht, wenn du jemals wieder so einen Schwachsinn wie heute abziehst. Ich muss sicher sein können, dass du es ernst nimmst. Dass du es willst.« Diesmal schweigt sie länger. »Willst du wirklich ein Model sein?«
Bea steht auf, durchquert das Zimmer und passiert den Spiegel, vor den sie ein Halstuch gehängt hat, um ihr Spiegelbild nicht sehen zu müssen.
Sie lehnt sich an den Fensterrahmen und blickt über die Dächer von Marrakesch. Unter ihr sind Touristen und Einheimische unterwegs. Sie reden, kaufen, verkaufen, drängeln, leben.
Willst du wirklich ein Model sein?
Sie hat sich diesen Beruf nicht ausgesucht. Er ist zu ihr gekommen. An einem verregneten Samstagmorgen in einem Einkaufszentrum in Reading. Eine Talentsucherin ist auf sie aufmerksam geworden und hat sich ihr und ihrer Mutter vorgestellt. Sie hat den beiden von ihrer Agentur erzählt und Bea zu Probeaufnahmen eingeladen. Bea hat sich suchend nach einer Gruppe lachender Schulkinder umgesehen, sicher, dass das nur ein Scherz sein konnte. Models sollten schön sein – und als schön hatte sie noch nie irgendjemand bezeichnet. Sie war schlaksig und schien nur aus Ellbogen und Knien zu bestehen. Ihre Augenbrauen waren wild und buschig. Ihre Augen standen so weit auseinander, dass die Mädchen in ihrer Klasse sie Weltraum-Bea nannten.
Als die Talentsucherin weg war, ging ihre Mutter mit ihr in ein Restaurant zum Mittagessen. Ihre Wangen waren vor Freude über die unverhofft guten Zukunftsaussichten ihrer Tochter ganz rosig – die Reisen um die Welt, die Designerstücke, das Geld. Sie war so sehr aus dem Häuschen, dass Bea fälschlich glaubte, selbst begeistert zu sein.
Hat es ihr je Spaß gemacht? Backstage kommt es manchmal zu freundschaftlichen Begegnungen, bei denen sie mit den anderen Models lacht. Bei ihrer ersten Show saß ihre Mutter in der ersten Reihe und klatschte. Es ist aufregend, von einem wichtigen Modeschöpfer gecastet zu werden. Aber meistens ist sie einsam und erschöpft. Jeden Tag kämpft sie mit ihrem Gewicht. Es ist zermürbend, ständig gesagt zu bekommen, was an ihrer Erscheinung stimmt und was nicht – und nicht selbst über ihr Äußeres bestimmen zu können. Und es bereitet ihr Gewissensbisse, mehr Geld als Krankenschwestern oder Lehrer zu verdienen, obwohl sie lediglich ein wandelnder Kleiderständer ist.
Doch andere Mädchen sehnen sich nach diesem Beruf. Es gibt mehrere Unterhaltungsshows, in denen sich Leute den Traum einer Topmodelkarriere zu erfüllen versuchen. Eigentlich müsste Bea vor Glück und Selbstvertrauen nur so strotzen. Was stimmt bloß nicht mit ihr? Sie ist erst dreiundzwanzig. Dieses Leben sollte turbulent und aufregend sein, intensiv und emotional. Doch sie fühlt sich …
Bea starrt aus dem Fenster und fragt sich, was sie eigentlich fühlt. Sie versucht, es zu öffnen und die Geräusche der Stadt hereinzulassen, doch es lässt sich nicht entriegeln. Also gibt sie auf und legt die flache Hand an die Scheibe. Sie kommt sich vor, als wäre sie unter Wasser und würde zur Oberfläche hinaufblicken. Der Rest der Welt liegt vor ihr, wabert jedoch außerhalb ihrer Reichweite.
»Bea?«, reißt Madelines Stimme sie aus ihren Grübeleien.
Sie wartet auf eine Antwort.
Bea kann nur daran denken, dass man irgendwann ertrinkt, wenn man zu lange unter Wasser bleibt.
Sie hält sich das Handy ganz dicht an den Mund. »Ich will es nicht.«
Bea nimmt das Tuch vom Spiegel und legt es sich um den Hals. Dann nimmt sie ihren Rucksack und geht.
Sie läuft so schnell durch die Hotellobby, dass eine Frau mit einem jadegrünen Kopftuch von ihrer Zeitung aufblickt, weicht zwei Touristinnen aus, die mit Einkaufstüten beladen von der Medina zurückkehren, und geht zur Rezeption. »Ich checke früher aus als geplant«, erklärt sie und gibt ihren Schlüssel zurück. Sie kann nicht hierbleiben, da sie auf keinen Fall irgendjemandem vom Shooting begegnen möchte. Für heute Nacht wird sie sich eine andere Bleibe suchen müssen und morgen wie geplant nach London zurückfliegen.
Sie bekommt ihren Pass ausgehändigt und verstaut ihn im Rucksack. Dann tritt sie ins gleißende Sonnenlicht hinaus, wo ihr die Geräusche aus der Medina entgegenbranden – eine Kakofonie aus Musik, Gesprächen und den Rufen von Marktschreiern: »Lady, Lady …«
Bea bahnt sich einen Weg durch das Gedränge zum Hauptplatz und nimmt mit großen Augen das Chaos und die pulsierenden Farben um sich herum wahr. Leise Musik lenkt ihre Aufmerksamkeit zu einem Flechtkorb, aus dem sich eine züngelnde Schlange erhebt. Ein Junge taucht neben ihr auf und präsentiert ihr eine Schnur, an der bestickte Taschen baumeln. Ein junges Mädchen in gegerbten Ledersandalen trägt zwei kopfüber hängende, gackernde Hühner an ihr vorbei.
Bea umklammert die Riemen ihres Rucksacks und ärgert sich darüber, dass er so schwer ist. Vor ihr schiebt ein gebückter Mann in einer Djellaba einen mit marokkanischen Flaggen dekorierten Karren. Durstig sieht sie zu, wie der automatische Entsafter darauf goldene Orangen auspresst. Sie hat den ganzen Tag noch nichts getrunken oder gegessen und fühlt sich vollkommen leer.
Sie kramt in ihrer Tasche nach ein paar Dirham und gibt sie dem Mann. Im Gegenzug reicht er ihr strahlend ein großes Glas frisch gepressten Saft und sagt: »Bisaha ou raha.«
Sie führt sich das Glas an die Lippen. Der Saft schmeckt wunderbar. Sie trinkt mit geschlossenen Augen, wischt sich mit dem Handrücken den Mund ab und reicht dem Verkäufer dankend das Glas zurück. Dabei fühlt sie sich, als würde sich in ihren Adern flüssiger Sonnenschein ausbreiten.
In der Nähe lehnen zwei junge Männer an einer Säule und unterhalten sich miteinander. Der größere der beiden trägt ein rotes Fußballtrikot. Er schiebt sich die Sonnenbrille in die Haare und schaut Bea an. Grinsend entblößt er seine krummen Schneidezähne. Sie nickt und geht weiter, vorbei an einer Reihe von Händlern, die ihre Waren vor sich auf dem Boden ausgebreitet haben. Sie verkaufen Silbernippes, gewebte Mützen und handgeschnitzte Holzschüsseln.
Bea lässt sich von der Menschenmenge mitreißen und betritt den Gewürz-Souk, wo haufenweise Safran, Kurkuma und Zimt darauf warten, in Papiertüten abgefüllt zu werden. Die stehende Luft ist von intensiven Aromen erfüllt.
Die Medina ist extrem unübersichtlich – ein Gewirr aus engen Gassen, schattigen Laubengängen und Holztüren. Im Gehen lässt sie noch einmal den Tag Revue passieren und denkt an die entgeisterten Blicke, als sie in den Brunnen gestiegen ist.
Sie malt sich die frostige Reaktion ihrer Mutter aus, wenn sie ihr erzählen wird, dass sie alles hingeschmissen hat. Und jetzt, du Genie?, wird sie fragen.
Bea weiß nicht, was als Nächstes passieren wird. Seit dem Umzug ihrer Mutter nach Spanien hat sie kein Zuhause mehr, zu dem sie zurückkehren kann. Ihre wenigen Habseligkeiten hat sie eingelagert. Wenn sie in London ist, steigt sie in günstigen Hotels ab. Sie hat keine eigene Wohnung und weder Verwandte noch Freunde, bei denen sie unterschlüpfen könnte. Wie lange die zweitausend Pfund auf ihrem Bankkonto wohl noch reichen werden?
Die Hitze nimmt weiter zu und droht sie zu überwältigen. Am Rücken unter ihrem Rucksack sammelt sich Schweiß. Sie sieht nach links und rechts und biegt aufs Geratewohl ab, ratlos, wo sie sich befindet und wie sie wieder aus der Medina hinauskommen soll. Sie braucht Platz und kühle Luft. Einen Ort, an dem sie sich in den Schatten setzen und den Rucksack abnehmen kann. Die Gässchen werden immer enger und dunkler, und sie hat das Gefühl, tief in ein Labyrinth vorgedrungen zu sein.
Sie wischt sich über die Stirn und schaut sich um. Hier gibt es keine Touristen mehr – und auch keine Verkaufsstände. Sie hat nicht auf den Weg geachtet und merkt, dass sie sich vollkommen verlaufen hat.
Bea dreht sich im Kreis. An diesem halb verfallenen, nach Diesel und Urin riechenden Ort gibt es niemanden, den sie um Hilfe bitten könnte. Sie ist allein.
Bea lockert das Halstuch, um etwas mehr Luft an die Haut zu lassen. Sie geht weiter, ohne zu wissen, wohin. Die Gasse wird noch enger, und sie fühlt sich von allen Seiten eingeschlossen.
Ein Schauder läuft ihr über den Rücken. Sie spürt, dass sie nicht allein ist.
Hinter ihr erklingen Schritte.
Bea lauscht. Es sind zwei Personen – den Geräuschen nach zu urteilen Männer.
Auf ihren Armen breitet sich eine Gänsehaut aus.
Sie riecht Zigarettenrauch und hört etwas Nasses auf den Boden klatschen. War das Spucke?
Eine Stimme erklingt. Ein Mann. Er spricht Englisch, mit starkem Akzent: »Hey, Lady. Du verlaufen?«
»Nein«, erwidert sie, ohne stehen zu bleiben oder sich auch nur umzudrehen. Sie geht schneller und umklammert die Riemen ihres Rucksacks.
Die Schritte hinter ihr beschleunigen sich ebenfalls.
Ihr Puls beginnt zu rasen. Sie passiert einen alten, ausrangierten Generator. Die nächsten beiden Türen sind mit Brettern vernagelt. Und dann taucht vor ihr eine Wand auf.
»Lady, wir helfen dir.«
Sie muss sich umdrehen. Es bleibt ihr gar nichts anderes übrig. Sie ist in eine Sackgasse geraten.
Bea schluckt, nimmt allen Mut zusammen und wendet sich mit weiß hervortretenden Fingerknöcheln langsam um.
Zwei Männer verstellen ihr den Weg. Der vordere ist kleiner. Sein dünnes schwarzes Haar umrahmt fransig seine Stirn. Sein Blick ist unstet, und er tritt rastlos von einem Fuß auf den anderen.
Sein Begleiter ist unrasiert und trägt ein rotes, am Ärmel zerrissenes Fußballtrikot. In seinem Mundwinkel hängt eine Zigarette. Er trägt eine Sonnenbrille auf dem Kopf und lächelt sie mit krummen Zähnen an.
Bea erstarrt: Sie hat die beiden auf dem Hauptplatz gesehen.
Sie haben sie verfolgt.
Der Mann mit dem Fußballtrikot mustert sie gierig. Sein Blick wandert über ihren Körper. Eine uralte Angst durchzuckt sie: Sie ist eine Frau und allein. Nehmt meine Sachen, denkt sie. Aber bitte fasst mich nicht an.
»Wohin wollen, hübsche Lady?«, fragt er und tritt einen Schritt vor. Würde er jetzt den Arm ausstrecken, könnte er sie berühren.
»Ich treffe mich mit meinem Mann«, sagt sie – merkt aber selbst, wie wenig überzeugend das klingt.
Er sieht ihre Hände an. Kein Ring. Er grinst.
»Wir bringen dich zu ihm«, sagt der Kleinere, unruhig trippelnd. »Vielleicht er gibt uns Belohnung, weil wir dich zurückbringen?« Er lacht, was Bea noch nervöser macht.
Inzwischen ist sie sicher, dass die beiden sie nicht bloß beklauen wollen. Diebe sind grundsätzlich auf Schnelligkeit bedacht.
Die beiden versperren ihren einzigen Fluchtweg.
»Dein Tasche sieht schwer aus«, sagte der Kleinere. »Wir helfen dir damit.«
Fieberhaft denkt Bea darüber nach, was sie tun soll, und beschließt mitzuspielen. »Danke.« Sie nimmt den Rucksack ab und reicht ihn dem kleineren Mann.
Mit einem selbstgefälligen Grinsen setzt er ihn sich auf den Rücken und sucht den Blick seines Freundes. Er sieht aus, als wolle er gehen.
Doch der Mann mit dem Fußballtrikot fixiert noch immer Bea und lässt erneut den Blick an ihr herabwandern. Sie ist froh über das Tuch, das ihren Ausschnitt bedeckt.
Er nimmt die Zigarette aus dem Mund, schnippt sie weg und streckt die Hand aus. Ohne ihr Gesicht aus den Augen zu lassen, greift er nach einem Ende des Tuchs und wickelt es ihr langsam vom Hals. Sein Atem stinkt nach Zigaretten, und ein ungewaschener, erdiger Geruch geht von ihm aus. Als er das Tuch abgewickelt hat, lässt er es zwischen ihnen auf den Boden fallen.
Bea hebt instinktiv eine Hand, um ihren Hals zu bedecken. Dabei berührt sie die Goldkette, die sie von ihrer Mutter zum ersten Modeljob bekommen hat. Der Anhänger besteht aus ihrem kursiv geschriebenen Namen. Sie weiß noch, wie sie die Schachtel aufgemacht und sich gefühlt hat, als würde sie eine Auster öffnen und eine Perle darin entdecken. Für meine Tochter, das Model, hatte ihre Mutter dazugeschrieben.
Als der Mann die Kette ansieht, bereut sie sofort, dass sie seine Aufmerksamkeit darauf gelenkt hat.
»Sehr hübsch«, sagt er grinsend. Dann wird sein Blick hart. »Nimm das ab.«
Bea bewegt sich nicht. Sag aber auch nicht Nein.
Er lacht. »Sonst ich mache es.«
Sie sieht ihm an, dass das keine leere Drohung ist.
Der andere Mann blickt über die Schulter und zischt etwas auf Arabisch. Bea versteht zwar nicht, was er sagt, spürt aber, dass irgendetwas vor sich geht, womit die beiden nicht gerechnet haben.
Der Mann mit dem Trikot ignoriert den anderen und sieht weiter Bea an. »Jetzt.«
Sie fummelt am Verschluss herum, doch ihre Hände sind feucht, die Fingerspitzen taub.
Genüsslich sieht er dabei zu, wie sie sich abmüht.
Schließlich geht die Schließe auf, und sie nimmt die Kette ab. Als das federleichte Gewicht von ihrem Nacken verschwindet, kommt es ihr vor, als würde sie ein Körperteil von sich hergeben. Sie streckt die Hand aus.
Auf ein Zeichen des Mannes kommt sein rastloser Kumpel und nimmt Bea die Kette aus der Hand. Anschließend tritt er, unter dem Gewicht des Rucksacks leicht gebeugt, wieder ein paar Schritte zurück.
Der Mann mit dem Fußballtrikot streckt seinen nikotinfleckigen Zeigefinger nach Beas Hals aus. »Was werde ich sonst noch finden?«
Als er ihr Schlüsselbein berührt, fühlt sich seine Fingerspitze wie eine Pistolenmündung an. Bea hört nur noch ihren dröhnenden Herzschlag, der sie für die Flucht oder den Kampf wappnet.
Er fährt mit dem Finger über ihr Schlüsselbein und starrt sie mit zusammengekniffenen Augen an. Aus seinem Blick spricht purer Hass. Beas Eingeweide fühlen sich an, als wären sie mit Eis gefüllt.
Sie zieht sich aus ihrem Körper zurück, ist nicht mehr länger damit identisch. Sie schwebt über sich selbst und sieht zu, wie er mit dem Finger von ihrem Schlüsselbein nach unten über ihre rechte Brust fährt und sie in die Brustwarze kneift. Im nächsten Moment packt er sie grob mit beiden Händen an den Hüften und stößt sie so fest gegen die Wand, dass sie mit dem Hinterkopf dagegenknallt.
Ein Schrei erklingt. Jemand kommt brüllend angerannt.
Die Männer zucken zusammen.
Eine dunkelhaarige Frau herrscht die beiden mit gebleckten Zähnen auf Französisch an und bedroht sie mit einem Messer.
Der Kleinere macht auf dem Absatz kehrt und rennt davon. Der andere lässt die Hände von Beas Hüften sinken und sieht die Frau an.
Bea bemerkt, dass sie relativ klein ist – höchstens eins sechzig. Sie trägt eine dunkle Pluderhose und eine beige Umhängetasche und ist ein paar Jahre älter als Bea. Ihre Arme sehen muskulös aus, und ihre Augen sind angriffslustig zusammengekniffen.
Der Mann scheint ebenfalls den Eindruck zu haben, dass mit ihr nicht zu spaßen ist, denn er hebt beschwichtigend die Hände.
Die Frau beobachtet mit Argusaugen, wie er den Rückzug antritt und an ihr vorbeigeht. Er bedenkt sie mit seinem schiefen Lächeln, als wolle er sie zu ihrem Sieg beglückwünschen.
Sie richtet weiter mit ruhiger Hand das Messer auf ihn und hält seinen Blick fest.
Blitzartig lässt er die linke Faust vorschnellen. Der Hieb trifft ihr Handgelenk. Das Messer fliegt in hohem Bogen davon und landet klirrend auf dem Betonboden.
Der Mann drückt die Frau an die Wand, packt sie am Hals und sagt dicht an ihrem Ohr etwas auf Französisch.
Ihre Augen quellen hervor. Sie tritt nach ihm und versucht, sein Gesicht zu zerkratzen, doch er hält eisern ihre Kehle fest.
Bea sieht wie erstarrt zu.
Nun legt er ihr beide Hände um den Hals. Er erwürgt sie!
Bea hört ein gequältes Keuchen. Die Frau ringt nach Luft. Ihre offenkundige Todesangst reißt Bea aus ihrer Trance.
Das Messer! Es liegt unbeachtet auf dem Boden. Beas Blick erfasst den Holzgriff und die silbrige scharfe Klinge.
Das Gesicht der Frau verfärbt sich rot. An ihren Schläfen treten die Adern hervor.
Er wird sie umbringen.
Nein, denkt Bea. Das darf nicht sein.
Sie hebt hastig das Messer auf und stürzt sich auf den Angreifer.
Sie rammt ihm das Messer seitlich in den Hals und spürt, wie es Knorpel, Fleisch, Sehnen und Bänder durchtrennt.
Der Mann stößt einen hohen, schockierten Schrei aus. Er greift sich an den Hals und wirbelt herum.
Seine Finger umschließen den Messergriff. Mit ungläubigem Entsetzen sieht er Bea an.
Dann reißt er sich das Messer aus dem Hals.
Es fällt klirrend zu Boden. Die Klinge ist voller Blut.
Bea sieht zu, wie er nach hinten taumelt und mit dem Rücken an die Wand stößt. Ein schrecklicher rubinroter Strahl pulsiert aus der Wunde.
Er drückt mit den Fingern darauf, kann die Blutung aber nicht stillen.
Seine Augen sind panisch aufgerissen. Er öffnet den Mund, als wolle er etwas sagen, bringt jedoch nur ein entsetzliches Gurgeln heraus. Bea beobachtet, wie seine Beine unter ihm nachgeben und er an der Wand herabrutscht. Sein blutiges Trikot wirkt fast schwarz.
Bea ist wieder wie erstarrt.
»Komm, weg hier!«, sagt die Frau hinter ihr.
Bea braucht einen Moment, um zu begreifen, dass sie mit ihr spricht.
Bea starrt sie stumm an.
Die Frau hebt rasch Beas Halstuch auf, wickelt das blutige Messer darin ein und klemmt sich das Bündel unter den Arm.
Mit der freien Hand greift sie nach Bea und läuft mit ihr davon.
3
Sie atmen schnell und flach. Ihre Sohlen knallen laut auf den Boden, während sie durch die verwinkelten Gassen rasen.
Als sie vor sich Touristen sehen, werden sie langsamer und mischen sich unter sie.
Beas Herz trommelt gegen ihre Rippen. Sie wirft einen Blick zu der Frau neben sich, die zwar schnell geht, aber nicht gehetzt wirkt. An ihrer Kehle prangen rote Fingerabdrücke.
»Ich … ich habe ihn erstochen«, flüstert Bea.
Die Frau hält den Blick geradeaus gerichtet.
Bea zittert am ganzen Körper. Sie hat einem Mann ein Messer in den Hals gestoßen. »Habe … habe ich ihn getötet?«
Die Frau sieht sie von der Seite an. Ihre Augen sind hellblau und funkeln wie nasses Meerglas. »Andernfalls hätte er uns getötet.«
Bea blickt über die Schulter zurück. »Und jetzt?« Ihre Stimme klingt dünn, atemlos.
»Wir hauen von hier ab.«
»Die Polizei. Wir müssen sie verständigen.«
»Wir hatten eine Waffe. Es würde Ermittlungen geben. Dann landest du vielleicht …« Sie muss den Satz nicht beenden. Bea kann es sich auch so gut vorstellen: das marokkanische Rechtssystem, verzweifelte Anrufe bei der Botschaft, die abgestandene Luft einer Gefängniszelle. Sie hat das Gefühl, den Verstand zu verlieren.
»Wo wohnst du?«, fragt die Frau.
Bea sieht sie verständnislos an.
»Kannst du irgendwohin?«, versucht die Frau es noch einmal.
»Ich … ich habe gerade aus meinem Hotel ausgecheckt. Ich wollte mir für heute Nacht eine neue Unterkunft suchen … Mein Flug geht morgen.« Schlagartig wird ihr etwas klar. »Mein Rucksack! Der andere Mann hat ihn mitgenommen. Mein Pass war da drin …« Sie klopft ihre Taschen ab und spürt nur das flache Rechteck ihrer Debitkarte.
»Melde ihn besser noch nicht als verloren. Du willst nicht, dass er mit dieser Gasse in Verbindung gebracht wird.«
Bea bleibt unsicher stehen. Ein Mann mit einem zusammengerollten Teppich über der Schulter schlängelt sich an ihr vorbei. »Aber was mache ich denn jetzt bloß? Wo soll ich denn hin?«
Die Frau schaut sie nachdenklich an. Schließlich wird ihr Blick weich. »Du kommst mit zu mir.«
Im Schatten parkt ein dunkelgrüner Campingbus. Bea klettert ins Fahrerhaus. Die warme Luft riecht nach Neopren und Kokosnuss.
Die Frau stellt sich Bea als Marnie vor und dreht den Zündschlüssel.
Das protestierende Grollen des Motors wird von dem fetten Reggaebeat übertönt, der aus einem alten Lautsprecher schallt. Ohne die wummernde Musik leiser zu machen, legt Marnie den Gang ein und parkt aus. Am Innenspiegel baumelt ein Traumfänger.
Sie wirkt hinter dem Lenkrad zierlich, navigiert das breite Fahrzeug aber mühelos durch den Verkehr, eine Hand permanent auf der Hupe. Die Straße ist mit Autos, Lastwagen, Motorrädern, Eseln und Fahrrädern vollgestopft, die miteinander um den wenigen Platz wetteifern.
Bea wirft einen Blick nach hinten in den Bus. Er enthält ein kleines Waschbecken, einen Campingkocher, Holzschubladen und ein Gewürzregal. In Drahtkörben schwingen Zimmerpflanzen, und unter dem Dach sind zwei Surfbretter festgezurrt.
Es fühlt sich alles unwirklich an, als würde sie mit offenen Augen einen Albtraum erleben. Sie zwickt sich in die empfindliche Innenseite ihres Oberschenkels.
Marnie sagt kein Wort, während sie das Chaos der Stadt hinter sich lassen. Allmählich werden die Straßen breiter und winden sich durch eine weite, staubige Landschaft. In der Ferne ragen rote Berge auf. Sie fahren an Straßenverkäufern vorbei, die billige Elektronikprodukte und getöpferte Tajines anpreisen.
Bea merkt, dass die dröhnende Musik sie nicht stört. Sie muss nicht nachdenken und auch nichts sein. Nicht zu wissen, wohin man unterwegs ist, und keinen Pass zu besitzen, hat etwas Erleichterndes. Kein Pass. Keine Kleidung. Keine Halskette. Bea hat das Gefühl zu treiben, als hätte sie jeden Halt verloren.
Marnie schaltet das Radio aus. »Ich betreibe ein Gästehaus an der Küste.« Ihr Akzent ist schwer einzuordnen. Grundsätzlich klingt er britisch, aber mit einer internationalen Note, die von einem Leben im Ausland zeugt.
Bea sieht sie von der Seite an. Ein goldener, blattförmiger Stecker ziert ihre Nase, und an ihren schlanken braun gebrannten Handgelenken hängen mehrere Gold- und Lederarmbänder. Ihre dunklen Haare sind zu einem kinnlangen Bob mit einem modischen kurzen Pony geschnitten.
»Es ist klein, nur ein paar Zimmer mit Blick auf die Bucht. Die meisten Gäste kommen zum Surfen. Wir sind voll ausgebucht, aber in dem Raum neben unserem Zimmer steht ein unbenutztes Bett. Das kannst du ein paar Nächte lang haben.«
Marnie sagt nicht, wen sie mit wir meint – und Bea fragt nicht nach. Stattdessen nickt sie nur. »Vielen Dank.«
Eine Zeit lang fahren sie schweigend dahin und lauschen dem Wummern der Räder auf dem Asphalt. Hinten im Bus vibriert irgendetwas.
Bea betrachtet Marnies Hände am Lenkrad. Sie sind klein und gebräunt. Auf das erste Glied des rechten Zeigefingers ist eine schwarze Welle tätowiert. Ihre Hände zittern.
Auch Beas Herzschlag will sich nicht beruhigen. Nach wie vor strömt Adrenalin durch ihre Adern. Bilder tanzen durch ihren Kopf. Die beiden Männer, die ihr den Weg versperren. Ihre nackte Angst, als der Mann mit dem roten Fußballtrikot mit der Fingerspitze über ihren Hals streicht. Die Entschlossenheit, mit der Marnie in die Gasse stürmt, schreiend und mit einem gezückten Messer. Ohne sie …
Bea dreht sich zur Seite. »Ich danke dir. Du hast mich gerettet.« Die Worte könnten hohl klingen, doch sie wissen beide, dass es stimmt.
Marnie wendet den Blick von der Straße ab und sieht Bea an. »Du hast für mich dasselbe getan.«
Einen Moment lang schauen sie sich intensiv in die Augen.
Marnie sieht kurz nach vorne, dann wieder zu Bea. »Wir haben es getan, um zu überleben.«
Bea weiß, dass sie recht hat. Sie wären beinahe in ein dunkles Loch gestürzt, aus dem sie nie wieder aufgetaucht wären.
Marnies Kiefermuskeln mahlen. »Ich bereue nicht, was wir getan haben.«
Wir, denkt Bea dankbar und erwidert: »Ich auch nicht.«
Sie sehen sich noch immer in die Augen, und Bea spürt, wie etwas zwischen ihnen entsteht, das das schreckliche Ereignis von vorhin in den Hintergrund drängt.
Marnie nickt und sieht wieder auf die Straße.
4
Die Zeit scheint sich auszudehnen und zusammenzuziehen. Die Fahrt dauert eine Stunde, möglicherweise auch zwei. Bea sieht durch das offene Fenster und versucht, die raue Schönheit ihrer Umgebung auf sich wirken zu lassen – die kahlen roten Hügel, das blau schimmernde Meer in der Ferne –, aber sie findet keinen Zugang dazu. Ihr Herz rast nach wie vor, und immer wieder tauchen Erinnerungsfetzen an den Angriff vor ihrem geistigen Auge auf.
»Was hast du in Marrakesch gemacht?«, fragt Marnie.
»Gearbeitet«, antwortet Bea vage, weil sie nicht gemodelt sagen will. »Und du?«
»Ich habe einen Laden für Künstlerbedarf gesucht. Dabei habe ich mich verirrt. Normalerweise wäre ich gar nicht in dieser Straße gewesen …« Sie verstummt.
Beide wissen, dass der Tag für sie auch ganz anders hätte enden können.
»Ein paar Meilen vor uns zweigt eine unbefestigte Straße ab. Sie ist immer leer. Dort werfen wir das Messer und das Tuch ins Meer. Okay?«
Bea schaut in Marnies Fußraum, wo die beiden blutigen Gegenstände unter dem Sitz verstaut sind. »Okay«, stimmt sie zu.
Auch sie will beides loswerden. Die Vorstellung, dass dieser Mann – sein Blut, seine DNA – hier bei ihnen ist, findet sie grauenvoll. Sobald das Messer und das Tuch verschwunden sind, gibt es nichts mehr, was sie beide mit dem Vorfall in der Gasse verbindet.
»Wieso hast du eigentlich ein Messer dabeigehabt?«, fragt sie vorsichtig.
»Ich bin vor Jahren mal überfallen worden. Seither habe ich immer eins in der Tasche. Ich bin eins sechzig und wiege fünfzig Kilo. Mit einem Messer kann ich mehr ausrichten.«
Der warme Wind, der durch das offene Fenster hereinweht, zerzaust Marnies dunkle Haare. Sie streicht sich eine Strähne hinters Ohr und enthüllt dabei einen Halbmond aus filigranen Goldsteckern. »Das vorhin hätte dir übrigens in jeder Stadt der Welt passieren können. Diese Männer waren vielleicht nicht mal Einheimische. Die meisten Leute, denen ich hier begegne, sind freundlich.«
»Wie lange lebst du schon in Marokko?«
»Seit drei Jahren. Die ersten paar Monate habe ich mit Ped – das ist mein Freund – in diesem Camper geschlafen. Er ist Australier. Wir haben uns unterwegs kennengelernt. Im Moment ist er nicht da, aber er kommt bald zurück. Wir haben Mallah gemeinsam entdeckt.«
»Mallah?«
»Das ist ein kleines Fischerdorf. Dort gibt es nur die Klippen und das Meer – und die unglaublichsten Wellen. In die haben wir uns verliebt und beschlossen, uns dort was aufzubauen. Vor etwas mehr als einem Jahr haben wir unser Hostel eröffnet. Du wirst …« Marnie verstummt abrupt und beugt sich angespannt auf ihrem Sitz vor.
Bea folgt ihrem Blick.
Auf einer Hügelkippe vor ihnen steht ein Polizeiwagen mit angeschaltetem Blaulicht. Ihr wird eiskalt. »Ist das eine Straßensperre?«
»Nur ein Kontrolle. Das ist ganz normal. Sie ziehen Touristen raus und erzählen ihnen, sie wären zu schnell gefahren oder hätten nicht die richtigen Papiere dabei. Damit verdienen sie sich ein bisschen was dazu.«
»Was ist mit dem Messer?«
»Ich kenne den hiesigen Polizisten. Er heißt Momo. Der wird uns durchwinken. Seine Mutter backt das Brot für das Surf House. Anderswo könnten wir es billiger bekommen, aber man muss sich mit den richtigen Leuten gutstellen.«
Ein Polizist in einer dunklen Uniform deutet mit resoluten Armbewegungen zum Straßenrand. Für Bea sieht es nicht so aus, als würde er sie durchwinken, sondern sie auffordern anzuhalten. Sie wirft Marnie einen Seitenblick zu.
Um Marnies Mund bildet sich ein angespannter Zug. »Das ist ein Neuer.«
Bea umklammert die Ränder ihres Sitzes. »Und was machen wir jetzt?«
»Wir bleiben ruhig und lächeln.«
Der Mann, der sich dem Bus nähert, hat einen sehr aufrechten Gang und einen eingeölten Schnurrbart. Er spricht Marnie auf Französisch an. Bea versteht nur, dass er Inspektor Karim heißt. Seine halb unter schweren Lidern verborgenen Augen blicken zwischen ihnen beiden hin und her.
»Bien sûr«, sagt Marnie und holt lächelnd ihren Führerschein aus einem Fach über ihrem Kopf. Gleichzeitig zieht sie mit der anderen Hand ein paar Dirham aus der Hosentasche und reicht alles zusammen Karim.
Er nimmt die losen Geldscheine zwischen Daumen und Zeigefinger, als würde er eine Ratte am Schwanz festhalten. »Il me semble que votre argent s’est mélangé à vos papiers.«
»Mon erreur«, sagt Marnie.
Bea schaut zum zweiten Polizisten, der ein Stück entfernt steht und zusieht. Das muss Momo sein. Er ist jünger und sieht in seiner marineblauen Uniform und den polierten schwarzen Schuhen schneidig aus. Auf der linken Seite seiner Stirn verläuft eine senkrechte silbrige Narbe.
»S’il vous plaît, sortez du véhicule«, befiehlt Inspektor Karim.
Mit hämmerndem Herzen sieht Bea zu, wie Marnie die Fahrertür öffnet und auf die staubige Straße hinaustritt. Das blutige Messer liegt unter ihrem nun verwaisten Sitz.
»Et vous aussi«, sagt Inspektor Karim und bedeutet Bea, ebenfalls auszusteigen. Dabei schnalzt er ungeduldig mit der Zunge.
Sie blinzelt verdattert und nestelt mit feuchten Fingern am Türgriff. Als sie in die staubige Hitze hinausklettert, knirscht Sand unter ihren Sandalen. Sie stellt sich dicht neben Marnie, die ihr ein knappes, beruhigendes Lächeln zuwirft.
Inspektor Karim ruft auf Arabisch nach Momo und deutet barsch auf den Bus.
Als Momo sie passiert, beugt Marnie sich zu ihm vor und flüstert ihm, beinahe ohne die Lippen zu bewegen, etwas zu. Dieses Intermezzo dauert höchstens zwei Sekunden – dann geht Momo weiter zu Inspektor Karim.
Die zwei Männer beginnen, den Bus zu durchsuchen. Bea schlägt das Herz bis zum Hals. Sie kann nicht zusehen. Sie wendet sich ab.
Marnie zeichnet mit einer Sandale einen Regenbogen aus mehreren Halbkreisen in den Sand.
An Beas Schläfen bilden sich Schweißperlen.
Hinter sich hört sie erhobene Stimmen. Sie klingen unzufrieden. Bea riskiert einen Blick über die Schulter und sieht, dass Inspektor Karim gegen den hinteren rechten Reifen drückt. Einen Moment später geht er zu Marnie. »Dangereux. Très dangereux.« Er deutet auf den Reifen. Marnie antwortet ruhig. Dann begleitet sie ihn zum Polizeiwagen und unterschreibt mit einem verbindlichen Lächeln den Papierkram.
Bea sieht noch einmal über die Schulter und bemerkt, dass auch Momo nicht mehr beim Bus ist. Hat er das Messer an sich genommen? Hat er es versteckt? Hat Marnie ihm deswegen etwas zugeflüstert?
Marnie kehrt zu ihr zurück. »Wir können weiterfahren.«
Schweigend steigen sie wieder ein und schnallen sich an. Marnie setzt den Blinker, sieht in den Rückspiegel und fährt vorsichtig los.
Als sie ein gutes Stück von den Polizisten entfernt sind, hält Bea es nicht mehr aus. »Was ist mit dem Messer?«
»Es ist weg.«
»Hat Momo es an sich genommen?«
Marnie nickt.
Eine Welle der Erleichterung durchflutet Bea, doch Marnie wirkt angespannt. »Was ist los?«
Marnie sieht in den Seitenspiegel. Ihre Stirn ist gerunzelt. »Solche Gefallen sind nicht billig.«
5
Marnie biegt auf eine holprige, unbefestigte Straße ab. »Kurbel die Scheibe hoch«, ruft sie, als die Reifen Staubwolken aufwirbeln.
Bea klammert sich an ihrem Sitz fest, während sie immer wieder Schlaglöchern ausweichen. Das Kochgeschirr hinten im Bus scheppert und klirrt. Die niedrigen Sträucher links und rechts sind in gespenstische Staubschleier gehüllt.
Auf ihrem gewundenen Weg nach unten starrt Bea auf den blau schimmernden Atlantik. Ein breiter, von einer Felswand gesäumter Bogen aus goldenem Sand. Hoch oben befindet sich ein kleines Dörfchen, dessen Gebäude sich wie Seepocken an der Klippe festklammern.
»Willkommen in Mallah«, sagt Marnie. »Jahrzehntelang haben hier nur Fischer gelebt, bis Surfer die Wellen in dieser Bucht entdeckten und mit ihren Campern anrückten. Seitdem hat eine kleine Gemeinschaft ein paar Hostels und andere Unterkünfte errichtet.«
Sie fahren an niedrigen Häusern vorbei, deren Farben von der Sonne ausgebleicht sind. Ein paar haben Flachdächer aus Wellblech. An den bröckelnden Fassaden ranken wilde Bougainvilleas empor. Ein Stück weiter passieren sie einen schmalen Laden, vor dem ein langhaariger, europäisch aussehender Mann im Schatten einer Plane Orangen aus einer blauen Kiste hebt.
Schließlich hält Marnie an. Am Rand des Wegs parkt eine Handvoll Campingbusse. Neoprenanzüge hängen zum Trocknen über den Seitenspiegeln. Die Schiebetüren sind offen, um das letzte Sonnenlicht hereinzulassen.
Bea steigt aus und wird von einer frischen Meeresbrise empfangen, die nach Fisch und einem Hauch Hasch riecht. Die Bucht wird von der Sonne vergoldet und ist mit Surfern gesprenkelt.
»Wir sind hier oben«, sagt Marnie und geht voraus.
Bea folgt ihr. Sie kommen an einem sonnengelben Hostel vorbei, dessen seitliche Wand mit einem Wellengraffiti verziert ist. Sein Name, Offshore, ist auf ein Surfbrett gepinselt, das halb aus seiner Halterung gerutscht ist und jämmerlich herabhängt.
Dahinter gelangen sie zu einem schönen weiß verputzten Gebäude. »Das ist unseres«, sagt Marnie.
Das in Sonnenschein gebadete Surf House thront stolz am Rand der Klippe. Ein mit breiten weißen Säulen gesäumter Weg führt zu einer massiven Holztür, die von zwei riesigen Kaktuspflanzen in Terrakottatöpfen eingerahmt wird.
Bea betritt einen großen, lichtdurchfluteten Raum mit hohen Decken. Ihr Puls ist noch immer erhöht, ihre Gedanken kreisen unaufhörlich um enge Gassen und Polizeikontrollen, doch die Ruhe, die dieser Ort ausstrahlt, färbt auf sie ab. In weißen Alkoven stehen glatt polierte Skulpturen und dekorative marokkanische Teekannen.
Die marmorierten Bodenfliesen tragen zum angenehmen, schlichten Ambiente bei. In der hinteren Ecke stehen vor einer Beamer-Leinwand niedrige Sitzmöbel aus Paletten. Auf einem hölzernen Couchtisch liegt ein Stapel Bildbände über verschiedene Surfspots.
Ein breites Panoramafenster aus faltbaren Glastüren vermittelt den Eindruck, als wäre das Gästehaus Teil des Himmels und des Meeres. Neugierig tritt Bea ins Freie und gelangt auf eine Terrasse, die von großen Pflanzgefäßen mit Olivenbäumen, Kakteen und Palmen gesäumt ist. Ein schmaler Pool, dessen glatte Oberfläche den rötlichen Himmel reflektiert, scheint sich bis ins Meer zu erstrecken. In der Mitte einer gepolsterten Sitzgruppe stehen ein paar Bodenlaternen. Beas Blick fällt auf einen weißen, würfelförmigen Anbau, dessen nüchterne Fassade mit Orangenblüten verziert ist. Auf einem dezenten Holzschild steht Surf Studio.
An einer Mauer sitzen ein paar Gäste und sehen zu, wie sich unten die Wellen brechen. Sie drehen sich zu Marnie um und begrüßen sie mit einer Vielzahl ausländischer Akzente.
»Wie war das Surfen?«, fragt sie.
»Ganz okay«, sagt ein Mann und rückt die Mütze auf seinen dichten Locken zurecht. »Anfangs gab es ein bisschen Wind, aber jetzt ist das Meer spiegelglatt.«
»Bist du reingegangen, Aimee?«, fragt Marnie ein Mädchen in einem kurzen gelben Top, das gerade ihre rechte Schulter dehnt.
»Eine Stunde habe ich geschafft. Es ist toll, wieder im Wasser zu sein.«
Marnie lächelt. »Das hier ist übrigens Bea. Sie wird eine Weile hierbleiben.«
Die Surfer lächeln ihr zu. Ein paar von ihnen winken.
Nach diesem furchtbaren Tag fällt es Bea nicht leicht, sich auf diesen ruhig und einladenden Ort einzulassen. Sie versucht, das Lächeln der Surfer zu erwidern und ihre entspannte Art aufzunehmen, doch sie fühlt sich befangen, als stünde ihr auf die Stirn geschrieben, was sie getan hat.
»Komm, ich zeige dir, wo du schläfst«, sagt Marnie. »Aber davor plündern wir noch die Fundsachen.«
Bea folgt Marnie in ein kleines Büro mit einem schlichten Holztisch, auf dem ein flacher Laptop steht. Marnie öffnet einen Karton voller Klamotten und Toilettenartikel. Außerdem sieht Bea darin Finnen, Wachs und Fangriemen für Surfbretter. »Nimm dir einfach, was du brauchst.«
Bea klaubt eine Handvoll Toilettenartikel, ein T-Shirt und einen übergroßen Hoodie sowie ein Handyladegerät heraus. Anschließend folgt sie Marnie ins obere Stockwerk.
»Hier wohnen Ped und ich«, sagt Marnie und öffnet die Tür zu einem geräumigen sonnigen Zimmer.
Bea sieht ein großes Bett mit einem Bambuskopfteil, Zierkissen und zurückgeschlagenen weißen Leinendecken. Es wird von zwei niedrigen Nachttischchen flankiert, auf denen Bücher liegen. Vor einem offenen Fenster mit Blick aufs Wasser steht ein einfacher Korbstuhl.
»Dein Zimmer ist nebenan«, sagt Marnie und geht zur nächsten Tür.
Bea betritt den kleineren Raum. Die untergehende Sonne scheint durchs Fenster und taucht eine der Wände in goldenes Licht. Bea bemerkt eine Verbindungstür nach nebenan und fragt sich, ob Marnie und Ped das kleine Zimmer als Ausweichschlafplatz dient. Auf dem Holzboden liegt eine Yogamatte. Ansonsten gibt es nur ein schmales Tagesbett, das mit einem gewebten Überwurf und schlichten Kissen bedeckt ist. Alles ist einfach gehalten, wirkt jedoch einladend.
»Hier ist es wunderschön«, sagt sie, während sie auf der Bettkante Platz nimmt und die Sandalen abstreift.
Marnie rollt die Yogamatte zusammen und setzt sich neben Bea. Ihr freundlicher Blick wirkt besorgt. »Wie geht es dir?«
»Es erscheint mir alles so unwirklich.«
Marnie drückt ihr die Hand. »Das ist nur der Schock. Wir werden uns daran gewöhnen.«
»Auf dem Messer sind meine Fingerabdrücke«, sagt Bea mit gesenkter Stimme. »Was ist, wenn Momo es seinen Kollegen übergibt?«
»Das wird er nicht tun. Davon hätte er nichts. Er weiß, dass wir das Messer wiederhaben wollen, und wird etwas dafür verlangen.«
»Schmiergeld?«
Marnie lächelt. »Er wird es als Geschenk bezeichnen.«
»Und wann wird er dieses ›Geschenk‹ haben wollen?«
»Wir warten, bis er zu uns kommt. Wir dürfen nicht übereifrig wirken.«
Bea denkt kurz nach und nickt.
»Was immer er will, wir werden es ihm geben.« Marnie drückt Bea die Hand. »Und dann vergessen wir das Ganze.«
»Ich muss immer wieder daran denken …«, erwidert Bea leise. »An all das Blut … wie es in hohem Bogen aus seinem Hals gespritzt ist … und wie er auf dem Boden zusammengesunken ist.« Sie schluckt. »Er ist tot, oder?«
Marnie nimmt auch Beas andere Hand. Am Daumen trägt sie einen gehämmerten Goldring. Ihre Fingernägel sind kurz und gepflegt. »Was hätte er mit dir gemacht, wenn ich nicht zufällig vorbeigekommen wäre?«
Bea schluckt. Ihre Hände schwitzen, aber sie lässt Marnie nicht los. »Er hätte mich vergewaltigt.«
Marnie hält ihren Blick fest. »Und als ich da war und er mir die Hände um den Hals gelegt hat … Was hätte er da wohl mit mir angestellt?«
Bea hat das Weiße in Marnies Augen gesehen, während der Typ sie an die Wand presste und ihr die Luft abschnürte. Ihr Hals ist davon noch immer rot. »Er hätte dich erwürgt.«
Marnie fixiert Bea mit ihren hellblauen Augen. »Es ist so, wie ich es vorhin schon im Bus gesagt habe: Wir haben getan, was wir tun mussten. Und jetzt ist es vorbei. Wir sind nun hier und in Sicherheit.« Sie drückt wieder Beas Hände. »Wir machen ganz normal weiter.«
Bea sieht sie forschend an. Sie will glauben, dass das möglich ist.
»Schau nicht zurück. Nicht mal für eine Sekunde. Lass dir davon nicht das Leben versauen, Bea. Gib diesem Mann nicht so viel Macht über dich. Du hast es dir nicht ausgesucht, verfolgt, ausgeraubt und attackiert zu werden. Aber du hast dich dafür entschieden zu überleben.«
Bea hält ihren Blick fest.
»Wenn wir morgen früh aufwachen, beginnt ein neues Leben, okay?«
Bea spürt Marnies warmen, festen Griff. »Ein neues Leben«, wiederholt sie.
6
Bea steht am offenen Fenster und blickt in die Nacht hinaus. In Mallah gibt es keine Straßenlaternen, nur die beleuchteten Fenster der Wohnhäuser und Hostels. Die Luft riecht nach Salz, Holzfeuer und etwas Kreidigem, vielleicht dem Felsgestein.
Unten auf der Poolterrasse sitzen Surfer und andere Reisende auf niedrigen Kissen um eine Feuerstelle herum. In der Dunkelheit glühen Zigaretten. Ihr Gemurmel, das von gelegentlichem Gelächter unterbrochen wird, wirkt tröstlich. Bea könnte sich zu ihnen gesellen – Marnie hat sie ausdrücklich dazu eingeladen –, aber sie ist nicht imstande, mit anderen Leuten zusammen zu sein und zu tun, als wäre nichts geschehen.
Immer wieder sagt sie wie ein Mantra Marnies Worte vor sich hin: Wir sind nun hier und in Sicherheit. Wir machen ganz normal weiter.
Gekräuselte Rauchfäden steigen in den Nachthimmel empor, die Flammen beleuchten braun gebrannte, entspannte Gesichter. Ein Mädchen mit einer Beanie-Mütze steht auf und macht zur allgemeinen Belustigung vor, wie sie beim Surfen ins Wasser gefallen ist. Die verschiedenen Akzente vermischen sich und schwellen an und ab wie Musik. Bea merkt, dass ihr diese gesellige Runde aus Leuten in Jeans, T-Shirts und grobmaschigen Pullovern gefällt. Keine der Frauen trägt Make-up oder hat sich die Haare gemacht. Sie reden miteinander, erzählen sich Geschichten und lassen Getränke herumgehen.
Marnie sitzt mitten unter ihnen, im Schneidersitz und mit einer Flasche Bier in der Hand. Als sie sie an die Lippen hebt, funkelt ihr goldener Daumenring im Feuerschein. Sie wirkt vollkommen ruhig, geerdet und entspannt. Sie trägt einen dünnen Schal. Bea fragt sich, ob auf ihrem Hals noch immer Fingerabdrücke zu sehen sind.
Bea schnappt einzelne Gesprächsfetzen auf. Sie unterhalten sich über einen Kinoabend auf der Klippe, eine Müllsammelaktion am Strand und über andere Surfspots, die günstiger gelegen sind, wenn der Wind aus Osten kommt. Schließlich löst sich das Grüppchen auf.
Bea legt sich aufs Bett und zieht die dünne Decke über sich. Sie wünscht sich, sie könnte ihre Mum anrufen und sagen: Es ist was Schlimmes passiert. Ich brauche dich. Doch aus langjähriger, leidvoller Erfahrung weiß sie, dass ihre Mutter nicht für sie da sein wird. Sie würde ihr nur Vorhaltungen machen, weil sie in die Medina gegangen ist, statt beim Shooting zu bleiben. Auf keinen Fall würde sie den nächsten Flieger besteigen und nach Marokko kommen. Sie würde ihr weder bei der Polizei noch in der Botschaft zur Seite stehen. Keinen Finger würde sie für ihre Tochter rühren. Bea ist auf sich allein gestellt.
Sie dreht sich auf die Seite und zieht die Knie an die Brust. Der Bettbezug riecht nach Marnie – eine Mischung aus Kokosbutter und Vanille. Sie atmet den Duft tief ein.
Kurz darauf hört sie Schritte im Korridor und den Lichtschalter in Marnies Schlafzimmer. Bea schließt die Augen und lauscht den beruhigenden Geräuschen, die Marnie nebenan macht. Eine Schublade gleitet auf, und Metall klirrt. Bea stellt sich vor, wie Marnie ihren Schmuck abnimmt und in ein Schälchen legt. Als Nächstes öffnet sie den Schrank und schiebt Kleiderbügel auf der Stange hin und her. Irgendetwas landet auf dem Boden.
Kurz darauf geht das Licht wieder aus. Bea hört eine Decke rascheln, dann quietschende Bettfedern, gefolgt von einem tiefen Seufzer.
Ihre Betten sind nur durch eine dünne Wand voneinander getrennt. Sie stellt sich vor, wie Marnie auf der Matratze liegt und der Deckenventilator die feinen dunklen Haare an ihren Schläfen kräuselt. Bea streckt die Finger aus und berührt die kühle Wand.
Sie spitzt die Ohren und glaubt, Atemgeräusche zu vernehmen.
Nach einer Weile wird ihr klar, dass sie das Meer hört. Das Wasser, das ans Ufer brandet und sich wieder zurückzieht, klingt, als würde jemand ein- und ausatmen.
Sie stellt sich vor, wie die Wellen in der Finsternis an den Fuß der Klippe branden, auf der das Surf House steht. Wie sie den Sandstein lockern und in die Risse im Fels eindringen und wie an der Steilwand Staub herabrieselt.
Mit einem Mal steht ihr wieder das Messer vor Augen, das Blut, das aus dem Hals ihres Angreifers geschossen ist. Seine zusammengesunkene Gestalt auf dem Boden. Immer enger schlingen sich ihre Gedanken um dieses Bild.
Bea setzt sich mit rasendem Herzen kerzengerade auf. Sie stellt die nackten Füße auf den Fliesenboden und ringt nach Atem.
Nein, sie schafft es nicht, allein mit ihren Gedanken in der Dunkelheit liegen zu bleiben.
Also zieht sie den Hoodie und ihre Shorts an und verlässt das Zimmer. Auf leisen Sohlen geht sie den Korridor entlang, schlüpft die Treppe hinunter, durchquert den Eingangsbereich und tritt in die Nacht hinaus.
Die Sterne strahlen. Der Vollmond, der wie eine unglaublich helle Laterne am Himmel hängt, taucht die Landschaft in silbriges Licht. Bea umrundet den Pool und sucht nach einem Weg am Surf Studio vorbei zur Klippe.
Die Felsen sind zerklüftet und fühlen sich unter ihren nackten Füßen sandig an. Sie weiß, dass sie sich vom Rand fernhalten sollte, aber die Dunkelheit, der steile Abgrund und die weißen Wellenbänder weit unten ziehen sie an.
Es ist Ende September – der marokkanische Herbst. Obwohl die Tage noch immer sehr heiß sind, wird es abends viel kühler. Auf ihren nackten Beinen breitet sich Gänsehaut aus. Sie streift ihre Kapuze über.
Bea bleibt am Rand der Klippe stehen und blickt nach unten. Welle um Welle brandet an den Strand. Sie hat ihr ganzes Leben im Landesinneren oder in Städten verbracht. Am Meer hat sie nur hin und wieder Urlaub gemacht – an der Strandpromenade von Bournemouth und einmal in Spanien, wo sie im Schatten eines Sonnenschirms lag, während ihre Mutter an ihrer Bräune arbeitete. Eine Küste wie diese, umtost von Wassermassen, hat sie jedenfalls noch nie erlebt.
Sie bemerkt etwas auf dem Meer. Merkwürdig. Das kann kein Boot sein. Dafür ist es zu klein.