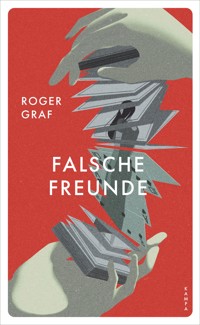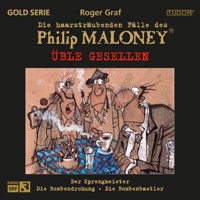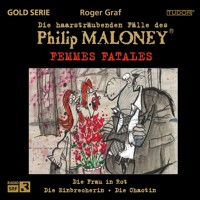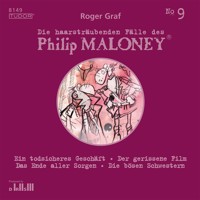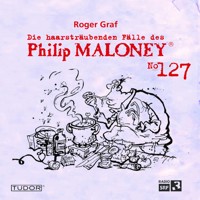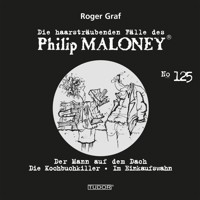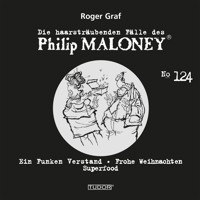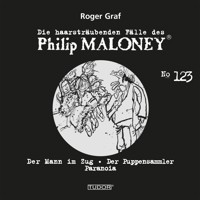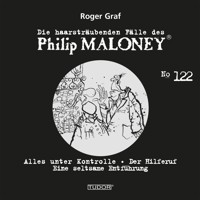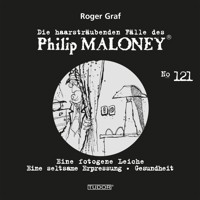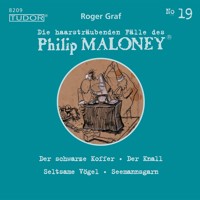Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Atlantis Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Marco Biondi hat einige Jahre als Journalist gearbeitet. Was ihn am Journalismus gereizt hat: »Sich in etwas vertiefen zu können, im Dreck zu wühlen.« Warum er sich vom Journalismus abgewendet hat: »Leider erwarten die meisten Zeitungen und Zeitschriften, dass man nicht im Dreck wühlt, sondern welchen absondert.« Heute schreibt Biondi stattdessen schlechte Drehbücher für noch schlechtere Serien - und versucht sich als Privatdetektiv. Regelmäßig bietet er seine Dienste in Zeitungsinseraten an und wundert sich doch, dass es tatsächlich noch Leute gibt, die das Kleingedruckte lesen. Referenzen hat er keine. Umso erstaunlicher, dass eine gewisse Katharina Boxler ihn tatsächlich engagiert: Biondi soll ihren verschwundenen Bruder ausfindig machen, der, dem Alkohol verfallen, auf der Straße lebt. Bei seinen Recherchen wird Biondi mit seiner eigenen Vergangenheit konfrontiert, den bewegten Jahren in der autonomen Szene Zürichs. Und er begegnet alten Freunden aus einer Zeit, in der alles möglich schien. Auch Mord?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 369
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Roger Graf
Zürich bei Nacht
Kriminalroman
atlantis
Für Ruth, my love
1
Der Anruf kam, als das Null zu Eins fiel. Ich hatte gerade eine Druckperiode des Gegners überstanden und freute mich auf das glückliche Unentschieden, als neben meinem Computer das Telefon klingelte und gleichzeitig ein Spieler namens Smith meinen Torhüter bezwang. Während ich den Hörer abnahm und mich meldete, vergingen die letzten Spielminuten, und mein Team musste die erste Heimniederlage der Saison hinnehmen. Ich starrte auf die Resultate der übrigen Partien, während sich Katharina Boxler unsicher erkundigte, ob sie sich nicht verwählt hatte.
»Ich habe Ihre Anzeige gelesen, Herr Biondi.«
»Es gibt also noch Leute, die das Kleingedruckte in der Zeitung lesen?«
»Suchen Sie auch vermisste Personen?«
»Aber sicher.«
»Tatsächlich? Wie viel Vermisste haben Sie schon gefunden?«
»Einen.«
Die Stimme am Telefon klang mit jeder Sekunde misstrauischer, doch das störte mich nicht, denn eigentlich hätte ich sowieso lieber noch ein paar Runden Fußballmanager gespielt.
»Ich möchte nicht die Polizei einschalten«, sagte sie. »Vielleicht taucht er von selber wieder auf. Ich bin einfach ein wenig beunruhigt.«
»Wer ist der Vermisste?«
»Mein Bruder. Er hat sich seit zwei Wochen nicht bei mir gemeldet. Normalerweise ruft er einmal in der Woche an. Können Sie ihn finden?«
»Finden kann man jeden, fragt sich nur, wo man suchen muss. Ich schlage vor, Sie kommen zu mir und wir reden in aller Ruhe darüber.«
»Ich weiß nicht. Haben Sie so etwas wie Referenzen?«
Ich schüttelte den Kopf und atmete tief durch. Ich schaute mir die Tabellenlage meines Clubs an. Oberes Mittelfeld. Das war nicht schlecht, aber auch nicht besonders gut.
»Sind Sie noch dran?« Ihre Stimme klang ein wenig empört. »Ich habe das Gefühl, dass Sie gar nicht an einem Auftrag interessiert sind.«
»Ehrlich gesagt, weiß ich das nicht so recht. Wie Sie in meinem Inserat gelesen haben, mache ich Nachforschungen aller Art. Das heißt, ich suche mir aus, was ich mache.«
»Verstehe. Vielleicht sollten wir uns in der Stadt treffen. Im Odeon? Um halb drei?«
Ich sagte ihr, dass ich erst um drei könne, sie war einverstanden. Eine volle halbe Stunde schaute ich mich auf dem Transfermarkt um. Ein starker Verteidiger war nicht zu haben. Nur mittelmäßige Kicker zu übersetzten Preisen. Mein Starstürmer fiel noch vier Wochen aus; der Idiot hatte sich das Schlüsselbein gebrochen. Ich nahm eine kleine Umstellung vor und brachte den erst zwanzigjährigen Miller als rechten Außenverteidiger. Der Kerl hatte Zukunft. Ich spielte zwei Partien. Ein Sieg und ein Unentschieden. Das war nicht schlecht. Als ich mein Büro verließ, tat ich das als Manager einer Mannschaft, die in der englischen Premier League Platz sieben belegte.
2
Es war kein Flanierwetter, der Wind blies kühl durch die Straßen, der Himmel war mit Regenwolken verhangen. Im Odeon saß nur etwa ein Dutzend Leute. Junge Paare, ein paar Schwule und Geschäftsleute, die schnell einen Kaffee tranken; das Übliche. Sie saß ganz hinten an einem kleinen Tisch. Ein Wasser vor sich, gespannt auf den Eingang starrend. Sie realisierte erst spät, dass ich es war, auf den sie wartete. Sie war in meinem Alter, Anfang dreißig, lange dunkle Haare mit ein paar neckischen grauen Strähnen. Elegant, aber dezent gekleidet. Viel Rot, auch auf den Lippen. Ich nannte ihr meinen Namen. Sie lächelte.
»Ich heiße Katharina. Ich habe mir dich ganz anders vorgestellt, Marco.«
»Als Wandschrank mit beschränkter Haftung?«
»So ähnlich.«
»Also gut. Von vorne. Ich habe früher als Journalist gearbeitet. Heute schreibe ich schlechte Drehbücher für miserable Serien. Programmiere ein wenig auf dem Computer und daneben suche ich Aufgaben, die mich davor bewahren, als Alkoholiker zu enden.«
Ich bestellte mir eine Cola light, nicht aus Prinzip, aber ich mag es nicht, tagsüber angesäuselt zu sein. Sie nickte, schaute an mir vorbei auf einen Mann an der Bar, der ihr offenbar gefiel. Er war in eine Diskussion mit einem blonden Schönling vertieft. Katharina wandte sich erst nach einigen Sekunden wieder mir zu, was mein Ego ein wenig beleidigt zur Kenntnis nahm.
»Du machst das nur zum Spaß?«
»Nein. Das Einzige, was mich am Journalismus gepackt hat, waren die Nachforschungen, sich in etwas vertiefen zu können, im Dreck zu wühlen. Leider erwarten die meisten Zeitungen und Zeitschriften, dass man nicht im Dreck wühlt, sondern welchen absondert. Als ich damit aufhörte, begann ich gezielt nach Wühlarbeit zu suchen. Ich inserierte regelmäßig in der NZZ. Ich forschte nach Stammbäumen, arbeitete an Konzerngeschichten, und ab und zu suchte ich nach Personen. Ein alter krebskranker Mann wollte zum Beispiel, dass ich ihm seine Jugendliebe ans Sterbebett bringe.«
»Und? Hast du sie gefunden?«
»Ja«, sagte ich. »In einem Altersheim in Solothurn. Sie konnte sich nicht mehr an ihre Jugend erinnern. Ich brachte sie dennoch zu ihm ins Spital. Es war eine seltsame Angelegenheit. Er hat sie berührt und sie saß einfach nur da, ohne Erinnerung. Er starb eine Woche später. Sie lebt wieder im Altersheim. Vermutlich kann sie sich mittlerweile auch nicht mehr an den Besuch im Spital erinnern.«
»Mein Vater hat auch Alzheimer. Frühes Stadium. Wenn ich daran denke, was noch kommen wird, habe ich Angst.«
»Kann ich gut verstehen.«
Sie trank Mineralwasser. Ihr Blick folgte dem Mann an der Bar, der sich vom blonden Schönling verabschiedete und nach draußen ging. Ihre Augen folgten ihm durch das Glasfenster. Mein Ego war eifersüchtig, auch wenn ich keinerlei erotisches Interesse an Katharina verspürte. Das Ego ist wahrscheinlich immer eifersüchtig. Irgendetwas muss es schließlich tun. Sie schaute auf die Uhr.
»Mein Bruder hatte vor acht Jahren einen Unfall. Er fiel von einem Balkon. Nicht sehr tief, knallte aber voll auf den Rücken und den Kopf. Er hatte eine schwere Gehirnerschütterung. Seither ist er arbeitsunfähig. Er hat häufig Kopfschmerzen und, wie er es selber nennt, Bienen im Kopf. Das war wohl auch der Grund, weshalb er zu trinken anfing. Wenn er trinkt, sind die Bienen weg, sagt er. Auf jeden Fall hat der Unfall Spuren hinterlassen. Er ist nicht blöd, nein, er hat manchmal einfach so etwas wie Anfälle. Da wird er rastlos, hält es nirgends lange aus. Er streunt dann richtiggehend durch die Stadt, lebt im Freien und trinkt. Wie ein Penner.«
»Wie lange macht er das schon?«
»Fünf, sechs Jahre. Er hat bei mir ein Zimmer. Ich besitze ein kleines Haus, das eigentlich unserer Mutter gehört. Ich wohne da zusammen mit einer Freundin. Meine Mutter weiß nicht, dass Martin ein Zimmer im Haus hat. Es sind zwei Wohnungen und zwei Mansardenzimmer. Mein Bruder kommt manchmal für ein oder zwei Wochen, dann verschwindet er wieder. Aber, wie gesagt, er ruft regelmäßig bei mir an. Das hat er mir versprochen. Ich habe ihm eine Telefonkarte geschenkt.«
»Wann hast du ihn zuletzt gesehen?«
»Vor einem Monat. Er hat danach noch zweimal bei mir angerufen, zuletzt am Dritten. Seither habe ich nichts mehr von ihm gehört.«
»Hat er Freunde?«
»Wenige. Und die wechseln ständig. Er lebt oft auf der Straße. Natürlich kennt er ein paar Junkies, denen geht er aber eher aus dem Weg, weil sie ihm schon öfters Geld geklaut haben. Am wohlsten fühlt er sich unter Pennern.«
»Hast du in der Bäckeranlage nach ihm gesucht?«
Die Bäckeranlage ist ein kleiner Park, in dem etwa ein halbes Dutzend Penner leben und von der Polizei mehr oder weniger geduldet werden.
Sie schüttelte den Kopf.
»Ich gehe da nicht hin. Aber ein Bekannter war da und hat nach ihm gesucht. Mehrmals. Mein Bruder ist seit über zwei Wochen nicht mehr gesehen worden.«
»Und die Polizei? Wie wäre es mit einer Vermisstenanzeige?«
»Ich habe meinem Bruder versprochen, nie die Polizei auf ihn zu hetzen. Dieses Versprechen möchte ich halten, solange es geht.«
»Verstehe«, sagte ich. »Hat dein Bruder Geld?«
»Er bekommt eine Invalidenrente. Wenn er zusätzlich Geld braucht, gebe ich ihm welches. Ich bin aber nicht reich. Das Haus, in dem ich wohne, ist hoch mit Hypotheken belastet. Meine Mutter möchte nicht, dass ich Martin unterstütze. Aber er kriegt so wenig Rente.«
»Kann er frei über sein Geld verfügen?«
»Ja. Er hat keinen Vormund, wenn du das meinst. Er ist kein Asozialer. Er ist kein Genie, aber auch nicht hirnlos. Er kann sich selber durchschlagen. Allerdings trinkt er sehr viel. Immer mehr. Leider.«
Sie schaute auf ihr leeres Glas.
»Hast du Einblick in seine Konten? Hat er Geld abgehoben?«
»Nein. Seit drei Wochen nicht. Am Dritten, das war der Tag, als er mich anrief, da hat er fünfhundert mit der EC-Karte abgehoben. Er braucht nicht viel Geld.«
»Ich brauche ein Foto von ihm, möglichst neu.«
»Ich habe nur Fotos, die ihn frisch geduscht und rasiert zeigen. Wenn er drei Wochen auf der Straße lebt, sieht er manchmal zum Fürchten aus. Ich kann dir aber eine Zeichnung mitbringen. Die Freundin, die bei mir wohnt, ist Illustratorin, und sie kennt Martin.«
Ich erklärte ihr, dass ich möglichst viel über die Gewohnheiten ihres Bruders wissen müsste. Sie nickte.
»Jetzt im Frühling ist er oft am See. Er liebt es, auf die Wellen zu schauen und zu träumen. Ich war fast jeden Tag unten, wenn ich zur Arbeit ging oder zurückkam, aber ich habe ihn nie gesehen. Er war meistens am Zürihorn, da, wo sie im Sommer nackt baden.«
»Trägt er einen Pass oder eine ID auf sich?«
»Ja, eine ID. Es ist aber unwahrscheinlich, dass er ins Ausland gegangen ist. Vielleicht ist er in einer anderen Stadt. Manchmal ging er nach Bern oder Basel, einmal auch nach Locarno, aber nie mehr als zwei, drei Tage. Er braucht eine vertraute Umgebung. Er ist in Zürich aufgewachsen. Er liebt diese Stadt.«
»Gut«, sagte ich. »Ich werde deinen Bruder suchen.«
»Brauchst du einen Vorschuss? Ich habe einen Tausender bei mir. Reicht das?«
»Tausend genügen fürs Erste. Wenn ich mehr brauche, sage ich es dir.«
»Okay«, sagte sie. »Mehr als fünftausend kann ich aber nicht ausgeben. Ich möchte nur, dass du das weißt. Ich lasse dir die Fotos und die Zeichnung per Kurier zukommen. Wenn du Fragen hast, kannst du mich anrufen.«
Sie gab mir ihre Karte. Ich gab ihr meine. Ich ging danach einkaufen und zurück in mein Büro. Während ich an einem Stück Zwetschgenkuchen knabberte, überlegte ich mir, ob ich noch zwei, drei Runden spielen sollte, ließ es dann aber bleiben. Irgendwo in der Stadt irrte vielleicht Martin Boxler umher. Ihn zu suchen, war mindestens so unterhaltsam wie die Suche nach einem guten Verteidiger.
3
Das Foto und die Zeichnungen zeigten zwei Ausgaben ein und desselben Mannes. Auf dem Foto lachte er mir fröhlich mit breiten Wangenknochen, nach hinten gekämmten Haaren und makellosen Zähnen entgegen. Auf der Zeichnung sah ich einen geknickten Mann, der mindestens zehn Jahre älter aussah, eine wirre Mähne trug, unrasiert war und wie ein verängstigtes Tier dreinschaute. Außer den markanten Wangenknochen hatten die beiden Männer nicht viele Gemeinsamkeiten. Er kam mir vor wie die Zürcher Ausgabe von Jekyll and Mister Hyde. Ich konnte wohl davon ausgehen, dass Martin Boxler zurzeit eher Mister Hyde verkörperte, deshalb schaute ich mir die Zeichnung genauer an als das Foto. Es war eine gute Zeichnung, die Frau hatte Talent, das Bild des Mannes war präzise und strahlte so etwas wie Leben aus, wenn auch ein kaputtes Leben. Unter der Zeichnung stand der Name der Illustratorin. Melanie Mahrer. Klang auch nicht übel. Katharina hatte auf einem Blatt zusammengefasst, was ich ihrer Meinung nach über ihren Bruder wissen sollte. Es war nicht viel, aber es genügte, um mir zusammen mit der Zeichnung ein präziseres Bild von ihm zu machen.
Ich kaufte mir ein Sixpack Bier und machte mich auf zur Bäckeranlage. Vor zwei Wochen war das Areal geräumt worden. Das geschah alle paar Monate, wenn sich Nachbarn über die Penner beschwerten oder es zu Schlägereien kam. Wenn sich alles beruhigt hatte, tauchten die Penner wieder auf, mit neuen Matratzen und Zeitungen, und richteten sich häuslich ein. Einige Mütter gingen dennoch mit ihren Kindern in den Park, es war weit und breit die einzige Spielmöglichkeit und die Penner galten als friedlich. Einige davon waren schon in der Zeitung oder auf einem der lokalen Fernsehsender porträtiert worden. Immer nach dem Motto: leben und leben lassen. Einen der Penner kannte ich vom Sehen. Er nannte sich Charly und hatte die Angewohnheit, Passanten anzubrüllen und Frauen zu beleidigen. Er stank meist fürchterlich nach Pisse und Kotze. Eine Journalistin, die ich gut kannte, hatte Charly einmal porträtiert. Sie schilderte mir danach voller Abscheu, wie Charly versucht hatte, ihre Brüste zu berühren, und wie er sich ständig zwischen den Beinen kratzte. In ihrem Artikel las ich kein Wort davon, da stand nur, er verberge seine Verletzlichkeit unter einer rauen Schale.
Als ich die Anlage betrat, war ich froh, Charly nirgends zu sehen. Vor dem kleinen Rondell saßen zwei Penner, die ich nicht kannte. Als ich mich zu ihnen gesellte, trat eine Frau hinzu. Sie war aufgedunsen und bewegte sich so andächtig wie ein Rhinozeros. Sie begrüßte die beiden Männer lautstark und fluchte über einen anderen Mann, der sie versetzt hatte. Die beiden Männer nickten nur und rauchten. Einer trank Wein aus einer Flasche. Ich setzte mich auf die Steinstufen und stellte das Sixpack neben mich. Einer der Penner schaute mich an, zog es dann aber vor, seinen Kopf sofort wieder wegzudrehen. Die Frau stellte sich vor mich hin und stemmte ihre Arme in die Hüften.
»Das ist mein Platz.«
»Schon gut«, sagte ich. »Ich habe deine Markierung nicht gerochen.«
»Was ist?«
Der Mann neben mir lachte und schaute mich an. Die beiden oberen Schneidezähne fehlten ihm und über der linken Augenbraue hatte er eine verkrustete Wunde. Ich stand auf und machte der Frau Platz. Sie nickte nur, setzte sich aber nicht.
»Dich habe ich hier noch nie gesehen.« Der Mann ohne Schneidezähne bot mir eine Zigarette an, ich schüttelte den Kopf.
»Ist auch gesünder«, sagte er.
»Ich heiße Marco«, sagte ich. »Ich suche jemanden.«
»Godi.« Der Mann ohne Schneidezähne streckte mir seine Hand hin. Die Frau neben mir grunzte und suchte in ihrer Hosentasche nach etwas. Der andere Mann schwieg noch immer und starrte auf seine gelben Finger, die den Stummel einer filterlosen Zigarette hielten. Ich zeigte auf das Bier. Godi nickte und nahm sich eine Dose. Der andere schaute gar nicht hin. Die Frau setzte sich neben Godi und begann mit ihren Fingern in ihren Zähnen zu kratzen. Was an ihren Fingern kleben blieb, strich sie unter der Achsel an ihrem Pullover ab. Der Zwetschgenkuchen in meinem Magen machte sich bemerkbar. Ich versuchte, die Frau nicht mehr zu beachten, was mir aber nicht gelang. Sie kratzte erneut in ihren Zähnen. Godi leerte eine der Dosen, ohne abzusetzen.
»Nicht schlecht«, sagte er. »Trinke gerne Bier. Die anderen mögen lieber Wein. Muss man weniger pissen.«
Ich hielt Godi eine Kopie der Zeichnung hin. Er blinzelte. Dann nickte er.
»Das ist Martin. Lieber Kerl. Hat was im Kopf. Trinkt nur, weil er Schmerzen hat. Ist noch ziemlich jung.«
»Wann hast du ihn zuletzt gesehen?«
»Wann? Schwierig. Wann war Martin zuletzt hier?«
Er schaute zuerst die Frau an, dann den anderen Mann, schließlich wieder die Frau. Der Mann reagierte nicht, zündete sich eine neue Zigarette an. Die Frau hatte in der Zwischenzeit den Zeigefinger gewechselt. Sie schaute sich neugierig an, was auf der Fingerspitze zu sehen war, und strich es unter die andere Achsel. Ich atmete tief durch. Godi zuckte die Schultern.
»Weiß auch nicht mehr, wann das genau war. Eine Woche, vielleicht zwei. Martin ist manchmal monatelang nicht aufgetaucht. Er wohnt bei seiner Schwester.«
»Vor zwei Wochen habe ich ihn gesehen«, sagte die Frau plötzlich. Sie bohrte mit ihrem Zeigefinger nun im Ohr herum. Vermutlich gehörte das alles zu ihrer täglichen Körperhygiene.
»Bist du da ganz sicher?«, fragte ich sie.
»Klar. Was willst du von ihm?«
»Seine Schwester sucht ihn.«
»Bist du ein Detektiv oder so was?«
»So was. Ich möchte herausfinden, wo sich Martin zurzeit aufhält.«
»Vor zwei Wochen traf ich ihn hier. Am Abend. Er war mit Anna zusammen.«
»Wer ist Anna?«
»Du stellst vielleicht Fragen.«
Sie leckte sich den Finger ab und öffnete eine Dose. Sie war noch etwas schneller leer als jene, die Godi ausgetrunken hatte.
»Ich weiß nicht, wer sie ist. So wie sie aussieht, nimmt sie Drogen. Ganz dünn ist sie, und Narben hat sie an den Armen. Die haben doch alle Narben, oder?«
»Nimmt Martin auch Drogen?«
»Nein, das glaube ich nicht. Nein. Martin nicht. Der trinkt nur.«
»Hast du eine Ahnung, wo Martin pennt?«
»Nein. Keine Ahnung. Mir auch egal. Bin froh, dass er wieder ging mit dieser Anna. Möchte nicht, dass all die Junkies hier auftauchen. Das Dealerpack steht ja überall herum. Weißt du, um die Junkies machen sie ein Riesentheater, denen geben sie jetzt sogar die Drogen gratis ab. Eine Frechheit ist das. Wir müssen uns unseren Stoff selber kaufen. Mir schenkt keiner was.«
Sie nahm eine zweite Dose und kippte das Bier hinunter. Am anderen Ende des Parks stritten zwei Kinder um einen Ball. Die Mutter versuchte zu schlichten. Sie nahm den Ball und hielt ihn in die Höhe. Wie sie so dastand, sah sie aus wie eine Statue, die die Weltkugel vor den bösen Mächten der Finsternis schützt. Die Kinder verbündeten sich gegen ihre Mutter und versuchten, sie gemeinsam aus dem Gleichgewicht zu bringen. Eine andere Frau erschien mit einem Kinderwagen. Sie setzte sich auf eine Parkbank und zündete sich eine Zigarette an. Ich stand nur da und schaute mich um. Plötzlich spürte ich eine Hand auf meiner Schulter. Godi stieß mich sanft vom Rondell weg, Richtung Rasen. Ich wich einem langen, dicken Hundekot aus und drehte mich zu Godi um. Er sprach leise, wollte offenbar nicht, dass die anderen ihn hörten.
»Martin ist ein guter Kerl. Weshalb können die Ärzte ihm nicht helfen? Es summt in seinem Kopf. Da muss man doch verrückt werden, oder?«
»Weißt du, wer diese Anna ist?«
»Seine Freundin. Er hat mir von ihr erzählt. Ich habe sie aber nie gesehen. Auch ein armes Ding. Ist schwer süchtig. Hat vielleicht AIDS. Die Drogensüchtigen haben doch alle AIDS, oder?«
»Wo wohnt Anna?«
»Wo soll sie schon wohnen? Auf der Straße. Vielleicht im Asyl. Martin sagte, dass sie auf dem Letten gelebt hat. Was für ein Scheißleben. Ich war nie da. Finde das schon richtig so, dass sie da aufgeräumt haben. Hier räumen sie ja auch manchmal alles weg. Weißt du, das hat auch seine guten Seiten. Martin hat gesagt, man dürfe sich nicht an das Getto gewöhnen. Da hat er recht. Ich habe mich daran gewöhnt. Und auch wieder nicht.«
»Möchtest du raus aus der Scheiße?«, fragte ich.
»Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Was erwartet mich? Einen Job krieg ich nicht mehr. Irgendein Loch in einer Hütte, wo alles geregelt ist. Keine Haustiere und so. Hatte mal einen Hund, möchte wieder einen.«
Er zündete sich eine Zigarette an. Er sah jetzt jünger aus, als es zuerst den Anschein hatte. Mitte vierzig vielleicht. Seine Finger waren gelb, die Fingerkuppen schwarz, am rechten Daumen fehlte ihm der halbe Nagel. Sein Gesicht war eingefallen, die Augen wachsam. Die Falten um seinen Mund verrieten, dass er gerne lachte oder zumindest Grimassen schnitt.
»Gehen wir was trinken?«, fragte ich ihn.
»Essen wäre besser.« Er lachte. Bis auf die fehlenden Schneidezähne sah sein Gebiss noch ganz ordentlich aus.
Wir verließen die Anlage und gingen einige Querstraßen Richtung Langstrasse. Das Milieu hatte sich in den vergangenen Jahren breitgemacht wie nie zuvor in Zürich. Überall stieß man auf Erotikstudios und Prostituierte, die aus dem Fenster schauten oder einkaufen gingen. Es war kurz vor fünf, der Feierabend nahte und mit ihm die Feierabendbumser. Godi blieb ab und zu stehen, schaute sich einige der Nutten genauer an, gab Kommentare ab und lachte.
»Manchmal hätte ich schon Lust auf einen Fick. Aber dann denke ich, was ist, wenn ich ihn nicht hochkriege? Wenn ich den Hunderter versaufe, weiß ich wenigstens, was ich davon habe.«
Auf dem Straßenstrich sah man vor allem Südamerikanerinnen. Ganz junge Frauen um die dreißig, dünne, vollbusige, kleine, größere, die Auswahl war riesig. Straßenzug um Straßenzug hatten sich die Zuhälter zusammengekauft oder eingemietet. Da, wo einst eine Jugendfreundin von mir wohnte, war aus dem ganzen Haus ein verkapptes Bordell geworden. Ich erinnerte mich daran, wie wir mit dem Fahrrad um die Autos gekurvt waren und uns in Hauseingängen geküsst hatten. Unschuldig und naiv. Nebenan wohnte der Metzger, der seine Frau verprügelte, und zwei Häuser weiter Herr Wattenwyl, der immer die neuesten Brettspiele zu Hause hatte. Ein paar Jahre später wurde er wegen Unzucht mit Minderjährigen eingelocht. Herr Wattenwyl würde sich fürchterlich aufregen über das, was aus der Straße mittlerweile geworden war. Alle regen sich darüber auf. Ich fragte Godi, ob bei ihm vor zehn Jahren alles besser war.
»Vor zehn Jahren? Verdammt lang her. Nein, war nicht besser. Wohnte bei meiner Mutter. Hab damals schon gesoffen. Wir flogen aus der Wohnung, meine Mutter starb. So hat die Scheiße begonnen. Weiß nicht, ob das schon zehn Jahre her ist. Weißt du, ich könnte wieder arbeiten. War ein guter Arbeiter. Auf dem Bau, als Magaziner oder im Service. Habe alles Mögliche gemacht. Die Chefs waren mit mir zufrieden. Martin hat gesagt, ich solle es versuchen. Ich mache mir aber keine Illusionen. Schau doch all die Leute, die keine Arbeit finden. Die sind jünger und gescheiter. Und die saufen nicht. Noch nicht. Ohne Arbeit beginnen die meisten zu saufen, früher oder später. Ist doch so, oder?«
Ich schlug ihm ein italienisches Restaurant vor, er schüttelte nur den Kopf und zeigte nach vorne. Wir gingen die Langstrasse runter. Die Straße war halbseitig gesperrt, viele Radfahrer waren unterwegs. Einige Dealer standen herum und warteten auf Süchtige. Bei den Auslagen eines Kleidergeschäftes diskutierten ein paar Frauen und hielten Kinderkleider in das trübe Licht der sich neigenden Sonne. Viel war vom Frühling noch nicht zu spüren. In den Hinterhöfen lagen vereinzelt noch kleine Schneehügel, schwarz eingefärbt. Kinder sprangen umher, spielten Fangen. Wir gingen durch den Tunnel auf die andere Seite der Geleise. Godi zeigte auf ein chinesisches Fast-Food-Restaurant.
»Ich habe einmal bei einem Chinesen gearbeitet. In der Küche. War einer der ersten Chinesen hier in der Stadt. Sauteuer. Aber ich durfte gratis essen, so viel ich wollte. War ein netter Kerl. Weiß nicht, was aus ihm geworden ist. Sein Laden ist jetzt thailändisch. Ist mir zu scharf. Das Essen meine ich, nicht die Weiber.«
Godi bestellte Schweinefleisch mit Reis und einen Kaffee. Ich nahm frittierte Shrimps mit Reis und eine Cola. Wir setzten uns ans Fenster zur Langstrasse hin. Godi packte die Stäbchen aus und grinste. Ich aß mit Messer und Gabel. Er hatte keine Probleme mit den Stäbchen. Einige Passanten schauten uns eingehend an. Godi zeigte auf meine Shrimps.
»Ist auch nicht schlecht. Stehe nicht so auf Fisch und anderes Zeugs aus dem Wasser. Hab nie schwimmen gelernt. Liegt vielleicht daran. Arbeitest du für die Polizei?«
»Nein«, sagte ich. »Ich suche manchmal nach vermissten Personen oder Tieren oder nach verschollenen Klassenkameraden für ein Klassentreffen.«
»Und davon kannst du leben?«
»Nein. Ich schreibe auch noch Drehbücher fürs Fernsehen.«
»Krimis oder so?«
»Alles Mögliche.«
»Schreiben können muss toll sein. Ich war immer froh, wenn ich nicht schreiben musste. Verstehst du? Das Einzige, was ich jahrelang gemacht habe, war Einzahlungsscheine ausfüllen. Den Rest erledigt man mit dem Telefon.«
»Seit wann bist du ohne Arbeit?«
»Vier Jahre, oder acht, wie du willst. Hab zwischendurch ab und zu gejobbt. Vor vier Jahren hatte ich einen Job für drei Monate im Arbeitslosenprogramm der Stadt. Damals gab’s noch nicht viele Arbeitslose. Heute hast du keine Chance mehr ohne Wohnung.«
»Einen Entzug hast du nie gemacht?«
»Doch. Zweimal. Bin zusammengeklappt. Hab’s aber nie geschafft, wirklich aufzuhören. Hab mich irgendwie damit abgefunden, dass ich mich zu Tode saufe. Nein, nicht wirklich. Jetzt in diesem Moment würde ich aufhören. Was aber ist in einer Stunde? Man weiß nie, was in einer Stunde ist, oder?«
Er hielt die Tasse mit beiden Händen fest und schlürfte. Wir aßen eine Weile schweigend. Neue Gäste kamen hinzu, Asiaten, eine ältere Frau, die zwei alte, schmutzige Plastiktüten trug, ein junges Pärchen in Ledermontur mit Schnürstiefeln. Die Frau trug wuchtige Ringe an den Fingern und eine schwere Metallkette um den Hals. Sie war kaum zwanzig, hatte eine zarte, helle Haut. Ihr Freund war etwa gleich alt, die Haare auf der linken Seite bis auf einen Millimeter Länge rasiert, auf der rechten Seite lange Strähnen. Die Frau hatte grün-violett gefärbte Haare. Godi war auf dem Weg, sich einen Kaffee zu holen, ich folgte ihm, drückte ihm eine Zehnernote in die Hand. Er nickte und fragte, ob ich auch noch etwas wolle. Ich setzte mich wieder. Er kam mit zwei Kaffees, verschüttete ein wenig und entschuldigte sich. Als er mir wieder gegenübersaß, zeigte er auf seine fehlenden Schneidezähne.
»Martin hat gesagt, dass er einen guten Zahnarzt kennt. Ich glaube, ein Freund seiner Schwester.«
»Wieso gehst du nicht in die Poliklinik?«
»War ich schon. Martin hat gesagt, er kenne den besten Zahnarzt der Stadt.«
»Ist vermutlich auch der teuerste.«
»Glaubst du, wenn ich dir helfe, Martin zu finden, dass er mir dann einen günstigen Tarif macht? Ich meine nicht ganz gratis, aber fast.«
»Keine Ahnung. Ich kenne nur Martins Schwester. Nicht ihren Freund.«
»Ist nicht ihr Freund. Ich meine, die haben nichts zusammen. Der Zahnarzt ist schwul. Aber das stört mich nicht. Sei ein guter Typ. Und wenn Martin das sagt, dann stimmt das auch.«
»Wo, glaubst du, kann ich Martin finden?«
»Vielleicht bei Anna. Ich glaube, er liebt sie. Das ist das Elend der Straße. Wenn du dich verliebst, dann garantiert in jemanden, dem es noch dreckiger geht als dir selber. So kommst du nicht aus der Scheiße raus. Martin ist ein Träumer. Wahrscheinlich glaubt er, Anna von dem Dreck wegbringen zu können. Niemand kann das. Weg kommst du nur allein. Und auch das funktioniert meistens nicht. Die Drogensüchtigen kommen doch nie ganz weg vom Stoff, oder?«
»Weißt du, wie Anna mit Nachnamen heißt?«
»Anna? Nein. Hat keinen Nachnamen. Auf der Straße hat niemand einen Nachnamen. Ist nicht nötig. Es gibt auch keine Briefkästen.« Er lachte und zündete sich eine Zigarette an. Im Gegensatz zu McDonalds war bei dem Chinesen das Rauchen erlaubt. Es war kurz vor sechs, ich spürte eine satte Trägheit in meinen Gliedern. Der Geschmack der Zigarette war nicht unangenehm, er erinnerte mich daran, wie ich selber jahrelang vor einer Tasse Kaffee gesessen und geraucht hatte. Doch ich spürte kein Verlangen. Das ist das Unvorstellbare: dass man eines Tages kein Verlangen mehr verspürt, dass man einfach nur dasitzen kann, ohne nervös an den Nägeln zu kauen oder Zahnstocher zu verspeisen. Ich erzählte Godi von meiner Qualmerei.
»Ja«, sagte er. »Saufen und Rauchen ist das Schlimmste. Willst du aufhören zu rauchen, säufst du dafür mehr, und im Suff rauchst du auch wieder. Und aufhören zu saufen ist noch was anderes. Eine verdammte Scheiße ist das. Weißt du, weshalb ich Martin so mag?«
Ich zuckte mit den Schultern.
»Mit ihm kannst du dich stundenlang unterhalten. Einfach so. Über alles. Hast ja gesehen, wie die anderen sind. Was soll ich mit denen reden? Haben schon über alles geredet. Und sich immer über denselben Mist aufregen mag ich nicht. Also diese großkotzigen Reden mag ich auch nicht, so über Kultur und was weiß ich für Mist. Manchmal kommen so Leute von der Zeitung oder Studenten, die wollen alles wissen, wie du lebst, was du früher gemacht hast. Einer wollte von mir wissen, ob ich eine Lebensphilosophie hätte. Einen Scheißdreck habe ich, sagte ich zu ihm. Wenn du auf dem Scheißhaus sitzt, brauchst du auch keine Lebensphilosophie. Nur eine Rolle Toilettenpapier.«
Wir saßen noch ein paar Minuten da und schauten aus dem Fenster. Der Bus hielt auf unserer Höhe. Die Passagiere, die am Fenster saßen, sahen zu uns rüber. Einige waren unsicher, schauten wieder weg oder an uns vorbei, andere starrten nur geradeaus auf einen Punkt, so als müssten sie sich mit den Augen an etwas festhalten. Sie kamen von der Arbeit, wollten nach Hause, andere waren ziellos unterwegs, um sich abzulenken, ein paar Stunden zu vergessen, was ihnen Kopfschmerzen und Bauchkrämpfe bereitet. Ein paar waren auch glücklich. Es muss immer auch ein paar Glückliche geben. Gestärkt durch diesen Gedanken ging ich mit Godi zurück zur Bäckeranlage. Die Dicke und der Schweiger waren nicht mehr da. Dafür hörte ich Charly brüllen, neben ihm ein grauhaariger dünner Kerl in einem alten Militärmantel. Godi sagte, dass er noch ein wenig Tram fahren wolle. Die Stadt hatte ihm und den meisten anderen Pennern eine spezielle Jahreskarte geschenkt. Sie war nicht übertragbar und deshalb auch nicht handelbar. Und sie verhinderte, dass Leute wie Godi ständig vor dem Kadi landeten wegen Schwarzfahrerei.
»Ich fahre gerne mit dem Tram herum. Auch wenn mich die Leute anstarren. Ich schaue einfach aus dem Fenster. Das ist fast wie Ferien. Und ich bin froh, wenn ich Charly aus dem Weg gehen kann. Er mag mich nicht und ich ihn nicht.«
»Wo, glaubst du, kann ich Anna und Martin am ehesten finden?«
»Schwierig. Die Drogensüchtigen sind in der ganzen Stadt unterwegs. An der Langstrasse, überall im Kreis Cheib. Oder bei den Bahnhöfen, in der S-Bahn. Martin ist oft bei den Bahnhöfen. Er steht auf Eisenbahnen. Versuch es mal beim Bahnhof Wiedikon, Martin war ab und zu da, vielleicht hat er sich dort immer mit Anna getroffen.«
»Wenn du Martin siehst, rufst du mich an?« Ich gab ihm meine Visitenkarte, auf der auch die Nummer meines Handys drauf war, und dazu noch eine Telefonkarte für zehn Franken. Er nahm sie und lachte.
»Die Dinger werden überall gehandelt. Ich kenne Leute, die den ganzen Tag nur Telefonkabinen abklappern und schauen, ob jemand die Karte vergessen hat. Du ahnst gar nicht, wie viele Leute ihre Karten im Schlitz lassen, weil gerade das Tram kommt oder weil sie einfach den Kopf voll haben mit anderem Blödsinn.« Ich gab ihm auch noch einen Hunderter, er schüttelte den Kopf, steckte das Geld aber in die Hosentasche.
»Du bist jetzt mein Angestellter, Godi. Ich bezahle lausig, dafür kannst du dir die Arbeit selber einteilen.« Er stieg in ein Tram und winkte. Ich drehte mich um und ging in die andere Richtung. Die Gassenküche lag ganz in der Nähe. Niemand hatte große Lust, meine Fragen zu beantworten. Einer sagte immerhin, dass er Anna schon seit Längerem nicht gesehen hatte. Ich ließ mir seine Anna beschreiben, ich hatte den Verdacht, dass er eine andere meinte. Tatsächlich reagierte ein anderer Junkie und sagte, dass noch eine andere Anna auf der Straße sei. Ich zeigte ihm die Zeichnung, er zuckte bloß mit den Schultern. Die Anna, die er meinte, hatte er aber seit der Lettenschließung nicht mehr gesehen. Ich wollte mich noch ein wenig in der Stadt umsehen, ehe es dunkel wurde. Viel Zeit blieb mir nicht, aber genug, um wenigstens die Gegend um den Bahnhof Wiedikon abzugehen.
4
Die Gegend gehörte nicht zu den attraktivsten Orten der Stadt. Starker Autoverkehr aus allen Richtungen, quietschende Trams und dazu ein düsterer Bahnhofsbau, der genauso gut ein altes Schlachthaus hätte beherbergen können. Seit dem Ausbau des Bahnnetzes und der Einführung der S-Bahn war der Bahnhof zu neuem Leben erwacht, wie überhaupt die zuvor praktisch stillgelegten kleineren Bahnhöfe der Stadt wieder frequentiert wurden vom Pendlerverkehr. Manchmal lohnt es sich gar, mit dem Zug von einem Bahnhof zum anderen innerhalb der Stadt zu fahren, weil man schneller ans Ziel kommt als mit dem Tram oder dem Bus. Vor dem Bahnhof standen ein paar junge Ausländer. Weiter hinten standen die Leute, die auf die Überlandbusse warteten, die Richtung Birmensdorf ins Säuliamt fuhren. Junkies konnte ich keine entdecken. Die jungen Ausländer sahen auch nicht unbedingt aus wie Dealer, aber das wollte nichts heißen. Ich erinnerte mich an ein Plakat, das eine linke Gruppierung in der Stadt an Säulen und Wände geklebt hatte und auf dem stand: Nicht alle Ausländer sind Dealer. Vermutlich hatte das Plakat etwa gleich viel Erfolg, wie wenn man irgendwo in der Dritten Welt ein Plakat mit der Aufschrift Nicht alle Schweizer sind reich aufgehängt hätte. Ich ging auf die jungen Ausländer zu, es waren Männer vom Balkan. Ich zeigte ihnen die Zeichnung. Einer schaute sich um und tippte mit dem Fingernagel auf die Zeichnung.
»Ist Freund von dir?«
»Nein. Seine Schwester sucht ihn.«
»Ich nicht gesehen.« Er fragte die anderen etwas in seiner Sprache. Eine kurze Diskussion entstand. Niemand hatte Martin Boxler gesehen. Es wäre auch zu schön gewesen.
Ich ging rüber zum Bahnhof, betrat die Halle, ging die breite Treppe runter zu den Geleisen. Die Beschreibung, die ich von Anna hatte, war vage. Vermutlich hätte sie an mir vorbeigehen können, ohne dass ich sie erkannt hätte. Ich konzentrierte mich darauf, nach Junkies Ausschau zu halten. Die meisten erkannte man an ihrem Äußeren, den Rest an ihren Blicken, der Art, wie sie sich bewegten. Ich hatte eine Zeit lang in einem abbruchreifen Haus gelebt, in dem eine Menge Junkies wohnten. Die meisten lebten nicht mehr, einige waren vielleicht clean geworden, andere noch immer irgendwo auf der Straße. Ich kaufte mir oben am Kiosk eine Packung Kaugummis. Steve stand direkt neben mir, aber es dauerte eine Weile, bis ich es realisierte. Steve arbeitete seit ein paar Jahren als Streetworker, ich kannte ihn nur vom Sehen. Jeder, der ihn nicht kennt, würde ihn selber für einen Junkie halten. Er ist beinahe eins neunzig groß und dünn wie der Pfosten einer Verkehrsampel. Seine dunklen Haare sind fettig und mittellang. Immer wenn ich ihn sehe, trägt er ein Paar hellblaue Jeans, stonewashed, vermutlich sind es immer dieselben. Dazu ein weites T-Shirt und eine alte Lederjacke. Steve ist clean wie nur sonst was, er raucht nicht, trinkt nur Tee und ernährt sich vegetarisch. Und trotzdem sieht er seit Jahren schon aus wie ein Todkranker auf seinem letzten Spaziergang. Ich berührte seine Lederjacke.
»Ich bin Marco Biondi. Ich suche eine Fixerin, die Anna heißt.«
»Tatsächlich?« Er musterte mich. Er war einen Kopf größer als ich, aber vermutlich ein paar Kilo leichter. Seine Handgelenke sahen so aus, als würden sie nicht einmal einem Herbststurm standhalten.
»Und was willst du von der Anna? Sie bumsen?«
»Anna hat einen Freund. Er heißt Martin, und der ist seit drei Wochen verschwunden.«
»Und wer bist du? Wie ein Ziviler schaust du nicht aus.«
»Bin ich auch nicht. Ich habe der Schwester von Martin versprochen, ihn zu suchen.«
»Verstehe. Machst ihr einen Gefallen. Möchtest bei ihr landen, ihr imponieren. Ein bisschen Detektiv spielen. Ist es nicht so?«
»Vielleicht. Kennst du Anna?«
»Weißt du, wie viele Junkies es in der Stadt hat? Auch jetzt noch? Die Szene ist voll von Annas, Marias, weiß der Teufel, weshalb sich die Girls ausgerechnet solch biedere Namen zulegen.«
»Du glaubst, dass sie ihrem Freund einen falschen Namen angegeben hat?«
»Was weiß ich schon? Alles ist möglich. Kannst dir gar nicht vorstellen, was ich schon für Geschichten gehört habe. Und seit der Letten zu ist, streunen nicht nur die Junkies und Dealer umher. Hab auch schon brave Papas gesehen, die verzweifelt nach ihrer Tochter gesucht haben. Pah. Die suchen nicht die Tochter, die suchen den billigen Spaß. Woher soll ich wissen, was du suchst? Ich kenne dich nicht.«
Ich hielt ihm die Zeichnung unter die Nase. Er schaute nicht richtig hin, begann auf den Füßen zu wippen. Ich wollte schon weitergehen, als er mit dem Finger schnippte.
»Gute Zeichnung. Ich kenne den Typen. Ja, er war ab und zu mit Anna zusammen. Ist aber kein Junkie. Die beiden sind ein Paar, schätze ich mal. Hab wenig mit Anna zu tun. Sie schlägt sich ganz gut durch. Will keine Hilfe. Hat sie mir wenigstens gesagt. Ich dränge mich nicht auf. Bringt auch gar nichts. Bin einfach da, wenn einer etwas von mir will. Ich habe mir nie Illusionen gemacht. Vielleicht bin ich deshalb noch dabei. Die anderen hören alle nach ein paar Jahren auf.«
»Weißt du, wie Anna mit Nachnamen heißt?«
»Reber, wenn ich mich nicht irre. Ihre Eltern wohnen in Schwamendingen. Ihre Mutter kam ab und zu runter zum Letten und hat Anna saubere Kleider gebracht. Anna wollte nicht nach Hause. Die Mutter ist okay. Hab einmal lange mit ihr geredet. Der Typ auf der Zeichnung, du sagst, dass seine Schwester nach ihm sucht?«
»Ja. Er säuft und lebt zeitweise auf der Straße.«
»Hab ihn immer nur in Begleitung von Anna gesehen.«
»Wann zuletzt?«
»Vor einem Monat oder so.« Er tippte sich an den Kopf. »Hier drin habe ich ein paar tausend Gesichter gespeichert, aber das mit den Zeiten ist so eine Sache. Kann dir nicht sagen, ob es drei oder fünf Wochen waren, aber sicher nicht länger.«
Ich bedankte mich bei ihm und ging in eine Telefonkabine. Das Telefonbuch war darin so zerrissen, dass ich gar nicht erst bis zum R blätterte. Die Kabine nebenan war besetzt. Ich ging nach oben, stieg in ein Tram und fuhr nach Hause. Ich hatte eine Zweizimmerwohnung an der Weinbergstrasse, dazu teilte ich mir mit einem Journalisten ein Büro zwei Häuserblocks weiter. Ich machte mir zu Hause einen Espresso und hörte den Anrufbeantworter ab. Drei Anrufe, aber keine Mitteilung. Ich fand die Adresse der Rebers leicht, es gab nur eine Familie Reber mit einer Telefonnummer, die Schwamendingen zugeteilt war. Ich schaute auf die Uhr. Kurz vor sieben, die Zeit, in der in den meisten Wohnungen gekocht wurde und sich die Ehemänner ein Bier gönnten. Es klingelte fünfmal, ehe Frau Reber abnahm. Ich sagte ihr, wer ich bin und nach wem ich suchte. Frau Reber sagte nichts. Ich glaubte schon, dass die Verbindung unterbrochen worden war, dann hörte ich ein leichtes Knistern und Frau Rebers brüchige Stimme.
»Anna lebt nicht mehr.«
5
Es war eine Siedlung des sozialen Wohnungsbaus mit lang gezogenen grünen Häusern. Drei Stockwerke, kleine Räume, kleiner Balkon und zwischen den Häusern ein breiter grüner Rasen, gestutzt mit der Nagelschere und vermutlich überwacht von diversen Videokameras. Ein paar Kinder fuhren auf der schmalen Straße mit ihren Skateboards, andere lehnten sich an ihre Mountainbikes oder spielten Fußball. Niemand nahm Notiz von mir, aber irgendwo stand garantiert jemand hinter einem Fenster und beobachtete mich. Aus einer Wohnung hörte man eine Mutter, die ihr Kind anschrie. Nebenan rumpelte es in der Küche und ein türkisches Liebeslied begleitete mich ein paar Meter. Die Rebers wohnten im hinteren Teil des vierten Hauses in der Straße. Erster Stock links. Im Treppenhaus roch es nach Essen; gebratenes Fleisch und Zwiebeln. Frau Reber führte mich in die Küche. Die Tür zum Wohnzimmer war angelehnt. Ich sah die Füße eines Mannes. Sie steckten in schwarzen Pantoffeln. Der Fernseher lief. UEFA-Cup Hinspiele. Ohne zu fragen, stellte mir Frau Reber eine Tasse dampfenden Kaffee auf den Küchentisch. Ich setzte mich. Sie lächelte ein wenig verlegen, wusch sich die Hände und setzte sich ebenfalls. Ihre Haare waren hellblond getönt, ihr Teint dunkel, eine Warze über der linken Augenbraue. Die Falten am Hals machten sie älter, als sie vermutlich war. Ich erzählte ihr von meiner Suche nach Martin. Sie nickte stumm und schaute nachdenklich auf ihre Tasse.
»Anna hat mir von ihm erzählt. Ich habe ihn aber nie gesehen. Sie hat ihre Freunde nie mit nach Hause gebracht. Wissen Sie, es ist einige Monate her, als sie uns das letzte Mal besuchte. Sie hat sich nie gut mit meinem Mann verstanden. Er ist nicht ihr leiblicher Vater. Ihr Vater ist vor acht Jahren gestorben. Bei der Arbeit. Es war nicht leicht mit Anna, wirklich nicht. Auch für mich nicht. Ich habe sie bis zuletzt gerngehabt. Auch wenn das nicht immer einfach war. Sie hat mich belogen und bestohlen, aber sie war mein Kind. Ich musste ihr ganz einfach verzeihen. Wozu sonst sind Eltern da? Ich meine, das ist das, was ich auch selber als Jugendliche so schön fand. Egal, was du anrichtest, es gibt immer einen Ort, an den du zurückkannst. Glauben Sie mir, das ist das Einzige, was wir unseren Kindern wirklich bieten können. Sicher, Anna ist nicht in idealen Verhältnissen aufgewachsen. Aber was heißt schon ideal? Ich war bei einigen Treffen von Eltern drogensüchtiger Kinder. Es gibt Leute, die stellen sich vor, dass da lauter Säufer und kaputte Gestalten zusammenkommen. Aber das ist nicht so. Da ist alles vertreten. Einfache Menschen, gescheite, erfolgreiche, sanfte und laute. Nicht nur Geschiedene oder Alleinerziehende. Alles. Ich habe noch einen Sohn. Patrick. Er ist jetzt dreißig Jahre alt. Er hatte nie Probleme mit Drogen oder Alkohol. Es gibt keine Erklärung dafür. Und jetzt braucht man auch keine Erklärung mehr. Anna ist tot. Keine Erklärung kann sie wieder lebendig machen.«
Während sie redete, drehte sie ihre Tasse in einem eigenartigen Rhythmus auf dem Unterteller. Sie tat es langsam, fast mechanisch, ohne dass dabei Kaffee verschüttet wurde. Sie schaute mich nicht an, blickte nur ab und zu auf meine Hand, die neben meiner Tasse lag. An der Wand hing eine große Küchenuhr, die laut tickte, aus dem Wohnzimmer hörte man, wie der Geräuschpegel des Fernsehers schwankte, je nach Intensität des übertragenen Spiels. Ich war mir nicht sicher, vermutete aber, dass Borussia Dortmund spielte. Frau Reber trank einen Schluck Kaffee und schaute mir in die Augen. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, und schwieg. Sie drehte ihre Tasse.
»Natürlich hatte ich immer im Hinterkopf, dass es eines Tages passieren könnte. Oft, wenn das Telefon klingelte, schlug mein Herz schneller. Der Puls raste. Ich wusste, dass eines Tages die Polizei am Telefon ist und mir sagt, dass Anna tot ist. Einmal wurde sie als Notfall eingeliefert. Überdosis. Sie hat mir nie gesagt, ob es ein Unfall war oder ob sie Schluss machen wollte. Wissen Sie, ich habe es aufgegeben, ihr gut zuzureden. Ich zeigte ihr, dass ich für sie da bin, wenn sie mich braucht. Nicht wegen des Geldes. Ich habe ihr kein Geld mehr gegeben. Ich weiß schon, wie sich junge Frauen das Geld für die Drogen besorgen. Aber was sollte ich tun? Anfangs gab ich ihr Geld. Immer wieder, wenn sie mich anflehte. Aber was sollte ich tun? Ich hätte ihr alles Geld gegeben, das ich besitze, wenn es ihr wirklich genützt hätte. Aber so? Nein, es war ihr Leben. Ich musste lernen, damit umzugehen. Sie nicht zu verachten, sie aber auch nicht ständig zu bemitleiden. Manchmal, wenn sie sich wieder wochenlang nicht gemeldet hatte, da ging ich in die Stadt, suchte nach ihr. O ja, ich kenne die Drogenszene. Ich war oft da. Am Platzspitz, am Letten. Oft habe ich meine Anna dort angetroffen. Habe sie mit nach Hause genommen. Sie blieb manchmal eine Nacht, manchmal auch zwei. Aber sie hatte nie die Kraft, wirklich etwas gegen die Sucht zu machen. Aber das alles ist für Sie nicht so interessant, oder? Sie suchen nicht Anna, sie suchen ihren Freund.«
»Je mehr ich über Anna erfahre, desto leichter finde ich vielleicht Martin.«
»Ich hoffe, Sie müssen nicht da suchen, wo Anna jetzt ist.«
Ich war überrascht, als sie lachte. Sie errötete und stand auf. »Entschuldigen Sie. Aber diesen Galgenhumor habe ich von meiner Mutter. Immer dann, wenn es zu stark schmerzt, kommt er hoch. Wissen Sie, was meine Mutter sagte, als mein Vater starb? Sie erfuhr es auch am Telefon, er hatte einen Schlaganfall. Es geschah an einem Freitag. Er hat am Freitag immer den Lottozettel abgegeben. Nie hat er eine größere Summe gewonnen. Als meine Mutter erfuhr, dass er gestorben war, sagte sie am Abend, als wir im Wohnzimmer saßen und weinten, hoffentlich, sagte sie, hoffentlich hat er wenigstens noch die richtigen Zahlen angekreuzt. Wenn er schon im Leben nie Glück hatte, könnte er wenigstens als Toter sechs Richtige haben. So ist meine Mutter. Ich habe sie immer bewundert. Sie ist jetzt fünfundachtzig und macht sich über die anderen Alten lustig, die den ganzen Tag nur Fernsehserien anschauen und sich gegenseitig etwas vorjammern. Anna hat sie sehr gemocht.«
»Starb Anna an einer Überdosis?«
»Nein. Sie ist überfahren worden. Draußen in der Allmend. Aber wahrscheinlich waren die Drogen daran schuld. Sie war high, als es passierte. Wahrscheinlich ist sie vor das Auto gelaufen.«
»Was machte sie in der Allmend? War sie oft da draußen?«
»Die Polizei glaubt, dass sie den Autostrich machte. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Der Drogenstrich ist nicht in der Allmend, soviel ich weiß. Vielleicht hat sie auch einer da draußen abgeladen. Natürlich mache ich mir manchmal Gedanken, versuche mir vorzustellen, was genau geschah in jener Nacht. Aber dann sage ich mir, was bringt mir das? Und was bringt es Anna?«
»Was stand im Polizeibericht?«
»Nicht viel. Sie wurde erst am frühen Morgen gefunden.«
»Fahrerflucht?«