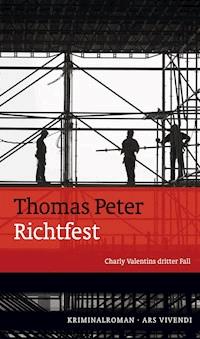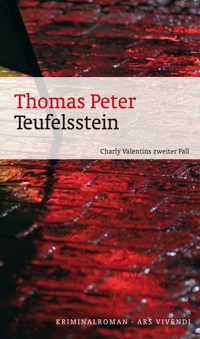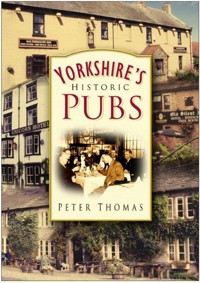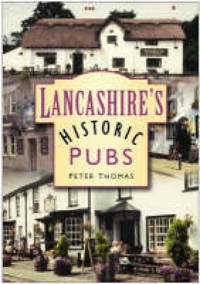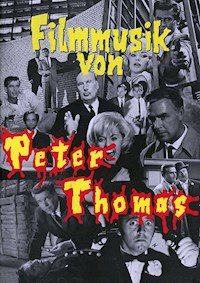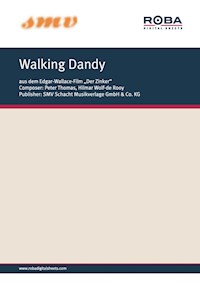Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ars vivendi Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Hans Strohmeier, ein ehemaliger Kollege von Kommissar Charly Valentin, wird tot in seiner Wohnung aufgefunden. Offenbar wurde Strohmeier, der nach seiner Entlassung aus dem Polizeidienst als Privatdetektiv arbeitete, während des Zwölfuhrläutens des Ingolstädter Münsters bei der Weißwurst-Brotzeit mit Pentobarbital betäubt und anschließend erwürgt. Charly und sein Team probieren sich bei ihren Ermittlungen nicht nur durch verschiedene Weißwurst-Metzgereien, sondern stoßen auch auf einige private Abgründe Strohmeiers. Spielte bei dem Mord Industriespionage in der Automobilbranche eine Rolle? Stecken die chinesischen Triaden dahinter? Da wird ein ehemaliger Mitarbeiter Strohmeiers tot aus der Donau gefischt ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 364
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thomas Peter
Zwölfuhrläuten
Charly Valentins vierter Fall
Kriminalroman
ars vivendi
Alles frei erfunden
Dies ist ein Kriminalroman. Die Handlung und alle darin agierenden Figuren sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder bereits verstorbenen Personen wären rein zufällig. Sofern real existierende Institutionen, Nationen oder Orte vorkommen, die in einem Regionalkrimi nicht zu vermeiden sind, entspringen auch deren Verknüpfungen mit der Geschichte in jedem Fall der Fantasie des Autors.
Vollständige eBook-Ausgabe der im ars vivendi verlag erschienenen Originalausgabe (Erste Auflage August 2017)
© 2017 by ars vivendi verlag GmbH & Co. KG, Bauhof 1, 90556 Cadolzburg
Alle Rechte vorbehalten
www.arsvivendi.com
Lektorat: Stephan Naguschewski
Umschlaggestaltung: FYFF, Nürnberg
Motivauswahl: ars vivendi
Coverfoto: mauritius images/foodcollection
Datenkonvertierung eBook: ars vivendi verlag
eISBN 978-3-86913-899-2
Inhalt
Eins – Freitag
Zwei – Dienstag
Drei – Dienstagabend
Vier – Mittwoch
Fünf – Mittwochnachmittag
Sechs – Donnerstag
Sieben – Donnerstagnachmittag
Acht – Donnerstagabend
Neun – Freitag
Zehn – Samstag
Elf – Sonntag
Zwölf – Montag
Dreizehn – Dienstag
Vierzehn – Dienstagnachmittag
Fünfzehn – Mittwoch
Sechzehn – Donnerstag
Siebzehn – Freitag
Achtzehn – Samstag/Sonntag
Neunzehn – Montagvormittag
Zwanzig – Montagmittag
Einundzwanzig – Montagnachmittag
Eins – Freitag
»Als Höhepunkt wähle mir dann aach noch die Königin. Is jedes Mal a Mordsspaß. Hättn Sie denn da jemanden in Ihrm Betrieb?« Die markige Stimme des unterfränkischen Weinbauern ließ den Telefonhörer erzittern.
Charly verneinte.
»Na, des ergibt sich. Es werd zu guter Letzt in unserm Weinberg als noch da eene oder andre Schoppe gedrunge, und dann tun mir all zam am Schluss des Lied der Franken, äh …«
»Sing müss«, ergänzte Charly. Er musste sich konzentrieren, um den Unterfranken zu verstehen, der mit seinem Handy vom Traktor aus telefonierte und werbewirksam seinen breitesten Dialekt einsetzte.
»Genau, wern S’ sehn, des gibt a Riesengaudi.«
Davon war Charly noch nicht so ganz überzeugt. Aber Wein, Weib und Gesang waren eigentlich immer Erfolgsgaranten für Gemeinschaftsveranstaltungen, also bestimmt auch für den Betriebsausflug der Kripo. Charly war dieses Jahr als Organisator auserkoren worden. Als ob er sonst nichts zu tun hätte. Aber Kommissariatsleiter Klaus Barsch hatte sich beim Chef für die Aufgabe nahezu enthusiastisch angeboten, als es um die Planung des diesjährigen Betriebsausfluges ging. Nach dem Zuschlag hatte Barsch die Organisation jedoch ganz schnell delegiert, und seine Wahl war auf Charly gefallen. Natürlich hatten Helmuth und Sandra mitgeholfen, aber die meiste Arbeit war an ihm hängen geblieben.
»Also gut, heute ist schon Freitag, da wird sich bei den Anmeldungen nicht mehr viel ändern.« Charly tätigte die letzten Rückrufe, um alle Aktionen und Termine zu bestätigen. »Sollten sich am Montag noch Änderungen ergeben, dann melde ich mich. Und ansonsten kommen wir am Dienstag zu Ihnen.«
»Jo, ich freu mich«, tönte der agile Actionwinzer, dessen Konterfei Charly aus dem aufgeschlagenen Prospekt heraus über eine riesige Ziehharmonika hinweg breit angrinste.
»Für alle Fälle geb ich Ihnen vielleicht mal meine Handynummer durch.«
Der Weinbauer notierte die Zahlen. »Kripo Ingolstadt, Herr Valentin, Charly Valentin«, diktierte er sich selbst. »Also Karl, oder?«
»Nein, eigentlich Georg. Aber im Dienst Charly. Wegen dem bayerischen Komiker. Weil schon in der Ausbildung …« Die Erklärung wurde Charly zu lang. »Genau, Karl. Sagen S’ einfach Charly.«
Er schickte noch einen Gruß nach Unterfranken und legte auf. Sein bevorzugtes Ziel für den Betriebsausflug wäre der Tegernsee gewesen. Eine schöne Bergwanderung, eine gemütliche Einkehr, und fertig. Aber der Dienststellenleiter, Kriminaloberrat Zwerglein, hatte so anschaulich von Kultur, Wein, Land und Leuten seiner Heimat geschwärmt, dass schnell deutlich geworden war, wohin er wollte. Da natürlich daraufhin jede andere Idee über kurz oder lang verworfen wurde, war Charly letztendlich nichts anderes übrig geblieben, als die Fahrt an die Mainschleife zu organisieren. Volkach hieß das Ziel.
Nachdem auch noch die fränkische Traditionsgaststätte, die er fürs Abendessen ausgewählt hatte, den Termin bestätigte, konnte sich Charly wieder den dienstlichen Unterlagen widmen, die er heute Morgen aus dem Aktenraum geholt hatte. Ein Prozess wegen einer Vergewaltigung stand bevor, und Charly wollte sich noch einmal die Vernehmungen und die Berichte, die er erstellt hatte, durchlesen.
Die Sache selbst war relativ klar. Für Charly bestand kein Zweifel an der Schuld des Tatverdächtigen. Die Anklage stützte sich jedoch auf einige wenige Spuren und hauptsächlich auf die Aussage des Opfers. Der Beschuldigte hatte den Vorwurf stets abgestritten. Das Beunruhigende war jedoch, dass hinter dem Angeklagten, obwohl er nicht so aussah, anscheinend Geld und Verbindungen standen. Und dieses Geld hatte ihm eine Anwältin aus München besorgt, eine bekannte Konfliktverteidigerin. Als lokales Bindeglied würde auch noch Dr. Bierschneider hinter der Anklagebank sitzen. Dem gegenüber wirkte die Ingolstädter Anwältin des Opfers zu anständig. Sie würde diesem Staraufgebot in der bevorstehenden Gerichtsshow nicht gewachsen sein.
Die Anklägerin, Frau Gambrini-Steinmetz, wäre zwar von sich aus keiner Konfrontation mit den Rechtsanwälten aus dem Weg gegangen, hatte aber vermutlich wieder die Anweisung, sich zurückzuhalten, um das Verfahren nicht zu gefährden.
Obwohl Charly in dem Fall wie immer seine Aufgaben nach bestem Wissen und Gewissen erledigt hatte, überfiel ihn vor derartigen Verhandlungen komischerweise meist ein mulmiges Gefühl. Während er Vernehmungen und Berichte durchlas, stellte er sich bereits auf alle möglichen berechtigten oder völlig absurden Einwürfe der Verteidiger ein.
Als sich wenig später aber rund herum alle Kollegen verabschiedeten, klappte auch Charly den Ordner zu. Verhandlung hin oder her, jetzt war erst mal Wochenende.
* * *
Chen Xuang stellte sein Fahrrad zu den Tausenden anderen hinter der Großen Halle des Volkes und versperrte es mit drei Ketten. Der junge Projektingenieur richtete sich auf und blinzelte in die Sonne, die an diesem Freitag von einem ungewohnt blauen Himmel über Peking strahlte. Chen ärgerte sich wieder einmal über den Eingriff in die Natur. Seit mehreren Tagen hatten die vorausschauenden Führer durch den gezielten Einsatz von Silberiodid alle Wolken über der Metropole abregnen lassen. Dadurch war die Luft heute von dem sonst üblichen Smog reingewaschen, der normalerweise die Sonne nur als gelblichen Klecks hinter einem grauen Vorhang erahnen ließ. Nun patrouillierten die Wetterflieger der chinesischen Luftwaffe einige Kilometer vor der Stadt und sorgten dafür, dass während der bevorstehenden Veranstaltung kein Wölkchen das perfekte Bild stören würde. Auf dem Platz vor der Halle sollte heute die neueste Errungenschaft der glorreichen Wirtschaftsnation der Weltöffentlichkeit präsentiert werden: Das Fahrzeug sah aus wie eine Mischung aus den gängigsten deutschen Automodellen. Die entscheidende Neuerung stellte allerdings eine innovative Technologie dar, die als interaktives Head-up-Display kombiniert mit einer Datenbrille über Eye-Tracking und Sensorenmessungen künftig das Verkehrsgeschehen weit vorauslesen konnte und das Fahrzeug, die Straße, die Umgebung und vieles andere überwachte. Alles wurde zueinander und mit GPS in Verbindung gebracht, wodurch in weiten Teilen autonomes Fahren möglich und der Mensch überflüssig wurde. So ganz genau konnte die Technik eigentlich niemand erklären. Außer Chen, der mit seinem Namen für das Projekt zeichnete.
Er zeigte einem Wachmann seinen Sicherheitsausweis der Klasse 1B, durfte die Große Halle des Volkes durchqueren und blieb an den mächtigen Türen, die hinaus zum Platz vor der Halle führten, stehen. Draußen wehten rund um das Areal die roten Flaggen mit den gelben Sternen sanft im Wind. Ein ganzes Heer von Medienvertretern hatte ein Meer von Kameras und Mikrofonen aufgebaut, und das jubelnde Volk schwenkte Papierfähnchen.
Aus der Tiefe der Halle erschien der zuständige Parteisekretär für technische Entwicklung, der ehrenwerte Zing Wan, der die Präsentation heute eröffnen würde. Der hagere Mann im schwarzen Anzug zog eine mächtige Bugwelle aus Parteifreunden, Beamten und Security hinter sich her. Er erkannte Chen und steuerte auf ihn zu. Beide deuteten eine Verbeugung an und der Parteibonze blickte gütig durch seine dicken Brillengläser auf den Techniker.
»Werter Herr Ingenieur, heute ist ein großer Tag für unsere Partei und für den technischen Fortschritt unseres Volkes. Sie können sehr stolz auf Ihre Arbeit sein.«
Chen biss sich auf die Unterlippe. Der Herr Sekretär hatte den wunden Punkt getroffen: den Stolz.
»Das könnte ich, wenn wir tatsächlich das System selbst entwickelt hätten.« Chen Xuang wusste, dass er besser geschwiegen hätte. Aber schon oft hatte ihn sein dummer Stolz in die Bredouille gebracht. Er konnte manchmal einfach die Klappe nicht halten, wenn ihn etwas wurmte.
Die Mundwinkel des Parteisekretärs zuckten kurz. »Wir haben die Technik durch die hervorragende Arbeit unserer Ingenieure und dank des Weitblicks unserer Führer zu dem entwickelt, was wir heute der Welt vorstellen dürfen«, entgegnete er schroff, und hinter den Brillengläsern verengten sich die Schlitzaugen noch etwas mehr.
»Genau genommen haben wir nur die Farben in der Darstellung geändert.« Aus Chen sprach eine Stimme, die ihm im Hinterkopf schon lange einredete, dass das alles nicht richtig sein konnte. »Den Rest der Technik haben wir eigentlich von anderen …«
»Wie auch immer, verehrter Freund«, unterbrach ihn der Parteisekretär und legte ihm kameradschaftlich die Hand auf die Schulter. »Ich habe jetzt der Welt etwas zu präsentieren. Über alles andere sprechen wir später noch einmal ausführlich.«
Als der ehrenwerte Zing Wan durch die Pforte nach draußen in den Sonnenschein trat, gab er dem gorillaartigen Securitymann neben sich einen kurzen Wink, und der nickte verständig.
Chen wollte sich der Bugwelle anschließen, wurde aber angehalten und mit Nachdruck in eines der Parteibüros nach hinten gebeten, um ein Problem mit seinem Sicherheitsausweis zu klären, wie man ihm mitteilte.
»… und so verdanken wir diese großartige Entwicklung nicht nur dem Weitblick unseres ehrenwerten Parteivorsitzenden«, rief Zing Wan kurz darauf in die Kameras der Welt, »sondern auch der Kraft unseres Volkes und vor allem dem Sachverstand unserer Techniker unter der Leitung des ehrenwerten Chefingenieurs Pang Sing.«
Der so Gelobte hatte bisher als Chens Stellvertreter agiert, war aber vor fünf Minuten überraschend befördert worden. Man brauchte im Zusammenhang mit dieser Sensation einen Mann, der in nächster Zeit den Journalisten wohlgefällige Reden und abgestimmte Antworten in technischen Belangen geben konnte. Von Chen Xuang würde man ab heute aber nichts mehr hören.
* * *
Erwin Bachhuber hatte ein ungutes Gefühl, als er so kurz vorm Wochenende ins Personalbüro zitiert wurde. Das besserte sich auch nicht, als der junge Personalreferent im hellgrauen Maßanzug, der erst seit Kurzem in der Firma war, ihm mit einem überheblichen Gesichtsausdruck einen Platz vor seinem Schreibtisch anbot. Er nahm Bachhubers Akte von einem Stapel und blätterte eine Zeit lang darin herum, bevor er sie zur Seite legte, die Ellbogen auf die Tischplatte stützte und sein Gegenüber ansah.
»Tja, Herr Bachhuber, Sie sind ja nun schon einige Jahre bei uns.«
»Vierundzwanzig werns in zwei Monat«, warf Bachhuber ein, dem das Messer in der Tasche aufging, wenn der Typ, der seit einem halben Jahr das Sagen im Personalbüro hatte, ›bei uns‹ sagte.
»Nun«, fuhr der Personalreferent unbeirrt fort, »da könnte man wohl ein wenig Loyalität erwarten. Aber Sie beklauen die Firma.«
Bachhuber fuhr hoch. »Wer behauptet das?«
»Herr Bachhuber. Haben Sie schon vergessen, dass der Werkschutz Sie angehalten hat, als Sie das Gelände mit der Bohrmaschine und dem Satz Schraubenschlüssel verlassen wollten?«
Das Schlimmste war, dass dieser Kerl auch noch so ein keimfreies Hochdeutsch sprach. »Ausgeliehen«, schleuderte ihm Bachhuber entgegen. »Ich wollt mir die Sachen nur übers Wochenende ausleihen. Für private Arbeiten. Macht doch jeder mal.«
Der hochdeutsche Anzugträger winkte ab. »Wir haben jetzt die Beweise dafür, dass Sie seit Jahren Werkzeug aus dem Betrieb mitgehen lassen. Und nicht nur das. Sie schmuggeln auch Ersatzteile nach draußen und verkaufen die privat.«
»Beweise? Was für Beweise?«
»Es ist alles haargenau dokumentiert, mit Fotos, Berichten, Zeugenaussagen und Protokollen von Ihrem Ebay-Account. Das muss ich Ihnen ja wohl hier jetzt nicht darlegen. Wenn Sie wirklich wollen, können wir das vor dem Arbeitsgericht machen.«
»So ein Schmarrn.« Bachhuber überlegte, aber ihm fiel nichts ein, was in letzter Zeit anders gewesen wäre als die Jahre zuvor. Woher konnten denn diese Beweise stammen?
»Wie auch immer. Wir sehen jedenfalls keine Basis mehr für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.«
Was quatschte der Typ da? Er war doch kein Politiker, er war Feinblechner. Und was für Zeugenaussagen? Wer hatte da was erzählt?
»Und damit kommen wir nicht umhin …«
Das mit diesem Ebay war ein Fehler. Das hatte er gleich geahnt. Er hätte auf den Flohmärkten bleiben sollen.
»… Ihnen die fristlose Kündigung auszusprechen.«
»Was? Des können S’ ned macha!«
»Doch Herr Bachhuber, das müssen wir sogar. Sie brauchen am Montag nicht wieder zu kommen und haben ab sofort Hausverbot auf dem Firmengelände. Ihre Papiere, die Kündigung und ein Arbeitszeugnis für die letzten Jahre schicken wir Ihnen zu.«
Erwin Bachhuber schluckte und rieb sich das stoppelige Doppelkinn. Er sank in dem Besucherstuhl zusammen, als er langsam kapierte, was dieser Schnösel gerade gesagt hatte. Kurz keimte in Erwin der Gedanke, diesem Scheißkerl, der in seinem Anzug so selbstsicher und unnahbar wirkte, die glatt rasierte Fresse zu polieren. So sah sonst oft Erwins bevorzugter Problemlösungsansatz aus. Aber das hatte doch alles keinen Sinn. Fristlose Kündigung!
»Ich muss meinen Spind ausräumen«, entgegnete er kraftlos.
»Wenn Sie jetzt rausgehen, steht da eine Schachtel mit Ihren persönlichen Sachen. Wir haben Ihren Spind schon für Sie ausgeräumt. Sie haben Glück, dass wir da nicht auch noch Dinge gefunden haben, die da nicht hingehören.«
Nach vierundzwanzig Jahren. Fristlose Kündigung. Wegen ein paar Ersatzteilen und einer billigen Bohrmaschine. Erwin konnte es nicht fassen. Es war aber so.
»Auf Wiedersehen, Herr Bachhuber. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft.« Der junge Personaler nahm sich die nächste Akte vom Stapel und beachtete Erwin nicht mehr.
Als Erwin mit der Pappschachtel unter dem Arm den Schlagbaum passierte, sah es aus, als hätte man ihn aus dem Gefängnis entlassen. Es fühlte sich aber genau andersrum an. Er sah sich noch einmal um und blickte auf die vier Werkshallen, die er nach all den Jahren jetzt nicht mehr betreten durfte. Der Pförtner winkte ihm lässig zum Abschied.
Das Gute an der Sache war, dass seine Frau schon vor Jahren abgehauen war. Wenigstens ihr musste er nichts mehr erklären. Er stand von jetzt auf gleich auf der Straße und hatte keinerlei Plan, was nun als Nächstes passieren würde. Er musste das alles erst mal verdauen. Wie jeden Freitag nach Feierabend führte ihn darum sein Weg in den Weißbierstadel. Als erster Anlaufpunkt, um die Gedanken zu sortieren, um die Situation zu verarbeiten, um über den Personalchef und das System zu schimpfen, waren die etwas heruntergekommene Kneipe und das dazugehörige Publikum durchaus geeignet.
* * *
Charly konnte die Zahlen in den kleinen Kästchen fast nicht mehr erkennen. Er war jetzt Mitte vierzig – gut, eigentlich schon eher Ende vierzig. Aber das konnte ja wohl nicht sein, dass er in diesem jugendlichen Alter einen Lottoschein beinahe nicht mehr lesen konnte. Bis jetzt hatte er doch gesehen wie ein Adler. Es lag bestimmt nur an dem abrupten Wetterumschwung. Die sommerlichen Temperaturen, die übergangslos auf die letzten nasskalten, verregneten Frühlingstage gefolgt waren, belasteten den Kreislauf, und damit auch das Sehvermögen. Da musste man sich keine Sorgen machen, das würde schon wieder vergehen. Er beugte sich ein wenig zurück und setzte mit ausgestrecktem Arm seine Kreuze.
Als vor einiger Zeit ein riesiger Jackpot gelockt hatte, waren er und seine Kollegen Helmuth und Sandra auf die Idee gekommen, eine Tippgemeinschaft zu gründen. Sie hatten sich fantasievoll ausgemalt, wofür sie die Millionen verschleudern würden, hatten natürlich den Jackpot nicht geknackt, waren aber trotzdem beim Gemeinschaftstipp geblieben. Und seitdem war Charly zuständig für die Abgabe des Lottoscheines. Inzwischen war es für ihn Routine, freitags nach Dienstschluss als Erstes diese Pflicht zu erfüllen.
Zusammen mit seiner Kundenkarte legte er den ausgefüllten Schein auf den Tresen und lächelte der zierlichen Dame dahinter freundlich zu. Wie immer piepte der Automat, weil er den Chip der Kundenkarte nicht lesen konnte. Kommentarlos nahm die Lottofee die Karte wieder heraus, besprühte sie mit einer geheimnisvollen Flüssigkeit und rubbelte sie an ihrer Bluse trocken.
»Servus beinand! Ahh, der Herr Kommissar. So so, probierst auch dein Glück!«, dröhnte es hinter Charly. Er drehte sich um und erkannte die schmale Nase im runden Gesicht von Hans Strohmeier. Der ehemalige Kollege wirkte immer noch drahtig, war nicht sonderlich groß, hatte aber breite Schultern.
»Servus, na ja, die Hoffnung stirbt zuletzt«, entgegnete Charly.
»Aber sie stirbt.« Strohmeier lachte über seinen gelungenen Witz. »Und, wie geht’s immer?«
»Geht scho.« Charly hatte wenig Lust, sich mit dem Mann, der ein wenig älter war als er, zu unterhalten. Er hatte Hans Strohmeier schon damals, als der noch bei der Polizei war, nicht leiden können. Mit der selbstgefälligen und rücksichtslosen Art, die der Exkollege an den Tag gelegt hatte, war Charly nicht klargekommen. Er war auch nicht sonderlich traurig gewesen, als Strohmeier vor etlichen Jahren aus dem Dienst entfernt worden war.
»Muss ja. Und dir?« Der Anstand sprach aus Charly, denn er mochte diese Frage zwischen Tür und Angel nicht. Entweder bekam man ein nichtssagendes »Gut« oder die bayerische Lebensformel »Passt scho« zur Antwort, womit der Gesprächspartner signalisierte, dass er darüber nicht reden wollte – oder aber man trat eine endlose Lawine an mitleidheischendem Gejammer los. Außerdem interessierte es ihn im Grunde gar nicht, wie es Strohmeier ging.
»Wie’s mir geht? Charly, man bringt kranke Delfine zu mir, damit ich mit ihnen schwimme.« Wieder lachte er über seinen eigenen Witz. »Und bei der Kripo? Alles in Ordnung? Was macht die Karriere?«
»Passt scho, es läuft so dahi.«
»Du bist jetzt bestimmt scho Hauptkommissar, oder?«
Charly nickte. Strohmeier war damals gerade erst Polizeihauptmeister geworden, als sie ihn rauswarfen. Hätte er sich nicht selbst rausgekegelt, könnte er heute denselben Dienstrang bekleiden wie Charly.
Die Lottofee war mit Charlys Spielschein fertig. Sie legte ihm die Quittung und seine Karte hin.
»Drauf war leider nix. Neunundzwanzigfünfzig wärns dann, bitte.«
»Hoi, ganz schöner Einsatz! Willst mit Gwalt gewinnen, Charly?«
»Is ja ned nur meiner. Mir san mehrer mitnand.« Charly hatte keine Lust, die Hintergründe der Spielteilnahme zu erörtern.
Während er alles sorgfältig verstaute, legte Strohmeier seinen Lottozettel auf den Tisch.
»Ja, mir san auch sowas wie a Tippgemeinschaft«, erklärte er. »A paar Mitarbeiter, Kumpels, quasi.«
Seine Kundenkarte sprühte die zierliche Dame vorsorglich gleich mit der geheimnisvollen Flüssigkeit ein und trocknete sie wiederum an ihrer Bluse ab.
»Also dann, servus, auf Wiedersehn«, verabschiedete sich Charly.
»Ja, servus, Charly! Schönes Wochenende. Sag allen einen schönen Gruß.«
»Mach ich.« Ganz bestimmt, dachte Charly.
* * *
Zwei Stunden später parkte Hans Strohmeier vor dem Haus seiner Ex. Es gehörte zu seinen vielen Unarten, Häuser und Wohnungen zu betreten, ohne vorher zu klingeln oder anzuklopfen.
Rosalinde, seine geschiedene Frau, lag auf dem Sofa und auf einem Kerl in weißen Jeans, der vom ersten Eindruck her einige Jahre jünger war als sie. Zärtlich zwirbelte sie eine Strähne aus seinem Friseur-Werbungs-Scheitel um ihre Finger, bevor sie erschrocken hochfuhr.
»Verdammt Hans, kannst du nicht klingeln? Du kannst doch nicht einfach so reinspazieren, wie es dir gefällt. Was willst du?«
»Des is auch mein Haus, in dem du da rumflackst.«
»Es ist eben nicht mehr dein Haus, sondern nur noch meins.« Im Stehen zupfte sie ihr T-Shirt zurecht. Auch der Scheitelträger stand auf und baute sich hinter Rosalinde auf.
»Was willst du überhaupt?«, bellte sie Strohmeier an.
»Ich wollt unserer Tochter ihr Geschenk zum Namenstag geben.« Er hielt eine Pralinenschachtel mit Schleife und ein Kuvert in die Höhe. »Is sie da?«
»Die Kimberley-Chayenne ist oben. Aber sie hat heut nicht Namenstag.« Rosalinde wirkte immer noch derangiert und jetzt zudem ein wenig verwirrt.
»Heut feiern die Einwohner von Kimberley ihren Gründungstag und ich hab sonst nichts Anständiges im Kalender gefunden.« Strohmeier hatte in Wirklichkeit keine Ahnung, wann die Bewohner der südafrikanischen Stadt ihren Jahrestag feierten, aber er hatte sich mit dem Vornamen seiner Tochter nie anfreunden können. Und ab und zu war es ihm ein Bedürfnis, einen kleinen Nadelstich zu setzen.
»Idiot!«
»Unser Tochter is oben und du suhlst dich da mit deim Lover auf der Couch!«
»Die Kimberley-Chayenne ist siebzehn. Und die ist nicht so verklemmt, wie du denkst.«
»Koa Wunder, wenn sich die eigene Mutter so aufführt.«
»Du Blödmann!«
»Apropos Blödmann«, Strohmeier deutete mit der Pralinenschachtel auf die weiße Jeans. »Schön, dass du wieder Anschluss gefunden hast. Dann kann sich ja ab sofort Prinz Charming um dich kümmern. Von mir gibt’s für dich kein Geld nicht mehr. Nur noch den Teil für meine Tochter.«
»Von wegen, du zahlst, bis du schwarz wirst«, keifte sie und beugte sich nach vorne.
»Vergiss es!«, fauchte er zurück.
Der Träger der weißen Jeans schob sich nach vorne. »Ick finde, du machst hier ganz schön een uff dicke Hose, wa«, berlinerte er und unterschritt dabei Strohmeiers Verteidigungsdistanz. Ohne genau hinzusehen, registrierte Strohmeier, dass sein Gegenüber die rechte Hand zur Faust ballte und die Muskeln spannte. Der ältere Ex verfügte gegenüber dem jüngeren Neuen über einen gehörigen Erfahrungsvorsprung in puncto Bierzelt- und Discoschlägereien. Durch einen kleinen Schritt zur Seite wischte der Schlag des Berliners ins Leere. Gleichzeitig traf Strohmeiers Haken ungebremst auf die kurzen Berliner Rippen, sodass sich der Körper oberhalb der weißen Jeans nach vorne krümmen wollte. Da trafen aber Strohmeiers vorschnellende Handballen beide Schultern des Kontrahenten und der Angreifer landete mit zerzaustem Scheitel vor dem Sofa auf dem weißen Hosenboden.
Strohmeier hob die Pralinen und das Kuvert auf und lies beides auf den Wohnzimmertisch fallen. »Sag der Kim einen schönen Gruß«, sagte er, machte kehrt und ging.
»Wir sind noch nicht fertig, du Arsch«, rief ihm der Berliner vom Boden aus hinterher.
Doch Strohmeier winkte nur gelangweilt ab, ohne sich noch einmal umzudrehen.
* * *
Familie Valentin saß bei der Brotzeit zusammen und Charly war froh, dass dieser Tag endlich zu Ende ging. Obwohl er heute noch nichts Warmes gegessen hatte, war es ihm auch schon egal, dass es wieder mal gesundes Gemüse und selbst gebastelte Brotaufstriche gab, die das bröslige, trockene Vollkornbrot nicht wirklich aufwerteten. Hauptsache, er war jetzt zu Hause und hatte seine Ruhe. Ein gebrauchter Tag, wie es immer so hieß. Aber die zurückliegenden Stunden im Dienst, und eigentlich die ganze vergangene Woche, hatten sich wirklich so angefühlt, als hätte sie schon jemand anders ausprobiert und nach kurzer Zeit wieder weggeworfen, weil einfach nichts passte. Und dann hatte das Schicksal diese weggeworfenen Stunden Charly aufs Auge gedrückt. Aber jetzt war es geschafft. Er würde in Ruhe sein Gemüse essen, sich danach noch ein kühles Weißbier genehmigen und sich auf ein erholsames Wochenende freuen. Auf jeden Fall wollte er in nächster Zeit von Polizei nichts mehr hören.
Petra streichelte seinen Arm und lächelte. »Du, Schorschi«, flötete sie sanft, »die Julia möcht sich bei der Polizei bewerben.«
Charly blieb das Vollkornbrot im Hals stecken. Er kämpfte gegen einen Hustenanfall und zwang sich zu schlucken. Das Töchterchen war jetzt in der neunten Klasse der Realschule und machte sich natürlich Gedanken über ihren Berufswunsch. Und jetzt kam sie auf diese Idee. Er wusste im ersten Moment wirklich nicht, was er dazu sagen sollte.
»Lern halt was G’scheits«, blaffte er, als das Vollkornbrot endlich drunten war.
Petra lächelte weiter, sie wusste, dass man die erste Reaktion ihres Mannes nicht immer so ernst nehmen durfte. Julia starrte ihn ungläubig mit weit aufgerissenen Augen an und im offenen Mund von Sohn Ludwig konnte man den Bärlauch-Paprika-Aufstrich erkennen.
»Ich mein«, Charly räusperte sich, »es gibt so viele schöne Berufe für ein Mädchen: Buchhändlerin, Reiseverkehrs… fach… kauf…, Medien… Design… Dings, oder Büro.«
Petra lächelte, Ludwig kaute weiter und Julia schaute immer noch ungläubig. »Ich hab den Test vom Arbeitsamt gemacht«, erklärte sie. »Entweder Förster oder Bestatter oder Polizist, war das Ergebnis.«
»Vergiss den blöden Test.« Charly richtete sich auf. »Wer will denn heut noch Polizist werden? Überleg doch mal, was das heißt.«
Petra hörte auf zu streicheln und beobachtete ihn interessiert.
»Ich mein, das geht schon in der Ausbildung los. Da musst du im besten Fall die ganze Woche über nach Eichstätt oder München, im schlimmsten Fall nach Würzburg oder vielleicht sogar direkt nach Nürnberg.«
»Aber man soll doch mobil und flexibel sein, sagst du immer«, war Julias trotzige Antwort.
»Ja schon, aber danach kommst zuerst mal in eine Einsatzhundertschaft. Da bist dann jedes Wochenende auf irgendeiner Demo oder im Fußballstadion. Du kannst dich vom schwarzen Block mit Farbbeuteln und Pflastersteinen bewerfen lassen, mit völlig verblödeten Neonazis rumstreiten oder mit besoffenen Fans rumärgern.« Die Vorstellung, seine kleine Julia würde diesen gewaltbereiten Vollidioten gegenüberstehen, wühlte Charly derart auf, dass er keine Gegenreden zuließ. »Du wirst beleidigt, angespuckt und provoziert. Und wennst dich dann amal wehrst, denn stehn Zehne mitm Handy da und filmen dich. Facebook und Youtube lassen grüßen.«
Julia holte Luft, doch mit einer energischen Handbewegung bremste Charly sie aus.
»Und dann, nach der Ausbildung, kommst nach München. Da reißt dann Nachtschichten und Wochenenddienste runter, bis du am Zahnfleisch daherkommst. Und das is in Ingolstadt genauso, wenns’d nach Jahren endlich heimkommst.«
Julia setzte erneut zu einer Antwort an, kam aber wieder nicht zu Wort.
»Oh, oder du kommst natürlich gleich zur Kripo. Ganz toll. Dann beschäftigst dich mit Kinderschändern, Mördern, Betrügern und Einbrechern. Und wenn du mit dem Gesocks fertig bist und den ganzen Dreck ordentlich aufgearbeitet hast, dann kommt der Herr Rechtsanwalt und sagt dir vor Gericht, dass du alles falsch gmacht hast und dass du eigentlich der dümmste von allen Beteiligten bist.« Charly dachte kurz an den bevorstehenden Vergewaltigungsprozess, konnte sich mit dem Gedanken aber jetzt nicht aufhalten.
»Aber das wird dir ja vorher schon gsagt, von den ganzen Menschenrechtlern und unseren Freiheitspolitikern, dass du als Polizist ein ganz Schlimmer bist, weil du rund um die Uhr alle abhörst und überwachst und alle Daten speicherst.« Er merkte, dass er aufpassen musste, nicht allzu polemisch zu werden. »Und das Beste ist, dass dir dann hinterher, wenn alles vorbei ist, die ganzen Gscheidhaferln in der Presse groß und breit erklären, wie’s richtig gewesen wär und was du unbedingt hättst machen müssen.« Charly musste Luft holen, er hatte sich direkt ein wenig echauffiert.
Julia nutzte den Moment für einen Einwurf: »Aber der Einstellungsberater hat gesagt, ich könnt auch zur Reiterstaffel gehen.«
Charly schlug die Hände vors Gesicht. »Mir hams damals gsagt, ich kann den Motorradführerschein machen, Hubschrauber fliegen und Polizeiboot fahren. Schatz, eine von tausend kommt zur Reiterstaffel, wenn überhaupt.« Er hatte keine Ahnung, wie viele es wirklich waren. Er wollte nur verdeutlichen, wie utopisch Julias Ansinnen war.
»Warum bist’n dann du bei der Polizei, wenn’s so scheiße is?«, fragte Ludwig kauend nach einer kurzen Pause.
»Und warum hängst du dich bei jedem von deine Fälle so nei, wenn’s eh keinen Sinn nicht hat?«, setzte Julia nach.
»Und wieso hast du Hunderte von Überstunden, wenns’d nicht gern dort bist?«, fügte Petra beiläufig an.
Charly betrachtete seine Familie der Reihe nach. Petra lächelte immer noch milde, als würde sie seine Erklärungen nicht so ganz ernst nehmen. Ludwig kaute ungerührt weiter und glotzte ihn dabei teilnahmslos an. Julia aber saß aufrecht und blickte ihm herausfordernd in die Augen. Offenbar war sie nicht gewillt, ihren Berufswunsch aufgrund seiner Einwände sofort aufzugeben.
Eigentlich sah sie ein bisschen aus wie seine Kollegin Sandra, dachte Charly. Auch sie trug wie Julia ihr Haar meist zu einem wippenden Pferdeschwanz gebunden. Auch sie war eine selbstbewusste, geradlinige, junge Frau, die sich nicht so schnell von ihrem Kurs abbringen ließ. Und Sandra war bei der Polizei und machte ihren Weg. Vielleicht sollte er sich einfach zurückhalten und sein Mädchen ihre eigene Entscheidung treffen lassen.
»Überleg dir des noch mal genau. Am Schluss musst du machen, was du für richtig hältst.« Er wollte es ihr nicht direkt verbieten. Aber sie sollte schon spüren, dass er nicht damit einverstanden war. Er stand auf, schenkte sich ein Weißbier ein und setzte sich damit nach hinten in den Garten, um die letzten Sonnenstrahlen zu genießen. An den Gedanken musste er sich erst gewöhnen.
* * *
Schon während des Landeanflugs waren Tao Fusan und Maja Miller-Lee fasziniert von dem üppigen Grün am Boden und dem strahlenden Blau und Weiß des Himmels. Die Maschine aus Peking setzte pünktlich in München auf. Nach einer problemlosen Pass- und Zollkontrolle saßen sie im Fond eines Taxis und fuhren auf der Autobahn einem Sonnenuntergang entgegen, wie sie ihn in ihrer chinesischen Heimat schon lange nicht mehr gesehen hatten.
Tao hatte seinen ersten Auftrag in Deutschland überraschend erhalten, als Ersatz für einen älteren, erfahrenen Agenten, der sich vor einigen Tagen beim Kung-Fu-Training den Unterschenkel gebrochen hatte. Zwei Tage bevor das selbstfahrende Auto präsentiert werden sollte, war Tao ins Büro des Parteisekretärs in die Abteilung für technische Entwicklung im Wirtschaftsministerium zitiert worden. Der ehrenwerte Zing Wan selbst hatte ihm seine Aufgabe eröffnet: Die Informationsquelle, die bisher technische Details aus Deutschland geliefert hatte, war aus irgendeinem Grund versiegt. Jemand müsse hinfliegen und den Grund erforschen sowie die Quelle zur weiteren Zusammenarbeit anregen, durch gutes Zureden, durch ein verlockendes Angebot, notfalls durch Drohungen oder deren Ausführung. Tao war ein Partner zugewiesen worden, den er aber entsprechend der üblichen Verfahrensweise erst beim Abflug treffen würde.
Er war durchaus nicht enttäuscht gewesen, als er am Beijing Capital Airport auf Maja Miller-Lee getroffen war. Sie war wie er Ende zwanzig und auch noch nie in Deutschland gewesen. Dass zwei junge, unerfahrene Mitarbeiter gemeinsam einen Auftrag übernehmen sollten, war dem Umstand geschuldet, dass alle anderen Agenten des Wirtschaftsministeriums sich bereits irgendwo auf der Welt in langwierigen Einsätzen befanden.
Bereits während des langen Fluges hatte Tao festgestellt, dass Maja eine sehr sympathische und vor allem eine auffallend attraktive junge Frau war, die gern lachte und mit ihrem Lächeln vermutlich die Terrakottaarmee zum Leben erwecken könnte.
Er blätterte in einem Reiseführer, während das Taxi Richtung A 9 fuhr. Da kam ihm eine Idee. Heute war erst Freitag. Um die Aufgabe zu erledigen, stand ihnen eine Frist von über einer Woche zur Verfügung. Und Spesen spielten keine Rolle. In wenigen, aber dafür umständlichen Sätzen Mandarin teilte er Maja seinen Plan mit. Sie sah ihn zuerst mit großen Mandelaugen an. Dann begann sie zaghaft zu lächeln und nickte verschämt.
Tao wandte sich an den Taxifahrer. »Excuse me, Sir, bitte nickt fahren nak Indolgestaadt.« Als der Chauffeur nach hinten sah, streckte ihm Tao den Reiseführer entgegen und tippte auf die aufgeschlagene Seite.
»Okay, von mir aus, dann halt zum Starnberger See«, quittierte der Taxifahrer.
Taos Augen glänzten. Er lehnte sich bequem zurück ins Polster und nahm zaghaft Majas Hand. »Und morgen Neuschwanstein«, schwärmte er.
Am Starnberger See stiegen sie aus. Im letzten Schimmer des schwindenden Tages ließen sie ihren Blick über das Wasser wandern. Sie betrachteten die Silhouette der Alpengipfel, die zum Greifen nah schienen. Und sie atmeten die frische Luft, die ihnen ein lauer Abendwind über den See entgegentrug. Waren dieser Anblick und diese Stimmung schon für einen Bayern eine unbeschreibliche Wonne, so war es für einen Pekinger Stadtmenschen unbegreiflich, dass man so etwas erleben durfte, ohne gestorben zu sein.
Überwältigt von der Stimmung legte Tao vorsichtig den Arm um Majas Schultern. Und mit Freude registrierte er, dass sie sich an ihn kuschelte. Sollte er wirklich Chancen bei ihr haben? Konnte es sein, dass dieses bildhübsche Mädchen ihn trotz seines Makels mochte? Tao hatte für ein chinesisches Gesicht eine auffallend große und schiefe Nase. Das hatte ihm schon manches Rendezvous verdorben. Doch Maja störte es anscheinend nicht.
Sie standen umschlungen am Seeufer, bis es endgültig dunkel war und die Sterne über den Bergen erschienen. Dank eines großzügigen Trinkgeldes hatte der Taxifahrer gern gewartet, bis seine Fahrgäste die Romantik ausgekostet hatten. Als sie wieder einstiegen, empfahl er ihnen, in Anbetracht des morgen anstehenden Ausfluges nach Neuschwanstein, ein Hotel in München zu beziehen, statt heute noch bis nach Ingolstadt zu fahren. Er stünde dann morgen früh gern für den Transfer nach Füssen bereit. Maja beantwortete Taos fragenden Blick wieder mit einem Lächeln und einem schüchternen Nicken. So wurde kurz darauf aus zwei Einzelzimmern in Ingolstadt ein Doppelzimmer in München.
* * *
Dr. Stefan Martin ließ den BMW X5 in die Garage rollen und schaltete die Scheinwerfer aus. Wie von Geisterhand schloss sich hinter ihm das Tor fast lautlos. Er war in Gedanken immer noch bei dem Rennpferd, das er gerade verarztet hatte. Und immer noch ärgerte er sich über die gewinnorientierte Einstellung des Pferdebesitzers, der jede weitere Behandlung des Tieres ablehnte, da es künftig ohnehin keinen Preis mehr für ihn gewinnen würde. Dabei war noch gar nicht klar, ob das Bein wirklich gebrochen war. Das konnte Dr. Martin erst in ein, zwei Tagen mit Sicherheit feststellen. Als er sich geweigert hatte, das Tier an Ort und Stelle einzuschläfern, hatte der Halter ihm gesagt, er allein sei ab sofort für Stall- und Futterkosten zuständig. Gleich morgen früh musste er also Kontakt mit dem Tierschutzverein und mit dem Gnadenhof aufnehmen. Es wäre wirklich schade um das junge und ansonsten kerngesunde Pferdchen.
Während er seinen Arztkoffer von der Rückbank nahm, fühlte er die Müdigkeit. Die Anspannung des langen Tages fiel von ihm ab. Er hatte sich in der Praxis den ganzen Tag um alle möglichen Tiere gekümmert, hatte dann einige Hausbesuche bei Schoßhündchen und Perserkatzen der besseren Gesellschaft absolviert und war schließlich zu dem Notfall mit dem Rennpferd gerufen worden. Jetzt freute er sich auf seinen Jogginganzug und einen guten Whisky in seinem bequemen Ledersessel.
Er löschte das Licht in der Garage. Bevor er jedoch hinaus in den Garten trat, sah er durchs Fenster hinüber zum Wohnhaus. Zwei Schatten bewegten sich hinter dem hell erleuchteten Fenster der Eingangshalle. Einen dieser Schatten identifizierte er ohne Probleme als den seiner Frau. Der Umriss ihres teuren Busens an der schlanken Gestalt und die Silhouette ihrer Frisur – nicht so teuer wie die Brüste, aber auch von einem kostspieligen Coiffeur kreiert – waren unverkennbar. Der zweite Schatten wirkte männlich, nicht sonderlich groß, aber breitschultrig. Beide Silhouetten bewegten sich auf die Haustür zu. Kurz davor blieben sie stehen. Sie legte die Arme um seinen Hals und er legte die Hände auf ihren gestrafften Hintern. Nach einem leidenschaftlichen Kuss wurde die Tür geöffnet und der männliche Schatten verschwand nach hinten durch den Garten in die Nacht. Sie schloss die Tür und knipste das Licht in der Diele aus. Ihr Schatten löste sich im Dunklen auf, bis er wenige Augenblicke später hinter dem schummrig beleuchteten Schlafzimmerfenster im ersten Stock wieder auftauchte.
Dr. Martin wartete noch eine Weile, bevor er die Garage verließ und hinüber zum Haus ging. Er wusste, dass seine Frau ihn betrog. Und dieser breitschultrige Schatten war nicht der Einzige. Aber dass diese Schlange offenbar überhaupt keine Skrupel mehr hatte, entdeckt zu werden, und ihre Liebhaber jetzt schon am frühen Abend empfing, wenn er jeden Moment heimkommen konnte, das war neu. Lang konnte er diesem Treiben nicht mehr zusehen. Sie machte ihn ja mehr und mehr lächerlich. Es war an der Zeit, konkrete Schritte einzuleiten.
Zwei – Dienstag
Früher hatte Erwin Bachhuber den Weißbierstadel meist erst nach Feierabend besucht. Die Aufenthalte am Vormittag hatten sich aufs Wochenende beschränkt. Seit seiner Entlassung saß er zu jeder Tageszeit in der Kneipe. Dementsprechend sah er auch an diesem Dienstagvormittag aus: ein zerknittertes Hemd, speckige Jeans, ungekämmte fettige Haare und schwarzgraue Stoppeln im breiten, schwammigen Gesicht.
»Geh weiter, gib ma no a Halbe!«
Es war schon die vierte an diesem Vormittag. Der Wirt zögerte kurz. Aber schließlich war es sein Geschäft und Bachhuber war ja auch alt genug. Also zapfte er ein frisches Bier und brachte es seinem einzigen Gast an den Stehtisch.
»Des konn doch alles ned wahr sei«, brummelte der breitschultrige ehemalige Arbeiter und fixierte das leere Glas vor sich, bis der Wirt es gegen das volle austauschte.
Bachhuber heftete seinen trüben Blick an den Kneipier. »Einfach nausgschmissen! Kannst dir des vorstellen?«, fragte er zum zwanzigsten Mal, ohne eine Antwort zu erwarten. »Wegen a Bohrmaschin. Und diesem blöden Ebay.« Er hob das frische Bier an. »Dieses scheiß Internet. Auf einmal san die ganzen Jahre völlig wurscht, die du gebuckelt hast, verstehst. Einfach wurscht.«
Mit einem großen Schluck leerte er das Glas zur Hälfte, setzte es wieder ab und wischte sich mit dem Handrücken über den Mund. »Dieser mistige Schnüffler, die Drecksau!«
Inzwischen hatte Erwin Bachhuber von einigen Kollegen Einzelheiten erfahren, die in der Firma die Runde machten. Offenbar hatte ein eingeschleuster Privatdetektiv die Belegschaft überwacht, was dann zur Kontrolle Bachhubers und zur Entdeckung der Bohrmaschine durch den Werkschutz geführt hatte.
»Was geht’s den denn an, wenn ich mir a Bohrmaschin ausleih. Und überhaupt meine Ebay-Dings und so. Wo bleibt denn da dieser Datenschutz. Des derf der gar ned.«
»Geh, Erwin«, warf der Wirt ein, »des hast doch jetzt schon ghört, dass des die Firma selber ermittelt hat. Des war ned der Detektiv. Der hat doch auch nur sein Job gmacht.«
»Toller Job, ehrliche Leut ausspioniern, pah. Ohne die Drecksau wär ich jetzt auf jeden Fall ned entlassen. Egal, was der Arsch genau gmacht hat und was ned.«
Mit einem zweiten Zug leerte Bachhuber das Glas komplett. Er rülpste und orderte einen Klaren, den er kurz darauf kommentarlos in sich hineinkippte.
»Ich könnt ihn umbringen, die Sau.« Auch die Identität des Detektivs war bereits durchgesickert. Und Bachhuber hatte von einem, der einen kennt, der einen kennt, der es genau weiß, den Namen und sogar die Adresse seines Feindbildes erfahren.
Er knallte das Schnapsglas auf die Tischplatte.
»Zahlen tu ich heut Abend. Jetzt geh ich nämlich und polier dem Schnüffler die Fresse.«
»Erwin, mach keinen Schmarrn«, rief ihm der Wirt hinterher.
Aber da stapfte Bachhuber schon mit rotem Gesicht und finsterem Blick draußen an der großen Fensterscheibe vorbei.
* * *
Maxl hatte ehrlich die besten Vorsätze. Insbesondere, nachdem ihm sein Vater zuletzt die Leviten gelesen hatte, als er in der Schule die Mädchentoilette überflutet hatte. Eigentlich hat sein Vater diese Leviten, was immer das auch war, von vorne bis hinten auswendig aufgesagt, überlegte Maxl. Denn mit dem Lesen hatte es der Alte nicht so. Außerdem war es nach dem Abendessen gewesen, und da konnte für gewöhnlich der väterliche Blick sowieso nur noch die großen Buchstaben der Bild-Schlagzeilen erfassen. Wenn er noch einmal etwas kaputt machen oder sonst irgendwie in der Schule auffallen würde, dann könne er sich auf eine Tracht Prügel gefasst machen, wie er sie noch nie bekommen habe. Eine kleine Kostprobe hatte er umgehend erhalten und die Erinnerung daran brachte immer noch seine Backe zum Glühen. Und überhaupt käme er dann in ein Internat für schwer Erziehbare. Da könnte er seine Computerspiele vergessen, und seinen Fußball auch, der unnütze Hanswurst.
Er wollte sich wirklich bessern. Aber Geschichte und Sozialkunde, da verstand er sowieso nie, was die Lehrer da vorne erzählten. Und draußen schien endlich wieder mal die Sonne und die Vögel pfiffen in den Bäumen.
Leviten hin oder her, der Nachmittagsunterricht war nichts für ihn. Wär schade um die Zeit und um den schönen Tag. Die Sache mit dem Bauchweh hatte wieder prima funktioniert. Die besorgte Frau Lehrerin wollte ihn sogar mit dem Auto nach Hause fahren. Das hatte er gerade noch abbiegen können. Tapfer hatte er darauf bestanden, selbst nach Hause zu gehen. War ja nicht so weit.
Zu Hause war um diese Zeit niemand, also brauchte er auch nichts zu erklären. Er schnappte sich seinen Fußball und ging hinunter in den Hof. Leider war er allein. Die anderen saßen ja noch in der Schule und lernten was über so alte Italiener. Also kickte er mit sich selbst und ließ seiner Fantasie wieder mal ihren Lauf.
Tausende auf den Rängen sangen und jubelten ihm zu, als der Stadionsprecher ihn ankündigte. Dann hörte er die Stimme eines Reporters, der die Fangesänge übertönte: »Dieser Maxl ist zurzeit in einer bestechlichen Form. Unglaublich, was der am Ball alles kann.« Der Superstar trickselte ein wenig herum, spielte sich den Ball auf den Kopf, köpfte ihn nach oben, stoppte ihn mit der Brust, ließ ihn abtropfen und vollführte zwei, drei Übersteiger, wie Ronaldo es nicht besser gekonnt hätte. Das Volk tobte.
»Er war der teuerste Transdings, aber er ist jeden Cent davon wert. Er allein kann ein Spiel drehen und seiner Mannschaft zum Sieg verhelfen.«
Der Wunderstürmer trat einige Male gegen den Ball, und die Hausmauer spielte das Leder zurück. Geschickt brachte er die Kugel jedes Mal unter Kontrolle. Er war schon ein Ausnahmetalent.
»Doch es steht immer noch unentschieden und wir sind schon in der letzten Spielminute. Jetzt braucht es ein Fußballwunder, eine großartige Idee. Es gibt nur noch eine Richtung.«
Maxl schaltete auf Angriff. Er spielte einen gekonnten Doppelpass mit dem Mülltonnenhäuschen und hebelte damit die komplette Abwehr aus. Dann umkurvte er geschickt einige gegnerische Verteidiger.
»Wie Slalomstangen lässt er die Abwehrspieler stehen. Einfach unausstehlich, dieser Maxl«, fabulierte der Sprecher in seinem Kopf.
Noch ein öffnender Pass hinaus zum Fahrradständer. Von dort kommt der Ball zurück.
Die Stimme des Reporters überschlägt sich fast: »Jaaa, die Flanke kommt gut. Maxl steht strafbar frei in der Mitte.«
Der Ball kam perfekt, halbhoch. Er visierte das Garagentor an, holte aus und nahm ihn volley. Doch in dem Moment, als der Ball seinen Fuß verließ, wusste er, dass irgendetwas falsch gelaufen war.
»Uuuh«, stöhnte der Reporter, »da war er wohl selbst überrascht, wie frei er stand. Zu viel Rücklage! Er drischt diesen Ball übers leere Tor.«
Der Ball flog tatsächlich übers und neben das Tor, schlug aber nicht auf der Tribüne mit den entsetzten Fans ein, sondern in einem Fenster im Hochparterre.
Der weiße Holzrahmen des alten, zweiflügeligen Fensters hatte der Wucht des schweren Lederballes nicht viel entgegenzusetzen. Mit einem hellen Klirren zersplitterten die Scheiben und die Fensterflügel sprangen auf. Der Ball verschwand in dem Zimmer dahinter und unmittelbar darauf klirrte es wieder. Einmal hell und klar, ein zweites Mal mit einem dumpfen Plopp.
Durch stete Übung aufgrund der ständigen Notwendigkeit in letzter Zeit war der Hechtsprung, mit dem sich Maxl hinter dem Mülltonnenhäuschen in Deckung brachte, schon zu einem unwillkürlichen Reflex geworden, über den er nicht mehr nachzudenken brauchte.
»Teamleader an alle: Volle Deckung. Wir haben ihre Zentrale getroffen. Die Aliens werden gleich zurückfeuern.« Maxls Fantasie arbeitete flexibel und blitzschnell.
Er drückte sich gegen die moosige Waschbetonwand und lauschte. Wäre Maxl der deutschen Sprache im Allgemeinen ein wenig mehr zugetan gewesen, und nicht nur im Bezug auf Fußballberichte und Actionspiele, so hätte er sich vermutlich gedacht, dass eine gespenstische Ruhe, gleich der vor dem nahenden Sturm, über dem melancholisch-grauen Pflaster des Innenhofs waberte und diese Grabesstille unaufhaltsam dahinschlich, beinahe greifbar in einer imaginären eisigen Wolke, die sich ihm entgegenschob, nach ihm lechzte und ihn frösteln ließ.
Da er aber in den letzten Deutschstunden angeblich auch von akutem Bauchweh geplagt worden war, dachte er nur »Oh, leck!«.
Das Zwölfuhrläuten der Moritzkirche begann mit einer einzelnen hellen Glocke, die die Stille im Hof noch bedrohlicher wirken ließ. Schließlich stimmten tiefere Glocken und die Geläute der anderen Innenstadtkirchen ein und erfüllten den Innenhof mit ihrem mittäglichen Konzert.
Maxl kauerte in der Ecke und wartete auf das Geschrei, das üblicherweise nach ein paar Augenblicken, die der Fensterbesitzer brauchte, um ungläubig auf die Scherben zu glotzen, durch den Innenhof schallen würde. Aber abgesehen vom Getöse der Kirchenglocken blieb es ruhig. Und es dauerte schon viel zu lange. Auch in den anderen Luken des Raumschiffs tauchten keine neugierigen Aliens auf. Maxl lugte vorsichtig um die Mülltonnen herum.
»Teamleader an alle«, wisperte er in ein erdachtes Funkgerät, »alles ruhig. Ich nehm mir zwei Mann und seh mal nach. Vielleicht haben wir die Hunde fertiggemacht.«
Maxl winkte zwei unsichtbaren Teammitgliedern, gab ihnen kurze Handzeichen und lief dann gebückt hinüber zum getroffenen Fenster.
»Okay, Jungs, gebt mir Deckung. Ich riskier mal einen Blick.«
Er hielt sich an der Regenrinne fest und stellte sich auf einen Mauervorsprung. So konnte er ins Zimmer hinter dem Fenster linsen. Und was er sah, wollte er nicht glauben.
»Scheiße«, entfuhr es ihm, als er die Situation realisiert hatte, »ich will nicht ins Internat.« Er sprang hinunter aufs Pflaster, spurtete quer über den Hof und durch den Torbogen hinaus zur Straße.
Maxl war klar, er hatte mit seinem vermaledeiten Fehlschuss den Typen hinter dem Fenster erschossen. Und das jetzt, so kurz nach dieser blöden Sache mit dem Weiberklo.
* * *