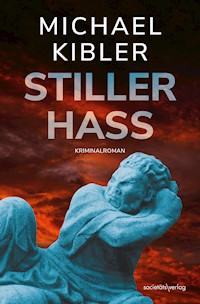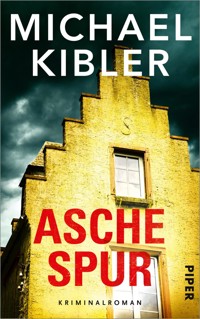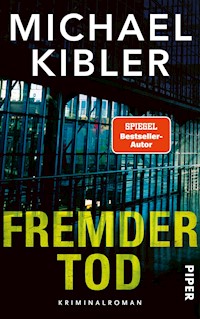9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Die hochbetagte Lukrezia Maria von Selberg-Broode wird tot in ihrem Zimmer im Darmstädter Senioren-Wohnstift »Goldenstern« aufgefunden. Die nicht sonderlich beliebte Dame wurde offenbar erstickt. Leah Gabriely und Steffen Horndeich von der Mordkommission nehmen die Ermittlungen auf. Schnell gerät die Familie ins Visier sowie eine Pflegerin – denn das Bargeld der Seniorin wurde gestohlen. Kurz darauf wird ein Pfleger des Heims erwürgt aufgefunden. Hängen die beiden Morde zusammen? Welche Motive spielen eine Rolle? Gänzlich verworren wird der Fall, als die Darmstädter Kommissare erfahren, dass sich im Blut der alten Dame Frostschutzmittel befand. Sie wurde bereits über einen längeren Zeitraum damit vergiftet. Horndeich und Gabriely stecken plötzlich mitten in einem höchst undurchsichtigen Fall.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für die Bewahrerin des Einhornstaubs
© Piper Verlag GmbH, München 2018
Covergestaltung: semper smile
Covermotiv: Katrin Binner
Datenkonvertierung: Kösel Media GmbH, Krugzell
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Ingeborg I
Montag, 4. Juni
Dienstag, 5. Juni
Ingeborg II
Mittwoch, 6. Juni
Donnerstag, 7. Juni
Freitag, 8. Juni
Samstag, 9. Juni
Ingeborg III
Sonntag, 10. Juni
Montag, 11. Juni
Dienstag, 12. Juni
Mittwoch, 13. Juni
Ingeborg IV
Donnerstag, 14. Juni
Freitag, 15. Juni
Samstag, 16. Juni
Epilog – Sonntag, 17. Juni
Nachwort und Dank
Ingeborg I
Fühlt sich so das Ende an?
Ich werde immer schwächer. Und mir ist kalt. Im Radio schwärmen sie von dem schönen, lauen Sommerabend, aber ich friere. Und sogar das Fischfilet heute Mittag hat mir nicht geschmeckt.
Echte Dorade. Keine Fischstäbchen vom Discounter. In feiner Senfsoße. Kartoffeln dazu. Ausgesuchtes Mischgemüse, Karotten, Erbsen, Brokkoli – auf den Punkt gegart. Ich glaube, vor zwei Wochen haben sie uns dieses Essen zuletzt serviert. Hat mir geschmeckt damals.
Ach, was das Essen angeht, war ich noch nie kompliziert. In den Jahren nach Kriegsende – mein Gott, womit wir uns da zufriedengegeben haben. Da war alles al dente. Denn es gab oft keine Kohlen, um das Gemüse zu kochen. Und wenn man die schimmeligen Stellen der Möhren weggeschnitten hätte, wäre das Mahl um die Hälfte geschrumpft.
Und jetzt? Jetzt gibt es Möhren genug, aber ich habe keinen Appetit mehr. Und mir ist kalt.
Die Dorade – ein französischer Name für die Goldbrasse. Irgendwie passt dieser Fisch zu meinem Leben. Seine Stirn ziert – und daher rührt sein Name – ein sichelförmiges Goldband. Mein Goldband: bürgerlicher Geldadel aus Bremen. Und dann die Zweigeschlechtlichkeit des Fisches. Bis zum Alter von zwei Jahren sind sie männlich, danach weiblich. Ich war immer ein Junge, als ich noch ein Mädchen war. Klettern auf Bäume, Flitzen durch Bäche, nur um zu sehen, was auf der anderen Seite ist. Die Jungs flüchteten vor dem Hund, ich bin auf ihn zugerannt und habe ihn angebrüllt, woraufhin er den Schwanz eingezogen und sich vom Acker gemacht hat.
Dann, als junge Frau, die Versuche meiner Eltern, mich möglichst schnell und gewinnbringend unter die Haube zu bekommen. Immer wieder Freunde meines Vaters, ich wurde zur Schau gestellt. Fest und schmackhaft, so wird das Fleisch der Dorade beschrieben. Hat auch auf mich zugetroffen, wenn man den Worten meiner Eltern Glauben schenken durfte.
Ich aber wollte nur eins: raus. Freund Nummer vier meines Vaters wollte mich heiraten. Vinzenz hatte Manieren und sah gar nicht so übel aus. Und geheiratet hat er mich tatsächlich. Besser als Möhren mit Schimmel. Und Ruhe vor meinen Eltern.
Was mir alles durch den Kopf geht, nur weil ich keinen Appetit mehr habe … Ich schlinge die Decke enger um mich.
Vinzenz wünschte sich einen Sohn. Ich hatte drei Totgeburten. Drei tote Mädchen. Veronika, Victoria, Vanessa – er hat auf den ersten Buchstaben seines Vornamens bestanden. Dann der Sohn, der gelebt hat: Valentin. Und Valentin hat sich prächtig entwickelt. Bei dem Zweitnamen habe ich mich dann durchgesetzt und ihn nach meinem Großvater benannt. Der einzige Mann in meiner Familie, den ich geliebt habe.
Und jetzt?
Jetzt habe ich nicht einmal mehr Lust auf diese Dorade. Sie schwimmt davon wie die Erinnerung an den leckeren Geschmack von Gemüse, Kartoffeln, Steak, von Chateaubriand oder den delikaten italienischen Spezialitäten, Ossobuco, davor Spaghetti alle vongole oder das von mir einstmals so geliebte Vitello tonnato. Eine Erinnerung an etwas, das ich nie wieder werde schmecken können, auch wenn ein Sternekoch es zubereiten würde.
Ach, das Essen. Kalorien, die einen am Leben erhalten.
Die wichtigen Dinge: die Kinder. In meinem Fall: das Kind. Mein Junge.
Ich habe ihn verloren, irgendwo auf dem Weg hierher.
Wo er jetzt ist? Keine Ahnung.
Die Dorade schmeckt mir nicht mehr.
Das Leben schmeckt mir nicht mehr.
Aber ihn noch einmal zu sehen.
Ja, das wäre der Nachtisch.
Der Nachtisch, bevor auch ich gehe.
Montag, 4. Juni
Es war die unbequemste Couch, auf der sie je gelegen hatte. Wahrscheinlich von einem Orthopäden gespendet, der sich erhoffte, auf diese Art und Weise neue Kunden unter der stattlichen Zahl von Polizeibeamten zu akquirieren.
Leah Gabriely wälzte sich auf die andere Seite. Dabei rutschte ihr die Decke vom Körper. Verhalten fluchend tastete sie mit der rechten Hand auf dem Boden herum, bis sie den Überwurf wieder zu fassen bekam.
Es dauerte eine weitere halbe Minute, bis sie Decke, Kissen und ihre langen Haare so weit sortiert hatte, dass an eine erneute Mütze Schlaf zu denken war. Bald wäre die Nachtschicht zu Ende, und sie war froh, dass man ihr ein wenig Ruhe zugestanden hatte. Im vergangenen Jahr hatten sie hier im Polizeipräsidium Südhessen einen Kriminaldauerdienst eingerichtet. Immer mit von der Partie: ein Kollege von K10, der Mordkommission. Heute hatte es sie getroffen. Und Nachtschichten waren ihr ein Graus.
Die Nacht war geruhsam verlaufen, sodass Leah sich um zwei Uhr in den Nebenraum hatte zurückziehen dürfen, um sich etwas auszuruhen. Das gelang allerdings nur, wenn man sich auf irgendeine Weise mit dem Sofa zu arrangieren wusste. Gleich nach der ersten Nacht, in der sie gegen die Couch gekämpft und eine bittere Niederlage hatte einstecken müssen, hatte sie eine zweite dicke Wolldecke mitgebracht. Die dämpfte die Attacken der drei fast bloß liegenden Sprungfedern gegen Pobacke, Hüftknochen und die dritte oder vierte Rippe, je nachdem, wie man den Körper zu posieren versuchte.
Kaum war sie wieder in jene Grauzone zwischen Wachen und Schlafen hinabgeglitten, die in wenigen Sekunden zu Tiefschlaf geführt hätten, flog die Tür auf, und das Deckenlicht tauchte den Raum in gleißendes Neonlicht: »Leah, wir müssen los. Eine tote Frau, vielleicht Fremdeinwirkung.«
Der Störenfried hieß Friedrich Wayne. Er war noch nicht sehr lange dabei, aber den Spitznamen John hatte er bereits weg. Auch wenn er in seiner Statur und seinem Gang dem Hollywood-Westernstar kaum glich.
Leah schlug die Decke zurück, schälte sich aus der unter Mühen hergestellten bequemen Liegeposition. Im Raum befand sich ein Waschbecken, darüber ein Spiegel, in dem sie, wenn schon nicht das gesamte Outfit, so doch zumindest ihr Gesicht kritisch beäugen konnte. Mit wenigen geübten Handgriffen hatte sie die Haare durchgekämmt und den Dutt gesteckt. Den Rock hatte sie abgelegt, um es etwas bequemer zu haben. Also, hinein in den Rock, hinein in die Schuhe – dann war sie gerüstet. Ihr Blick fiel auf das Handy. Es war Viertel nach fünf.
Sie fuhr mit in Johns Wagen. Die Kollegen der Spurensicherung starteten ebenfalls mit ihrem Sprinter. Der war bis unters Dach mit dem nötigen High- und Lowtech-Equipment ausgerüstet. John, der den Anruf aus einem Altenheim entgegengenommen hatte, berichtete ihr auf der Fahrt in knappen Worten, was er bereits erfahren hatte: Ein Arzt habe den Tod einer Bewohnerin untersucht und konnte eine Fremdeinwirkung nicht ausschließen. Genaueres würden sie dann vor Ort erfahren.
Die Kolonne von Polizeifahrzeugen fuhr die Nieder-Ramstädter Straße nach Norden, bog später nach Osten in die Dieburger ab. Jetzt erkannte Leah, um welches Heim es sich handelte. Sie war schon einmal hier gewesen.
»Hat total was von einem Schloss, das Ding«, brummte John, der den Wagen lenkte. »Meine Oma kann sich so was nicht leisten. Das Heim, in dem die wohnt – Mann, Mann, Mann, da überlegt man sich dreimal, ob man wirklich achtzig Jahre alt werden möchte! Aber die Hütte hier – das ist echt nur was für Bonzen.«
Leah kommentierte die Ausführung nicht. Es glich einem Schloss, da hatte John recht.
Im vergangenen Jahr hatte sie ihren Vorsatz, ihre sozialen Kontakte zumindest etwas zu erweitern, in die Tat umgesetzt. Diese trockene Umschreibung traf das Vorhaben wohl am nächsten. Mit einem Herrn hatte sie die erste Stunde des Tanzkurses in der Tanzschule Bäulke hier in der Nähe – nun, hinter sich gebracht schien durchaus die richtige Wortwahl zu sein. Vor der zweiten Stunde waren sie etwas zu früh vor dem Gebäude der Tanzschule angekommen. Daher war sie mit Wieland, so hieß ihr Tanzpartner, noch eine Runde spazieren gegangen. Die Seniorenresidenz lag keine zweihundert Meter entfernt. Zunächst erstaunte Leah das prunkvolle Gründerzeitpalais. Drei Bögen bildeten das Eingangsportal. Symmetrisch nach oben richtete sich der rechteckige Turm. Rechts ragte ein kleines Türmchen frech in die Höhe, und das Halbrund der Außenmauern auf dieser Seite nahm dem Bau das Konforme. An der linken Mauer war nachträglich ein gläserner Aufzug installiert worden. Wahrlich ein Schloss. Konterkariert durch drei alte Damen, die, jede auf ihren Rollator gestützt und in eine rege Unterhaltung vertieft, vor dem Portal flanierten.
Wieland hatte sofort über die Geschichte der Residenz referiert, die Leah kaum interessierte. Sie hatte sich vielmehr auf das munter plappernde Trio konzentriert. In dem Moment, in dem Wieland den letzten Satz seiner Ausführungen beendet hatte, war ein silberfarbener Rolls-Royce auf den Parkplatz des Hauses abgebogen. Der Chauffeur stieg aus, ging um den Wagen herum, öffnete den Verschlag des Fonds, und heraus stieg ein grau melierter Herr, auf einen Stock gestützt, dessen Griff, so schien es Leah zumindest, aus Elfenbein geschnitzt war.
Dann drängten auch die restlichen Erinnerungen an diesen verunglückten Tag an die Oberfläche ihres Bewusstseins. Denn unmittelbar nach der zweiten Tanzstunde hatte Leah den Kontakt zu Wieland final beendet. Er hätte nicht versuchen sollen, sie zu küssen. Und schon gar nicht, sie mit seiner Zunge in ihrem Mund zu ersticken. Schade. Denn eigentlich war er ganz nett gewesen.
»Echt, meine Oma hätte das auch verdient. Muss ein toller Schuppen sein«, bemerkte John und riss Leah aus ihren Gedanken.
John lenkte den Wagen auf denselben Parkplatz, auf dem Leah vor ein paar Monaten den Rolls-Royce gesehen hatte. Sie verließen ihren roten Opel Insignia, jüngster Spross der Flotte der Fahrzeugbereitschaft. Dann gingen sie auf den Haupteingang zu. Im Gegensatz zu ihrem letzten Besuch lag das Gebäude heute im Dunkeln, kein plapperndes Trio, kein eleganter Herr mit Stock. Dafür stand eine Frau vor dem Eingang, hielt eine Zigarette in der einen Hand, in der anderen ein Handy. Sie steckte das Smartphone in die Tasche ihres Kittels, als sie auf die Beamten zuging.
»Gut, dass Sie da sind«, begrüßte sie die Polizisten. »Mein Name ist Ria Brandes. Ich hatte die Nachtschicht.«
Eine Leidensgenossin, dachte Leah.
»Ich habe die Tote gefunden und den Hausarzt verständigt. Kommen Sie doch bitte herein.« Sie trat einen Schritt zur Seite.
Leah begutachtete die Dame und fällte ihr Blitzurteil: Ria Brandes glich einer Madonna. Das braune, glatte, schulterlange Haar umrahmte den dunklen Teint: Ein Elternteil musste afrikanischer Abstammung sein. Ria Brandes trug ein unaufdringlich geschnittenes blaues Kleid mit weißen Punkten, bis zum Hals geschlossen. Ein schlichtes Silberkreuz an einer schmalen Kette lag auf Höhe ihrer Brust. Ihre Stimme glich dem sanften Plätschern eines Baches im Frühling. Eine Stimme, der man Vertrauen schenken durfte.
Frau Brandes geleitete die Polizisten durch das Portal. Im Wettkampf um den prächtigsten Eindruck nahmen sich Eingangshalle und das Drei-Säulen-Entree nichts. Vom marmorierten Steinboden aus führte das breite Treppenhaus rechter Hand in den ersten Stock. Marmorstufen und Jugendstilfliesen an den Wänden steuerten ihr Übriges dazu bei, um Leah zu beeindrucken.
Das Land Hessen als ihr Arbeitgeber trug zwar seinen Teil zu ihrer Altersabsicherung bei. Aber auch das Geld ihrer Zusatzversicherung, da war Leah sich sicher, würde unter der Last der Miete in diesem Kasten verdampfen wie ein Tropfen auf einer Herdplatte und somit einen Lebensabend in diesem Ambiente unmöglich machen.
Sie stiegen die Treppen in den ersten Stock hinauf und bogen in den linken Gang ein. Der war erleuchtet und offenbarte, dass der Boden aus echtem Parkett bestand. Der Flur wurde am Ende durch zwei Glastüren abgeschlossen, Zugang zum Außenaufzug, ein Zugeständnis an die Menschen, die sich nicht mehr so agil bewegen konnten oder sogar einen Rollstuhl benötigten.
Im Türrahmen der letzten Wohnung auf der rechten Seite stand ein Mann, neben ihm auf dem Boden eine klassische Arzttasche aus schwarzem Leder. Er war ganz offensichtlich der Mediziner, der die Polizei verständigt hatte.
Als Leah einen Schritt über die Türschwelle trat, fühlte sie sich, als habe sie das Portal einer Zeitmaschine durchschritten und sei direkt im Musikzimmer eines Barockschlosses gelandet. Das lag vor allem an der Harfe am anderen Ende des Raumes. Sie war höher, als Leah groß war.
An der Wand befand sich ein großes Sofa mit geschliffenen und verzierten Beinen, die in feinem Schwung in die Seitenlehnen übergingen. Das lackierte Holz schimmerte, und die Maserung schien mustergültig auf jene der Harfe abgestimmt. Vor dem Sofa residierte ein flacher Tisch. Ein Esstisch vor dem Fenster, flankiert von zwei Stühlen, fügte sich ebenfalls harmonisch in den Raum. Der Bezug des Kanapees spiegelte den Charakter des ganzen Zimmers wider: Ein dezenter dunkelroter Brokat mit ziselierten Verzierungen, edel, aber nicht aufdringlich, zeugte vom Understatement, das dennoch unmissverständlich klarmachte, dass die Einrichtung dieses Raumes den Wettbewerb zu den Kosten des britischen Luxusautomobils mit Emily als Kühlerfigur nicht zu scheuen brauchte. Einzig die moderne Küchenzeile an einem Rand des Raumes störte das durchdachte Ensemble.
Und natürlich auch das Bild der Verstorbenen. Sie lag auf dem Rücken in unmittelbarer Nähe der Harfe, der Kopf unweit der Pedale. Ihr Morgenmantel war aus feinster Seide gefertigt und mit ornamentalen Stickereien versetzt. Obwohl ebenfalls aus Seide, wirkte das Nachthemd im Vergleich dazu unscheinbar.
Leahs nächster Gedanke blitzte auf, pietätlos, aber zu schnell zu Ende gedacht, als dass er sich hätte verdrängen lassen können: Die Dame braucht das Sofa nicht mehr – und im Ruheraum des Präsidiums würde es sicher eine vortreffliche Figur machen, die Gesundheit der Beamten schonen – und damit den Staatssäckel. »Sie sind der Arzt?«, fragte Leah.
»Ja, Perlau, Dr. Peter Perlau.«
»Wer ist die Tote?«
»Lucrezia von Selberg-Broode.«
»Sie haben die Tote entdeckt?«
»Nein. Entdeckt hat sie Frau Brandes.« Er deutete auf die Pflegerin, die ebenfalls im Türrahmen stand. »Sie war es auch, die mich angerufen hat.«
Leah vernahm Schritte im Flur, wenige Sekunden später erblickte sie Silvia Rauch, die Leiterin der Spurensicherung. »Vielleicht unterhaltet ihr euch irgendwo anders, dann können wir hier schon mal Spuren sichern«, schlug sie vor.
Leah nickte ihr zu, dann wandte sie sich an Ria Brandes: »Gibt es hier ein Zimmer, in dem ich mich in Ruhe mit Dr. Perlau unterhalten kann?«
»Im Erdgeschoss im Aufenthaltsraum, da sind Sie ungestört.«
»Mit Ihnen werde ich nachher auch sprechen müssen«, erklärte Leah sofort.
»Natürlich«, erwiderte die Altenpflegerin.
In diesem Moment öffnete sich die Tür der gegenüberliegenden Wohnung. Heraus trat ein älterer Herr, bekleidet mit einem auberginefarbenen Morgenmantel. Als er die Versammlung erblickte, stutzte er kurz: »Was ist denn hier los?«
Auch am Ende des anderen Flügels öffnete sich eine Tür: »Ist hier jetzt mal Ruhe?!«, krächzte eine alte Dame.
»Vielleicht halten Sie erst mal die ganzen Bewohner in Schach«, schlug Leah vor. Und in dem Moment wurde ihr bewusst, dass sie Hilfe benötigen würde: Sie musste wohl oder übel ihren Kollegen Steffen Horndeich vorzeitig aus der wohlverdienten Nachtruhe reißen. Und sie konnte auch gleich Verstärkung anfordern, damit die Kollegen die erwachten Hausbewohner befragen konnten. Sie griff zum Handy.
Der Klingelton des Handys riss Kriminalhauptkommissar Steffen Horndeich aus seinem Traum. Eben hatte er noch als Großwildjäger mit einem Krokodil gekämpft, das seine siebenjährige Tochter Stefanie bedroht hatte. Das Display zeigte, dass seine Kollegin Leah Gabriely anrief. Es war Viertel vor sechs und damit eine Stunde vor der Zeit, zu der der Wecker geklingelt hätte.
»Hallo, Leah, was gibt’s?«, murmelte er schlaftrunken.
»Ich bin im Seniorenstift Goldenstern. Dieburger Straße 241. Eine alte Dame ist verstorben – und die Todesursache noch nicht eindeutig geklärt. Ich denke, du solltest herkommen.«
Horndeich nickte. Was Leah natürlich nicht sehen konnte. »Ja, klar, ich komme. Bis gleich.« Sein Daumen drückte den roten Beenden-Button.
Er setzte sich auf den Bettrand. Eine Hälfte des Ehebettes war leer. Seine Frau Sandra schlief derzeit rund sechshundert Kilometer von ihm entfernt. Bereits seit einer Woche. Mit ihrem jüngeren Kind, Alexander, der nach den Sommerferien in den Kindergarten kommen sollte, war sie in eine Mutter-Kind-Klinik an der Ostsee gefahren. Der Kleine litt seit geraumer Zeit unter einer Bronchitis, die sich nicht auskurieren lassen wollte. Ihr Hausarzt setzte seine Hoffnung darauf, dass sich die Bronchien im milden Seeklima beruhigten. Drei weitere Wochen würde die Kur dauern, bevor Sandra und Alexander wieder nach Hause kämen.
Sandra hatte mit dem Gedanken gespielt, Stefanie ebenfalls mitzunehmen, doch die junge Dame von sieben Jahren hatte sich strikt geweigert. Sie wäre jetzt ein Schulkind, hatte sie betont, und als ein solches hätte man Pflichten. Ihr machte die Schule Spaß, obwohl diese das Mädchen derzeit nicht besonders herausforderte. Schon bevor sie eingeschult worden war, hatte sie Worte lesen können, Papa, Mama, und sie beherrschte den Zahlenraum bis zwanzig sicher, wie es im Lehrerdeutsch hieß.
Sandras Eltern wohnten nur fünfzehn Kilometer von Darmstadt entfernt in Büttelborn und hatten sich bereit erklärt, bei der Versorgung der Enkelin einzuspringen. Horndeich brachte sie morgens in die Schule, und die Großeltern holten sie von dort ab und nahmen sie bis zum Abendessen mit zu sich. Und Horndeich musste zugeben, dass er die anschließenden Papa-Tochter-Abende bei sich zu Hause genoss.
Es war noch zu früh, um seine Tochter zur Schule zu fahren. Kurz überlegte Horndeich, welche Optionen er hatte. Stefanie zu den Schwiegereltern zu chauffieren würde wenig Sinn machen, denn die müssten dann wenig später mit ihr wieder nach Darmstadt hineinfahren. Und Sebastian Rossberg, den Vater seiner ehemaligen Kollegin Margot Hesgart, der in der Souterrainwohnung ihres Hauses wohnte, wollte er um diese Zeit ebenfalls nicht wecken. So würde er seine Tochter wohl oder übel in das Altenheim mitnehmen müssen. Und sie dann von dort aus zur Schule bringen.
Er stand auf, ging ins Bad, wusch sich und zog sich an. Dann betrat er das Kinderzimmer. Der Kopf seiner Tochter lag am Fußende, das linke Bein ragte unter der Decke hervor, der Fuß lag auf dem Gesicht ihres Lieblingsteddybären. Seine Tochter brachte es pro Nacht auf mehr Drehungen in ihrem Bett als ein Laken in der Waschmaschine.
»Hey, meine Kleine«, sagte er und strich ihr über den Kopf. Der Effekt war ein blaues Auge für den Bären durch Stefanies Fuß. »Aufwachen«, sagte Horndeich. Stefanie drehte sich einmal um die eigene Achse, machte aber keine Anstalten zu erwachen. Horndeich stand auf und schaltete das Deckenlicht ein. Das wirkte.
Verschlafen blinzelte Stefanie und murmelte: »Ist schon Morgen?«
»Ja, meine Kleine.«
Stefanie hatte ein erstaunliches Talent, von dem er sich gerne eine Scheibe abgeschnitten hätte, nämlich spätestens nach dem dritten Augenaufschlag hellwach zu sein. »Papa, machst du Frühstück? Ich geh auf die Toilette, Zähneputzen und mich anziehen.«
»Klar.« Horndeich machte sich auf den Weg in die Küche ein Stockwerk tiefer.
Er bereitete seiner Tochter einen Kakao zu, sich selbst einen Kaffee. Dann schmierte er für Stefanie das Brot – viel Butter, viel Marmelade –, so viel Zeit musste sein.
Stefanie kam die Treppe hinunter, angezogen – was sie seit einem halben Jahr unbedingt immer selbst machen wollte – und mit geputzten Zähnen. Sie hauchte Horndeich an – auch eines der Morgenrituale.
»Papa, warum ist es heute dunkler am Morgen als gestern?«
»Wir sind heute viel früher aufgestanden. Eine ganze Stunde.«
»Warum?«
»Weil ich zur Arbeit muss. Jetzt.«
»Eine ganze Stunde, das heißt, dass ich jetzt noch nicht zur Schule kann, oder?«
»Ja, das stimmt.«
»Warum musst du denn jetzt schon los?«
Stefanie wusste, dass ihr Papa bei der Polizei arbeitete. Sie wusste auch, dass er die Bösen jagte. Vor zwei Jahren, als einer ihrer Betreuer im Kindergarten ermordet worden war, da hatte sie begriffen, was ihr Vater genau machte. Dass er keine Uniform tragen musste, dass er sich nicht darum kümmerte, wenn bei jemandem eingebrochen wurde. Sondern dass er diejenigen aufspürte, die anderen Menschen wehtaten. Und sie hatte ebenfalls erfasst, dass es den bösen Menschen dabei völlig egal war, wie spät es war.
»Ich muss in ein Altenheim fahren. Dort ist was passiert.«
»Ist da jemand gestorben?«
»Ja.« Horndeich hatte sich immer wieder überlegt, wie er seiner Tochter seinen Job vermitteln wollte. Er war zu dem Schluss gekommen, dass er sie nicht anlügen würde. Die Balance zwischen Aufrichtigkeit und Schutz der Kinderseele war manchmal ein Drahtseilakt.
»Ist ein alter Mensch gestorben?«
»Ja. Du kennst doch meine Kollegin, Leah. Sie ist schon dort, und sie hat mich angerufen, damit ich komme und ihr helfe. Ich nehme dich mit. Du kannst dort sicher irgendwo spielen. Und von dort aus fahre ich dich dann in einer Stunde in die Schule.«
Stefanie hatte inzwischen die Tasse Kakao geleert und ihr Brot aufgegessen. »Gut, Papa, dann lass uns gehen. Damit Leah schnell Unterstützung bekommt.«
Ja, seine Tochter mochte bisweilen etwas altklug wirken. Aber ihr Wortschatz war mit sieben Jahren sehr reich bestückt. Und einmal mehr war er stolz auf sie. Unterstützung bekommen gehörte ganz sicher nicht zum Standardwortschatz einer Erstklässlerin.
Horndeich fuhr seinen Mazda Xedos 9 auf den Parkplatz des Seniorenstifts. Vierundzwanzig Jahre hatte der Wagen inzwischen auf dem Buckel, sah aber immer noch aus, als sei er gerade vom Band gerollt.
Horndeich kannte das Gebäude vom Sehen. Aber er hatte nicht gewusst, dass es ein Seniorenwohnheim war.
Kaum hatte er den Motor abgestellt, parkte neben ihm ein dunkler BMW.
Horndeich ging um seinen Wagen herum, dann öffnete er die Beifahrertür. Ja, es war nicht korrekt, doch Stefanie hatte darauf bestanden, vorne zu sitzen. Und er, der jeden Test von Kindersitzen fürs Auto dreimal gelesen hatte, hatte sich heute früh von seiner kleinen Tochter breitschlagen lassen.
»Papa, ich kann ja gar nichts sehen!«, hatte sie gemeckert. Der Kindersitz bescherte ihr in seiner erhobenen Position einen wesentlich besseren Rundumblick.
»Ja, so ist das, wenn man vorne sitzt«, hatte der Papa nur geantwortet.
Sie stieg aus, zeitgleich mit dem Fahrer des BMW. Dr. Martin Hinrich. Rechtsmediziner aus Frankfurt. »Ach, Sie auch hier. Dann bin ich wenigstens nicht der Einzige, den man so früh aus dem Bett gescheucht hat«, brummte er.
»Du bist der Arzt, der die Toten anschaut?«, fragte Stefanie Hinrich. Ein wenig hatte sie die Strukturen der Polizeiarbeit bereits verinnerlicht.
»Wie wäre es mit einem Sie?« Hinrich warf Horndeichs Tochter einen scharfen Blick zu. Dann rang er sich ein gequältes Lächeln ab. »Ja, ich bin der Rechtsmediziner, der hier die Entscheidung fällen muss, ob die alte Dame eines natürlichen Todes gestorben ist oder ob da jemand nachgeholfen hat.«
Ein Mann kam ihnen entgegen. Er wirkte auf den ersten Blick, als sei er einem Werbefilm für Armani-Anzüge entsprungen. Großgewachsen, von schlanker Statur, zeugten die Knöpfe des Hemdes im Brustbereich, die sich krampfhaft an den für sie vorgesehenen Löchern festzukrallen schienen, vom ausgezeichneten Trainingszustand ihres Besitzers. Stimmig wie Kleidung und Körper harmonierten auch alle Proportionen im Gesicht, die besonders gut zur Geltung kamen, da ihr Besitzer kein Haar auf dem Kopf trug.
»Kommissar Horndeich?«, sagte er, als er mit ausgestreckter Hand auf den Polizisten zukam.
»Ja.« Horndeich nickte.
Der Händedruck des Mannes ließ darauf schließen, dass auch einer Hantel im Fitnessstudio dieser Griff mindestens Respekt, wenn nicht sogar ein Quäntchen Furcht abnötigte. Er wandte sich an Hinrich: »Und Sie müssen der Rechtsmediziner sein. Gut, dass Sie da sind.« Er reichte Hinrich die Hand.
»Und ich bin Stefanie.« Horndeichs Tochter streckte ihre Hand in Richtung des Anzugträgers.
Der ging in die Hocke. »Sehr angenehm, junge Dame. Mein Name ist Horst Diebold. Ich leite dieses Haus.« Er erhob sich wieder. »Bitte folgen Sie mir doch.«
Horst Diebold führte sie durch das Eingangsportal und bog dann nach links ab in Richtung eines Aufenthaltsraums.
Horndeich fühlte sich ein Jahrhundert zurückversetzt: Der Raum hätte perfekt zu einer Verfilmung von Thomas Manns Buddenbrooks gepasst: schwere Ledersofas und Sessel, Wände bestehend aus Bücherregalen, Beistelltischchen mit kunstvollen Elfenbeinverzierungen. Horndeich meinte den Zigarrenrauch, der zu so einem Herrenzimmer gehörte, förmlich wahrzunehmen.
Auf dem Ledersofa erwartete ihn bereits Leah Gabriely mit einem weiteren Herrn. Horndeich tippte auf den Hausarzt.
Leah begrüßte Horndeich, Stefanie und Dr. Martin Hinrich und stellte ihnen Dr. Peter Perlau vor. »Im Moment ist gerade die Spurensicherung am Werk. Aber ich denke, Dr. Hinrich, dass Sie dennoch einen Blick auf die Verstorbene werfen können. Am besten, wir beide gehen hoch in ihre Wohnung.«
Erst dann fiel Leahs Blick auf den Herrn an Horndeichs Seite: »Und Sie sind?«
»Horst Diebold. Ich leite dieses Heim. Frau Brandes hat mich angerufen.«
»Jemand von uns wird sich nachher auch mit Ihnen unterhalten. Wo finden wir Sie?«
»Im Erdgeschoss, im westlichen Flügel, da ist mein Büro. Ich würde gerne den laufenden Betrieb weiter organisieren.«
Leah nickte nur.
Stefanie trat auf Leah zu, dann fragte sie: »Darf ich mit euch hochgehen?«
»Ganz bestimmt nicht«, sagte Horndeich schnell. In einer Ecke des Raumes entdeckte er einen Sekretär. »Du kannst hierbleiben und malen.« Er hatte extra den Notfallrucksack mitgenommen. Darin eine Kiste mit Legosteinen, ein Malblock und das Mäppchen voller Filzstifte.
Bevor Horst Diebold in Richtung seines Büros verschwunden war, hatte er Horndeich und Dr. Perlau noch in einen Nebenraum geführt. Dort war es möglich, sich ungestört zu unterhalten. Der Raum wirkte wie die Miniaturvariante des Clubraums nebenan.
Dr. Perlau musste, wie er Horndeich augenblicklich mitteilte, schon eine ganze Weile darauf warten, dass sich jemand ihm und seinen Erläuterungen zu Lucrezia von Selberg-Broodes Todesursache widmete. Horndeichs Kollegin Leah hatte, nachdem innerhalb weniger Minuten fast das ganze Haus auf den Beinen gewesen war, genug damit zu tun gehabt, die Befragung durch die vor Horndeich eingetroffenen Kollegen zu koordinieren. Was augenscheinlich nicht einfach gewesen war – das gesamte Haus glich der Wohnstatt eines Taubenschwarms.
Horndeich und Dr. Perlau ließen sich auf zwei Lederfauteuils nieder, zwischen denen ein schmales Tischchen platziert war. Horndeich schaltete die Diktierapp seines Smartphones an und legte es auf den Tisch. Gleichzeitig zog er einen Notizblock aus der Innentasche des Jacketts. Was das anbelangte, bevorzugte er die altmodische Variante. Er begann die Befragung. »Warum haben Sie uns benachrichtigt?«
»Es kommt immer wieder vor, dass ich hierher gerufen werde, wenn einer der Bewohner von dieser Welt gegangen ist. Der Altersdurchschnitt liegt derzeit glaube ich bei fünfundachtzig Jahren. Es kommt also öfters vor, dass ich einen Totenschein ausstelle. In den seltensten Fällen bemerke ich da etwas Ungewöhnliches. Auch bei Lucrezia von Selberg-Broode ist mir anfangs nichts aufgefallen. Sie lag auf dem Boden. Auf den ersten Blick wirkte es, als ob sie auf dem Weg zur Toilette gewesen und dabei ihr Herz stehen geblieben sei. Ich habe keinen Puls fühlen können, aber der Körper war noch warm. Als ich mir die Augen genauer angeschaut habe, habe ich dort ganz feine Einblutungen in der Bindehaut feststellen können. Es waren nur ein paar geplatzte kleine Äderchen, doch solche Blutungen können ein Zeichen dafür sein, dass die Person erstickt worden ist. Da konnte ich nicht guten Gewissens natürlicher Tod ankreuzen. Liegt vielleicht auch daran, dass unsere Profession doch immer wieder in die Schusslinie gekommen ist. Viel zu oft wird Menschen ein natürlicher Tod attestiert, wenn ein Tötungsdelikt vorliegt. Es gibt da ja Studien zum Thema. Na ja, ich hab dann auf jeden Fall zu Frau Brandes gesagt, dass ich die Todesursache nicht eindeutig feststellen kann. Und dann haben wir Sie angerufen.«
»Und wer hat Sie angerufen? Frau Brandes?«
»Ja. Frau von Selberg-Broode hatte die Notklingel gedrückt, als Frau Brandes daraufhin ihr Zimmer betrat, fand sie sie auf dem Boden liegend. Und hat sofort mich gerufen. Aber sie selbst hatte schon nach dem Puls getastet und keinen mehr gefühlt.«
»War Frau von Selberg-Broode eine gesunde Frau?«
»Nun, sie war dreiundneunzig. Und das Herz war nicht mehr so kräftig. Seit sieben Jahren hat sie Blutverdünner genommen, um dem Herz den Job etwas leichter zu machen. Aber abgesehen davon, war sie sowohl körperlich als auch geistig in einem für ihr Alter guten Zustand.«
Leah stand mitten im Raum, während Martin Hinrich sich neben der Leiche niederließ. Silvia Rauch hatte einen Gang ins Zimmer markiert, dem sie folgten. Auch eine Fläche um die Verstorbene herum hatte sie freigegeben.
Hinrich begutachtete den Körper, maß die Körpertemperatur, dann besah er eingehend das Gesicht der Toten. »Können Sie mir gerade mal behilflich sein?«, fragte Hinrich an Leah gewandt.
Die ging daraufhin auf der anderen Seite des Leichnams in die Hocke. »Können Sie schon was zur Todesursache sagen?«, wollte sie wissen und ärgerte sich im selben Moment, dass sie die Frage überhaupt gestellt hatte. Hinrich würde kundtun, wenn ihm etwas aufgefallen wäre. Und sie wusste, wie leicht er sich reizen ließ. Entsprechend brummte der etwas in den Bart, und Leah konnte den Satzfetzen »… mich meinen Job machen lassen …« heraushören. Hinrich griff in seinen Koffer und entnahm ihm eine Taschenlampe, die er Leah reichte: »Können Sie bitte mal in die Nase leuchten?«
Leah tat, wie ihr geheißen. Sie ließ sich auf die Knie nieder. Dann hielt sie die Handleuchte in Richtung der Nase. Hinrichs Blick folgte dem Lichtstrahl. »Na also«, sagte er. Dann schwieg er.
»Und?«
»Auch wenn ich mir mit dem Lob anderer zugegebenermaßen etwas schwertue, muss ich gestehen, dass es eine weise Entscheidung meines Kollegen war, uns zu rufen«, sagte er. Dann nahm er Leah die Taschenlampe aus der Hand, leuchtete seinerseits in Richtung Nasenhöhle. »Schauen Sie selbst. Fällt Ihnen was auf?«
Leah musste den Kopf fast auf die Brust von Frau von Selberg-Broode legen, um Hinrichs Anweisungen zu folgen. »Rechtes Nasenloch. Also, aus unserer Perspektive.«
Und Leah erkannte, was der Rechtsmediziner meinte: Darin befand sich ein Fussel. Ein roter Fussel.
»Staublutungen in den Augen, ein Fussel in der Nase – da lohnt ein zweiter Blick. Also genau genommen ein dritter …«
»Sie ist erstickt worden?«, spekulierte Leah.
»Da will und kann ich mich noch nicht festlegen. Aber der Fussel gehört definitiv nicht in die Nase. Und er ist ganz bestimmt auch nicht von selbst reingesprungen. Meine Arbeitshypothese ist, dass hier kein natürlicher Todesfall vorliegt. Die Details kriegt ihr, wenn ich die Dame in Frankfurt auf meinem Tisch gehabt habe.«
Mit diesen Worten erhob er sich, verließ den Raum und ward nicht mehr gesehen.
Nun konnten die Bestatter, die inzwischen ebenfalls eingetroffen waren, die sterblichen Überreste von Frau von Selberg-Broode zum Rechtsmedizinischen Institut fahren.
Leah hatte sich mit Ria Brandes in den kleinen Raum neben der Bibliothek zurückgezogen, in dem bis vor Kurzem Horndeich und Dr. Perlau gesessen hatten. Perlau war inzwischen nach Hause gefahren, und Horndeich wollte sich nun mit dem Heimleiter Horst Diebold in dessen Büro unterhalten.
Leah hatte das Aufnahmegerät auf den Tisch zwischen ihnen gelegt und die Aufnahmetaste gedrückt. Inzwischen waren fast alle Hausbewohner wach geworden, und Leah hatte weitere Verstärkung angefordert. Die Kollegen sollten klären, ob jemandem in der Nacht irgendetwas Seltsames aufgefallen war.
Ria Brandes saß aufrecht, hatte die Hände auf die Tischplatte gelegt, wobei die rechte die linke bedeckte. Der madonnenhafte Eindruck verstärkte sich dadurch noch.
»Frau Brandes, könnten Sie mir bitte den Ablauf Ihrer Schicht schildern? Und mir bitte genau sagen, wann und wie Sie Lucrezia von Selberg-Broode gefunden haben?«
Kurz schaute Frau Brandes nach unten, als ob sie sich sammelte. Dann sah sie Leah an und sagte: »Die Nachtschicht geht bei uns immer von acht Uhr abends bis acht Uhr morgens. Frau von Selberg-Broode saß hier in der Bibliothek, als meine Nachtschicht begann. Es ist ein Ort, an dem sie jeden Tag eine Weile verbrachte. Sie hat gelesen, und sie hatte stets eine Kanne Tee neben sich stehen. Alles wie immer. Ich habe einen Rundgang durchs Haus gemacht, damit fange ich die Nachtschicht an. Wir haben im Moment zwei Bewohnerinnen und zwei Bewohner, die pflegebedürftig sind. Also deutlich über das normale Maß hinaus, wie Fußpflege, Eincremen oder auch mal das Helfen beim Umkleiden. Zwei von den vieren sind bettlägerig.«
Frau Brandes hielt kurz inne. Leah nutzte die Pause für eine Zwischenfrage: »Welche konkreten Aufgaben haben Sie denn während der Nachtschicht?«
»Unser Haus legt großen Wert auf individuelle Betreuung. Es gibt Bewohner, für die ist dieses Heim einfach das Haus, in dem sie ihre private Wohnung haben. Und sie sind noch so rüstig, um für sich selbst sorgen zu können, wenn sie das wollen. Frau von Selberg-Broode gehörte zu diesem Kreis. Sie verließ das Haus nicht mehr so oft wie früher. In den vergangenen drei Jahren, also seit ihrem neunzigsten Geburtstag, haben ihre Kräfte durchaus etwas nachgelassen. Bis dahin ist sie noch ein- bis zweimal in der Woche zu kulturellen Veranstaltungen unterwegs gewesen. Damals gab es kein Theaterstück und kein Konzert im Staatstheater, das sie versäumt hätte.
Und dann gibt es Bewohner, die mehr Fürsorge brauchen. Frau Bednartz zum Beispiel, sie ist vor fünf Jahren gestürzt, Schenkelhalsbruch. Der ist zwar wieder verheilt, doch seitdem hat sie Angst, dass sie fällt – und niemand das mitbekommt. Deswegen wünscht sie sich, dass man dreimal in der Nacht in ihrer Wohnung vorbeischaut, ob sie wirklich in ihrem Bett schläft und nicht im Badezimmer mit gebrochenen Knochen auf dem Boden liegt. Von solchen Sonderwünschen haben wir natürlich ein paar hier – aber ansonsten besteht die Nachtwache meist nur aus der Bereitschaft, wenn irgendetwas nicht in Ordnung sein sollte, sofort zur Stelle zu sein.
In unserem Gemeinschaftsraum steht eine bequeme Couch mit warmen Decken und einem Kissen – sodass wir bei einer Nachtschicht durchaus auch ruhen können.«
Leah hatte das Bedürfnis, die Augen zu schließen, als sie Ria Brandes zuhörte. Das ist die Stimme, die mir einen Roman als Hörbuch vorlesen sollte, dachte sie. Seit einem Jahr ungefähr hatte sie diese Art des Lektüregenusses für sich entdeckt. Beim Spazierengehen, beim in der Sonne Sitzen oder auch nur, wenn sie auf ihrem Balkon eine Tasse Kaffee oder ein Glas Wein zu sich nahm, ließ sie sich mit kabellosen Ohrstöpseln in fremde Welten entführen. »Ist in der vergangenen Nacht irgendetwas Ungewöhnliches passiert?«
»Nein, alles war im grünen Bereich. Um vier Uhr habe ich zum dritten Mal bei Frau Bednartz vorbeigeschaut.« Ria Brandes lächelte und zeigte dabei ihre strahlend weißen Zähne. Kurz fragte sich Leah, ob sie in dieser Perfektion ein Werk der Natur sein konnten oder ob die Pflegerin sie einigen kostspieligen Sitzungen bei einem äußerst fähigen Zahnarzt zu verdanken hatte.
Sie erinnerte sich an die letzte Rechnung ihres Dentisten, nachdem lediglich eine Krone hatte erneuert werden müssen. Ein solches Gebiss, wenn es denn künstlich war, konnte man sich vom Gehalt einer Altenpflegerin wahrscheinlich kaum leisten.
Ria Brandes fuhr fort: »Frau Bednartz lag in ihrem Bett und schnarchte laut«, sagte sie. »Ich bin danach wieder in unseren Gemeinschaftsraum gegangen, habe mich auf die Couch gelegt und mir den Wecker auf halb acht gestellt. Und gegen halb fünf kam dann der Alarm von Frau von Selberg-Broode.«
»Woher wussten Sie, dass es Frau von Selberg-Broode war, die den Alarm ausgelöst hatte?«
»Wir haben hier im Haus ein ziemlich ausgeklügeltes Notrufsystem. In den Zimmern der Bewohnerinnen und Bewohner ist eine klassische Krankenhausklingel angebracht, die sie drücken können, aber sie haben auch Armbänder mit einem Notfallknopf, oder Umhängebänder – je nachdem, was für unsere Bewohner am angenehmsten ist. Es gibt zwei unterschiedliche Klingeln: die mit dem gelben Knopf, wenn man Unterstützung braucht, und die mit dem roten, wenn es sich um einen Notfall handelt. Und ich habe auf meinem Diensthandy eine App, die mit unserer EDV verbunden ist. Wenn jemand eine der Klingeln betätigt, vibriert das Handy, der Alarm schwillt an, unabhängig davon, ob ich das Handy auf stumm geschaltet habe. Und wenn ich auf das Display schaue, kann ich genau sehen, wer den gelben oder roten Alarm ausgelöst hat.«
»Und der Alarm war rot?«
»Ja, der Alarm war rot.«
»Wie haben Sie reagiert?«
Wieder überzog Ria Brandes’ Gesicht jenes gewinnende Lächeln. »Ich habe das getan, was ich immer in solchen Fällen mache: Ich lief auf dem schnellsten Weg zur Wohnung der Bewohnerin, die den Alarm ausgelöst hat. Ich glaube, ich habe vierzig Sekunden gebraucht, bis ich die Tür zu ihrem Apartment geöffnet hatte.«
»Und dann?«
»Sie trägt dieses Notfallarmband nachts noch nicht lange. Ich habe mich sofort neben sie gekniet und den Puls gefühlt. Aber da war keiner mehr. Und sie hat auch nicht mehr geatmet.« Frau Brandes hielt inne.
»Haben Sie versucht, sie wiederzubeleben?«
Das Lächeln verschwand aus dem Gesicht der Altenpflegerin, so schnell davongehuscht wie eine Kakerlake, wenn man das Licht einschaltete. »Nein, das habe ich nicht getan«, sagte sie.
Leah war irritiert. Lucrezia von Selberg-Broode konnte kaum eine Minute lang ohne Atmung und Puls auf dem Boden gelegen haben. Da gab es keinen Grund, nicht zu versuchen, ihr Leben zu retten. Ria Brandes sprach nicht weiter. Und somit musste Leah die scheinbar rhetorische Frage stellen: »Und warum haben Sie das nicht getan?« Sie überlegte, ob hier nicht der Tatbestand der unterlassenen Hilfeleistung erfüllt war.
»Wissen Sie, Frau Gabriely, es ist erklärte Politik dieses Hauses, die Bewohnerinnen und Bewohner bewusst und gezielt darauf anzusprechen, was sie in einem Fall wie diesem für sich wünschen – sprich: Wir unterstützen unsere Hausgäste darin, genaue Patientenverfügungen zu erstellen. Wir arbeiten dabei sogar mit einem Notar zusammen, damit ihre Wünsche genau formuliert werden. Frau von Selberg-Broode war eine Frau, die das für sich präzise geregelt hatte. Sie wünschte keinerlei lebensverlängernde Maßnahmen, und sie hatte deutlich gesagt: Sollte ihr Herz einmal aufhören zu schlagen, würde sie es sich verbitten, dass irgendjemand versuchte, es nochmals zu weiterer Arbeit zu animieren. Viel zu groß war ihre Angst, dass auch nur wenige Sekunden Sauerstoffmangel im Gehirn dazu führen würden, dass das Herz zwar seinen Job noch einmal aufnehmen konnte, aber das Hirn seine Unterstützung versagte. Sie war so stolz darauf, dass sie mit ihren dreiundneunzig Jahren alle Sinne beieinanderhatte, von einer Demenz oder Ähnlichem weit entfernt war – und wer wäre ich, mich über diesen Wunsch zu erheben?«
Leahs Gedankenkarussell begann Fahrt aufzunehmen. Da war plötzlich das Bild von ihr selbst, in einem Krankenhausbett liegend, nicht fähig, sich zu bewegen, geschweige denn zu kommunizieren. Und so für Wochen, Monate, Jahre dahinzuvegetieren. Kurz war sie versucht, nach der Adresse des Notars zu fragen, doch sie hielt sich zurück.
In diesem Moment sprach Ria Brandes weiter: »Was ich hingegen gemacht habe, war, das Handy zu nehmen und Dr. Perlau anzurufen. Ich wusste, dass er Frau von Selberg-Broodes Hausarzt ist – auch das verrät uns die App nach zweimaligem Tippen.«
Um fünf Uhr zehn war der Anruf von Dr. Perlau auf dem Polizeipräsidium eingegangen, danach hatten sie sich auf den Weg zum Haus Goldenstern gemacht.
»Hatte Frau von Selberg-Broode denn Feinde?«
Ria Brandes zuckte mit den Schultern. »Frau Selberg-Broode war eine noble Dame – ein anderer Begriff fällt mir nicht ein. Ihre Familie war alter Adel, über Generationen hinweg, ich glaube, bis ins zwölfte Jahrhundert zurück. Sie kannte den Knigge auswendig – erwartete allerdings auch von allen anderen, sämtliche Regeln der Höflichkeit, des Benimms und der Etikette zu beherrschen und einzuhalten. Damit stand sie ein wenig allein auf weiter Flur, schien etwas aus der Zeit gefallen. Sie kam nicht mit allen Menschen gut aus, aber sie hatte keine Feinde.«
»Hatte sie hier im Heim Freundinnen oder Freunde? Mit denen sie Zeit verbrachte?«
Zwei Falten gruben sich in Ria Brandes’ Gesicht. Sie schien nachzudenken. »Soweit ich das mitbekommen habe, hat sie im Haus keine Freundschaften gepflegt – oder gar noch einen Gefährten für die letzten Lebenstage gefunden.«
»Sie leiten dieses Heim?«, wollte Horndeich von dem Mann ihm gegenüber wissen.
»Ja, seit wir das Gebäude vor sechzehn Jahren gekauft haben.«
Sie saßen im Büro des Heimleiters, das durch eine massive Eichentür vom Flur getrennt war und damit exzellent akustisch isoliert. Auch die Möblierung des Zimmers fügte sich stilvoll und nahtlos in das Ambiente der anderen Räume, die Horndeich inzwischen von innen gesehen hatte. Sollte Diebold dieses Haus einmal aufgeben, so könnte es ohne große Umbauten seine Pforten als Jugendstilmuseum öffnen.
»Ein eindrucksvolles Bauwerk«, stellte Horndeich fest.
»Ja, nicht wahr? Ich habe damals etwas Besonderes gesucht. Und als die Technische Universität das Gebäude veräußerte, habe ich zugeschlagen. Es hat eine wechselvolle, aber ereignisreiche Geschichte.«
Horndeich wusste, dass für ihn nun kaum ein Weg daran vorbeiführte, sich diese Geschichte anzuhören, konnte aber gut damit leben. »Erzählen Sie«, forderte er Diebold auf und hoffte, die kurze Variante präsentiert zu bekommen.
»1898 ist das Haus erbaut worden, zwölf Jahre lang war es ein Hotel – aber leider kein erfolgreiches. Später wurde es bereits im Jugendstil restauriert, dann als Privatvilla genutzt. Auch die Nationalsozialisten hatten ihren Narren an dem Bau gefressen und nutzten ihn als Gruppenschule der SA. Dann diente es als Hospital für Tuberkulosepatienten. In den Fünfzigerjahren fiel das Gebäude an die Technische Hochschule. Erst war es Studentenwohnheim, dann Gästehaus – und vor sechzehn Jahren habe ich es gekauft. Wir mussten natürlich investieren und umbauen. Allein der Glasaufzug am Ostflügel hat viel Nerven und Geld gekostet. Aber da wir hier eine äußerst solvente Klientel bedienen, hat sich das alles längst amortisiert.«
»Und Lucrezia von Selberg-Broode – wie lang wohnte sie hier?«
Horndeichs Gegenüber strich sich über die Glatze – vielleicht war diese Handbewegung eine Art Ritual – und erklärte, wieso die Haut auf seinem Haupt so perfekt glänzte. Dann sagte er: »Frau von Selberg-Broode war eine unserer ersten Bewohnerinnen. Schon drei Jahre zuvor hat sie zu uns Kontakt aufgenommen, als klar war, dass wir in Darmstadt ein geeignetes Objekt suchten, um Klienten mit gehobeneren Ansprüchen ein würdiges Heim für ihren Lebensabend zu ermöglichen. Und dabei meine ich Heim nicht im Sinne einer Institution, sondern im Sinne von Heimat.«
»Frau von Selberg-Broode lebte also seit etwa fünfzehn Jahren hier im Haus?«
»Ja.«
»Kennen Sie jemanden, der einen Grund gehabt hätte, sie umzubringen?« Ach, es war dieser Standardsatz, den er in jeder Befragung nach einem Todesfall aufsagen musste. In den seltensten Fällen lautete die Antwort: »Ja, klar, anbei die Liste der Top Drei!« Und dennoch war die Frage alternativlos, wie es die Bundeskanzlerin formuliert hätte.
»Nein, Lucrezia von Selberg-Broode hatte keine Feinde. Sie war nicht immer beliebt bei allen. Mit mir hat sie sich hingegen sehr gut verstanden. Offen gesagt: Sie war ein bisschen etepetete. Und damit kam nicht jeder zurecht. Wir haben hier eine Menge individueller Persönlichkeiten, von denen sich jede wünscht, der Rest der Menschheit hätte genau dieselbe Sicht auf die Welt wie sie selbst. Manchmal führt das zu einem Disput, jedoch ganz gewiss nicht zu Feindschaft.«
»Ich habe im Apartment der Dame eine Harfe gesehen – was hat es damit auf sich?«
Der Leiter des Seniorenstifts Goldenstern erhob sich. Er trat zum Fenster des Raumes, sah nach draußen, dann drehte er sich um und schaute Horndeich direkt an. »Sie haben den Namen Lucrezia von Selberg-Broode noch nie gehört?«
»Nein«, antwortete Horndeich wahrheitsgemäß.
»Nun, dann kläre ich Sie auf: Lucrezia von Selberg-Broode war eine Harfenistin. Nein, sie war die Harfenistin des europäischen Kontinents im vergangenen Jahrhundert. Sie hat unter Karajan gespielt, sie hat alle großen Harfenkonzerte auf LP und CD eingespielt. Sie war überall auf der Welt unterwegs, zum Teil mit den ganz berühmten Orchestern, den New Yorkern, den Berlinern, den Wiener Philharmonikern. Sie interessieren sich nicht für die Harfe?«
Auch wenn es widersinnig war, Horndeich fühlte sich ertappt. Nein. Er hatte in seinem Leben niemals irgendein Musikstück, in dem eine Harfe geklimpert wurde, bewusst gehört. Allein, dass er im Zusammenhang mit diesem Instrument an das doch etwas despektierliche Verb klimpern dachte, zeugte von seiner Einstellung.
»Lucrezia von Selberg-Broode hat mit zehn Jahren angefangen, Harfe zu spielen. Sie war ein Naturtalent. Es ist vielleicht ein etwas schräger Vergleich, aber Lucrezia war an der Harfe das, was Jimi Hendrix an der Gitarre fünfzig Jahre später war: Sie und ihr Instrument waren eins. Es gibt sogar eine inoffizielle Aufnahme von einer Jazz-Session, bei der sie mitgespielt hat. Sie konnte durchaus mit Alice Coltrane oder Dorothy Ashby mithalten. Entschuldigen Sie, ich schweife ab. Aber Frau von Selberg-Broode hat mir das Instrument nahegebracht. Wobei ich eher beim Jazz hängen geblieben bin. Sie hat noch bis vor fünf Jahren selbst auf ihrer Harfe gespielt. Das war der Moment, in dem die Arthrose in ihren Fingergelenken dazu führte, dass sie nicht mehr brillant, sondern nur noch gut war. Glauben Sie mir, ein Laie würde diesen Unterschied nie hören. Aber ich habe ihr geglaubt, als sie gesagt hat, dass sie nicht mehr spielen wolle, weil sie ihren eigenen Ansprüchen nicht mehr gerecht werden könne.«
»Und dennoch stand die Harfe weiterhin in ihrem Apartment?«
Diebold lächelte. »Selbstverständlich. Frau von Selberg-Broode hätte ihre Harfe niemals hergegeben. Alle sechs Monate bestellte sie einen Harfenbauer ein. Er überzeugte sich davon, dass die Mechanik in Ordnung war, die Gabelscheiben intakt, die Harfe sich problemlos stimmen ließ. Frau von Selberg-Broode hat sie alle zwei Tage durchgestimmt. Auch wenn sie selbst nicht mehr spielte.«
»Hat denn jemand anderes darauf gespielt?«
Diebold lächelte nicht, nein, er lachte auf: »Das Instrument war Frau von Selberg-Broode heilig. Meines Wissens nach haben dieser Harfe genau zwei Menschen jemals Töne entlockt: der Harfenbauer und Lucrezia selbst. Okay, es waren ein paar mehr: Die Harfenbauer, die sie gestimmt haben, gehören natürlich ebenfalls zum erlesenen Kreis. Wenn ich es richtig erinnere, hat sie das Instrument vor vierzig Jahren gekauft.«
»Herr Diebold, ich hätte da noch eine ganz andere Frage. Welche Überwachungseinrichtungen haben Sie hier installiert? Gibt es Kameras?«
Diebold hatte sich wieder auf seinen Stuhl gesetzt und sagte: »Ja, natürlich haben wir solche Systeme installiert. Wir haben beispielsweise an den Hauseingängen Überwachungskameras, die mit Bewegungsmeldern verknüpft sind. Aber dazu kann Ihnen unsere Mitarbeiterin Nathalie Ankenbrand mehr sagen. Sie hat heute ihren freien Tag. Aber soviel ich weiß, ist sie zu Hause. Ich gebe Ihnen die Telefonnummer.« Er setzte sich hinter den Schreibtisch, scheuchte kurz die Maus über das Mauspad, dann diktierte er Horndeich die Telefonnummer.
Nachdem er Namen und Nummer notiert hatte, sah Horndeich auf die Uhr. Es wurde Zeit, seine Tochter zur Schule zu fahren.
Als Horndeich zurück in die Bibliothek kam, lag auf dem Sekretär der aufgeschlagene Malblock seiner Tochter, umrahmt von verschiedenen farbigen Filzstiften. Auf das oberste Blatt des Blockes hatte Stefanie eine perfekt konstruierte Rakete gemalt, inklusive kleinem Mond in der oberen rechten Ecke. Aber von Stefanie selbst gab es keine Spur. Horndeich hörte Geschirr klappern und folgte dem Geräusch.
Die Tür zu dem Raum, hinter der er das Geräusch vermutete, war nur angelehnt. Er klopfte, zog die Tür auf und entdeckte seine Tochter, die von einem Beistellwagen aus den Tisch deckte.
Horndeich sah sich um. Der Raum glich eher einem Saal. Auch hier überzog feinstes Parkett den Fußboden. Die Decke war an den Rändern mit Jugendstilornamenten verziert. Vierertische verteilten sich über die Räumlichkeit, alle mit Tischdecken versehen. Der Abstand der Tische war so gewählt, dass man in Ruhe miteinander sprechen konnte, ohne den Rest der Anwesenden mit zu unterhalten. An der Stirnwand des Raumes öffnete sich eine Tür, und eine junge Frau mit weißer Kittelschürze trat ein. Stefanie wandte sich um, sah ihren Vater und die Haushälterin. Sie zeigte mit dem Finger auf die junge Dame, dann sagte sie zu Horndeich: »Das ist Stella. Sie ist nicht nur die Köchin, sie ist auch Hauswirtschaftsleiterin«, präsentierte Stefanie stolz das wohl eben erst gelernte Wort.
Stella kam auf Horndeich zu, reichte ihm die Hand: »Bankowski, Stella Bankowski.«
Horndeich stellte sich ebenfalls vor: »Hauptkommissar Steffen Horndeich.« Natürlich wusste die Hauswirtschaftsleiterin bereits, weshalb die Polizei im Haus war. »Das ist ja fürchterlich, die Sache mit Frau von Selberg-Broode. Haben Sie schon etwas herausgefunden?«
Sosehr Horndeich von einigen Fragen genervt war, die er selbst immer stellte, gab es im Gegenzug auch eine Liste jener Fragen, bei denen er immer ein Zucken unterdrücken musste, wenn sie ihm gestellt wurden. Die letztere gehörte definitiv dazu, hatte schon einen Platz unter den Top Ten ergattert. Platz eins nahm unangefochten »Wissen Sie schon, wer’s getan hat?« ein. Die Antwort, die er dann am liebsten gegeben hätte, lautete: »Klar. Das haben wir schon vor zwei Wochen rausgefunden. Da wir im Moment aber eher wenig zu tun haben, fragen wir noch ein bisschen herum.«
Frau Bankowski konnte von diesen Gedankengängen natürlich nichts wissen, als Horndeich nur knapp antwortete: »Nein.« Dann wandte er sich seiner Tochter zu: »Stefanie, wir müssen los. Es ist Zeit für die Schule.«
»Ich muss nur noch diesen Tisch fertig decken«, sagte sie. Und Horndeich ließ sie gewähren, denn eine Diskussion darüber, die Arbeit vorzeitig zu beenden, würde wahrscheinlich länger dauern, als das restliche Porzellan und Besteck auf dem Tisch zu verteilen.
Als Stefanie zu ihrem Vater ging, strich Stella Bankowski ihr übers Haar: »Das hast du ganz toll gemacht!«
Stefanie strahlte und sagte: »Vielleicht werde ich ja auch mal Wirtschaftshausleiterin, wenn ich groß bin!«
Horndeich überlegte kurz, ob er seine Tochter korrigieren sollte, aber das übernahm Frau Bankowski höchstselbst: »Hauswirtschaftsleiterin, du wirst bestimmt eine gute Hauswirtschaftsleiterin.«
»Haus-wirt-schafts-leiterin. Zumindest kann ich das Wort jetzt.« Sie griff Horndeichs Hand: »Komm, Papa, wir müssen los.«
Horndeich half seiner Tochter, die sich freiwillig auf dem Kindersitz niedergelassen hatte, sich anzugurten, dann startete er den Wagen. Die Schule lag unweit des Bürgerparks, und fünf Minuten später hatten sie ihr Ziel erreicht. Stefanie stieg aus, und Horndeich öffnete den Kofferraum des Wagens, um Stefanies Schulranzen herauszuholen.
»Hallo Frau Moltke«, hörte er seine Tochter sagen. Er schloss den Kofferraumdeckel wieder und sah nun auch die angesprochene Dame. Frau Moltke war Stefanies Lehrerin – und Stefanie hatte sie in ihr Herz geschlossen.
»Hallo, Stefanie!« Sie sah Horndeich an und begrüßte ihn ebenfalls.
Stefanie schulterte ihren Schulranzen. »Was machen wir denn heute?«
Frau Moltke lächelte sie an. »Wir malen ein Bild.«
Stefanie strahlte, als ob ihre Lehrerin ihr soeben ein Eis mit zehn Kugeln versprochen hätte. Frau Moltke hätte wohl auch sagen können, dass sie heute den Hof kehren würden, und Stefanie hätte bestimmt genauso begeistert reagiert. Würde man sie in diesem Moment fragen, Stefanie würde gewiss nicht sagen, dass sie Hauswirtschaftsleiterin werden wolle, wenn sie groß sei, sondern Lehrerin. Und zwar genau so eine wie Frau Moltke.
Stefanie drehte sich kurz zu Horndeich um, rief »Tschüss, Papa« und fragte dann, ohne noch einmal Luft zu holen: »Was für ein Bild malen wir denn heute?«
»Auf Wiedersehen, Herr Horndeich«, verabschiedete sich auch die Lehrerin.
Horndeich sah den beiden hinterher und hörte noch, wie Frau Moltke antwortete: »Wir malen heute ein Bild von der Familie.«
»Gehört Che auch zur Familie?«, war das Letzte, was er von seiner Tochter hörte, bevor diese mitsamt der Lehrerin auf dem Schulhof verschwand. Der kleine Chihuahua Che lebte zwar gerade bei Horndeichs Schwiegereltern, während seine Frau mit Alexander an der Ostsee residierte, aber er gehörte definitiv zur Familie.
Eine gute Freundin seiner Frau Sandra hatte Stefanie zahlreiche Tricks verraten, mit denen man einen Hund dazu brachte, aufs Wort zu gehorchen. Und was für Horndeich ein Buch mit sieben Siegeln blieb, war seiner Tochter mühelos gelungen: Wenn Che neben ihr an der Leine lief, war diese kein bisschen angespannt. Es schien, als hätte Stefanie in ihren Strümpfen eine Art Hundemagnet versteckt, der Che eisern an ihrer Seite hielt.
Die Frage, ob Che zur Familie gehörte, war also nur eine rhetorische.
Zurück im Goldenstern lockte das verführerische Aroma frisch aufgebrühten Kaffees Horndeich in die Küche des Anwesens. Dort traf er überraschenderweise nicht nur auf seine Kollegin Leah Gabriely, sondern auch auf die anderen Kollegen, die sich hier offenbar zu einer kurzen Kaffeepause verabredet hatten. Stella Bankowski eilte mit einer Kanne zwischen den Beamten umher und schenkte fleißig nach.
Leah hatte inzwischen mit dem Staatsanwalt telefoniert und die Leitung des Falls übertragen bekommen. Dementsprechend legte sie nun die nächsten Schritte fest. »Wir müssen mit dem Pflegepersonal sprechen und auch noch mit den restlichen Bewohnern dieses Heims. Die Frage lautet, ob irgendjemandem etwas Seltsames aufgefallen ist, in der letzten Nacht oder den vergangenen Tagen oder Wochen.«
Da konnte Horndeich seiner Kollegin nur zustimmen. In diesem Moment betrat auch Silvia Rauch den Raum. Die Chefin der Spurensicherung ergriff sofort das Wort: »So, wir sind jetzt durch. Wir haben alles dokumentiert und die relevanten Sachen mitgenommen.«
»Ich würde mir gern den Raum einmal anschauen und dabei deine Meinung hören. Kannst du ihn uns noch einmal zeigen?«, fragte Horndeich.
»Klar.«
An Tür und Türrahmen des Appartements prangte ein Polizeisiegel. Horndeich durchtrennte es mit dem Fingernagel.
»Ich zeige euch erst mal den hinteren Bereich.« Silvia Rauch führte sie durch das Wohnzimmer, an dessen hinterer Wand eine weitere Tür eingelassen war. Von hier aus ging es in einen winzigen Flur, der seinerseits zu Bad und Schlafzimmer führte.
Das Schlafzimmer fügte sich in seiner Einrichtung perfekt zu dem, was Horndeich im Wohnzimmer schon wahrgenommen hatte. Wäre die Wand statt mit einer Papiertapete mit Brokat überzogen gewesen, hätte auch dieses Zimmer direkt aus Schloss Neuschwanstein importiert sein können. Das Doppelbett überzog ein Baldachin, Vorhänge konnten als Sichtschutz vorgezogen werden oder um Mücken fernzuhalten.
Zwei weitere Möbel zierten den Raum: ein massiver Kleiderschrank, der auch mindestens hundertfünfzig Jahre auf dem Buckel hatte, obwohl er bestens in Schuss war, sowie eine Frisier- und Schminkkommode. Die kam sehr leichtfüßig daher, auf schmalen, geschwungenen Beinen. Unter dem mittig angeordneten Spiegel befanden sich mehrere Schubladen. Sowohl die Spiegeleinfassung als auch die Beine waren verschwenderisch verziert. Auf der Kommode selbst lag nur eine Bürste. Offenbar waren alle anderen Utensilien auf die Schubfächer verteilt.
»Hier haben wir absolut nichts Auffälliges gefunden.« Silvia Rauch deutete in Richtung des Bettes. »Ihr seht ja, die Bettdecke ist zurückgeschlagen und das Kopfkissen nicht akkurat ausgerichtet und verknautscht – sie hat offensichtlich dort geschlafen. Ansonsten gab es keinerlei Hinweise darauf, dass sich jemand in diesem Zimmer bewegt hat. Oder, im Kollegendeutsch: keine Kampfspuren.«
Silvia Rauch führte die beiden Kommissare in das kleine Badezimmer: eine Dusche, ebenerdig begehbar, ein Waschbecken, eine Toilette. Das Bad war innen liegend. Nachdem Silvia Rauch den Lichtschalter betätigt hatte, nahm ein Lüfter seine Arbeit auf. Über dem Waschbecken hing ein Spiegel, ebenfalls mit eindrucksvoll verziertem Holzrahmen. Auf der Ablage darunter stand ein Becher mit Zahnbürste, eine Tube Zahncreme lag daneben. Rechts vom Waschbecken hingen zwei Handtücher an Haken – und das war’s dann auch schon gewesen mit Gegenständen, die darauf hinwiesen, dass jemand dieses Bad benutzte. In der Ecke ebenfalls ein kleines Schränkchen, auch antik, aber, passend zu Keramik und Kacheln, in weißer Farbe. Horndeich konnte sich vorstellen, dass das Schränkchen die Feuchtigkeit auf Dauer nicht goutieren würde. Dennoch zeigte es bislang keinerlei Spuren eines Konflikts mit dem Wasserdampf.