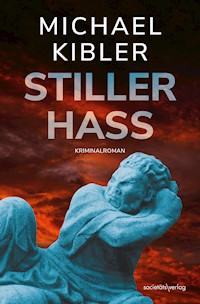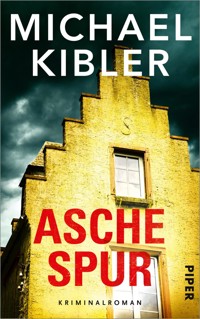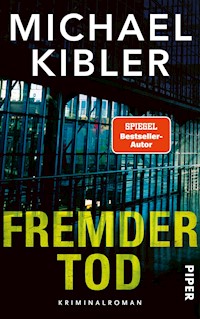8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Zwei Frauen werden nur wenige Tage nacheinander in Darmstadt ertränkt aufgefunden. Treibt ein Serienmörder in der beschaulichen kleinen Großstadt sein Unwesen? Margot Hesgart und Steffen Horndeich von der Mordkommission versuchen fieberhaft, die Fälle zu lösen. Bekennerschreiben, die die vernichtende Kraft des Wassers beschwören, eine alte Leiche unter dem Fundament des Jugendstilbads – das Puzzle scheint kaum entwirrbar. Hesgart tut alles, was in ihrer Macht steht. Trotzdem kann sie nicht verhindern, dass auch Menschen aus ihrem privaten Umfeld in höchste Gefahr geraten …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
1. Auflage 2010
ISBN 978-3-492-96835-5
© Piper Verlag GmbH, München 2010 Covergestaltung: semper smile, München Covermotiv: Mauritius images/imagebrokerr/J. W. Alker Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt
Und dann springst du rein, Tauchst ganz tief ein, Tauchst einfach ab, Und bist ganz für dich allein. Du bist in deinem Element, Und alles das, was in dir brennt, Wird gelindert und gekühlt vom Wasser, das dich ganz umspült …
Wise Guys, »Wasser«
Heavy, heavy water Won’t wash away the sins of the father Unholy, holy water Leading us like lambs to the …
Styx, »Heavy Water«
Prolog
Der Teppich ist schwer. Deshalb tragen wir ihn zu zweit. Wäre nicht die tote Frau darin eingewickelt, könnte ich ihn auch allein tragen. Es ist spät in der Nacht, und es ist gut, dass die eine Straßenlaterne trübe ist wie immer und die andere eine neue Birne braucht, denn sie flackert nur noch. Der Weg, den wir mit dem Teppich gehen müssen, ist zum Glück nicht weit.
Meine Kleidung werde ich wegschmeißen müssen. Das Blut hat die Schulterpartie durchweicht. Und wenn ich genau hinschaue, werde ich sicher noch ein paar weitere Flecke entdecken. Der Boden der Baugrube wird auch meine Schuhe versauen.
Sie ist tot, doch ich kann keine Traurigkeit empfinden. Ist es schlimm, dass – neben der Angst – nur eine einzige weitere Empfindung bei mir vorherrscht, nämlich Erleichterung? Am stärksten ist das Gefühl, von einer Bürde befreit zu sein. Nur dass sie augenblicklich durch eine andere ersetzt wurde. Das war mir nicht klar. Immer, wenn ich mir ihren Tod vorgestellt habe, wenn ich daran gedacht habe, wie es sein würde, wenn sie nicht mehr keifen und verbales Feuer speien würde, war sie einfach nicht mehr da. In diesen Gedankenspielen hat sie sich einfach in Luft aufgelöst oder ist in ihrer Verwirrtheit vor ein Auto gelaufen. Keinen dieser beiden Gefallen hat sie mir getan. Es musste nachgeholfen werden, damit sie aus meinem Leben verschwindet.
Dennoch, ich denke: Endlich! Ich denke, dass die Zeit eigentlich schon längst gekommen war, ihr Leben zu beenden. Kein Mann kann so existieren, mit einer wie ihr an seiner Seite.
Gut, dass die andere zu mir steht, wie eine Frau zu ihrem Mann stehen sollte. Dass sie mir hilft, diesen verdammten Teppich mit dem verdammten toten Körper zu tragen. Dass sie die Last mit mir teilt. Dass sie ebenfalls ihre Bürde auf sich genommen hat, in mehrfacher Hinsicht.
Ich frage mich, wie unser aller Leben nun weitergehen wird. Ihres, meines und natürlich auch das von Hans. Ich habe keine Antworten. Im Moment ist alles, was ich weiß, dass es ein stilleres Leben sein wird. Ohne Kreischen, ohne Zetern. Ohne Angst, die eigene Wohnung zu betreten, weil gleich, wie einem Naturgesetz folgend, statt einer Begrüßung die erste Attacke kommen wird.
Der Weg hinab in die Baugrube ist nicht leicht mit dem Teppich auf der Schulter. Es ist rutschig, aber wenigstens nicht schlammig. Die Dunkelheit schützt unsere Mission, doch wir sehen kaum, wo wir hintreten.
Wir haben an drei Stellen Kordel um den Teppich geschlungen, damit er sich nicht abrollen kann. Und unter die Kordel haben wir den Spaten gesteckt. Ich ziehe ihn heraus, nachdem wir die Leiche abgelegt haben.
Es gibt in diesem Boden nur wenige Stellen, an denen mehr Erde ist als Stein. Ich weiß um diese Stellen und fange an zu graben. Auch hier ist kein Licht, aber ich kenne mich aus. Das Loch muss nicht tief sein. Es wird die Leiche keine vierundzwanzig Stunden lang verbergen müssen, dann wird man Beton darübergießen.
Sie steht an meiner Seite und hilft mir, die Tote in die Grube zu legen. Ich schaufle Erde darüber. Wer morgen früh genau hinschaut, wird sehen, dass der Boden an einer Stelle etwas dunkler ist als drum herum. Aber bevor der Beton kommt, wird niemand mehr graben.
Wir verlassen die Baugrube. Und gehen gemeinsam zurück in die Wohnung.
Der Weg ist kurz.
Und führt sie und mich in ein neues Leben.
Montag
Der Schrei gellte.
Und Margot Hesgart fand es einfach ungerecht.
Nun hatte sie das Baby schon aus dem Kinderwagen heraus- und auf den Arm genommen, doch Zoey Jansen, Margots Enkelin, dachte nicht daran, sich dankbar zu zeigen, indem sie die Lautstärke ihres Kreischens wenigstens ein bisschen abmilderte.
Margot stieß den Wagen von sich – wozu waren die eigentlich gut, wenn man die Kinder ohnehin tragen musste? – und fingerte nach dem Hausschlüssel. Der war – natürlich! – in der anderen Manteltasche.
Sie bugsierte das schreiende Bündel Mensch auf die andere Schulter. Der Hörtest würde also künftig auch auf dem linken Ohr schlechter ausfallen.
Entnervt öffnete sie die Haustür und entdeckte gleich darauf den roten Hartschalenkoffer. Rainer Becker – Freund, Lebensgefährte, Vater ihres Sohnes Ben und Opa von Zoey – musste schon aus Berlin zurück sein. Auch wenn sein Koffer eigentlich nicht rot, sondern schwarz war. Vielleicht war der alte kaputtgegangen, dachte Margot, während sie das Schreien des Kindes mit ihrer eigenen Stimme zu übertönen versuchte. »Rainer?«, rief sie und betrat gleichzeitig das Wohnzimmer.
Der Angesprochene saß auf dem Sofa.
Zoey übte sich immer noch in der Erweiterung ihres Lungenvolumens. Margot hatte die Melodie ihres Handys nicht gehört, aber sie spürte den Vibrationsalarm in der Hosentasche. Sie trat drei Schritte auf Rainer zu, drückte ihm die menschliche Heulboje in die Hände, kramte nach dem Mobiltelefon, trat in den Flur, schloss die Zimmertür und nahm das Gespräch an. Das Display hatte ihr gezeigt, dass Steffen Horndeich anrief, ihr Kollege von der Mordkommission in Darmstadt.
»Was gibt’s?«, fragte sie knapp und fügte schnell hinzu: »Ich hab Urlaub.« Auch wenn der Lautstärkepegel aus dem Wohnzimmer nicht wirklich für Erholung und Freizeit sprach.
»Wir haben hier eine Leiche«, sagte der Kollege.
Margot antwortete nicht. Sie fragte sich nur still und heimlich, ob Horndeich nicht in der Lage war, die Ermittlungen in einem neuen Fall allein anzugehen.
Er interpretierte ihr Schweigen offenbar als Aufforderung weiterzuerzählen. »Eine alte Dame.«
»Und warum rufst du mich an?«
»Weil das alles ziemlich seltsam ist.«
»Was ist seltsam?«
»Sie wurde ertränkt.«
»In der Badewanne?«
»Ziemlich große Badewanne. Ich hol mir gerade nasse Füße im Jugendstilbad.«
Das Jugendstilbad war Darmstadts Wellnessoase, mit Schwimmbad, Spaßbädern und einem großen Saunabereich.
»Horndeich, ich hab Urlaub. Du kommst mit einer Toten wohl allein zurecht.«
»Ich dachte nur, wenn du Donnerstag wieder arbeitest, dann wärst du vielleicht froh, wenn du dir das hier mal persönlich angeschaut hättest.«
»Ich hab Urlaub«, wiederholte Margot und beendete das Gespräch, indem sie die Taste mit dem roten Telefonsymbol drückte, ihre Lieblingstaste.
Sie hatte keine Lust, die Wohnzimmertür wieder zu öffnen, denn die dämpfte das Geschrei, mit dem Zoey nun Rainers Trommelfelle malträtierte. Horndeichs dreister Versuch, sie zum Tatort zu zitieren, erschien ihr auf einmal als verlockendes Angebot. Eigentlich müssten alle Eltern spätestens nach dem dritten Kind taub sein, dachte sie und öffnete dann doch die Tür.
Zoey erblickte sie, ruderte mit den Ärmchen in ihre Richtung – und Rainer machte keinen Hehl aus seiner Freude, dass das Kind eindeutig klarmachte, wessen Schulter es für seine Stimmübungen bevorzugte.
Margot nahm das Kind wieder auf den Arm. »Schhhh«, machte sie und klopfte der Kleinen sanft auf den Rücken.
Das Bäuerchen war ein ausgewachsener Bauer und entlud sich in einem Schwall auf dem Mantelstoff über ihrer Schulter. Das Gute war, dass unmittelbar danach das Schreien aufhörte. Das Schlechte, dass sie sicher zwanzig Euro für die Reinigung berappen durfte. Sie sollte eine Liste der Posten aufstellen, die sie ihrem Sohn und seiner Freundin in Rechnung stellen würde, wenn die wieder im Lande waren.
Vor drei Wochen waren sie nach Amerika abgedüst. Bildungsurlaub für Ben, den Kunststudenten, von Kunsthistoriker Rainer kräftig gesponsert. Rainer und sie hatten sich bereit erklärt, in dieser Zeit Zoey zu versorgen. Bis es dann an ihr hängen geblieben war, weil Rainer kurzfristig nach Berlin gemusst hatte.
Margot ignorierte den säuerlichen Geruch, der von ihrer Mantelschulter ausging. Sie gab Rainer einen Kuss. »Hey – schön, dass du wieder da bist.«
»Ja. Schön.«
Eines Tages würde er an seinen euphorischen Ausbrüchen noch zugrunde gehen, dachte Margot.
»Du wolltest doch nach Frankfurt fahren, in den Palmengarten, oder?«, fragte er.
»Ja. Aber Zoey nicht. Sie hat ständig gekreischt.«
Wie zur Bekräftigung entfuhr dem kleinen Mädchen ein tiefer Seufzer.
Margot legte das Kind in die Wiege im Wohnzimmer, und die Kleine schlief sofort ein. Margot zog den Mantel aus. »Also hab ich nur einen Spaziergang gemacht. Und du? Hast du nicht gesagt, du wolltest erst abends wieder hier sein? Bist du die Nacht durchgefahren?«
»Ich, also …«
Erst da begriff Margot, dass irgendetwas nicht stimmte. Zoeys Phonorgien hatten die feinen Gefühlsantennen, mit denen Margot ausgestattet war, in ihrer Funktion beeinträchtigt. Nun aber lieferten sie wieder satte Signale. Nur waren das keine guten. »Was ist?«
Rainer war zehn Tage in Berlin gewesen. Eine Cousine zweiten Grades war gestorben. Er hatte sich um die Beerdigung gekümmert und die familiären Angelegenheiten geregelt. Es gab offenbar keine nahen Verwandten oder andere Familienmitglieder, die sich darum hätten kümmern können. Sie bewunderte seine Ritterlichkeit. Auch wenn sie sich etwas mehr Unterstützung hinsichtlich ihres kleinen Gastes erwünscht hätte. Aber sie mochte ihm daraus keinen Vorwurf machen.
»Sag mal, warum hast du dir einen neuen Koffer ausgerechnet in Rot gekauft? Ich dachte immer, du bevorzugst konservative Farbtöne?«
Die Wohnzimmertür wurde geöffnet. Herein trat eine junge Dame, bekleidet nur mit einem hellblauen Badetuch, das sie um ihren Körper geschlungen hatte, und einem dunkelblauen Handtuch, das um ihre offensichtlich üppige Haarpracht gewickelt war. Eine braune Locke lugte frech unter dem Frottee hervor.
Margot starrte die junge Frau – die sehr junge Frau – an, sah dann wieder zu Rainer.
»Hi«, flötete die Grazie, »du musst Margot sein.«
Rainer sagte gar nichts. Aber seine Gesichtsfarbe war auf einmal Ton in Ton mit dem Koffer, dessen Herkunft nun geklärt war.
Keine achtzehn, dachte Margot, während sie versuchte, all die Empfindungen und Fragezeichen in ihrem Kopf unter einen Hut zu bekommen.
»Sag, dass das nicht wahr ist!«, fauchte sie dann. Eine wirklich gute Eröffnung.
Doch Rainer sagte kein Wort.
»Ich bin Dorothee«, flötete die Lolita in Blau. In dem sehr wenigen Blau.
Margot sah zu Rainer, der seine eigene Interpretation von Lots Frau abgab und Salzsäule spielte, dann wanderte ihr Blick weiter zu Dorothee und wieder zu Rainer, und schließlich sagte sie: »Und ich bin nicht mehr hier. Wenn ich zurückkomme, würde ich mich über eine gute Erklärung sehr freuen. Und über eine glaubhafte. Am besten eine, die beiden Ansprüchen gerecht wird.« Ihre Augen blitzten, als sie Rainer ansah. »Und ich will niemanden außer dir in diesem Haus antreffen.«
Sie zückte ihr Handy, drückte auf eine der Kurzwahltasten.
»Margot, Schatz …« Rainer hatte seine Stimme wiedergefunden.
Margot wandte sich um. »Jetzt sag nur nicht: Es ist nicht so, wie es aussieht!«
»… es ist nicht so, wie es aussieht.«
Ihre Hand klatschte auf seine Wange.
Was Zoey weckte und sogleich zum Schreien animierte.
Margot schnappte sich ihren Mantel – ihren vollgespuckten Mantel – und vergaß nicht, die Wohnzimmertür laut knallen zu lassen, ebenso wenig wie die Haustür.
Dann eben nicht, dachte Horndeich und steckte das Handy wieder ein. Jedenfalls konnte Margot später nicht behaupten, er habe ihr nicht Bescheid gesagt.
»Ich danke Ihnen«, sagte er zu dem Arzt. Sie standen beide im Sanitätsraum des Jugendstilbads. Neben ihnen auf der Liege lag die tote alte Dame. Sie trug einen schwarzen, sehr konservativ geschnittenen Badeanzug. Ihre silbergrauen Haare bedeckte eine rosafarbene Bademütze mit hässlichen rosa Gummiblümchen.
Ihren Namen kannten sie nicht. Aber den Grund ihres Ablebens. Der war zugleich auch der Grund, weshalb der Doktor die Polizei gerufen hatte.
»Sie wurde ertränkt«, hatte er Horndeich soeben erklärt.
Der hatte gefragt, woran er das denn erkennen könne. Schließlich gäbe es ja außen keinen Wasserstandsanzeiger der Lunge.
Der Doktor hatte auf die Überreste von Schaum gezeigt, die um den Mund der Dame zu erkennen waren. Der erinnerte Horndeich eher an Rasierschaum. Ziemlich unpassend auf dem Gesicht einer Dame.
»Das ist Schaumpilz«, hatte der Mediziner erklärt. »Eindeutiges Zeichen dafür, dass sie nicht an einem Herzanfall gestorben, sondern ertrunken ist.«
Horndeich musste sich entscheiden: Sollte er zunächst warten, bis Hinrich von der Gerichtsmedizin die Diagnose bestätigte? Oder sollte er die Erklärung des Doktors schon mal als Arbeitshypothese übernehmen und bereits mit seinen Ermittlungen anfangen?
Margot hätte die Entscheidung sicher schneller getroffen. Aber Margot war nicht da. Horndeich hatte, als er gerade mit ihr telefonierte, Babygeschrei im Hintergrund gehört. Mit ihr war sicher nicht mehr zu rechnen.
Offenbar hatte der gute Doktor seine Gedanken gelesen, denn er sagte: »Sie können mir glauben. Und Kollege Hinrich in Frankfurt wird meine Diagnose bestätigen und kann Ihnen auch ergänzend mitteilen, wie viel Wasser sich in den Lungen der Guten befindet.«
»Sie kennen sich?«, fragte Horndeich irritiert.
»Wir sind in derselben Studentenverbindung.«
Das war zwar sicher nicht unbedingt ein Gütesiegel, doch wenn es sich bei dem Ableben der Dame um ein Tötungsdelikt handelte, wollte Horndeich keine weitere Zeit verlieren.
»Danke noch mal«, wiederholte er sich, dann verließ er mit dem Arzt den Raum.
Ein Bademeister stand vor der Tür, und Horndeich bat ihn: »Halten Sie bitte diese Tür verschlossen, bis die Leiche abgeholt wird. Dann möchte ich, dass Sie das Bad schließen. Machen Sie eine Durchsage, und erklären Sie den Gästen, dass meine Kollegen alle Personalien aufnehmen werden, bevor sie gehen können.«
»Das kann ich nicht, das muss der Badleiter entscheiden.«
»Dann sagen Sie dem Badleiter, dass ich es so entschieden habe. Wenn es Probleme gibt, soll er sich an mich wenden. Und jetzt möchte ich mit dem Bademeister sprechen, der gemerkt hat, dass die Dame nicht mehr lebt.«
»Das war Jürgen Wohlfahrt. Er sitzt dort hinten.«
»Gut, dann bringen Sie uns bitte in einen Raum, in dem wir ungestört reden können.«
Der Bademeister nickte nur. Horndeich veranlasste, dass sich die Spurensicherung das Becken vornahm, in dem die tote Frau gefunden worden war, und wies dann die Kollegen an, dass sie die Personalien der Gäste aufnahmen. Danach führte ihn der Bademeister zusammen mit dem jungen Jürgen Wohlfahrt in einen kleinen Büroraum abseits des Badebetriebs.
Sie hatten sich kaum an den Tisch gesetzt, als es klopfte. Als sich Wohlfahrt nicht bemüßigte – oder bemächtigt fühlte –, Einlass zu gewähren, rief Horndeich: »Herein!«
»Guten Tag, mein Name ist Sigmar Karawitschek. Ich bin der Leiter dieses Bades.«
Horndeich erhob sich, reichte dem älteren Herrn die Hand. »Horndeich, Kripo Darmstadt.« Nette Schildchen tragen die hier, dachte er. Neben dem Namen war ein Tintenfischsymbol abgebildet, das Emblem des Bades.
»Herr Horndeich, mein Angestellter sagte mir gerade, wir sollen das Bad schließen.«
»Ja, das ist richtig.«
»Bei allem Respekt, Herr Horndeich, ich kann das Bad nicht zumachen. Auch wir müssen schauen, dass wir rentabel arbeiten. Zumindest ohne Verlust.«
Verlust, dachte Horndeich. Du hast heute einen Gast verloren, und das für immer.
Laut sagte er: »Herr Karawitschek, Sie werden das Bad jetzt schließen, denn die Kollegen von der Spurensicherung müssen ihre Arbeit tun, und ich weiß nicht, wo die überall ihre Lupen hinhalten wollen.«
»Können wir nicht wenigstens die Saunalandschaft geöffnet lassen?«
»Klar. Wenn es die weiblichen Gäste nicht stört, dass sich die Jungs von der Spusi auch dort gründlich umschauen …«
»Aber das mit den Personalien … Ich meine, das wirft nicht gerade ein gutes Licht auf unser Haus.«
Horndeich seufzte. »Herr Karawitschek, mal Klartext: Die alte Dame ist höchstwahrscheinlich ermordet worden. Mein Job und der Job meiner Leute ist es, denjenigen zu finden, der dafür verantwortlich ist. Und Sie wollen sich doch lieber damit brüsten, der Polizei bei der Aufklärung eines Verbrechens geholfen zu haben, statt in der Zeitung lesen zu müssen, dass Sie die Ermittlungen behindert hätten, oder?«
Karawitschek wirkte auf einmal ziemlich entgeistert. »Ich wusste nicht, dass die Dame … Wie ist sie denn gestorben?«
Horndeich ignorierte die Frage. »Könnten wir einen Kaffee bekommen?« Er wandte sich an Wohlfahrt. »Sie könnten auch einen vertragen, nicht wahr?« Wohlfahrt reagierte nicht, also sagte Horndeich: »Zwei, bitte.«
Karawitschek verließ den Raum.
Horndeich setzte sich Wohlfahrt gegenüber. »Also, jetzt erzählen Sie mir doch bitte, was hier passiert ist.«
»Ich verlier meinen Job«, jammerte der junge Mann.
»Am besten von Anfang an«, fügte Horndeich hinzu.
»Okay. Ich hatte heute die erste Schicht. Bin schon seit acht Uhr da. Vorhin war hier im Salzbad Mutter-und-Baby-Schwimmen, von neun bis Viertel vor zehn. Um zehn macht das Bad dann für alle auf. Die Ersten kommen so um kurz nach zehn. Ich hab die alte Dame gegrüßt, die hat zurückgegrüßt, hat mich sogar mit Namen angesprochen.«
»Sie wissen aber nicht, wer die Dame ist … beziehungsweise war?«
»Nein, die Gäste tragen ja kein Namensschildchen. Sie kam so um zehn nach zehn, war die Erste, die in das Solebecken ging.«
»Was ist das Besondere an diesem Becken?« Horndeich hatte schon gehört, dass das frisch renovierte Jugendstilbad als Tempel der Entspannung konzipiert war. Aber er war nicht gerade ein Fan von Hallenbädern. Und von sogenannten Spaßbädern ohnehin nicht.
»Das Solebecken hat einen Salzgehalt von drei Prozent. Sie können darin treiben, ohne unterzugehen. Zumindest fast. Wenn Sie sich so eine Schwimmnudel aus Schaumstoff in den Nacken und unter die Beine legen, dann schweben Sie regelrecht im Wasser. Das Becken ist von einer Wand umgeben, und das Licht dort ist recht gedämpft.«
»Aha.« Horndeich nickte. »Was geschah dann?«
»Ich machte meine Runde. Schaute, dass hier im Spa-Bereich alles in Ordnung ist.«
Die Bezeichnung Spa kannte Horndeich. Am Tag der Neueröffnung des Bades war Margots Vater, Sebastian Rossberg, auf dem Präsidium gewesen, um seiner Tochter ein Buch über die Rosenhöhe vorbeizubringen. Horndeich stritt gerade mit Margot darüber, wofür das Kürzel Spa stand. Er tippte auf »Sportive Pulse Action« oder auf etwas ähnlich Sinnloses aus Amerika, Margot glaubte an einen deutschen Ursprung. Sebastian Rossberg verfolgte das verbale Duell, um schließlich einzugreifen.
»Spätestes damit dürfte erwiesen sein, dass es sich gelohnt hat, meine Lateinkenntnisse wieder aufzufrischen«, sagte er mit einem triumphierenden Lächeln. »Spa steht für ›sanitas per aquam‹ – Gesundheit durch Wasser.«
Der Bademeister fuhr fort: »Auch die Dame hat sich mit zwei Schwimmnudeln treiben lassen.«
»Und dann haben Sie nach zwanzig Minuten gemerkt, dass sie sich nicht mehr rührt?«
»Quatsch. Ich muss spätestens alle vier Minuten persönlich nachschauen, ob im Solebecken alles in Ordnung ist. Da sind in der Wand überall die Fensteröffnungen, und immer, wenn ich nachgeschaut habe, schwamm die Dame an einer anderen Stelle.«
»Und daraus haben Sie geschlossen, dass sie noch lebt?«
»Nein, ich hatte überhaupt keinen Zweifel daran, und da bin ich mir auch jetzt sicher. Unter Wasser, da sind ja diese Düsen, die eine Strömung erzeugen.«
»Also schwimmt jemand, der sich treiben lässt, immer im Kreis herum?«
»Nein. Wenn man sich gar nicht bewegt, dann landet man in einem der toten Winkel, aus denen man nicht mehr herausgetrieben wird. Wenn man sich weiter vom Wasser treiben lassen will, muss man schon ein bisschen paddeln, um sich wieder in die Strömung zu manövrieren. Deshalb kann sie nicht lange tot gewesen sein, denn als ich merkte, dass was nicht stimmt, befand sie sich seit maximal vier Minuten in der einen Ecke des Beckens.«
»Kam sie öfter her?«
»Ja, jeden Montag und jeden Donnerstag.«
»Und?«
»Nun, sie schwamm im Wasser, in einer dieser Ecken, aus denen man sich herausmanövrieren muss. Sie war ja schon zwanzig Minuten im Wasser. Da hab ich nach ihr gerufen, direkt von der Fensteröffnung aus über ihr. Sie hat nicht reagiert. Da ist mir aufgefallen, dass sie so einen stieren Blick hat. Da bin ich sofort rein ins Becken. Kein Puls, also hab ich sie rausgebracht, auf den Boden gelegt, nach den Kollegen gerufen, dass sie einen Arzt holen sollen.«
»Und dann?«
Eine Träne rann über die Wange des Jungen. »Wie gesagt, ich konnte keinen Puls mehr spüren. Also hab ich sofort mit der Herzmassage begonnen. Ich glaube, ich hab ihr ein paar Rippen gebrochen.«
Gebrochene Rippen waren nun wirklich ihr geringstes Problem, dachte Horndeich.
»Zusammen mit dem Doktor hab ich sie auf die Liege gelegt. Der hat dann gesagt, es sei zu spät.«
Wieder klopfte es an der Tür.
Horndeich hatte sich schon an die Rolle des Conférenciers gewöhnt. »Herein.«
Karawitschek brachte den Kaffee sogar persönlich. Auf einem kleinen Tablett, mit Zucker, Milch und sogar ein paar Keksen.
Das nennt man Stil, dachte Horndeich.
»Herr Karawitschek, haben Sie eigentlich Kameras im Kassenbereich?«
»Ja, klar. Auch bei den Wertschränken und an noch ein paar sicherheitsrelevanten Stellen.«
»Das heißt, wir können sehen, wer das Bad betreten und wer es verlassen hat?«
»Ja. Nicht unbedingt in Auflösung, aber das sollte möglich sein.«
»Im Solebad ist auch eine Kamera«, brachte sich Jürgen Wohlfahrt wieder ins Gespräch ein.
»Dort, wo die Dame gestorben ist?«
»Ja.«
»Zeigen Sie die mir, bitte.«
»Kommen Sie mit«, sagte Karawitschek.
Margot lenkte ihren schwarzen Einser-BMW auf den großen Parkplatz vor dem Jugendstilbad. Wenigstens war um diese Zeit noch ein Parkplatz zu ergattern. Statt einen Parkschein zu ziehen, ging sie direkt auf das Bad zu.
Die Fassade gefiel ihr, besonders nachdem das komplette Gebäude seit einem Jahr wieder in würdigem Glanz erstrahlte. Hundert Jahre war der Bau bereits alt, errichtet in einer Zeit, in der es keineswegs in jeder Wohnung ein Badezimmer gegeben hatte. Damals war eine öffentliche Badeanstalt eine hygienische Notwendigkeit gewesen.
Nach dem Krieg notdürftig zur Hälfte wieder zusammengeflickt, hatte die knapp dreijährige Restaurierung dem einstmals prunkvollen Bau seine Würde zurückgegeben.
Margot zeigte dem Polizeibeamten am Eingang ihren Dienstausweis. In der weitläufigen Eingangshalle saß ein Pulk von Menschen. Beamte in Uniform nahmen die Personalien der Gäste auf.
»Wo finde ich den Kollegen Horndeich?«, fragte sie einen der Gesetzeshüter. Der zuckte nur mit den Schultern und schrieb weiter Name und Adresse einer adretten Brünetten in seinen Notizblock.
»Die Kollegen sind im Technikraum«, klärte sie ein junger Polizist auf.
»Und der ist wo?«
Darauf zuckte auch er mit den Schultern.
Das ist nicht mein Tag, dachte Margot. Sie ging weiter zum Kassenbereich, hielt ihren Ausweis hoch. »Der Technikraum – wo finde ich den?«
»Welchen Technikraum?«, fragte die Dame in blauer Kleidung.
Margot konnte einen Teil des Badebereichs hinter der Kasse einsehen. Und dort eine junge Frau, die ein dunkelblaues Handtuch um ihren Körper geschlungen hatte und ein hellblaues um die Haare.
»Nicht mein Tag«, murmelte sie.
Die Dame hinter der Kasse hatte inzwischen ihren Chef angefunkt und herausgefunden, wo sich die Polizisten aufhielten. »Ich bringe Sie hin«, bot sie an.
Zehn Gänge und gefühlte zwanzig Abbiegungen durch ein Labyrinth später öffnete sie eine Tür, deutete hinein. »Hier sind sie.«
»Danke«, sagte Margot.
Die Kollegen Horndeich und Sandra Hillreich standen zusammen mit zwei Männern vor einem großen grauen Stahlschrank, in dem kubikmeterweise Technik verstaut war. Margot sah in dem ganzen Gewirr von Rechnern und Kabeln, Kästen und Knöpfen einen Monitor, der Horndeichs ganze Aufmerksamkeit zu fesseln schien.
»Da geht sie rein«, sagte der Jüngere der beiden Männer, deren blaue Kleidung sie als Mitarbeiter der Badeanstalt auswies.
»10Uhr09«, fügte der andere hinzu.
Horndeich schaute gebannt auf den Monitor, und Sandra Hillreich schaute gebannt auf Horndeich. Weshalb sie Margot wohl als Erste entdeckte. »Hallo, Margot«, sagte sie und hüstelte, weil Margot wieder einmal ihr kleines – offenes – Geheimnis erkannt hatte.
Horndeich drehte den Kopf synchron mit den beiden Mitarbeitern. Dann machte Horndeich sie mit Bademeister Jürgen Wohlfahrt und dem Leiter des Bades, Sigmar Karawitschek, bekannt.
»Gut, dass du doch noch kommst«, meinte er und berichtete knapp, was er bislang in Erfahrung gebracht hatte. »Da hängt eine Überwachungskamera über dem Solebad«, erklärte er. »Vielleicht können wir sehen, wann sie ertrunken ist.«
Margot stellte sich so neben Horndeich, dass sie das Bild auf dem Monitor ebenfalls sehen konnte und sie zugleich Sandra nicht die Sicht auf Horndeich versperrte.
Sandra Hillreich war der Computercrack der Abteilung. Und seit geraumer Zeit verschossen in Kollege Horndeich, der das entweder einfach nicht merkte oder nicht merken wollte. Vor eineinhalb Jahren, als sie nach einem schweren Autounfall lange Zeit in der Rehaklinik gewesen war, hatte Margot gedacht, zwischen ihr und Horndeich hätten sich zarte amouröse Bande entwickelt, zumal er sich an dem Unfall schuldig gefühlt hatte.
Aber sie hatte sich getäuscht.
In den vergangenen achtzehn Monaten war Horndeich immer wieder mal von anderen Damen vom Präsidium abgeholt worden – ein Zeichen für Sandra, dass es wohl besser für sie sei, ihren Traum zu begraben. Umso erstaunlicher war es, dass sie in den vergangenen Wochen offenbar erneut Anlauf genommen hatte, Horndeichs Herz zu erobern.
Margot ertappte Sandra abermals dabei, wie sie nicht auf den Monitor sah, sondern Horndeich anschaute. Sie erinnerte Margot an Nora Tschirner, die in der Vorabend-Soap »Sternenfänger« ihren Schwarm Jochen Schropp angehimmelt hatte, auch wenn Sandra optisch eher der weitaus forscheren Florentine Lahme glich.
Horndeich lenkte sie ab, indem er ihr zuflüsterte: »Hier riecht’s auf einmal irgendwie sauer.«
»Aha«, murrte Margot nur.
Er warf ihr einen schnellen Seitenblick zu und fügte an: »Du hast da was auf deiner Mantelschulter.«
»So so«, murrte sie.
»Siehst irgendwie eklig aus.«
»Ich weiß«, zischte sie.
»Und riecht auch so.«
Margot holte bereits Luft, um ihren Kollegen zu maßregeln. Sollte der doch mal ein kleines Gör hüten. Er würde sich wahrscheinlich sehr lautstark bedanken, wenn ihm das Baby nur aufs Jackett sabberte. Doch Wohlfahrt warf in diesem Moment ein: »Da, jetzt hat sie je eine Schwimmnudel unter Beinen und Nacken.«
»Da ist außer ihr niemand im Becken«, stellte Horndeich fest. »Gibt es hier so was wie einen schnellen Vorlauf?«
Wohlfahrt nickte, und einen Mausklick später zog die alte Dame ihre Kreise wie ein Sportboot.
»Stopp!«, rief Horndeich. Er deutete mit dem Finger auf den unteren Rand des Bildes. »Können Sie das mal ein bisschen ranzoomen?«
Der Schatten am unteren Bildrand wurde zu einem dunklen Pixelgebirge.
»Ist das ein Mann?«
Margot starrte auf den formatfüllenden Fleck. Horndeichs Frage erinnerte sie an einen psychologischen Test: »Was könnte dieser Fleck sein?« Wer darauf antwortete: »Ein Blutfleck«, war gewalttätig, wer sagte: »Eine Frau«, war Triebtäter, und wer sagte: »Ein Mann«, war schwul. Oder ein schwuler Triebtäter. Zum Glück durfte Margot bei ihren Ermittlungen noch den gesunden Menschenverstand benutzen, doch man munkelte, dass beim LKA in Wiesbaden die Psychologen langsam, aber sicher das Ruder übernahmen.
»Nein, das ist ein Haufen dunkler Pixel«, brachte es Sandra auf den Punkt. »Weiter, bitte. Normalgeschwindigkeit, Normalgröße.«
Margot bemerkte die zunehmende Nervosität der jungen Kollegin.
Sandra ging um Margot und Horndeich herum. »Darf ich mal?«, sagte sie in einem Tonfall, der eher Befehl als Frage war, und übernahm die Herrschaft über Maus und Tastatur.
Einmal mehr fragte sich Margot, wie Sandra es schaffte, auch komplexe Programme aus dem Stegreif bedienen zu können.
Wenige Sekunden später entpuppte sich der Pixelhaufen als der Kopf eines Mannes, der ebenfalls ins Solebad stieg. Sandra fror das Bild ein, vergrößerte es. Dann fragte sie: »Geht das auch ein bisschen schärfer?«
»Schärfer?«, wiederholte Karawitschek.
»Ja. Sodass wir zum Beispiel das Muster der Badehose sehen können? Oder zumindest eine Ahnung von seinem Gesicht bekommen?«
Auch Margot war der Ansicht, dass das Bild ziemlich wenig hergab. In dem Raum auf dem Monitor war es zudem recht dunkel. Es gab zwar Lampen unterhalb der Wasseroberfläche, doch da sie den Mann von unten anstrahlten, wirkte er wie ein Scherenschnitt.
Karawitschek antwortete nicht, und Sandra ließ den Film weiterlaufen. Der Mann machte keine Anstalten, sich vom Salzwasser treiben zu lassen. Vielmehr steuerte er direkt auf die alte Dame zu.
Er erreichte sie, als sie unmittelbar über dem Lichtkegel eines Strahlers trieb, genau dort, wo eine der Düsen das Wasser aufwirbelte.
Zwei dunkle Schatten vor sprudelndem Wasser, mehr war nicht zu sehen.
»Er bringt sie um«, keuchte Wohlfahrt, obwohl er es mehr ahnte als sehen konnte.
Etwa dreißig Sekunden später trat der Mann wieder rückwärts aus dem Becken.
Sandra spulte den Film zurück, vergrößerte den Ausschnitt. »Und das geht wirklich nicht schärfer?«, fragte sie verärgert. Wasser wirbelte, spritzte. Es war nicht auszumachen, was davon dem Todeskampf der Frau und was der Düse im Becken zuzuschreiben war.
»Nein, das geht nicht schärfer«, erwiderte Karawitschek, dessen Ton dafür umso schärfer war.
Sandra sah ihn an. »Dieses verwaschene Pixelgemisch ist alles, was die Kamera liefert?«
»Ja, gute Frau. Wir sind hier nämlich nicht beim Geheimdienst. Wir wollen mit den Kameras nicht unsere Gäste ausspionieren, sondern nur dafür sorgen, dass nichts passiert und keiner Dummheiten macht. Zumindest nicht unbemerkt.«
Toll, dachte Margot, wenn das eure Absicht war, ist es leider voll in die Hose gegangen. Die Kamera hatte einen Mörder bei der Tat gefilmt, aber die Aufnahme brachte gleich Null. Das heißt, zumindest den Todeszeitpunkt kannten sie nun auf die Sekunde genau.
»Ich werde die Festplatten mitnehmen«, sagte Sandra, an Horndeich gewandt. »Vielleicht kann ich bei uns noch was aus den Bildern rauszaubern.« Dann ließ sie die Aufnahme weiterlaufen.
»Der weiß ganz genau, dass wir hier filmen«, sprach Wohlfahrt Margots Gedanken aus.
Die Frau trieb im Halbkreis, dann bewegte sie sich nicht mehr.
»Das ist genau der tote Punkt. Wenn jemand dort hingetrieben ist, muss er erst wieder in den Strudel reinrudern.«
»Das dürfte ihr in diesem Zustand schwergefallen sein«, vermutete Sandra.
»10Uhr24«, murmelte Wohlfahrt. »Ich hab sie danach noch mal gesehen. Da war sie aber in der anderen Ecke!«
Sandra schaltete wieder auf schnellen Vorlauf. Ein Pärchen stürmte ins Bad. Sie plantschten im Wasser, küssten und neckten sich. Und während einer stürmischen Umarmung stießen sie gegen die alte Dame, die daraufhin die nächste Runde im Wasserkreislauf begann.
Nachdem sie wieder in einem der toten Winkel der Wasserstrudel feststeckte, betrat Wohlfahrt den Raum. Es war 10Uhr28.
In diesem Moment erschien Polizeiobermeister Bernd Süllmeier im Technikraum, erkannte Margot als ranghöchste Ermittlerin und sagte zu ihr: »Wir wissen, wer die Dame ist.«
Alle Augenpaare richteten sich auf ihn.
»Wir haben in ihrem Spind den Personalausweis gefunden. Susanne Bretz. Sie ist … Ich meine: Sie war fünfundsiebzig.«
»Danke«, murmelte Margot. »Damit sind wir schon mal ein Stück weiter.«
Sie drehte sich schon wieder um, um zu sehen, was weiter auf dem Monitor geschah, doch Süllmeier fuhr fort: »Wir haben da draußen auch noch einen Badegast. Die Bretz war nicht allein hier.«
Horndeich saß wieder in dem kleinen Büroraum, doch ihm gegenüber hockte diesmal kein Bademeister, sondern ein durchtrainierter, sonnenstudiogebräunter Mittdreißiger.
Margot lehnte an der Wand und sah auf den Rücken des Mannes.
»Sie heißen?«, eröffnete Horndeich das Gespräch.
»Ferdinand Markötter.«
»Sie waren mit Frau Susanne Bretz heute Morgen hier im Jugendstilbad?«, fragte Horndeich.
»Ja. Wir kommen hier jeden Montag und Donnerstag her. Die alte Dame will … wollte sich fit halten.«
»Und in welcher Funktion begleiteten Sie Frau Bretz?«
»Ich bin ihr persönlicher Leibsklave«, antwortete der Schönling trocken.
»Leibsklave?«, wiederholte Margot fragend.
»Unterhalter, Bespaßer, Beglücker, Zeitvertreiber … Nennen Sie es, wie Sie wollen.«
»Gegen Geld?«, fragte Horndeich.
»Na klar. Ich verdiene mein Geld damit. Verdiente … War ja klar, dass sie irgendwann stirbt. Aber sie war eigentlich noch ganz rüstig. Wenn auch das Gehirn wahrscheinlich nur noch die Hälfte des Schädels einnahm.«
»War sie geistig nicht mehr … beieinander?«, fragte Horndeich vorsichtig.
Ferdinand Markötter war da weniger rücksichtsvoll: »Sie war senil. Eine zickige, senile alte Schachtel, die keine Freunde mehr hatte, nur noch den bezahlten Leibeigenen. Der sich alles anhören musste. Wie schlecht die Welt ist, wie gut alles früher war, wie böse die Politiker, Verbrecher, Jugendlichen, Faulen, Terroristen und Tagediebe sind – womit sie sicher neunundneunzig Prozent der Menschen um sich herum meinte. Das erzählte sie jeden Tag gleich viermal, weil sich das Kurzzeitgedächtnis in den vergangenen zwei Jahren so ziemlich verabschiedet hatte.«
Die Schilderungen des Adonis zeichneten kein freundliches Bild der Verstorbenen. Aber sie gaben auch keines von ihm selbst ab. Horndeich gab diesem Ferdinand Markötter, der seine tote Herrin so hässlich ankläffte, im Stillen den Spitznamen Marktköter.
»Woran ist sie eigentlich gestorben?«, fragte Markötter. »Herzanfall beim Schwimmen?«
»Nein. Sie wurde ermordet.«
Markötter starrte Horndeich an, dann drehte er sich um, sah Margot an und wiederholte ungläubig: »Ermordet?«
»Ja. Um 10Uhr24«, bestätigte Horndeich. »Wo waren Sie zu diesem Zeitpunkt?«
»Ich?«
Horndeich antwortete nicht.
Es dauerte ein paar Sekunden, dann sagte Markötter: »Ich war im Saunabereich. Unter der Dusche. Wir kamen ja erst um kurz nach zehn hier an. Ich musste mich erst noch ausziehen, dann … dann ging ich duschen.«
Horndeich erwiderte nichts.
»He, ich hab mich mit der Bretz unten umgezogen und bin dann über das Schwimmbad und den Spa-Bereich hoch zur Sauna«, erklärte der Befragte, dem wohl gerade dämmerte, dass er zurzeit ganz oben auf der Liste der Verdächtigen stand – schon deswegen, weil bisher nur sein Name auf dieser Liste vermerkt war. »Das können Sie doch an meinem Schlüssel ablesen. Die ganzen Drehkreuze zwischen Sauna und Schwimmbad – da muss man den Schlüsselchip nämlich dranhalten, dann wird registriert, wo man war.«
»Es sei denn, man klettert drüber«, sprach Horndeich den Gedanken aus, der auch Margot sofort gekommen war.
»Wo drüberklettern?«, fragte Ferdinand Markötter, offensichtlich zu nervös, um folgen zu können.
»Über die Drehkreuze«, präzisierte Horndeich.
»Was soll das?«, regte sich Ferdinand Markötter auf. »Warum sollte ich die alte Dame umbringen?«
»Vielleicht, weil sie Ihnen auf die Nerven ging?«, schlug Horndeich nonchalant vor. Natürlich war das ein ziemlich schwaches Motiv, und jeder Jurastudent im dritten Semester hätte es ihm um die Ohren geschlagen, ganz zu schweigen von der Staatsanwaltschaft, wenn er damit Haftbefehl gegen Markötter beantragen wollte. Aber der Mann vor ihm war ihm unsympathisch. Außerdem kann man einen Täter frisch nach der Tat mit ein bisschen Provokation gut aus der Reserve locken, wie Horndeich aus Erfahrung wusste, denn sie gehen zu diesem Zeitpunkt immer davon aus, einen entscheidenden Fehler gemacht zu haben.
»Hören Sie, wenn ich jeden umbringen würde, der mich nervt, säße hier ein ganz übler Serienkiller vor Ihnen«, behauptete Markötter.
Horndeich zuckte nur mit den Schultern. »Sie sagten, Sie verdienen … oder verdienten … Ihr Geld durch Frau Bretz. Arbeiten Sie …«, Horndeich suchte nach dem richtigen Wort, »… freiberuflich?«
»Ich? Nein. Ich bin angestellt. Bei ›ProGlide‹.«
»Wer oder was ist das?«, fragte Horndeich und notierte sich den Namen in sein Büchlein.
»Das ist ein Limousinenservice. Bei uns können Sie ein Auto mieten samt Chauffeur. Aber eben nicht nur die ganz teuren Limousinen, sondern auch etwas günstigere Fahrzeuge.«
»Und Sie arbeiten dort als Chauffeur?«
»Ja.«
»Und in Ihrer Funktion als Chauffeur bespaßen Sie alte Damen«, hakte Horndeich nach. Sein Tonfall klang, als würde er einen Bäcker fragen, ob er auch Schweinelendchen verkaufe.
»Ja.«
»Gehört das auch zum … äh, Service?« Er betonte das letzte Wort mit Absicht.
»Nein.«
»Ja, nein … Also was jetzt?«
Markötter seufzte. »Ich bin zu dem Job gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Vor drei Jahren … nun, da lief das Unternehmen nicht so rund. Das heißt, wir sind nicht genug gewachsen. Das ist nämlich die Definition von ›nicht rund‹ für meinen Chef. Und dann kam diese Anfrage von der Bretz, ob sie nicht jemanden für dreimal die Woche haben könnte, der sie rumkutschiert und mit ihr was unternimmt. Und bevor ich eine betriebsbedingte Kündigung riskiert hab, da hab ich lieber diesen Job gemacht.«
»Und seitdem fuhren Sie Frau Bretz?« Margot war um den kleinen Tisch herumgetreten und stemmte die Hände in die Hüften. Offenbar war auch ihre Sympathie für den jungen Mann von begrenzter Natur.
»Ja. War ja anfangs auch okay. Sie hat mich immer mal wieder zum Essen eingeladen oder mir mal eine Pulle guten Rum geschenkt. War wirklich okay. Aber in den letzten zwei Jahren, da hat sie einfach massiv abgebaut. Auch im Jugendstilbad wusste sie schon zweimal nicht mehr, wo sie war. Verlangte nach ihrer Mutter. Und erkannte mich nicht. War echt gruselig. War nach ein paar Minuten vorbei, der Anfall. Sie hat mir nicht glauben wollen, was passiert war. Ist richtig aggressiv geworden. War nicht lustig, echt nicht.«
Alzheimer, dachte Horndeich, und kurz fröstelte er. Hatte er selbst noch nicht erleben müssen. Aber Anna – seine Exfreundin – hatte eine Mutter, die unter Alzheimer litt. Anna pflegte sie. In Moskau. Dorthin war sie zurückgekehrt, nachdem sich ihre Mutter ein Bein gebrochen hatte. Kurz danach war die Krankheit zutage getreten, sehr schnell und sehr heftig. Er hatte noch losen Kontakt zu Anna, hin und wieder schrieben sie sich E-Mails. Ihre vorletzte Mail, in der sie ihre ganze Wut auf diese Krankheit herausgeschrien hatte, war ihm noch Tage später durch den Kopf gegangen.
»Gut, Herr Marktkö …« Horndeich schluckte. Fast hätte er sich versprochen. »Herr Markötter, das war es dann erst mal für heute. Bitte halten Sie sich für weitere Fragen zur Verfügung.« Was das bedeutete, wussten die fleißigen Fernsehzuschauer inzwischen: Verlassen Sie nicht die Stadt, das Land, den Planeten …
Markötter nickte, stand auf und war gleich darauf verschwunden.
»Was hältst du von ihm?«, wollte Margot von ihrem Kollegen wissen.
»Keine Ahnung. Welches Motiv sollte er haben, die Bretz umzubringen? Sie war sein Job. Sägt jemand in der heutigen Zeit an dem Ast, auf dem er sitzt?«
Die Liste mit den Namen der Badegäste verschaffte Margot ein Alibi, um sich vor dem Heimweg zu drücken. Horndeich war ins Präsidium gefahren und wunderte sich gewiss noch immer, weshalb Margot, die noch vor wenigen Stunden darauf gepocht hatte, Urlaub zu haben, auf einmal so dienstbeflissen war.
Sie hatte bereits sechs Leute aufgesucht, die zum Todeszeitpunkt der alten Dame im Jugendstilbad gewesen waren. Aber sie hatte nichts herausgefunden, was ihren Informationsstand um eine Neuigkeit bereichert hätte. Bademeister Wohlfahrt war wohl der ergiebigste Zeuge.
Es ist an der Zeit, nach Hause zu fahren, dachte Margot, als sie den Motor ihres BMW erneut anließ.
Rainer hatte sechsmal versucht, sie anzurufen. Dreimal hatte er eine Nachricht auf ihrer Mailbox hinterlassen, die sie jedoch nicht abgehört hatte.
Sie lenkte den Wagen auf die Straße. Und spürte erneut Widerwillen, nach rechts, in Richtung Heimat, abzubiegen. Sie entschied sich für links. Und dachte, wie schlecht es um ihre Beziehung wohl stand, wenn sie nicht einmal mehr zum gemeinsamen Heim fahren wollte. Doch sie war Rainers Extratouren und Halbwahrheiten allmählich leid. Wie sehr sie das hasste. Und wie wenig sie bereit war, das in Zukunft hinzunehmen.
Wer auch immer das Mädchen war, das er da angeschleppt hatte – die Kleine war bestimmt keine Tramperin, der er eine Dusche gewährt hatte. Margot spürte, dass dahinter viel mehr steckte. Und dass Rainer ihr wieder etwas verschwiegen hatte.
Es hatte Jahre gedauert, bis sie endlich zueinander gefunden hatten. Mal war sie verheiratet gewesen, mal er, und zwischendurch hatten sie immer wieder eine Affäre zusammen gehabt. Ihr Timing war noch nie besonders gut gewesen. Seit fast fünf Jahren waren sie nun fest zusammen, vor zwei Jahren war Rainer ganz zu ihr gezogen, in das Haus im Richard-Wagner-Weg 56.
Sie hatte gedacht, damit hätte das große Verschweigen und Taktieren ein Ende – wie etwa vor drei Jahren, als er ihr nicht gesagt hatte, dass er einen Tumor hatte. Oder vor eineinhalb Jahren, als er fünfzigtausend Euro verloren hatte, weil das Unternehmen, in das er investiert hatte, pleitegegangen war. Er traf seine Entscheidungen wie ein einsamer Wolf und ließ Margot an den wirklich wichtigen Überlegungen und Ereignissen immer erst dann teilhaben, wenn er Fakten geschaffen hatte. War das die Art von Ehe, die sie führen wollte? Auch für die nächsten zwanzig Jahre?
Sie musste sich korrigieren – sie waren ja gar nicht verheiratet. Auch so ein unausgesprochenes großes, schwarzes Etwas, das zwischen ihnen stand. Er hatte sie nie gefragt, ob sie seine Frau werden wolle. Und hatte jede ihrer Brücken ignoriert, die sie ihm gebaut hatte, damit er sie fragen konnte. Natürlich, sie war emanzipiert genug, um auch ihn fragen zu können. Doch sie hätte ein Nein nicht ertragen. Noch weniger ein Herumdrucksen, das nichts anderes als ein Nein bedeutet hätte.
Und nun stand eine junge Dame in ihrem gemeinsamen Wohnzimmer, die ihm zumindest so vertraut war, dass sie sich nicht schämte, vor Rainer mit einem Handtuch nur recht mäßig verhüllt aufzutreten. Und deren roter Koffer darauf hinwies, dass sie nicht vorhatte zu gehen, wenn sie wieder trocken war. Eine Person, die offenbar genau wusste, wer Margot war, von der Margot aber im Gegensatz dazu keinen blassen Schimmer hatte. Und Margot war sich keineswegs sicher, ob sie überhaupt wissen wollte, wer die Kleine war.
Sie stellte den Wagen vor einem winzigen Einfamilienhäuschen in der Nansenstraße ab. Hier also hatte Susanne Bretz gewohnt.
Ein kleiner Garten lag zwischen Haus und Trottoir. Das Gartentörchen war nicht verschlossen. Rechter Hand befanden sich hübsch angelegte Blumenbeete. Auch wenn die alte Dame etwas senil geworden war, ihre Blumen hatte sie offenbar noch pflegen können. Oder sie hatte einen Gärtner gehabt. Wenn sie sich einen bezahlten Kavalier samt Limousine hatte leisten können, dürften auch für die Gartenpflege noch ein paar Euro drin gewesen sein. Auch wenn das Haus wirkte, als könne es einen frischen Anstrich durchaus vertragen.
Margot hatte den Haustürschlüssel von Polizeiobermeister Süllmeier erhalten. Der Schlüssel hatte sich ebenfalls im Spind im Jugendstilbad befunden, wo Süllmeier auch den Personalausweis und die anderen Sachen der alten Dame entdeckt hatte.
Margot betrat das Haus. Alle Räume lagen im Erdgeschoss, die Tür zum Dachgeschoss war verschlossen. Links führte ein kleiner Flur ins Schlafzimmer. Das Ehebett war nur auf einer Seite in Gebrauch. Umso stärker wirkte der Kontrast zwischen der linken, nicht besonders ordentlichen Seite und der nicht angerührten rechten.
»Witwe«, konstatierte Margot.
Kleider lagen über den Boden und einen Stuhl verstreut. Die Möbel wirkten alt, stammten offenbar noch aus der Zeit, als das Haus gebaut worden war. Im Kontrast dazu stand der riesige Panasonic-Flachbildfernseher, der die Wand neben dem Kleiderschrank ausfüllte. Billig war etwas anderes.
Sie sah auf die Uhr. Horndeich hatte bestimmt schon Feierabend. Es würde bis morgen dauern, bis sie mehr über das Leben der Susanne Bretz erfahren würde.
Ein weiterer Raum war nur noch schemenhaft als Arbeitszimmer zu erkennen. Frau Bretz schien ein kleines Messieproblem gehabt zu haben. In dem Zimmer häuften sich alte Zeitungen, überall standen Kartons und volle Plastikkästen. Ein massiver Schreibtisch, der augenscheinlich um Befreiung von der Last flehte, ächzte unter weiteren angesammelten Dingen, die ein normaler Mensch unter dem Überbegriff »Müll« abgetan und entsorgt hätte. Hat Ähnlichkeit mit deinem Schreibtisch, meldete sich das vorlaute innere Stimmchen in Margot. Wobei sie nur wichtige Akten auf ihrem ablegte, verteidigte sie sich vor sich selbst.
Rechter Hand gelangte man in die Küche, daneben befand sich das Wohnzimmer. In der Küche stand ein nagelneuer Herd mit Ceranfeld, der sich unter den anderen Küchenmöbeln ausmachte wie ein Ferrari auf dem Werksparkplatz von VW. Die Küche war ebenfalls nicht sonderlich ordentlich, doch zumindest roch es nicht nach verdorbenen Lebensmitteln.
Das Wohnzimmer erschien wie ein Lagerraum und war nur am betagten Röhrenfernseher als solches zu erkennen. Ansonsten fanden sich dort Tageszeitungen und Frauenillustrierte der vergangenen zehn oder zwanzig Jahre, fein säuberlich zu Haufen gestapelt. Sie waren überall, auf der Couch, auf den Sesseln, auf dem Boden. Die Verlage vom »Darmstädter Echo«, von »Frau im Spiegel« und dem Werbeblättchen »Südhessenwoche« brauchten kein eigenes Archiv mehr; in diesem Wohnzimmer fand sich jede Ausgabe zumindest der letzten zehn Jahre.
Auf dem Tisch zwischen zwei Stapeln des »Darmstädter Echo« stand eine Vase mit einem verwelkten Blumenstrauß; Margot wollte nicht wirklich wissen, wie alt das Wasser darin war – sofern es noch nicht gänzlich verdunstet war.
Morgen würde sich die Spurensicherung durch das Chaos von Susanne Bretz’ Eigenheim wühlen.
Ihr Blick fiel auf Fotografien auf einem der Regale. Susanne Bretz neben ihrem Mann. Dann ein paar Mal sie allein. Und sogar ein Bild von ihr und ihrem bezahlten Begleiter Markötter.
Margot stutzte. Das Gesicht der Dame kam ihr bekannt vor. Vorhin hatte sie sich die Aufnahmen der Toten im Display von Horndeichs kleiner Digitalkamera nur flüchtig angeschaut; im Hallenbad hatte Margot die Tote nicht mehr zu Gesicht bekommen, denn sie war bereits auf dem Weg zur Gerichtsmedizin nach Frankfurt gewesen. Doch auf den gerahmten Fotos auf dem Regal kam ihr Frau Bretz seltsam vertraut vor.
Die ist schon einmal im Präsidium gewesen, dachte Margot.
Und dann fiel der Groschen.
Margot erinnerte sich wieder genau, wann sie Susanne Bretz schon einmal begegnet war.
Sie verließ die Wohnung. Rainer und das Lolita-Problem würden noch etwas warten müssen. Ihre Fahrt führte sie zum Präsidium.
Die alte Dame, die sie am Morgen aus dem Wasser gezogen hatten, hatte schon einmal vor ihr gesessen, in einem Verhörraum. Margot hatte sie zu einem alten Mordfall befragt. Susanne Bretz’ Schwester Kathrin war vor mehr als vierzig Jahren verschwunden. Die Leiche hatte man jedoch erst vor drei Jahren auf dem Gelände des inzwischen renovierten Jugendstilbads gefunden. Kathrin Bretz war ermordet worden. Doch ihrer Schwester hatte man nach all den Jahren nichts nachweisen können. Der Fall lag zu weit zurück.
Aber nun wirkten die Parallelen doch befremdlich: Die Schwester einer Frau, die ermordet wurde, wird ebenfalls umgebracht. Und dann auch noch am selben Ort. War das Zu-fall?
Margot saß am Schreitisch ihres Büros, wollte gerade aufstehen, um sich auf den Weg ins Archiv zu machen und die Akte zu holen, da klingelte ihr Telefon.
»Hier ist Zupatke. Ich habe einen etwas verstörten Mann in der Leitung. Sein Hund wurde erschossen.«
»Wir sind zuständig für menschliche Leichen.«
»Ja, aber ich glaub trotzdem, es wär gut, wenn Sie mit ihm sprechen.«
»Stellen Sie durch.«
Es klackte in der Leitung, und Margot nannte ihren Namen und ihre Dienststelle.
»Rudolf Sänger, guten Tag. Jemand hat meinen Hund erschossen.«
»Ihren Hund, ja?«
»Ja. Laska, meinen Wachhund. Eine Schrotladung aus unmittelbarer Nähe, von vorn. Ich hab meinen Hund kaum mehr wiedererkannt.«
»Haben Sie eine Ahnung, wer das getan haben könnte?«
»Nein. Schicken Sie jemanden vorbei. Das muss man untersuchen.« Margot hörte, dass der Mann weinte. »Da muss doch jetzt jemand kommen von Ihnen. Ich meine, sie ist tot. Ermordet.«
Nun, strafrechtlich gesehen handelte es sich bei der Tötung eines Tieres um Sachbeschädigung. Nicht gerade ganz oben auf der Prioritätenliste eines Kriminalisten, der gerade einen Mordfall zu bearbeiten hat. Doch Margot war klar, dass sie dem Mann diesen feinen Unterschied nicht würde begreiflich machen können.
»Gut, ich schicke jemanden vorbei.«
Sie ließ sich noch die Anschrift des Bauernhofs von Rudolf Sänger geben, dann rief sie Zoschke an. Er würde kurz nach Spachbrücken fahren und den Tatbestand aufnehmen. Wahrscheinlich hatte ein Nachbar, dem das Gebell auf die Nerven ging, dem Hund eine Ladung verpasst. Margot hatte es in ihrer Polizeilaufbahn mehrfach mit sich fanatisch bekämpfenden Nachbarn zu tun gehabt. Zwei waren sogar einmal mit Messern aufeinander losgegangen. Wegen eines Streits, wer wann von ihnen wo Schnee zu schippen hatte. Einer der beiden hatte den Streit nicht überlebt.
Und einen Hund zu erschießen war ebenfalls nicht die feine Art. Margot war froh, dass sie keinen Hund hatte. Zum einen mochte sie die bellenden, sabbernden Vierbeiner nicht besonders. Zum anderen wusste sie genau, dass sie ihr Herz dennoch an den Köter verlieren würde. Wenn das mit Rainer wirklich auseinanderging, vielleicht würde sie dann …
Margot seufzte. Sie sollte sich besser auf die Arbeit konzentrieren. Und die Akte Bretz aus dem Archiv holen. Ein Blick darauf würde bestimmt nicht schaden.
Da aber hörte sie das Quietschen des Wägelchens von Werner Klewes draußen auf dem Flur. Der Handwagen des Hausboten zeichnete sich dadurch aus, dass eines der vier Räder immer quietschte. Zumindest wurden die Polizisten durch das Geräusch stets vorgewarnt, wenn das redselige Faktotum im Anmarsch war. Als Klewes sein Wägelchen an der offenen Bürotür vorbeigeschoben hatte, wollte Margot schon erleichtert aufatmen, da verstummte das Quietschen abrupt.
Und im nächsten Augenblick stand Klewes doch im Türrahmen von Margots und Horndeichs Büro.
»Na, Sie sinn ja aach noch da, Frau Koleeschin!«, begrüßte er sie. »Noch kaan Feie’abend? Isch bin heud ja aach a bisssche schpäd dran – hawwe Sie den komische Brief scho’ aafgemachd? Isch binn ja nedd neugieriesch, awwer der war scho’ seldsamm …«
»Was für ein Brief?«, fragte Margot.
»Na, der, denn isch Ihne auf Ihne ihr’n Disch geleegt hab.«
Margot ließ den Blick ihrer Argusaugen über das Alpenmassiv aus Akten schweifen, das sich auf ihrem Schreibtisch erhob, entdeckte aber keinen Brief.
»Wenn isch Ihne da grad mal helfe däffd, Fraa Koleeschin«, sagte Kleves und nahm vom äußersten Stapel links etwa die Hälfte herunter und legte diesen kurzerhand auf Horndeichs Schreibtisch ab. Margot erinnerte sich, dass sie, als sie für die Akten von Susanne Bretz Platz geschaffen hatte, genau diesen Stapel erhöht hatte.
»Da isser ja«, freute sich Klewes und hielt den blauen Umschlag, der mit dem Piktogramm einer kleinen Träne verziert war, triumphierend in die Höhe. »Saache Sie mir mo’je, was da drinn schdand? Isch mein, isch binn ja nedd neugierisch, awwer …«
Margot sah auf den Umschlag. Kein Absender, abgestempelte Briefmarke, die Postfachadresse des Polizeipräsidiums mit dem Zusatz: »Hauptkommissarin Hesgart persönlich.« Sie schlitzte die Oberkante des Kuverts mit dem Brieföffner auf, während das Quietschen verriet, dass sich Klewes wieder auf den Weg gemacht hatte.
Sie überflog die Zeilen. Dann griff sie zum Telefon. Susanne Bretz’ Tod bekam gerade zum zweiten Mal an diesem Tag eine gänzlich neue Dimension.
Er war es ihr schuldig. Horndeich hatte sein dummes Versprechen bereits in dem Moment bereut, als er es gegeben hatte. Vor einem halben Jahr, nach dem dritten Glühwein auf dem Darmstädter Weihnachtsmarkt. Damals hatte er vor Sandra getönt, einen Ikea-Wohnzimmerschrank aufzubauen sei ein Kinderspiel. Sandra – der es nicht schwerfiel, jedem Computer binnen Minuten seine bestgehüteten Geheimnisse zu entreißen – hatte gemeint, dass selbst Straßenkartenlesen einfacher sei, als mit den Aufbauanleitungen des schwedischen Möbelhauses zurechtzukommen. »Ich bin sicher«, hatte sie gesagt, »die Anleitungen werden von Mitarbeitern von Edelmöbelhäusern eingeschleust, um Ikea das Geschäft zu verderben.«
Horndeich hatte nur selbstgefällig gegrinst. Ein Grinsen, das sich nach dem dritten Glühwein unwillkürlich bei ihm eingestellt hatte.
»Dann bau du mir doch das nächste Mal so ein Teil auf, wenn du meinst, dass das so einfach ist!«, hatte sie gefaucht.
»Klar«, hatte er geantwortet.
»Versprochen?«
»Ein Mann, ein Wort.« Er hatte sich den Machospruch nicht verkneifen können.
Vor acht Monaten war Sandra umgezogen, in ein kleines, gemütliches Häuschen in der Waldkolonie in Darmstadt. Das Haus hatte blaue Fensterläden, einen kleinen Garten und insgesamt vielleicht neunzig Quadratmeter Wohnfläche. Knuffig, hatte Horndeich gedacht, als er beim Umzug geholfen hatte. Zwar waren die Decken niedrig – und er liebte die hohen Decken seiner Altbauwohnung –, doch das Häuschen hatte was.
Vor drei Wochen hatte Sandra ihn dann gefragt, ob er sich seiner markigen Sprüche noch erinnere, sie habe da jetzt einen neuen Schrank gekauft, der gerade geliefert worden sei. Und nun stand Horndeich da, den Sechskantschlüssel in der einen, den verwirrenden Plan in der anderen Hand. Er hatte den Verdacht, Sandra habe den Wohnzimmerschrank ausschließlich nach einem Kriterium ausgewählt: der blödesten Aufbauanleitung.
Er rätselte immer noch darüber, in welches der sechzehn zur Verfügung stehenden Löcher der Schraubverschluss einzusetzen war. Acht schieden aus, aber die anderen acht erschienen jedes für sich betrachtet eine gute Lösung zu sein.
»Noch ’nen Kaffee?«, flötete Sandra.
Er nahm die Unterbrechung dankbar an. Auf dem Esstisch, dem eine rustikale, bayerisch anmutende Sitzbank zur Seite gestellt war, hatte Sandra ein paar belegte Brote drapiert.
»Aus diesen blöden Filmchen aus dem Bad ist wirklich nicht mehr rauszuholen«, sagte sie nebenbei und völlig unvermittelt. »Die Aufnahmen sind so grobkörnig und dunkel, da können wir froh sein, dass wir wenigstens erkennen konnten, dass es ein Mann ist.«
Horndeich nickte, doch seine Gedanken waren nicht bei der Sache.
Bevor Sandra ihn zur Pause gebeten hatte, hatte er aus den Augenwinkeln registriert, wie sie im Türrahmen gestanden hatte, den Blick auf ihn gerichtet, während er seinen Kampf mit dem Schrank ausgefochten hatte.
Es war ja nicht das erste Mal.
Dennoch war es für ihn irritierend.
Er hätte nicht behaupten können, dass es ihm gleichgültig gewesen wäre. Er hätte nicht behaupten können, dass es ihm unangenehm gewesen wäre. Allerdings auch nicht, dass es ihn wirklich freute.
Seit vielen Jahren arbeiteten sie bereits zusammen bei der Mordkommission in Darmstadt. Eine Zeit, in der sie sich ziemlich gut kennengelernt hatten. Besonders, nachdem Sandra vor zwei Jahren den Autounfall gehabt hatte. Er hatte sie oft besucht, zunächst im Krankenhaus, später auch privat, um ihr unter die Arme zu greifen. Nach komplizierten Brüchen im Knöchel und im Handgelenk hatte sie lange gebraucht, bis sie sich wieder ohne Einschränkungen bewegen konnte. Er hatte sie immer wieder aufgebaut, wenn die nur kleinen Fortschritte, die sie in der Krankengymnastik machte, sie daran hatten zweifeln lassen, ob sie sich jemals wieder würde vollständig bewegen können. Horndeich hatte sich schuldig gefühlt, weil der Unfall mit seinem Wagen passiert war, einem alten Golf II ohne nennenswerte Knautschzone, ohne Airbag und weitere Sicherheitseinrichtungen.
Noch während Sandra im Krankenhaus lag, hatte Anna, seine damalige Freundin, ihm mitgeteilt, dass sie nicht mehr nach Darmstadt zurückkommen werde, sondern in Moskau bleibe.
Natürlich war Sandra da Trost gewesen, um die Mischung aus Schuldgefühlen ihr gegenüber und enttäuschter Liebe zu Anna zu dämpfen. Aber sie waren nur Freunde. Ein Zustand, den er als Teenager auf der Suche nach Kontakt zum anderen Geschlecht gehasst hatte, den er aber in seinem Verhältnis zu Sandra tunlichst nicht aufgeben wollte. Sie waren Arbeitskollegen. Sehr gute Arbeitskollegen. Und Horndeich wollte das durch nichts gefährden.
Nun gut, er war auch nur ein Mann. Und als sie vor einem Jahr Sandras ersten Hundertmeterlauf nach dem schweren Unfall gefeiert hatten, da waren sie sich nähergekommen. Sehr viel näher. Zu nah.
Er hätte es gern auf den Alkohol geschoben, doch er musste sich eingestehen, dass in dieser Nacht ein Gefühl seltsamer Vertrautheit zwischen ihnen bestanden hatte. Als ob dies nicht die erste Nacht gewesen wäre.
Ja, er mochte Sandra. Vielleicht gab es sogar Momente, in denen er ein wenig in sie verliebt war. Aber vernünftig war es nicht. Und letzten Endes musste die Vernunft siegen.
Er biss herzhaft in das nächste Brot.
Während er in seine Gedanken vertieft war, erzählte ihm Sandra etwas, doch das nahm er nur als akustische Kulisse wahr. Erst als sie beim Gestikulieren mit dem Unterarm gegen den Blumenstrauß auf dem Tisch stieß, ihn jedoch noch im letzten Moment vor dem Umkippen bewahren konnte, indem sie mit beiden Händen danach griff, hatte sie wieder seine volle Aufmerksamkeit.
Rote Rosen, erkannte Horndeich, während Sandra sich wortreich entschuldigte, dass sie die Brotplatte mit Blumenwasser geflutet hatte.
Obwohl der Strauß die ganze Zeit vor seiner Nase gestanden hatte, hatte er ihn nicht bewusst wahrgenommen. Anna hatte sich schon immer darüber lustig gemacht, dass er solche Verschönerungen in ihrer Wohnung nie bemerkte. »Männerblick«, hatte sie es genannt.
Er fragte sich, ob sich eine Frau auch selbst rote Rosen kaufte oder ob es für ein Bouquet dieser Art immer eines männlichen Verehrers bedurfte.
Bevor er zu einer zufriedenstellenden Antwort fand, dudelte sein Handy. Margot. Er nahm das Gespräch an.
»Hallo, ich bin noch im Präsidium. Ich glaube, wir haben ein Problem. Ich brauch dich.«
»Was ist los?«
»Kannst du noch vorbeikommen?«
Horndeich war jede Ausrede recht, dem Ikea-Teufelswerk für einen weiteren Moment zu entkommen. Sandras Blick verriet zum einen, dass sie den Inhalt des Telefonats erahnte, zum anderen, dass ihre Meinung hinsichtlich eines Aufschubs der Bastelarbeiten jener von Horndeich diametral entgegenstand.
Während sie auf Horndeich wartete, fotografierte Margot den Brief ab und ebenso den Umschlag. Die Originale gab sie Kollege Otto Fenske, der beides auf Fingerabdrücke untersuchen würde.
Dann wählte Margot die Nummer ihrer Freundin Cora. Denn sie konnte sich nicht mehr lange vor einem Gespräch mit Rainer drücken. Der hatte inzwischen sogar auf ihrem Dienstapparat angerufen, nachdem sie seine Anrufe auf dem Handy geflissentlich ignoriert hatte.
Doch Cora ging nicht ran, und unter der Handynummer meldete sich nur die Mailbox. Schade, denn Cora war Margots beste Freundin und für einen Gedankenaustausch – zumindest einen kurzen – prädestiniert. Sie hatte alle Höhen und Tiefen zwischen Margot und Rainer miterlebt und Margot immer mit guten Ratschlägen versorgt. Und auch wenn Margot es nicht immer hatte wahrhaben wollen, so war Coras Blick auf die Dinge zumeist ein treffender.
Margot schickte ihr eine kurze SMS, bat um ein Treffen am kommenden Tag.
Sie hatte gerade auf »Senden« gedrückt, als Horndeich im Türrahmen zum Büro erschien, gefolgt von Sandra. Margot runzelte kurz die Stirn, war aber mit ihren Gedanken noch viel zu sehr mit Rainer und Cora beschäftigt, um über Horndeichs und Sandras Liebesleben nachzugrübeln.
»Was gibt es denn so Wichtiges?«, fragte Horndeich.
»Wir haben Post bekommen. Schau mal.« Sie deutete auf den Bildschirm ihres Computers. »Fenske ist seit zehn Minuten dabei, den Brief und den Umschlag auf Fingerabdrücke zu untersuchen. Dann darf sich das Labor damit beschäftigen. Ich hab ihn mit der Digi abfotografiert, damit wir schon mal damit arbeiten können.«
Horndeich trat hinter Margot und las die Zeilen. Es waren nicht viele.
Nummer eins Und ich sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Ich will den Menschen von der Fläche des Erdbodens auslöschen. Also ließ ich das Gewässer überhand nehmen, und es wuchs sehr, 15Zentimeter hoch ging das Gewässer. Da ging alles Fleisch unter. Alles, was einen lebendigen Odem hatte auf dem Trockenen, das starb. Wie auch sie.
Die Botschaft war auf einem Computer geschrieben und dann ausgedruckt worden. Sie trug weder Anrede noch Unterschrift.
»Was ist das für krudes Zeug?«, fragte Horndeich.
»Das ist ein Bekennerschreiben, würde ich sagen«, meinte Margot.
»Wie kommst du darauf? Kann das nicht irgendein Spinner an der Pforte abgegeben haben?«
Margot drückte eine Taste, und auf dem Bildschirm erschien der Briefumschlag. »Nein. Dieser Brief wurde vorgestern in Darmstadt abgestempelt. Jemand hat hier quasi den Tod von Susanne Bretz angekündigt.«
»Wie kommst du denn darauf?«, fragte Horndeich verwundert.
»Na, wie viele Leute sind denn heute hier ertränkt worden?«
»Da steht aber nicht: ›Hey, werte Polizei, ich habe die Bretz ertränkt!‹«
»Natürlich nicht.«
»Was ist das überhaupt für eine verquere Sprache? Und wieso soll die Bretz böse gewesen sein?«
»Das kann ich dir nicht sagen.«
Sandra, die Margot zuvor nur flüchtig gegrüßt hatte, hielt den Blick auf den Bildschirm gerichtet. »Schick mir bitte mal die Datei mit dem Brief«, sagte sie zu Margot. »Ich glaub, mir ist was aufgefallen.«
Margot schloss das Dokument, versendete es als Anhang einer E-Mail an Sandras elektronische Postadresse.
»Morgen solltet ihr euch die Wohnung der Bretz noch mal vornehmen«, sagte Margot zwischendurch. »Ein bisschen messiehaft, aber vielleicht findet ihr noch was Brauchbares.«
Horndeich nickte. »Du meinst, etwas über ihren persönlichen Hintergrund, das ein Motiv ergeben könnte.«
»Wenn ich an diesen Brief denke, frage ich mich, ob wir es nicht mit jemandem zu tun haben, der gar kein persönliches Motiv hat.«
»Das ist aber nicht gerade die Regel«, meinte Horndeich. »Ich meine, welches Motiv ist schon unpersönlich und dient nicht der Rache oder dem eigenen finanziellen Gewinn?«
Margot gab ihm keine Antwort.
»He, du meinst doch nicht etwa, wir haben es hier mit einem Hannibal Lecter zu tun, der gerade eine Serie von Morden beginnt?«, rief Horndeich.
»Wenn, dann ist der Täter kein Kannibale, sondern ein religiöser Fanatiker«, sagte Sandra, die eben wieder ins Büro trat.
»Religiös?«
»Ja. Mose. Erstes Buch, sechstes Kapitel. Und siebtes.«
Margot schlug sich mit der Hand gegen die Stirn. »Die Sintflut. Klar.«
Horndeich schaute von Sandra zu Margot und wieder zurück, als ob sie sich in einer anderen Sprache unterhielten. Die Sprache hieß »Bibel«, und die beherrschte er ungefähr so gut wie Hindi, Chinesisch und Esperanto. Mose kannte er natürlich. War ja auch fast so bekannt wie Jesus. Aber bibelfest, das war etwas anderes.
Es hatte noch eine Sprache gegeben, in der sich Sandra und Margot einstmals hatten austauschen können, ohne dass er ein Wort verstanden hatte: Computer. Aber da hatte er aufgeholt.
Damit allerdings war sein Ehrgeiz im Erlernen von Fremdsprachen gedeckt.
Ende der Leseprobe