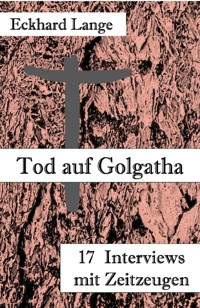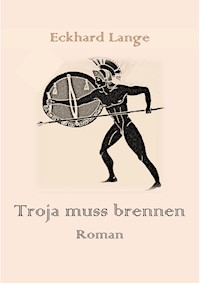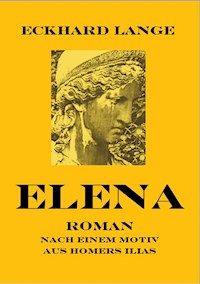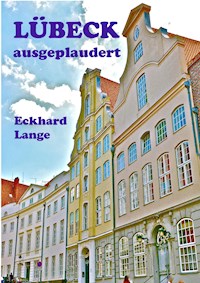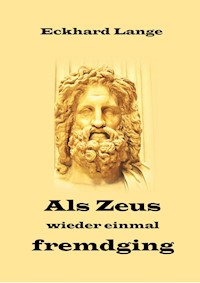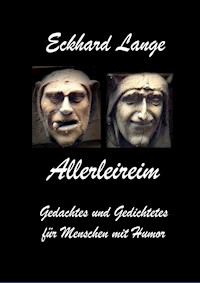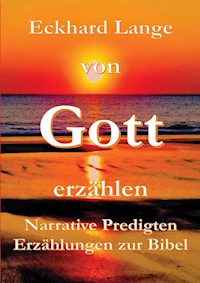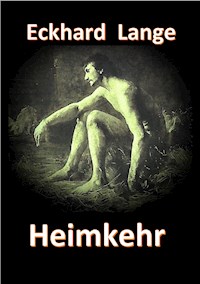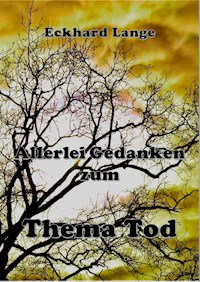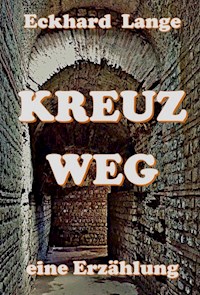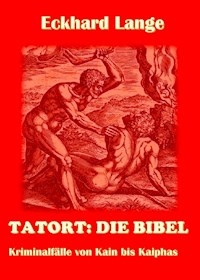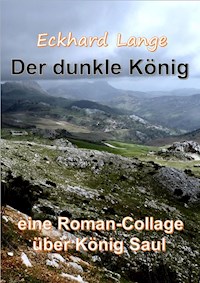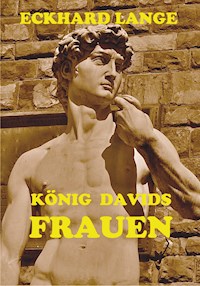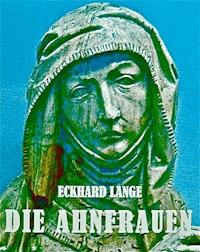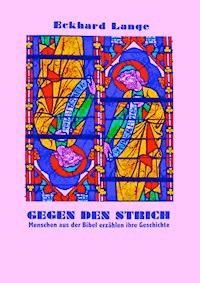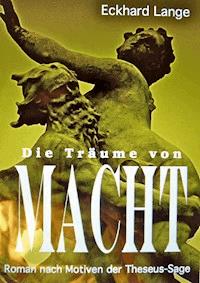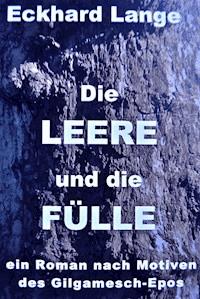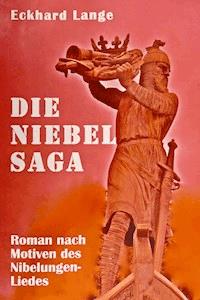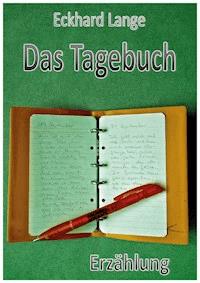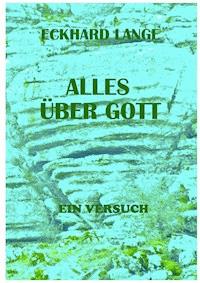
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Religionsgeschichtliche Essays
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Am Anfang steht nicht der Gottesglaube, sondern die Erkenntnis, alles sei beseelt: Pflanze und Tier, und auch der Mensch. Deswegen endet sein Sein nicht im Tod. Doch wie entstand dann die Vorstellung von all den himmlischen Wesen, wie der Glaube an den einen Schöpfer? Und was von alledem bleibt uns noch, den modernen, aufgeklärten, von wissenschaftlichen Erkenntnissen geprägten Menschen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 62
Ähnliche
Eckhard Lange
Alles über Gott
ein Versuch
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
I. WIE ES ANFING - VIELLEICHT
II. WIE DIE GÖTTER ZU DEN MENSCHEN KAMEN
III. WIE GÖTTERWELT UND MENSCHENWELT SICH VERBÜNDETEN
IV. WIE DER EINE GOTT SICH OFFENBARTE
V. WIE AUS EINER OFFENBARUNG DREIMAL GOTT WURDE
VI. WIE KRITISCHES DENKEN GOTT IN FRAGE STELLT
VII. WIE WIR HEUTE VON GOTT REDEN KÖNNEN
VIII. ZUM SCHLUSS
Impressum neobooks
I. WIE ES ANFING - VIELLEICHT
Alles über Gott – tatsächlich alles? Natürlich nicht. Was weiß man denn schon wirklich über ihn, wo man doch nicht einmal so richtig weiß, ob es ihn denn überhaupt gibt. Und wenn ja – wo er lebt, wie er aussieht, wer er ist. Alles unbekannt, alles nur Vermutungen, alles nur Bilder und Geschichten, von Menschen für Menschen.
Und genau dies ist das Besondere an Gott: Was man erkennen kann, ist stets nur ein Bild, eine Vorstellung. Ist – ja, Fantasie! Was man meint, von ihm zu wissen, kann man nur in Geschichten verpacken, in Gleichnissen erzählen, und das heißt: auf dem Umweg über Menschlich-Allzumenschliches wiedergeben. Also auch hier ist Fantasie angesagt und notwendig. Aber das sagt noch nichts darüber aus, wer oder was er nun wirklich ist – und auch dieser Satz ist zweideutig. Man kann ihn so verstehen: Wir können überhaupt nichts über ihn sagen. Doch wir könnten ihn auch anders auslegen: Es lässt sich nur das über Gott sagen, was im Bereich unserer Vorstellung bleibt. Denn das soll dieses merkwürdige Wort „Gott“ ja eigentlich ausdrücken: Etwas, was letztlich jenseits all dessen bleibt, was wir in Worte fassen können. Ein definierbarer Gott wäre ein Widerspruch in sich selbst.
Wir machen uns also auf die Suche nach etwas, was wir – streng genommen - gar nicht finden können. Und doch hat der Mensch, sobald die Evolution ihn aus dem bloß tierischen Dasein entlassen hatte, nach eben diesem Undefinierbaren, diesem unbeschreiblichen und jenseitigen Etwas gefragt, es als Wirklichkeit außerhalb aller Realität vermutet, geglaubt, und manchmal auch existentiell erfahren. Also müssen wir tatsächlich bei Adam und Eva anfangen, oder – entsprechend dem augenblicklichen Stand unserer Forschung – bei Selam und Lucy, beziehungsweise, im nüchternen Sprachgebrauch der Paläoantropologen, bei DIK 1-1 und AL 288-1. Und es ist vielleicht kein Zufall, daß beide Funde weiblich sind, denn nicht Adam, sondern Eva steht am Anfang, ist alleinige mütterliche Gen-Geberin aller nach ihr existierenden menschlichen Lebewesen – bis hin zu jenem in diesem Augenblick irgendwo auf der Welt geborenen Säugling. Adams Rippe war dafür nicht nötig. Das mag männlichen Stolz verstören, ist aber wahr.
Doch war ein Gott dafür nötig? Das werden wir klären müssen, allerdings erst irgendwann später. Jetzt geht es erst einmal darum, ob diese ersten Menschenwesen (falls man sie schon so nennen darf) Gott für ihre Existenz nötig hielten. Jahrtausende lang lässt sich diese Frage nicht beantworten. Bis unsere Vorfahren zwei recht unterschiedliche Dinge entdeckten: die Kunst und die Bestattung. Denn daraus lassen sich erste Schlüsse ziehen.
*****
Beginnen wir mit der Kunst, obwohl sie später kommt. Wir wollen dabei dem Fachwissen aus dem Internet, genannt „Wikipedia“ Glauben schenken. Danach ist menschliche Kunst vor vierzig Jahrtausenden erstmals greifbar – als bildende Kunst. Da hören wir dann von kleinen Figürchen, geschnitzt aus Elfenbein, von Flöten als allerersten Instrumenten, mit denen man musizieren konnte, und vor allem von den Malereien an den Wänden so mancher Höhle. Das erste, was der Steinzeitmensch da geschaffen hatte, ist das Abbild seiner selbst, genauer: ist die Darstellung des prallen weiblichen Körpers. Die Forscher nennen sie gerne „Venus“, doch ob die Figurinen etwas Göttliches darstellen, bleibt im Ungewissen. Jedenfalls aber war es wohl das Staunen über das Wunder des Lebens, das sie damit zum Ausdruck brachten – die Ehrfurcht vor dem Geheimnis der Geburt, die Verehrung der Fruchtbarkeit. Aber wohl noch nicht der Sexualität.
Daneben fanden sich noch andere Figuren – ungewiß, ob männlich oder weiblich, aber dafür eindeutig Mensch und Tier in eins: menschliche Körper mit dem Kopf eines Löwen. Auch hier lässt sich vieles hineinlegen und nichts wirklich beweisen. Waren es Darstellungen eines Zauberers, der sich mit dem Löwenfell in dieses gefürchtete und mächtige Tier verwandeln konnte, waren es schon jenseitige Wesen, so wie viel später in Ägypten und anderswo Götterstatuen mit Tierköpfen aufgestellt wurden? Jedenfalls aber entstanden hier Figuren, die etwas außerhalb der erfahrbaren Wirklichkeit abbildeten – etwas, was furchterregend und geheimnisvoll war, was man beschwören und besänftigen mußte. Wir begegnen, so will mir scheinen, zumindest einer Ahnung von transzendenter Macht – ob nun schon im „Himmel“ angesiedelt oder irgendwo in der Welt um diese Menschen herum.
Aus der gleichen frühen Zeit – und ebenfalls in Höhlen entdeckt – stammen mehrere Flöten, meist aus Vogelknochen. Der Steinzeitmensch machte also auch Musik! Aber welche und wozu? Einfach nur aus Spaß an dieser neuen Art, Töne zu erzeugen? Oder um Beute zu imitieren und damit anzulocken? Oder um sich danach im Tanz zu bewegen? Und wenn – um bloßer Lebenslust Ausdruck zu verleihen, oder doch eher, um sich in Trance zu versetzen, um so dem Jenseitigen zu begegnen oder ihm gar damit zu gefallen? Auch hier können wir nur rätseln. Doch daß der Mensch jener Zeit etwas Zweck-loses tat, l’art pour l’art sozusagen, vermag man sich schwer vorzustellen. Etwas so Geheimnisvolles wie eine Melodie zu erzeugen, das wird auch dem Geheimen, also letztlich dem Göttlichen, gewidmet sein.
Der umfangreichste und aufregendste Teil der Kunst jener frühen Tage des Menschseins jedoch sind zweifelsohne die vielen Malereien an den Wänden von Höhlen – Tiere, Symbole, auch der Vulva, finden sich dort im Dunkel unterirdischer Verliese. Man hat die Tierbilder oft als Abbildungen für eine Art Jagdzauber gedeutet, und das mag gelegentlich auch zutreffen, obwohl es vielfach bestritten wird. Aber es gibt ebenso – in der Grotte von Chauvet etwa – Bilder, die wir Heutigen vielleicht Paradies-Vorstellungen nennen würden: Es sind keine Jagdtiere dargestellt, sondern eher die Feinde des Menschen – Löwen, Bären, Panther, Nashörner oder Hyänen zum Beispiel – und sie scheinen friedlich beieinander zu stehen, einander zugewandt. Ein Bild der Hoffnung? Oder doch eher dazu bestimmt, den Feind durch irgendeinen Zauber versöhnlich zu stimmen? Oder soll die gewaltige Kraft dieser dem Menschen weit überlegenen Wesen durch das Bild übergehen auf den Betrachter?
Denn im Grunde war dieser aufrecht gehende Zweibeiner mit seiner nackten Haut das armseligste unter allen Säugetieren: Die einen waren größer und stärker, um unangreifbar zu wirken, die anderen konnten schneller sprinten und weiter springen, um ihr Opfer zu jagen; die einen hatten ein furchterregendes Gebiß, um ihre Beute zu reißen, die anderen krallenbewehrte Tatzen als Waffen; die einen konnten ausdauernder laufen, um dem Feind zu entkommen, die anderen hatten wenigstens einen mit Hörnern bewehrten Dickschädel, um einem Angreifer Paroli zu bieten. Der Mensch dagegen mußte das alles ersetzen durch das, was sein Verstand ihm eingab. Denn er war schon damals kein dumpfer Primitiver, unfähig zu komplexen Denken. Seine Synapsen wären durchaus in der Lage gewesen, die komplizierten Schaltkreise selbst einer künstlichen Intelligenz zu entwickeln. Was ihm fehlte – noch fehlte, war allein die Erfahrung, war das in Tausenden von Generationen angesammelte Wissen, um seine Welt besser zu verstehen und gründlicher zu nutzen.