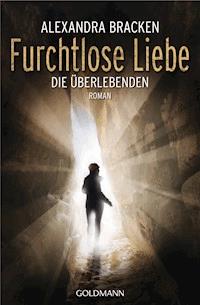9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Große Hollywoodverfilmung am 16.8.2018 in den deutschen Kinos
Ruby hat überlebt. Sie hat das schreckliche Virus überstanden, das die meisten Kinder und Jugendlichen in Amerika getötet hat. Doch der Preis dafür ist hoch. Sie hat alles verloren: Freunde, Familie, ihr ganzes Leben. Weil sie nun eine Fähigkeit besitzt, die sie zur Bedrohung werden lässt, zu einer Gefahr für die Menschheit. Denn sie kann die Gedanken anderer beeinflussen. Deshalb wurde sie in ein Lager gebracht mit vielen anderen Überlebenden. Deshalb soll sie getötet werden. Aber Ruby will nicht sterben. Ihr gelingt die Flucht, und sie beschließt zu kämpfen, schließlich hat sie nichts zu verlieren. Bis sie Liam trifft ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 743
Ähnliche
Buch
Ruby ist eine Überlebende. Sie hat das schreckliche Virus überstanden, das die meisten Kinder in Amerika getötet hat. Es hat sie verändert und ihr eine gefährliche Fähigkeit beschert: Sie kann die Gedanken von anderen Menschen manipulieren. Deshalb wird sie als hochgefährlich eingestuft und in ein brutales Rehabilitationslager gebracht, aus dem sie wahrscheinlich nie wieder entlassen wird. Doch dann gelingt ihr die Flucht. Schnell ist ihr klar, dass sie zu dem Ort will, von dem alle Überlebenden immer wieder sprechen. In East River ist man in Sicherheit, dort muss man sich nicht vor der Regierung und der Polizei fürchten. Auf dem Weg dorthin trifft sie auf andere Überlebende und auf Liam. Sie weiß, dass sie sich eigentlich auf niemanden einlassen darf, solange sie ihre Fähigkeit nicht unter Kontrolle hat. Doch gegen ihre Gefühle kann sie nicht ankämpfen, obwohl diese sie vor die schwierigste Entscheidung ihres Lebens stellen …
Weitere Informationen zu Alexandra Brackensowie zu lieferbaren Titeln der Autorinfinden Sie am Ende des Buches.
Alexandra Bracken
DieÜberlebenden
Roman
Band 1
Aus dem amerikanischen Englischvon Marie-Luise Bezzenberger
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. Die Originalausgabe erschien 2012 unter dem Titel »The Darkest Minds« bei Hyperion, an imprint of Disney Book Group, New York.
Copyright © der Originalausgabe 2012 by Alexandra Bracken Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2014 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München. Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München Umschlagmotiv: David Butali/Getty Images; Nikki Smith/ Arcangel Images Redaktion: Kerstin von Dobschütz NG · Herstellung: Str. Satz: DTP Service Apel, Hannover ISBN: 978-3-641-12321-5V004 www.goldmann-verlag.de
Für Stephanie und Daniel,die in jedem Minivan dabei waren
Prolog
Als das Weißrauschen losging, waren wir gerade im Garten beim Unkrautjäten.
Ich reagierte immer schlimm darauf. Egal, ob ich draußen war, in der Kantine beim Essen saß oder in meiner Baracke eingeschlossen war. Jedes Mal, wenn es ertönte, explodierte dieses kreischende Jaulen in meinen Ohren, in meinem Kopf. Andere Mädchen in Thurmond kamen nach ein paar Minuten wieder auf die Beine und schüttelten die Übelkeit und die Orientierungslosigkeit ab wie die Grashalme, die an ihrer Uniform klebten. Aber ich? Es dauerte Stunden, bis ich mich wieder im Griff hatte.
Diesmal hätte es eigentlich nicht anders sein sollen.
War es aber.
Ich bekam nicht mit, was die Strafaktion provoziert hatte. Wir arbeiteten so dicht am Elektrozaun des Lagers, dass ich die versengte Luft riechen konnte und die Spannung, die er erzeugte, in den Zähnen vibrieren fühlte. Vielleicht war ja jemand mutig geworden und hatte beschlossen, die Grenzen des Gartens zu überschreiten. Oder vielleicht hatte auch jemand mit großen Träumen all unsere Fantasievorstellungen wahr gemacht und dem nächsten Soldaten der Psi Special Forces einen Stein an den Kopf geworfen. Das wäre das Ganze wert gewesen.
Das Einzige, was ich sicher wusste, war, dass die Lautsprecher über uns zwei Warntöne ausspuckten: einmal kurz, einmal lang. Die Haut in meinem Nacken zog sich zusammen, als ich mich vornüber in die feuchte Erde krümmte, die Hände fest auf die Ohren gepresst und die Schultern verkrampft, um dem Ansturm zu trotzen.
Das Geräusch, das aus den Lautsprechern kam, war eigentlich gar kein Weißrauschen. Es war nicht dieses komische Sirren, das die Luft manchmal macht, wenn man ganz allein in völliger Stille dasitzt, oder das schwache Summen eines Computerbildschirms. Für die Regierung der Vereinigten Staaten und ihr Ministerium für Paranormale Jugendliche war es eine Kreuzung zwischen einem Autoalarm und einem Zahnarztbohrer, so laut, dass einem die Ohren bluteten.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Der Lärm brach aus den Lautsprechern hervor und zerfetzte jeden einzelnen Nerv in meinem ganzen Körper. Er überbrüllte die Schreie von hundert halbwüchsigen Freaks und nistete sich im Zentrum meines Gehirns ein, wo ich nicht hingreifen und ihn herausreißen konnte.
Tränen fluteten meine Augen. Ich versuchte, das Gesicht in den Boden zu rammen; alles, was ich schmecken konnte, waren Blut und Erde. Neben mir kippte ein Mädchen vornüber, den Mund zu einem Schrei aufgerissen, den ich nicht hören konnte. Alles andere verschwamm mir vor den Augen.
Und Stille.
1. Kapitel
Grace Somerfield starb als Erste.
Zumindest als Erste in meiner vierten Klasse. Bestimmt waren damals schon Tausende, vielleicht sogar Hunderttausende Kids genauso umgekommen wie sie. Die Menschen erkannten die Zusammenhänge nur langsam – oder sie hatten ausgeknobelt, wie sie uns am besten im Dunkeln lassen konnten, lange nachdem das Kindersterben begonnen hatte.
Als die Todesfälle endlich ans Licht kamen, verbot meine Grundschule dem Lehrpersonal strikt, mit uns über das zu reden, was damals als Everhart’sche Krankheit bezeichnet wurde. Nach Michael Everhart, dem ersten Jugendlichen, von dem bekannt war, dass er daran gestorben war. Bald beschloss irgendwo irgendjemand, dem Phänomen einen angemessenen Namen zu geben: Idiopathische Adoleszente Akute Neurodegeneration – abgekürzt IAAN. Und dann war es nicht mehr nur Michaels Krankheit. Es war unser aller Leiden.
Sämtliche Erwachsene, die ich kannte, verbargen das Wissen hinter verlogenem Lächeln und liebevollen Umarmungen. Ich saß damals noch in meiner eigenen Welt aus Sonnenschein, Ponys und meiner Rennautosammlung fest. Wenn ich jetzt zurückblicke, kann ich gar nicht fassen, wie naiv ich war, wie viele Hinweise ich übersehen habe. Sogar ganz große, zum Beispiel, als mein Dad, der Polizist war, anfing, abends lange zu arbeiten, und es kaum über sich brachte, mich anzusehen, wenn er endlich doch nach Hause kam. Meine Mom fing an, mich mit Vitaminen vollzustopfen, und war nicht bereit, mich allein zu lassen, nicht mal ein paar Minuten.
Andererseits waren meine Eltern beide Einzelkinder. Ich hatte keine toten Cousins oder Cousinen, die Alarm ausgelöst hätten, und die Weigerung meiner Mom, für meinen Dad einen »seelenabtötenden Billigunterhaltungs- und Schwachsinnverbreiter« anzuschaffen – jenes Gerät, das gemeinhin als Fernseher bekannt ist –, bedeutete, dass keine unheimlichen Neuigkeiten meine Welt ins Wanken brachten. Zusammen mit der CIA-mäßigen elterlichen Kontrolle unseres Internetzugangs sorgte dies dafür, dass ich mich sehr viel mehr mit der Reihenfolge beschäftigte, in der meine Stofftiere auf meinem Bett saßen, als mit der Möglichkeit, vor meinem zehnten Geburtstag zu sterben.
Außerdem war ich überhaupt nicht auf das vorbereitet, was am 15. September geschah.
In der Nacht hatte es geregnet, also schickten meine Eltern mich in roten Gummistiefeln zur Schule. Im Unterricht sprachen wir über Dinosaurier und übten Schreibschrift, ehe Mrs Port uns mit ihrer üblichen erleichterten Miene in die Mittagspause schickte.
Ich erinnere mich noch ganz genau an jede Einzelheit des Mittagessens an jenem Tag. Nicht weil Grace mir gegenüber am Tisch saß, sondern weil sie die Erste war und weil es nicht hätte passieren dürfen. Sie war doch nicht alt, so wie Grandpa alt gewesen war. Sie hatte keinen Krebs wie Moms Freundin Sara. Keine Allergien, keinen Husten, kein Schädel-Hirn-Trauma – nichts. Als sie starb, geschah es vollkommen aus heiterem Himmel, und keiner von uns begriff, was los war, bis es zu spät war.
Grace war gerade tief in eine Debatte darüber verstrickt, ob in ihrem Wackelpudding eine Fliege steckte. Die rote Masse wabbelte, als sie damit herumfuchtelte, und quoll ein wenig über den Rand des Plastikbechers, wenn sie diesen zu fest drückte. Natürlich wollte jeder seine Meinung dazu sagen, ob das da drin jetzt eine Fliege oder ein Stückchen Bonbon sei, das Grace da reingedrückt hatte. Ich auch.
»Ich lüge nicht«, gab Grace gerade von sich. »Ich hab nur …«
Sie verstummte. Der Plastikbecher glitt ihr aus den Fingern und landete auf dem Tisch. Ihr Mund stand offen, ihre Augen blickten auf irgendetwas direkt hinter meinem Kopf. Ihre Stirn war gefurcht, als würde sie jemandem zuhören, der etwas sehr Schwieriges erklärte.
»Grace?« Ich weiß noch, dass ich das sagte. »Alles okay?«
Ihre Augen rollten nach hinten, Weiß blitzte in jener einen Sekunde auf, die ihre Lider brauchten, um herabzusinken. Grace gab einen kleinen Seufzer von sich, nicht mal kräftig genug, um die braunen Haarsträhnen wegzupusten, die an ihren Lippen klebten.
Alle, die in ihrer Nähe saßen, erstarrten, obwohl wir bestimmt alle genau dasselbe gedacht haben: Sie ist ohnmächtig geworden. Eine oder zwei Wochen zuvor war Josh Preston auf dem Schulhof ohnmächtig geworden, weil er, wie Mrs Port uns erklärt hatte, nicht genug Zucker im Körper gehabt hatte – irgend so etwas Dämliches.
Eine Pausenaufsicht kam an den Tisch geeilt, eine von den vier alten Damen mit Schirmmützen und Trillerpfeifen, die während der Woche abwechselnd Aufsicht in der Cafeteria und auf dem Schulhof hatten. Ich habe keine Ahnung, ob sie irgendwelche medizinischen Kenntnisse besaß, die über eine vage Vorstellung von Herzdruckmassage hinausgingen, doch sie zog den zusammengesunkenen Körper von Grace trotzdem auf den Boden hinunter.
Ein gespanntes Publikum war ihr sicher, als sie das Ohr auf das pinkfarbene T-Shirt drückte und nach nicht vorhandenen Herzschlägen lauschte. Ich weiß nicht, was die alte Dame dachte, aber sie kreischte auf, und plötzlich waren wir von weißen Mützenschirmen und neugierigen Gesichtern umringt. Keiner von uns begriff, dass Grace tot war, bis Ben Cho ihre schlaffe Hand mit seinem Turnschuh anstupste.
Die anderen Kinder fingen an zu schreien. Ein Mädchen, Tess, weinte so sehr, dass sie keine Luft mehr bekam. Kleine Füße stürmten in Panik auf die Cafeteriatür zu.
Ich saß einfach nur da, umgeben von zurückgelassenem Essen, stierte den Becher mit dem Wackelpudding an, und blankes Entsetzen packte mich, ließ mich erstarren. Wäre der Mann vom Schulsicherheitsdienst nicht gekommen und hätte mich nach draußen getragen, ich weiß nicht, wie lange ich dort gehockt hätte.
Grace ist tot, dachte ich. Grace ist tot? Grace ist tot.
Und es wurde noch schlimmer.
Einen Monat später, nach den ersten großen Sterbewellen, gaben die Gesundheitsämter eine Fünf-Punkte-Liste mit Symptomen heraus, die Eltern helfen sollte, zu erkennen, ob bei ihrem Kind ein IAAN-Risiko bestand. Inzwischen war die Hälfte meiner Klassenkameraden tot.
Meine Mom verbarg die Liste so gut, dass ich sie nur durch Zufall fand, als ich auf den Küchentresen kletterte, um nach der Schokolade zu suchen, die sie immer hinter ihren Backzutaten versteckte.
»Wie Sie feststellen können, ob Ihr Kind gefährdet ist«, stand auf dem Flyer. Ich erkannte das leuchtend orangerote Blatt Papier wieder: Das hatte Mrs Port gestern ihren wenigen verbliebenen Schülern mit nach Hause gegeben. Sie hatte es zweimal gefaltet und mit drei Heftklammern zugetackert, damit wir es nicht lasen. »Nur für Eltern«, stand dreimal unterstrichen außen darauf. Dreimal unterstrichen, das war ernst. Meine Eltern hätten mir Hausarrest verpasst, wenn ich die Nachricht geöffnet hätte.
Zu meinem Glück war sie bereits offen.
1. Ihr Kind wird plötzlich missmutig und zieht sich zurück und/oder verliert das Interesse an Aktivitäten, die ihm früher Spaß gemacht haben.
2. Er/sie fängt an, ungewöhnliche Konzentrationsschwierigkeiten an den Tag zu legen, oder fokussiert sich plötzlich übermäßig auf eine Aufgabe, was dazu führt, dass er/sie jegliches Zeitgefühl verliert oder sich selbst und andere vernachlässigt.
3. Er/sie leidet unter Halluzinationen, Erbrechen, chronischer Migräne, Gedächtnisverlust und/oder Ohnmachtsanfällen.
4. Er/sie neigt plötzlich zu Gefühlsausbrüchen und ungewöhnlich leichtsinnigem oder selbstverletzendem Verhalten (Verbrennungen, Prellungen oder Schnittverletzungen, die nicht erklärt werden können).
5. Er/sie entwickelt Verhaltensweisen oder Fähigkeiten, die nicht erklärbar oder gefährlich sind oder Ihnen oder anderen körperlichen Schaden zufügen.Wenn Ihr Kind eines oder mehrere der o. a. Symptome zeigt, registrieren Sie ihn/sie auf IAAN.gov, und warten Sie, bis man Ihnen mitteilt, in welches Krankenhaus er/sie gebracht werden sollte.
Als ich den Flyer zu Ende gelesen hatte, faltete ich ihn sorgfältig wieder zusammen, legte ihn genau dorthin, wo ich ihn gefunden hatte, und übergab mich ins Spülbecken.
Grams rief einige Tage später an und erklärte mir das Ganze auf ihre übliche Art, nämlich alles genau auf den Punkt zu bringen. Überall starben Kinder, alle ungefähr in meinem Alter. Aber die Ärzte arbeiteten an dem Problem, und ich solle ja keine Angst haben, schließlich sei ich ihre Enkelin, und mir würde nichts passieren. Ich solle brav sein und meinen Eltern Bescheid sagen, wenn ich mich irgendwie komisch fühlte, verstanden?
Es war schlimm, und es wurde sehr schnell ganz furchtbar. Eine Woche, nachdem drei der vier Kinder in meiner unmittelbaren Nachbarschaft begraben worden waren, hielt der Präsident eine förmliche Rede an die Nation. Mom und Dad sahen sich den Livestream am Computer an, ich lauschte draußen vor der Bürotür.
»Meine lieben amerikanischen Mitbürgerinnen und Mitbürger«, fing Präsident Gray an, »wir sehen uns heute einer verheerenden Krise gegenüber, einer Krise, die nicht nur das Leben unserer Kinder bedroht, sondern die Zukunft unserer großen Nation. Möge es Ihnen ein Trost sein zu wissen, dass wir in Washington in diesen Notzeiten Programme entwickeln, um sowohl den Familien zu helfen, die von diesem grauenvollen Leiden betroffen sind, als auch den Kindern, die das Glück hatten, es zu überleben.«
Ich wünschte, ich hätte sein Gesicht sehen können, als er das sagte, denn ich glaube, er wusste – er muss gewusst haben –, dass diese Bedrohung, die Zäsur in unserer angeblich großartigen Zukunft, nichts mit den Kindern zu tun hatte, die gestorben waren. Unter der Erde verscharrt oder zu Asche verbrannt konnten sie doch gar nichts tun, außer die Erinnerungen jener heimzusuchen, die sie geliebt hatten. Sie waren fort. Für immer.
Und diese Symptomliste, jene, die von den Lehrern zusammengefaltet und -getackert nach Hause mitgegeben wurde und die hundertfach in den Nachrichten abgehandelt wurde, während die Gesichter der Toten unten am Bildschirmrand entlangscrollten? Sie hatten gar keine Angst vor den Kindern, die vielleicht sterben könnten, oder vor den Leerstellen, die sie hinterlassen würden.
Sie hatten Angst vor uns – vor denen, die am Leben blieben.
2. Kapitel
An dem Tag, an dem sie uns nach Thurmond brachten, regnete es, und es regnete die ganze Woche weiter und auch die Woche danach. Eiskalter Regen, die Sorte Regen, die Schnee gewesen wäre, wenn fünf Grad weniger geherrscht hätten. Ich weiß noch, dass ich zusah, wie die Tropfen wilde Spuren am Schulbusfenster entlangzogen. Wäre ich zu Hause gewesen, in einem der Autos meiner Eltern, hätte ich ihren Zickzackweg über das Glas mit den Fingerspitzen nachgezeichnet. Jetzt waren meine Hände hinter meinem Rücken gefesselt, und die Männer in den schwarzen Uniformen hatten vier von uns auf jeden Doppelsitz gepackt. Es war kaum Platz zum Atmen.
Die Wärme von über hundert Leibern ließ die Busfenster beschlagen, und das diente als Schutzschirm gegen die Außenwelt. Später würden die Fenster der leuchtend gelben Busse, mit denen sie die Kids herbeikarrten, schwarz übermalt sein. Sie hatten nur noch nicht genug Farbe.
Ich saß auf der fünfstündigen Fahrt ganz außen am Fenster, daher konnte ich kleine Bruchstücke der vorbeiziehenden Landschaft sehen, wenn der Regen mal ein bisschen nachließ. Für mich sah da draußen alles gleich aus – grüne Felder, dichte Baumbestände. Nach allem, was ich wusste, hätten wir immer noch in Virginia sein können. Das Mädchen, das neben mir saß und das später als Blaue eingestuft werden würde, schien irgendwann einmal ein Schild wiederzuerkennen, denn es beugte sich über mich, um besser sehen zu können. Sie kam mir ein bisschen bekannt vor, als hätte ich ihr Gesicht schon öfter in unserer Stadt gesehen. Ich glaube, alle Kinder um mich herum waren aus Virginia, doch es gab keine Möglichkeit, das genau festzustellen, denn es gab nur eine einzige Regel, und die lautete: Schweigen.
Nachdem sie mich am Vortag zu Hause abgeholt hatten, hatten sie mich zusammen mit den anderen über Nacht in einer Art Lagerhaus untergebracht. Der Raum war von unnatürlicher Helligkeit erfüllt; sie ließen uns auf den schmutzigen Zementboden setzen und richteten drei Scheinwerfer auf uns. Schlafen durften wir nicht. Meine Augen tränten von dem Staub so sehr, dass ich die schweißfeuchten, bleichen Gesichter um mich herum nicht erkennen konnte, geschweige denn die der Soldaten, die gleich außerhalb des Lichtrings standen und uns beobachteten. Auf merkwürdige Art waren sie plötzlich keine vollständigen Männer und Frauen mehr; im grauen Nebel des Halbschlafs verarbeitete ich sie zu kleinen, furchterregenden Teilen: der Benzingestank von Schuhcreme, das Knirschen von starrem Leder, die angewidert verzogenen Lippen. Die Spitze eines Stiefels, der sich in meine Seite bohrte und mich wieder ins Wachsein zurückzwang.
Auf der Fahrt am nächsten Morgen herrschte vollkommene Stille, bis auf die Funkgeräte der Soldaten und das Schluchzen der Kinder, die ganz hinten im Bus weinten. Der Junge, der am anderen Ende unserer Sitzreihe saß, machte sich in die Hose, doch das würde er der rothaarigen PSF-Soldatin, die neben ihm stand, ganz bestimmt nicht sagen. Sie hatte ihm eine Ohrfeige verpasst, als er sich beklagt hatte, dass er den ganzen Tag noch nichts gegessen hätte.
Ich bog meine nackten Füße gegen den Boden und versuchte, die Beine still zu halten. Es war schwer, sich zu konzentrieren, und noch schwerer, still zu sitzen. Mir war, als würde ich schrumpfen, in den Sitz sinken und ganz und gar verschwinden. Meine Hände wurden allmählich gefühllos, weil sie so lange in derselben Stellung gefesselt waren. Der Versuch, das Plastikband zu dehnen, das sie um meine Handgelenke straff gezogen hatten, brachte nichts, außer dass es sich noch tiefer in die weiche Haut dort grub.
Psi Special Forces – so hatte der Fahrer des Busses sich und die anderen bezeichnet, als sie uns aus dem Lagerhaus geholt hatten. Ihr kommt mit, auf Befehl des Kommandanten der Psi Special Forces, Joseph Taylor. Zum Beweis hatte er ein Stück Papier hochgehalten, also stimmte das wohl. Man hatte mir ohnehin beigebracht, Erwachsenen nicht zu widersprechen.
Der Bus fuhr durch eine tiefe Senke, als er von der schmalen Asphaltstraße auf einen noch schmaleren Feldweg abbog. Das unverhoffte Rütteln schreckte alle auf, die mit genug Glück oder Erschöpfung gesegnet gewesen waren, um einzuschlafen. Außerdem weckte es die schwarzen Uniformen zum Leben. Die Männer und Frauen richteten sich auf und sahen nach vorn auf die Windschutzscheibe.
Als Erstes entdeckte ich den hoch aufragenden Zaun. Der immer dunkler werdende Himmel ließ alles in einem melancholischen tiefblauen Licht schimmern, nicht jedoch den Zaun. Er glühte silbern, während der Wind durch die Maschen pfiff. Gleich unter meinem Fenster gaben Dutzende von Männern und Frauen in voller Uniform dem Bus in forschem Laufschritt das Geleit. Der PSF in dem Wachhäuschen am Tor stand auf und salutierte vor dem Fahrer, als dieser an ihm vorbeifuhr.
Schwankend kam der Bus zum Stehen, und wir wurden gezwungen, totenstill zu verharren, während das Lagertor hinter uns zurollte. Die Schlösser krachten in der Stille wie Donnerschläge, als sie einrasteten. Wir waren nicht der erste Bus, der hier durchkam – der war vor einem Jahr gekommen. Wir würden auch nicht der letzte sein. Der würde in drei Jahren hier einfahren, wenn die Lagerbelegung ihren Höchststand erreichte.
Einen einzigen Atemzug lang war es still, bevor ein Soldat im schwarzen Regenponcho an die Bustür klopfte. Der Fahrer streckte die Hand aus, betätigte den Hebel – und machte jeglichen Hoffnungen ein Ende, dass das hier nur ein kurzer Zwischenstopp wäre.
Der Soldat war ein gewaltiger Mann, so ein Typ, von dem man erwartet, dass er im Film einen bösen Riesen spielt oder in einem Cartoon einen Schurken. Der PSF behielt seine Kapuze auf und verbarg so sein Gesicht, sein Haar und alles, woran ich ihn später hätte wiedererkennen können. Das spielte wohl keine Rolle. Er sprach nicht für sich selbst. Er sprach für das Lager.
»Ihr steht jetzt auf und verlasst ruhig und ordentlich den Bus«, brüllte er. Der Fahrer wollte ihm das Mikrofon geben, doch der Soldat schlug es mit der Hand weg. »Ihr werdet in Zehnergruppen eingeteilt und zum Testen gebracht. Versucht nicht wegzulaufen. Es wird nicht geredet. Ihr tut überhaupt nichts anderes als das, was von euch verlangt wird. Verstöße gegen diese Anweisungen werden bestraft.«
Mit zehn gehörte ich zu den Jüngeren im Bus, allerdings waren ein paar bestimmt noch jünger. Die meisten schienen zwölf zu sein oder sogar dreizehn. Der Hass und das Misstrauen in den Augen des Soldaten mochten mir das Rückgrat gebrochen haben, die älteren Kinder jedoch stachelte das lediglich zum Widerstand auf.
»Fick dich doch ins Knie!«, brüllte jemand von hinten.
Wir alle drehten uns sofort um, gerade noch rechtzeitig, um zu sehen, wie die PSF mit dem flammend roten Haar dem halbwüchsigen Jungen den Kolben ihres Gewehres gegen den Mund rammte. Er schrie vor Schmerz und Verblüffung auf, als die Soldatin noch einmal zuschlug, und ich sah einen dünnen Blutschleier aus seinem Mund hervorquellen, als er das nächste Mal wütend ausatmete. Mit auf den Rücken gefesselten Händen hatte er keine Möglichkeit, sich zu wehren. Er musste es einfach hinnehmen.
Sie fingen an, die Kinder aus dem Bus zu schaffen, immer eine Viererreihe nach der anderen. Doch ich beobachtete nach wie vor diesen Jungen, die Art und Weise, wie er die Luft um sich herum mit stummer, toxischer Wut zu trüben schien. Ich weiß nicht, ob er mein Starren gefühlt hatte oder was sonst, doch er drehte sich um, und unsere Blicke begegneten sich. Er nickte mir zu, als wolle er mir Mut machen, und als er lächelte, tat er es mit blutigen Zähnen. Ich spürte, wie ich in die Höhe und von meinem Platz gezerrt wurde, und ehe ich wusste, wie mir geschah, rutschte ich die nassen Stufen am Buseingang hinunter und purzelte in den strömenden Regen hinaus. Ein anderer PSF zog mich von den Knien hoch und führte mich auf zwei andere Mädchen zu, die ungefähr in meinem Alter waren. Ihre Kleider klebten an ihnen wie alte Haut, durchsichtig und schlaff.
Fast zwanzig PSFs schwärmten um die ordentlichen Kinderreihen herum. Meine Füße waren vom Matsch vollständig verschluckt worden, und ich zitterte in meinem Pyjama, aber niemand bemerkte es, und niemand kam, um die Plastikbänder durchzuschneiden, mit denen unsere Hände gefesselt waren. Wir warteten stumm, die Zunge zwischen die Zähne geklemmt. Ich schaute zu den Wolken empor, wandte dem peitschenden Regen das Gesicht zu. Es sah aus, als würde der Himmel einstürzen, Stück für Stück.
Die letzte Vierergruppe wurde aus dem Bus gehoben und fiel zu Boden, darunter auch der Junge mit dem kaputten Gesicht. Er kam als Letzter, gleich hinter einem hochgewachsenen blonden Mädchen mit ausdruckslosem Gesicht. Ich konnte sie durch den Regen kaum erkennen, doch ich bin mir sicher, dass er sich vorbeugte und dem Mädchen etwas ins Ohr flüsterte, als sie gerade den ersten Schritt aus der Bustür machte. Sie nickte, ein kurzes Rucken mit dem Kinn. Sobald ihre Schuhe den Matsch berührten, schoss sie nach rechts los, duckte sich vor den Händen des am nächsten stehenden PSF weg. Einer der Soldaten bellte ein furchterregendes »Halt!«, doch sie rannte weiter, direkt auf das Tor zu. Da sämtliche Blicke auf sie gerichtet waren, kam niemand auf die Idee, auf den Jungen zu achten, der noch im Bus war – niemand außer mir. Er kam die Stufen heruntergeschlichen, das weiße Kapuzensweatshirt vorn mit seinem eigenen Blut befleckt. Dieselbe PSF, die ihn vorhin geschlagen hatte, half ihm jetzt auf den Boden hinunter, so wie sie es auch mit uns anderen gemacht hatte. Ich sah, wie sich ihre Finger um seinen Ellenbogen schlossen, und fühlte das Echo ihres Griffs auf meiner eigenen Haut. Ich sah, wie er sich herumdrehte und etwas zu ihr sagte; sein Gesicht war eine Maske völliger Gelassenheit.
Ich sah, wie die PSF seinen Arm losließ, ihre Pistole aus dem Holster zog und sich ohne ein Wort – ohne auch nur zu blinzeln – den Lauf in den Mund schob und abdrückte.
Ich weiß nicht, ob ich laut aufschrie oder ob der erstickte Laut von der Frau kam, die zu spät merkte, was sie da tat, zwei Sekunden zu spät, um es zu verhindern. Das Abbild ihres Gesichts – ihr kraftlos herabhängender Kiefer, die vorquellenden Augen, das Wabbeln plötzlich erschlaffter Haut – blieb wie ein Fotonegativ in der Luft hängen, viel länger als die Eruption aus rosafarbenem Blut gegen die Seite des Busses.
Das Mädchen neben mir kippte um, und dann gab es keinen Einzigen unter uns, der nicht aus vollem Hals schrie.
Die PSF schlug im selben Moment auf dem Boden auf, als das blonde Mädchen in den Matsch niedergerissen wurde. Der Regen wusch das Blut der Soldatin von den Busfenstern und dem gelben Lack, dehnte die zerlaufenen dunklen Streifen in die Länge, bis sie vollständig verschwanden. So schnell ging das.
Der Junge sah nur uns an. »Lauft!«, brüllte er zwischen seinen abgebrochenen Zähnen hindurch. »Was macht ihr denn? Haut ab – haut doch ab!«
Und das Erste, das mir durch den Kopf schoss, war nicht etwa: Was bist du? Oder auch nur: Warum?
Es war: Aber ich kann doch sonst nirgendwohin.
Genauso gut hätte er den ganzen Bus in die Luft jagen können, so eine Panik löste er aus. Ein paar Kids hörten auf ihn, sie versuchten, zum Zaun zu türmen, und fanden den Weg von einer Reihe Soldaten in Schwarz verstellt, die anscheinend aus dem Nichts auftauchten. Die meisten standen einfach nur da und schrien und schrien und schrien; der Regen fiel unablässig, der Schlamm saugte ihre Füße unerbittlich an Ort und Stelle fest. Ein Mädchen stieß mich mit der Schulter zu Boden, als sich die anderen PSFs auf den Jungen stürzten, der noch immer in der Bustür stand. Die anderen Soldaten brüllten uns an, wir sollten uns auf den Boden setzen und uns dort nicht von der Stelle rühren. Ich tat exakt das, was man mir sagte.
»Code Orange!«, hörte ich einen von ihnen in sein Walkie-Talkie brüllen. »Wir haben ein Problem am Haupttor. Ich brauche einen Knebel für einen Orangenen …«
Erst als sie uns wieder zusammengetrieben und den Jungen mit dem zerschlagenen Gesicht zu Boden gedrückt hatten, traute ich mich aufzublicken. Und während mir die Furcht den Rücken hinaufkroch, fragte ich mich, ob er der Einzige war, der zu so etwas imstande war. Ober ob jeder um mich herum hier war, weil er oder sie auch jemanden dazu bringen konnte, sich so etwas anzutun.
Ich doch nicht – die Worte flammten durch meinen Kopf –, doch nicht ich, die haben sich geirrt, geirrt …
Mit einem Gefühl der Leere in meiner Brust beobachtete ich, wie einer der Soldaten eine Sprühdose nahm und dem Jungen ein riesiges orangefarbenes X auf den Rücken sprühte. Der Junge hatte nur aufgehört zu schreien, weil zwei PSFs ihm eine seltsame schwarze Maske – wie ein Maulkorb für Hunde – über die untere Hälfte seines Gesichts gezogen hatten.
Spannung legte sich wie Schweiß auf meine Haut. Sie führten unsere Reihen zum Einstufen durch das Lager zur Krankenstation. Dabei sahen wir Kids, die in die Gegenrichtung unterwegs waren; sie kamen von einer Reihe erbärmlicher Holzhütten. Alle trugen weiße Uniformen, jeder hatte ein X in einer anderen Farbe auf dem Rücken, und darüber stand eine schwarze Nummer. Ich sah insgesamt fünf verschiedene Farben – Grün, Blau, Gelb, Orange und Rot.
Die Kinder mit grünem und blauem X durften sich frei bewegen, ihre Hände schwangen neben dem Körper. Die mit einem blassgelben, einem orangefarbenen oder einem roten X mussten sich in Hand- und Fußschellen aus Metall durch den Regen mühen; eine lange Kette fesselte sie zu einer Reihe aneinander. Diejenigen, die als Orangene gekennzeichnet waren, hatten diese komischen Maulkorbmasken vor dem Gesicht.
Eilig wurden wir in das grelle Licht und die trockene Luft des Traktes getrieben, den ein zerrissenes Papierschild als Krankenstation auswies. Ärzte und Schwestern säumten die langen Flure und musterten uns kopfschüttelnd und stirnrunzelnd. Der Fliesenboden im Schachbrettmuster wurde glitschig von Regen und Schlamm, und ich musste mich ganz darauf konzentrieren, nicht auszurutschen. Der Geruch von Wundbenzin und künstlichem Zitronenaroma drang mir in die Nase.
Einer nach dem anderen stiegen wir in einem dunklen Treppenhaus die Stufen hinauf, ganz hinten im Erdgeschoss, das voller leerer Betten und schlaffer weißer Vorhänge war. Nicht Orange. Nicht Rot.
Tief im Bauch konnte ich meine Eingeweide rumoren fühlen. Immer wieder sah ich das Gesicht der Frau vor mir, als sie abdrückte, oder die Masse aus ihrem blutigen Haar, die vor meinen Füßen gelandet war. Immer wieder sah ich das Gesicht meiner Mom vor mir, als sie mich in die Garage gesperrt hatte. Immer wieder sah ich Grams’ Gesicht vor mir.
Sie kommt, dachte ich. Sie kommt bestimmt. Sie macht, dass Mom und Dad wieder in Ordnung sind, und sie kommt mich holen. Sie kommt, sie kommt, sie kommt …
Oben schnitten sie endlich unsere Plastikhandfesseln durch und teilten uns abermals auf, schickten die eine Hälfte nach links den eiskalten Flur hinunter und die andere nach rechts. Beide Seiten sahen genau gleich aus – nicht viel mehr als ein paar geschlossene Türen und ein kleines Fenster ganz am Ende. Einen Augenblick lang tat ich nichts anderes, als zuzusehen, wie der Regen gegen diese winzige, beschlagene Glasscheibe drosch. Dann schwang die Tür zu meiner Linken mit einem leisen Quietschen auf, und das Gesicht eines dicklichen Mannes in mittleren Jahren erschien. Er warf einen Blick in unsere Richtung, bevor er dem PSF an der Spitze der Gruppe etwas zuflüsterte. Eine nach der anderen öffneten sich noch mehr Türen, und noch mehr Erwachsene erschienen. Das Einzige, was sie außer ihren weißen Kitteln gemeinsam hatten, war der argwöhnische Gesichtsausdruck.
Ohne ein Wort der Erklärung begannen die PSFs, Kinder auf jeden weißen Kittel und das dazugehörige Büro zuzuschieben. Die verwirrten, verängstigten Laute, die in den Reihen aufkamen, wurden von einem durchdringenden Summton zum Schweigen gebracht. Ich lehnte mich auf die Fersen zurück, sah, wie sich die Türen eine nach der anderen schlossen, und fragte mich, ob ich diese Jungen und Mädchen wohl jemals wiedersehen würde.
Was ist denn mit uns? Mein Kopf fühlte sich an, als wäre er voller nassem Sand, als ich über die Schulter nach hinten schaute. Der Junge mit dem kaputten Gesicht war nirgends zu sehen, aber die Erinnerung an ihn hatte mich den ganzen Weg durchs Lager begleitet. Hatten sie uns hergebracht, weil sie glaubten, wir hätten die Everhart’sche Krankheit? Dachten sie, wir würden sterben?
Wie hatte der Junge die PSF dazu gebracht, das zu tun? Was hatte er zu ihr gesagt?
Ich spürte, wie eine Hand in meine glitt, während ich dastand und so sehr zitterte, dass meine Gelenke schmerzten. Das Mädchen neben mir – dasselbe, das mich draußen in den Matsch gestoßen hatte – bedachte mich mit einem entschlossenen Blick. Ihr dunkelblondes Haar klebte ihr am Kopf und rahmte eine rosige Narbe zwischen Nase und Oberlippe ein. Ihre dunklen Augen blitzten, und als sie sprach, bemerkte ich, dass sie die Drähte ihrer Zahnklammer abgekniffen hatten, die kleinen Metallplättchen hatten sie aber kleben lassen.
»Hab keine Angst«, flüsterte sie. »Zeig’s ihnen nicht.«
Auf dem handgeschriebenen Schildchen am Etikett ihrer Jacke stand Samantha Dahl. Es ragte in ihrem Nacken in die Höhe wie ein nachträglicher Gedanke.
Wir standen Schulter an Schulter, nahe genug, dass unsere verschränkten Finger im Stoff meiner Pyjamahose und in ihrer lilafarbenen Daunenjacke verborgen waren. Sie hatten sie auf dem Schulweg mitgenommen, am selben Morgen, an dem sie auch mich geholt hatten. Das war einen Tag her, aber ich erinnerte mich daran, ihre dunklen Augen hinten in dem Lieferwagen, in dem sie uns eingeschlossen hatten, vor Hass brennen gesehen zu haben. Sie hatte nicht geschrien wie die anderen.
Die Kids, die durch die Türen verschwunden waren, kamen jetzt durch dieselben Türen zurück und umklammerten mit beiden Händen graue Shorts und Pullover. Anstatt sich wieder in die Reihe zu stellen, wurden sie die Treppe hinuntergeführt, bevor irgendjemand ein Wort oder einen fragenden Blick anbringen konnte.
Sie sehen nicht aus, als wäre ihnen etwas getan worden. Ich konnte Filzstift riechen und etwas, das Wundbenzin gewesen sein könnte, aber niemand blutete oder weinte.
Als schließlich das Mädchen dran war, trennte der PSF an der Spitze der Reihe uns mit einem scharfen Ruck. Ich wollte mit hineingehen, mich zusammen mit ihr dem stellen, was hinter dieser Tür lauerte. Bestimmt war alles besser, als wieder allein zu sein, ohne irgendjemanden oder irgendetwas, an dem ich mich halten konnte.
Meine Hände zitterten so heftig, dass ich die Arme verschränken und meine Ellenbogen umklammern musste, damit sie damit aufhörten. Ich stand ganz vorn in der Reihe und starrte auf die glänzende Fläche aus Schachbrettfliesen zwischen den schwarzen Stiefeln des PSF und meinen schlammverschmierten Zehen. Von der schlaflosen Nacht gestern war ich todmüde, und der Geruch der Schuhcreme des Soldaten ließ meinen Kopf noch tiefer im Nebel versinken.
Und dann riefen sie mich auf.
Ich fand mich in einem trübe beleuchteten Büro wieder, halb so groß wie mein enges Zimmer zu Hause, ohne jegliche Erinnerung daran, dort hineingegangen zu sein.
»Name?«
Ich schaute auf eine Liege und einen seltsamen, wie ein Heiligenschein geformten Apparat, der darüberhing.
Das Gesicht des Weißkittels tauchte hinter dem Laptop auf dem Tisch auf. Er war ein Mann von gebrechlichem Aussehen, dessen schmale Silberbrille scheinbar ernsthaft in Gefahr war, ihm bei jeder raschen Bewegung von der Nase zu rutschen. Seine Stimme war unnatürlich hoch, er quiekte das Wort mehr, als dass er es aussprach. Ich drückte den Rücken gegen die geschlossene Tür, versuchte, Abstand zwischen mich, den Fremden und den Apparat zu bringen.
Der Weißkittel folgte meinem Blick zu der Liege. »Das ist ein Scanner. Davor brauchst du keine Angst zu haben.«
Ich wirkte wohl nicht überzeugt, denn er fuhr fort: »Hast du dir schon mal etwas gebrochen oder dir den Kopf angeschlagen? Weißt du, was ein CT ist?«
Es war die Geduld in seiner Stimme, die mich einen Schritt nach vorn zog. Ich schüttelte den Kopf.
»Gleich bitte ich dich, dich hinzulegen, und benutze dieses Gerät, um zu sehen, ob dein Kopf in Ordnung ist. Aber zuerst musst du mir deinen Namen sagen.«
Um zu sehen, ob dein Kopf in Ordnung ist. Woher wusste er das?
»Dein Name«, sagte er, und die Worte klangen plötzlich scharf.
»Ruby«, antwortete ich und musste ihm meinen Nachnamen buchstabieren.
Er fing an, auf dem Laptop zu tippen, war einen Moment abgelenkt. Mein Blick huschte zu dem Scanner zurück, und ich fragte mich, wie weh es wohl tun würde, wenn das Innere meines Kopfes untersucht wurde. Fragte mich, ob er irgendwie sehen konnte, was ich getan hatte.
»Verdammt, die werden allmählich faul«, maulte der Weißkittel; er sprach mehr mit sich selbst als mit mir. »Haben sie dich denn nicht vorklassifiziert?«
Ich hatte keine Ahnung, wovon er redete.
»Als sie dich abgeholt haben, haben sie dir da Fragen gestellt?«, wollte er wissen und stand auf. Mit zwei Schritten war er neben mir, und ich in voller Panik.
»Haben deine Eltern den Soldaten deine Symptome geschildert?«
»Symptome?«, brachte ich heraus. »Ich hab keine Symptome … Ich hab keine Ever…«
Er schüttelte leicht verärgert den Kopf. »Ganz ruhig, hier bist du in Sicherheit. Ich tu dir nichts.« Der Weißkittel sprach weiter; seine Stimme war tonlos, irgendetwas flackerte in seinen Augen. Die Sätze klangen einstudiert.
»Es gibt viele verschiedene Symptome«, erklärte er und beugte sich herab, um auf Augenhöhe mit mir zu sein. Alles, was ich sehen konnte, waren seine schiefen Schneidezähne und die dunklen Ringe um seine Augen. Sein Atem roch nach Kaffee und Pfefferminz. »Viele verschiedene Arten von … Kindern. Ich mache ein Foto von deinem Gehirn, das hilft uns, dich zu denen zu stecken, die auch so sind wie du.«
Ich schüttelte den Kopf. »Ich hab keine Symptome! Grams kommt, ganz bestimmt, ich schwör’s … Bitte, sie wird es Ihnen sagen!«
»Sag, Schätzchen, bist du richtig gut in Mathe und beim Puzzeln? Grüne sind unglaublich klug und haben ein erstaunliches Gedächtnis.«
Meine Gedanken zuckten zurück zu den Kindern draußen, zu dem farbigen X hinten auf ihren Hemden. Grün, dachte ich. Welches waren noch mal die anderen Farben gewesen? Rot, Blau, Gelb und …
Und Orange. Wie der Junge mit dem blutigen Mund.
»Na schön«, sagte er und holte tief Luft, »leg dich einfach auf den Rücken auf die Liege da, und los geht’s. Sofort, bitte.«
Ich rührte mich nicht. Gedanken hasteten viel zu schnell in meinen Kopf. Es war schon mühsam, ihn nur anzusehen.
»Sofort«, wiederholte er und ging zu dem Apparat. »Zwing mich nicht, einen von den Soldaten zu rufen. Die sind nicht annähernd so nett, glaub mit.« Ein Bildschirm an der Seite der Maschine erwachte auf eine einzige Berührung hin zum Leben, dann leuchtete der Apparat selbst auf. In der Mitte des grauen Kreises war ein weißes Licht, das blinkte, während sich der Apparat für einen weiteren Test bereit machte. Er atmete heiße Luft aus, mit einem Prusten und Jaulen, das in jede Pore meines Körpers zu stechen schien.
Alles, was ich denken konnte, war: Er wird es wissen. Er wird wissen, was ich mit ihnen gemacht habe.
Mein Rücken presste sich wieder an die Tür, meine Hand tastete blind nach der Klinke. Jeder einzelne Vortrag, den mein Vater mir jemals über Fremde gehalten hatte, schien sich zu bewahrheiten. Das hier war kein sicherer Ort. Dieser Mann war nicht nett.
Ich zitterte so sehr, dass er vielleicht dachte, ich würde gleich ohnmächtig werden. Entweder das, oder er wollte mich selber mit Gewalt auf die Liege packen und mich dort festhalten, bis der Apparat sich senkte und über mir einrastete.
Vorher war ich nicht bereit gewesen wegzulaufen, jetzt dagegen schon. Als meine Finger sich um die Klinke schlossen, spürte ich, wie seine Hand durch meine dunkle Haarmähne fuhr und meinen Nacken packte. Bei dem Schock seiner eiskalten Finger auf meiner heißen Haut fuhr ich zusammen, doch es war die Schmerzexplosion an meiner Schädelbasis, die mich aufschreien ließ.
Er starrte mich an, ohne zu blinzeln; seine Augen hatten plötzlich keinen Fokus mehr. Ich aber sah alles – unmögliche Dinge. Hände, die auf das Lenkrad eines Autos trommelten, eine Frau in einem schwarzen Kleid, die sich vorbeugte, um mich zu küssen. Ein Baseball, der draußen auf einem Spielfeld auf mein Gesicht zugeflogen kam, eine endlose grüne Wiese, eine Hand, die durch das Haar eines kleinen Mädchens strich … Die Bilder spulten hinter meinen geschlossenen Augen ab wie ein alter Amateurfilm. Die Umrisse von Menschen und Gegenständen brannten sich in meine Netzhaut und blieben dort, trieben wie hungrige Gespenster hinter meinen Lidern umher.
Das sind nicht meine, schrie mein Verstand. Die gehören nicht mir.
Aber wie konnten sie ihm gehören? Jedes Bild … waren das Erinnerungen? Gedanken?
Dann sah ich mehr. Einen Jungen, derselbe Apparat über ihm, flackernd und qualmend. Gelb. Ich spürte, wie meine Lippen die Worte formten, als wäre ich dabei gewesen, um sie auszusprechen. Ich sah ein kleines rothaariges Mädchen auf der anderen Seite eines ganz ähnlichen Zimmers wie dieses hier. Sah sie einen Finger hochstrecken, und der Tisch und der Laptop vor ihr hoben sich mehrere Zentimeter vom Boden. Blau – wieder die Stimme des Mannes in meinem Kopf. Ein Junge hielt einen Bleistift in den Händen, studierte ihn mit beängstigender Konzentration … und der Bleistift ging in Flammen auf. Rot. Karten mit Bildern und Zahlen darauf wurden einem Kind vors Gesicht gehalten. Grün.
Ich kniff die Augen fest zu, doch ich konnte nicht vor den Bildern zurückweichen, die jetzt kamen – die Reihen marschierender, geknebelter Monster. Ich stand hoch über ihnen, schaute durch regengesprenkeltes Glas, doch ich sah die Handschellen und die Ketten. Ich sah alles.
Ich bin keiner von denen. Bitte, bitte, bitte …
Ich fiel, sackte auf die Knie, stemmte die Hände gegen die Fliesen, gab mir alle Mühe, nicht mich selbst und den Boden vollzukotzen. Die Hand des Weißkittels hielt noch immer meinen Nacken gepackt. »Ich bin Grün«, schluchzte ich. Die Worte gingen halb im Summen des Apparats unter. Das Licht war schon vorher grell gewesen, jetzt jedoch verstärkte es das Hämmern hinter meinen Augen. Ich starrte in seine ausdruckslosen Augen, wollte, dass er mir glaubte. »Ich bin Grün … Bitte, bitte …« Doch ich sah das Gesicht meiner Mutter, das Lächeln, das der Junge mit dem kaputten Mund mir geschenkt hatte, als hätte er etwas von sich selbst in mir wiedererkannt. Ich wusste, was ich war.
»Grün …«
Beim Klang der Stimme, die zu mir herabtrieb, schaute ich auf. Ich starrte, und er starrte unverwandt zurück, die Augen ziellos und glasig. Jetzt murmelte er etwas, den Mund voller Brei, als würde er auf seinen Worten herumkauen.
»Ich bin …«
»Grün«, sagte er und schüttelte den Kopf. Seine Stimme klang kräftiger.
Ich hockte noch immer am Boden, als er zu dem Apparat ging und ihn ausschaltete, und ich war so schockiert, als er sich wieder hinsetzte, dass ich tatsächlich vergaß zu weinen. Doch erst als er die Farbsprühdose nahm und ein riesiges grünes X auf das Uniformhemd sprühte und es mir reichte, erinnerte ich mich daran, wieder zu atmen.
Es wird alles gut, redete ich mir ein, als ich den kalten Flur entlangging, die Stufen hinunter, zurück zu den Mädchen und den Männern in Uniform, die unten auf mich warteten. Erst in dieser Nacht, als ich wach auf meiner Pritsche lag, wurde mir klar, dass es für mich jemals nur eine einzige Chance geben würde zu fliehen – und ich hatte sie nicht genutzt.
3. Kapitel
Samantha – Sam – und ich wurden beide in Baracke 27 gesteckt, zusammen mit den restlichen Mädchen aus unserem Bus, die als Grün eingestuft worden waren. Vierzehn insgesamt, allerdings wurden es am nächsten Tag schon zwanzig. Eine Woche später stockten sie auf dreißig auf und begannen, die nächste Holzhütte an dem dauermatschigen und zertrampelten Hauptdurchgangsweg des Lagers vollzumachen.
Die Stockbetten wurden in alphabetischer Reihenfolge zugeteilt, sodass Sam direkt über mir lag – ein kleiner Trost, denn der Rest der Mädchen war ganz anders als sie. Sie verbrachten die erste Nacht entweder mit Schluchzen oder in betäubtem Schweigen. Ich hatte keine Zeit mehr für Tränen. Ich hatte Fragen.
»Was machen die jetzt mit uns?«, flüsterte ich ihr zu. Wir waren ganz am hinteren linken Ende der Baracke; unser Stockbett klemmte in der Ecke. Die Wände waren so schnell hochgezogen worden, dass sie nicht vollständig dicht waren. Hin und wieder wehte ein eisiger Luftzug oder eine Schneeflocke von draußen herein.
»Weiß nicht«, antwortete sie leise.
Ein paar Betten weiter war eines der Mädchen endlich ins Vergessen des Schlafes hinübergetrieben, und ihr Schnarchen half, unser Gespräch geheim zu halten. Als ein PSF uns zu unserer neuen Behausung gebracht hatte, waren etliche Warnungen gefolgt: Nach dem Lichtausmachen nicht mehr reden, nicht rausgehen und ja nicht irgendwelche Freaknummern abziehen – weder mit Absicht noch aus Versehen. Es war das erste Mal, dass ich hörte, wie jemand das, was wir konnten, anstelle der höflichen Alternative »Symptome« »Freaknummern« nannte.
»Wahrscheinlich behalten sie uns hier, bis sie ein Heilmittel finden«, fuhr Sam fort. »Das hat mein Dad jedenfalls gesagt, als sie mich geholt haben. Was haben denn deine Eltern gesagt?«
Meine Hände hatten seit vorhin nicht aufgehört zu zittern, und jedes Mal, wenn ich die Lider schloss, sah ich nichts anderes als die blicklosen Augen des Wissenschaftlers vor mir, die in meine starrten. Die Frage nach meinen Eltern machte das Hämmern in meinem Schädel sehr viel schlimmer.
Ich weiß nicht, wieso ich log. Es war wohl einfacher, als die Wahrheit zu sagen – oder vielleicht auch, weil sich ein kleiner Teil von alldem anfühlte, als wäre es tatsächlich die Wahrheit. »Meine Eltern sind tot.«
Sie sog scharf den Atem zwischen den Zähnen ein. »Ich wünschte, meine wären auch tot.«
»Das meinst du doch nicht ernst!«
»Die haben mich doch hierhergeschickt, oder etwa nicht?« Es war gefährlich, wie rasch ihre Stimme lauter wurde. »Offenbar wollten sie mich loswerden.«
»Ich glaube nicht …«, begann ich und hielt dann inne. Hatten meine Eltern mich nicht auch loswerden wollen?
»Egal, ist schon in Ordnung«, meinte sie, obwohl das ganz eindeutig nicht stimmte und niemals stimmen würde. »Wir bleiben hier und halten zusammen, und wenn wir rauskommen, können wir gehen, wohin wir wollen, und keiner wird uns daran hindern.«
Meine Mom hatte immer gesagt, dass es manchmal schon reicht, etwas laut auszusprechen, damit es wahr wird. Ich war mir da nicht so sicher, doch die Art und Weise, wie Sam das sagte, die kleine Flamme unter ihren Worten, ließ mich noch einmal darüber nachdenken. Plötzlich erschien es möglich, dass es tatsächlich so kommen könnte – dass mir, wenn ich schon nicht nach Hause konnte, am Ende trotzdem nichts passieren würde, wenn ich mich nur an sie hielt. Es war, als täte sich überall, wohin Sam ging, ein Pfad hinter ihr auf. Alles, was ich tun musste, war, in ihrem Schatten zu bleiben, den PSFs nicht unter die Augen zu kommen und alles zu vermeiden, was Aufmerksamkeit erregen würde.
So ging es fünf Jahre lang.
Fünf Jahre fühlen sich wie ein ganzes Leben an, wenn jeder Tag mit dem nächsten verschwimmt und sich deine Welt nicht weiter erstreckt als bis zu dem grauen Elektrozaun, der nichts als Baracken und Matsch umgibt. Ich war nie glücklich in Thurmond, doch es war zu ertragen, weil Sam da war. Sie war mit dem Augenrollen da, wenn Vanessa, eine aus unserer Baracke, versuchte, sich mit einer Gartenschere die Haare zu schneiden, um »schicker« auszusehen – »Für wen denn?«, hatte Sam gebrummt. »Für ihr Spiegelbild im Waschraum?« Mit der albernen schielenden Grimasse hinter dem Rücken des PSF, der ihr eine Standpauke hielt, weil sie schon wieder ungefragt geredet hatte, und mit dem entschiedenen, aber sanften Weckruf in die Wirklichkeit, wenn die Fantasie der Mädchen mit ihnen durchging oder Gerüchte aufkamen, die PSFs würden uns gehen lassen. Sam und ich – wir waren Realisten. Wir wussten, dass wir nicht rauskommen würden. Träumen führte zu Enttäuschung und Enttäuschung zu einer deprimierten Schwermut, die man nur schwer wieder loswurde. Lieber im Grau bleiben, als von der Finsternis gefressen werden.
Nach zwei Jahren in Thurmond begann die Lagerleitung mit der Arbeit an der Fabrik. Sie hatten es nicht geschafft, die gefährlichen Kids unter Kontrolle zu halten, und sie bei Nacht und Nebel davongekarrt, doch damit endeten die sogenannten »Verbesserungen« nicht. Allmählich dämmerte ihnen, dass das Lager vollständig »autark« sein musste, wie es hieß. Von da an würden wir unsere Lebensmittel selbst anbauen und kochen, die Waschräume sauber machen und unsere Uniformen selbst nähen. Und die der PSFs gleich mit.
Der Ziegelbau lag ganz am westlichen Ende des langen Rechtecks, das Thurmond bildete. Sie ließen uns das Fundament ausheben, die eigentlichen Bauarbeiten jedoch vertraute die Lagerleitung uns nicht an. Wir sahen zu, wie die Fabrik Stockwerk um Stockwerk emporwuchs, und fragten uns, wozu das Gebäude dienen sollte und was sie dort mit uns machen würden. Damals waren alle möglichen Gerüchte in Umlauf und trieben wie Löwenzahnsamen im Wind – manche glaubten, die Wissenschaftler würden zurückkehren und noch mehr Experimente machen, manche dachten, in dem neuen Gebäude würden die Roten, Orangenen und Gelben untergebracht werden, so sie denn jemals zurückkamen, und manche sagten, dort würden sie uns ein für alle Mal beseitigen.
»Es wird alles gut«, hatte Sam eines Abends zu mir gesagt, kurz bevor das Licht gelöscht wurde. »Ganz gleich, was kommt – hörst du?«
Aber es war nicht gut. Es war damals nicht gut gewesen, und jetzt war es auch nicht gut.
In der Fabrik durfte nicht gesprochen werden, aber es gab Möglichkeiten, das zu umgehen. Eigentlich durften wir nur in unserer Baracke reden, vor dem Lichtausmachen. Überall sonst gab es nichts als Arbeit, Gehorsam, Schweigen. Doch man kann nicht jahrelang zusammen sein, ohne eine andere Sprache zu entwickeln, eine Sprache, die nur aus verstohlenem Grinsen und raschen Blicken bestand. Heute ließen sie uns die Stiefel der PSFs polieren und mit neuen Schnürsenkeln versehen, doch ein einziges Schlenkern eines schwarzen Schnürsenkels und ein Blick zu dem Mädchen, das einem gegenüberstand – genau die, die einem gestern Abend so ein fürchterliches Schimpfwort an den Kopf geknallt hatte –, sprach Bände.
Als Fabrik machte die Fabrik nicht viel her. »Lagerhaus« wäre wahrscheinlich ein besserer Name gewesen, weil das Gebäude bloß aus einem einzigen riesigen Raum bestand, mit Laufstegen über dem Arbeitsbereich. Die Bauherren waren schlau genug gewesen, vier große Fenster in die Ost- und die Westwand einzulassen, doch weil es im Winter keine Heizung und im Sommer keine Klimaanlage gab, ließen die meist mehr schlechtes Wetter als Sonnenlicht herein.
Die Lagerleitung versuchte, alles so einfach wie möglich zu gestalten; sie stellten Reihe um Reihe von Tischen längs auf dem staubigen Betonboden auf. An diesem Morgen arbeiteten Hunderte von uns dort drinnen, alle in Grün-Uniformen. Die PSFs patrouillierten über uns auf den Laufstegen, jeder mit seinem oder ihrem schwarzen Gewehr. Zehn weitere waren unten bei uns.
Es war nicht beklemmender als sonst, den Druck ihrer Blicke aus allen Richtungen zu spüren. Doch ich hatte in der Nacht zuvor schlecht geschlafen, sogar nach einem vollen Arbeitstag im Garten. Ich war mit Kopfschmerzen zu Bett gegangen und mit waberndem Fieberdunst im Hirn und den dazu passenden Halsschmerzen aufgewacht. Selbst meine Hände schienen lethargisch zu sein, meine Finger waren steif wie Bleistifte.
Ich wusste, dass ich nicht mithielt, doch in gewisser Weise war es wie Ertrinken. Je mehr ich mich anstrengte, den Kopf über Wasser zu halten, desto müder wurde ich und desto langsamer kam ich voran. Nach einer Weile schien selbst das Stehen zu mühsam zu sein, und ich musste mich gegen den Tisch lehnen, um nicht kopfüber daraufzufallen. An den meisten Tagen konnte ich mich mit Schneckentempo durchmogeln. Es war ja nicht so, als verrichteten wir hier wichtige Arbeit oder müssten Termine einhalten. Jede Aufgabe, die uns zugewiesen wurde, war lediglich zu Arbeit verklärte Beschäftigungstherapie, um unsere Hände zu beschäftigen und unsere Köpfe mit Langeweile zu lähmen. Sam nannte es »Zwangspause« – sie ließen uns aus den Baracken, und die Arbeit war nicht so anstrengend oder ermüdend wie die im Garten, doch niemand wollte gern dort sein.
Schon gar nicht, wenn Schläger auf dem Hof auftauchten.
Ich wusste, dass er hinter mir stand, lange bevor ich hörte, wie er anfing, die fertigen, blank geputzten Schuhe vor mir zu zählen. Er roch nach gewürztem Fleisch und Motoröl, was an und für sich schon eine ungute Kombination war, noch bevor ein Hauch von Zigarettenrauch dazukam. Ich versuchte, unter der Last seines Blickes den Rücken zu strecken, doch es fühlte sich an, als hätte er die Knöchel beider Fäuste zwischen meinen Schulterblättern tief ins Fleisch gegraben.
»Fünfzehn, sechzehn, siebzehn …« Wie schaffte er das, jede Zahl so scharf klingen zu lassen?
In Thurmond durften wir einander nicht berühren, und es war mehr als verboten, einen der PSFs anzufassen, doch das hieß nicht, dass sie uns nicht berührten. Der Mann machte zwei Schritte vorwärts, seine Stiefel – genau wie die auf dem Tisch – stießen von hinten gegen meine vorschriftsmäßigen weißen Slipper. Als ich nicht reagierte, schob er einen Arm an meiner Schulter vorbei, tat so, als würde er mein Arbeitsmaterial sortieren, und drückte mich dabei gegen seine Brust. Mach dich klein, sagte ich mir, krümmte den Rücken und senkte das Gesicht auf die Arbeit vor mir. Mach dich klein.
»Wertlos«, hörte ich den PSF hinter mir grunzen. Sein Körper verströmte genug Wärme, um das ganze Gebäude zu heizen. »Du machst das völlig verkehrt. Schau her … Schau her, Mädchen!«
Aus dem Augenwinkel sah ich ihn zum ersten Mal richtig an, als er mir das mit Schuhcreme verschmierte Putztuch aus der Hand riss und neben mich trat. Er war klein, nur ein paar Zentimeter größer als ich, mit einer Stupsnase und Wangen, die jedes Mal zu wabbeln schienen, wenn er Atem holte.
»So!«, sagte er und wischte an dem Stiefel herum, den er in die Hand genommen hatte. »Sieh mich an!«
Ein Trick. Wir durften ihnen auch nicht direkt in die Augen sehen.
Ich hörte das eine oder andere Kichern um mich herum. Es kam nicht von den Mädchen, sondern von anderen PSFs, die sich hinter ihm versammelt hatten.
Ich hatte das Gefühl, mein Blut würde kochen. Es war Dezember, und in der Fabrik konnten nicht mehr als vier Grad geherrscht haben, doch Schweißrinnsale strömten mir über die Wangen, und ich spürte, wie mir ein harter, unbeugsamer Husten in die Kehle stieg.
Eine leichte Berührung an meiner Seite. Sam konnte nicht von ihrer Arbeit aufblicken, doch ich sah, wie ihre Augen zu mir herüberhuschten, um die Situation einzuschätzen. Ein Schwall zorniges Rot stieg ihr vom Hals ins Gesicht hinauf, und ich konnte mir vorstellen, was für Worte sie sich verbiss. Ihr knochiger Ellenbogen streifte abermals den meinen, wie um mich daran zu erinnern, dass sie noch da war.
Dann spürte ich mit quälender Langsamkeit, wie sich derselbe PSF abermals hinter mich schob, meine Schulter und meinen Arm mit seinem streifte, als er den Stiefel sanft wieder vor mir auf den Tisch stellte.
»Diese Stiefel hier«, sagte er mit leiser, schnurrender Stimme, während er den Plastikkübel antippte, der meine ganze fertige Arbeit enthielt. »Hast du die Schnürsenkel da reingefädelt?«
Hätte ich nicht gewusst, was für eine Strafe ich mir dafür einhandeln würde, wäre ich in Tränen ausgebrochen. Ich kam mir immer dümmer und beschämter vor, je länger ich dort stand, doch ich konnte nichts sagen. Ich konnte mich nicht rühren. Meine Zunge war hinter den zusammengepressten Zähnen zu doppelter Größe angeschwollen. Die Gedanken, die in meinem Kopf herumsurrten, waren leicht und seltsam unscharf an den Rändern. Meine Augen konnten jetzt kaum noch etwas erfassen.
Noch mehr Gekicher hinter uns.
»Die Schnürsenkel sind total verkehrt.« Sein anderer Arm legte sich um meine linke Seite, bis es keinen Zentimeter seines Körpers mehr gab, der sich nicht gegen meinen presste. Etwas Neues stieg mir in die Kehle, und es schmeckte stark nach Säure.
An den anderen Tischen war es vollständig still geworden.
Mein Schweigen stachelte ihn nur noch mehr an. Ohne Vorwarnung nahm er den Kübel und kippte ihn um, sodass Dutzende von Stiefeln sich mit furchtbarem Krach auf dem ganzen Tisch verteilten. Jetzt schaute jeder in der Fabrik zu. Alle sahen mich, ins Licht hinausgestoßen.
»Verkehrt, verkehrt, verkehrt, verkehrt!«, verkündete er und stieß die Stiefel auf dem Tisch umher. Waren sie gar nicht, sie waren vollkommen in Ordnung. Es waren nur Stiefel, aber ich wusste doch, wer seine Füße da hineinstecken würde. Ich war klug genug, das hier nicht zu vermasseln. »Bist du genauso taub, wie du stumm bist, Grüne?«
Und dann, so klar wie Glas und so leise wie Donnergrollen, hörte ich Sam sagen: »Das war mein Kübel.«
Und alles, was ich denken konnte, war: Nein. O nein! Ich fühlte, wie der PSF sich hinter mir bewegte, überrascht zurückzuckte. So benahmen sie sich immer – überrascht, dass wir noch wussten, wie man Worte verwendete, und das auch noch gegen sie.
»Was hast du gesagt?«, bellte er.
Ich konnte sehen, wie die Beleidigung ihr auf den Lippen lag. Sie rollte sie im Mund herum wie ein Zitronenbonbon. »Sie haben mich schon verstanden. Oder hat Ihnen das Einatmen der Dämpfe hier alles abgetötet, was Sie an Restzellen noch im Gehirn hatten?«
Ich wusste, was sie wollte, als sie zu mir herüberschaute. Ich wusste, worauf sie wartete. Auf genau das, was sie mir gerade gegeben hatte: Rückendeckung.
Ich wich einen Schritt zurück und verschränkte die Arme vor dem Bauch. Tu’s nicht, sagte ich mir. Tu’s nicht. Sie schafft das schon. Sam hatte nichts zu verbergen, und sie war mutig – aber jedes Mal, wenn sie das tat, jedes Mal, wenn sie für mich in die Bresche sprang und ich ängstlich zurückwich, fühlte es sich an, als würde ich sie verraten. Wieder einmal war meine Stimme hinter Schichten aus Vorsicht und Angst weggesperrt. Wenn sie in meiner Akte nachschauen, wenn sie die Lücken dort sehen und anfangen würden, sie zu füllen, wäre keine Strafe, die sie Sam verpassten, jemals mit der zu vergleichen, die sie mir zuteilwerden lassen würden.
Zumindest redete ich mir das ein.
Der rechte Mundwinkel des Kerls hob sich, verwandelte einen grimmigen Strich in ein hämisches Feixen. »Da lebt ja noch eine.«
Na los doch, komm schon, Ruby. All das lag in der Neigung ihres Kopfes, in der Anspannung in ihren Schultern. Sie verstand nicht, was mit mir passieren würde. Ich war nicht so mutig wie sie.
Aber ich wollte so mutig sein. Ich wollte so gern so mutig sein.
Ich kann nicht. Ich brauchte es nicht laut auszusprechen. Sie konnte es ganz leicht in meinem Gesicht lesen. Ich sah das Begreifen hinter ihren Augen auftauchen, noch ehe der PSF vortrat und sie am Arm packte, sie vom Tisch und von mir fortzerrte.
Dreh dich um, flehte ich. Ihr blonder Pferdeschwanz pendelte bei jedem Schritt über den Schultern der PSFs, die sie hinausführten. Dreh dich um. Sie musste unbedingt sehen, wie leid es mir tat, musste verstehen, dass die Enge in meiner Brust und die Übelkeit in meinem Magen nichts mit dem Fieber zu tun hatten. Jeder einzelne verzweifelte Gedanke, der mir durch den Kopf ging, ließ mich vor Abscheu schwitzen. Die Augen, die auf mich gerichtet gewesen waren, wandten sich paarweise ab, und der Soldat kam nicht zurück, um seine ganz persönliche Folter zu beenden. Es war niemand mehr da, um mich weinen zu sehen; ich hatte schon vor Jahren gelernt, das stumm zu tun, ohne großes Getue. Sie hatten keinen Grund, auch nur noch einmal in meine Richtung zu schauen. Ich befand mich wieder in dem langen Schatten, den Sam zurückgelassen hatte.
Die Strafe für unerlaubtes Sprechen war ein Tag Einzelhaft, mit Handschellen an einen der Torpfosten im Garten angekettet, ganz gleich, bei welcher Temperatur oder bei welchem Wetter. Ich hatte Jugendliche in einem Schneehaufen hocken sehen, ganz blau im Gesicht und ohne Decke. Und sogar noch mehr Kids mit Sonnenbrand, mit Schlamm bedeckt oder voller Insektenstiche, die sie mit der freien Hand zu kratzen versuchten. Es war nicht überraschend, dass die Strafe dafür, einem PSF oder einem Mitglied der Lagerleitung zu widersprechen, dieselbe war, nur bekam man dann auch nichts zu essen und manchmal auch kein Wasser.
Die Strafe für Wiederholungstäter war etwas so Schreckliches, dass Sam nicht darüber sprechen wollte oder konnte, als sie zwei Tage später endlich wieder in die Baracke zurückkehrte. Nass und zitternd vom Winterregen kam sie herein und sah aus, als hätte sie nicht mehr geschlafen als ich. Ich rutschte von meinem Bett und war auf den Beinen, eilte an ihre Seite, ehe sie die Hütte zur Hälfte durchquert hatte.
Meine Hand legte sich um ihren Arm, doch sie machte sich los, den Kiefer auf eine Art und Weise angespannt, dass sie beinahe wild aussah. Ihre Wangen und ihre Nase waren knallrot vom Wind, doch sie hatte keine blauen Flecken oder Schrammen. Nicht einmal ihre Augen waren vom Weinen geschwollen wie meine. Vielleicht hinkte sie ein klein wenig beim Gehen, doch wenn ich nicht gewusst hätte, was passiert war, hätte ich gedacht, sie käme von einem langen Arbeitstag im Garten.
»Sam.« Es war mir verhasst, wie meine Stimme zitterte. Sie blieb nicht stehen oder würdigte mich auch nur eines Blickes, bis wir bei unserem Stockbett ankamen und sie eine Hand in ihre Matratze gekrallt hatte, bereit, sich ins obere Bett hinaufzuziehen.
»Sag doch was, bitte«, flehte ich.
»Du hast einfach nur dagestanden.« Sams Stimme war leise und rau, als hätte sie sie seit Tagen nicht mehr benutzt.
»Du hättest das nicht tun …«
Ihr Kinn senkte sich auf ihre Brust. Lange, wirre Haarmassen fielen ihr über Schultern und Wangen, verbargen ihren Gesichtsausdruck. Da spürte ich es – wie der Halt, den ich an ihr fand, sich plötzlich gelöst hatte. Ich hatte das eigenartige Gefühl dahinzutreiben, immer weiter weg, und nichts und niemand war da, an dem ich mich hätte festklammern können. Ich stand direkt neben ihr, doch die Entfernung zwischen uns war zu einer Schlucht aufgeklafft, über die ich nicht hinwegspringen konnte.
»Du hast recht«, sagte Sam schließlich. »Ich hätte das nicht tun sollen.« Sie holte tief und zittrig Luft. »Aber was wäre dann mit dir passiert? Du hättest einfach dagestanden und ihn machen lassen, und du hättest dich überhaupt nicht gewehrt.«
Und dann sah sie mich an, und alles, was ich wollte, war, dass sie sich wieder wegdrehte. Ihre Augen blitzten dunkler, als ich sie je gesehen hatte.
»Die können die fiesesten Gemeinheiten sagen, dir wehtun, aber du wehrst dich nie – und ich weiß, Ruby, ich weiß, so bist du eben, aber manchmal frage ich mich, ob dir das überhaupt wichtig ist. Wieso kannst du nicht für dich selbst einstehen, bloß ein einziges Mal?«
Ihre Stimme war kaum lauter als ein Flüstern, doch angesichts ihres brüchigen Klanges rechnete ich damit, dass sie entweder losbrüllen oder hysterisch in Tränen ausbrechen würde. Ich schaute nach unten, wo ihre Hände an den Rändern ihrer Shorts zerrten; sie bewegten sich so schnell, dass ich die tiefroten Spuren fast nicht gesehen hätte, die sich um ihre Handgelenke zogen.
»Sam … Samantha …«