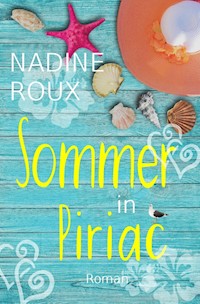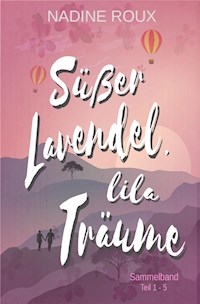3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Zwei Schwestern auf der Suche nach ihrem Platz im Leben Die pflichtbewusste Morgane hat es nicht leicht: Ihre extrovertierte Schwester Virginie hat mal wieder ihren Job verloren und kreuzt gleich mit einem neuen Angebot auf: Eine Unbekannte bietet ihr eine Bäckerei in Südfrankreich an. Als Virginie zu scheitern droht, muss Morgane einspringen. Die jedoch hat ihre ganz eigene Last zu tragen. Tante Sylvie hat vor Jahren die Trennung Morganes von ihrem Lebensgefährten erzwungen und mischt sich seitdem immer wieder in ihr Leben ein. In dem kleinen Dorf am Meer brechen die Wunden der Vergangenheit auf und die Schwestern müssen einen Weg finden, den Neuanfang zuzulassen. Denn zwischen ihnen steht ein Geheimnis, von dem beide nichts wissen. Eine packende Familiengeschichte unter der Sonne Frankreichs.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Flamingoherz
BookRix GmbH & Co. KG80331 MünchenÜber dieses Buch
Die Frauen der Familie Pétrusse sind grundverschieden. Virginie ist extrovertiert, ihre Schwester Morgane melancholisch und Tante Sylvie ist vor allem eines: Stinkreich. Doch jede der drei hat ihr Päckchen zu tragen und Geheimnisse machen ihnen das Leben schwer. Nach einer Enttäuschung will wenigstens Virginie neu anfangen und nimmt das Angebot einer Unbekannten an, eine Bäckerei in der Camargue auf Vordermann zu bringen. Doch das gelingt ihr nicht ohne die Hilfe ihrer Schwester. Während Virginie auch ohne den Job in Südfrankreich aufblüht und die Freunde findet, die sie nie hatte, zieht Morgane sich zurück. Sie hat in der Camargue ganz eigene Pläne, die ihre Wurzeln in der Vergangenheit haben. Erschütternde Parallelen treten zu Tage.
Nadine Roux ist ein Pseudonym. Die Autorin wurde 1988 geboren und studierte Französisch und Rechtswissenschaften. Sie lebt in der Lüneburger Heide, kocht und reist gerne. Flamingoherz ist ihr vierter Roman.
Blog: https://nadineroux.wordpress.com
Twitter: https://www.twitter.com/nadinerouxbooks
Dieses Buch entstand zwischen Mai 2017 und Juli 2019.
Besonderer Dank gilt meiner Autorenkollegin Anne Colwey für das Lesen und die vielen wertvollen Kommentare.
Grand merci auch an meine Eltern, die mir als Dreikäsehoch die Liebe zu dieser Landschaft zwischen Land und Meer, der Camargue, eingepflanzt haben.
Sara Kali
Man weiß nicht, was Sara Kali vorgefunden hat, als sie an der Küste der Camargue landete. Man weiß nicht, welche Farbe ihr Boot hatte, welche Farbe ihre Gewänder. Man ist sich nur über die Farbe ihrer Haut einig: Schwarz. Kali. Sara, die Schwarze.
Während ihre drei Begleiterinnen, allesamt Marien, zu Berühmtheiten unter den Heiligen der Kirche aufstiegen, blieb Sara die Ausgestoßene, die Randfigur, die nur umgeben von Sand, Meer und Wetter Magie entfaltete. Sie wurde Schutzheilige der reisenden Völker, die sich noch heute Ende Mai in Saintes-Maries-de-la-Mer – da wieder: Marien, von Sara kein Wort – versammeln, um sie in einer anrührenden Prozession ins Meer zu tragen. Reich geschmückt, prächtig gekleidet, wehklagend und ehrend besungen.
Sara Kali steckt im Wind, der Geschichten erzählt. Sie steckt im Sand, der verschlingt und erschafft. Sie steckt in den Liedern der Menschen, in ihrer Melancholie, ihren Sehnsüchten. Sie hört zu und schweigt, dort in der schnörkellosen Kirche mit dem Dach, das erklommen werden kann wie ein Himmel. Ein Moment der Rast über allem, bevor man zurückkehrt in das Getümmel der Menschen, die ohne Ziel umherirren, auf der Suche nach Sinn, Veränderung und Neuanfängen. Sara Kali wacht über sie.
Kapitel 1: Morgane 1993, Melonenlächeln
»Morgane, hierher! Sofort!« Der Tonfall ihrer Mutter duldete weder Widerspruch noch Aufschub. Morgane ließ die Puppe, an der sie gerade nähte, fallen und lief ins Wohnzimmer. Miche Pétrusse hatte eine Hand in die Hüfte gestemmt, die andere streckte sie Morgane entgegen. Im Gegenlicht der Nachmittagssonne erschien dem kleinen Mädchen ihre Mutter wie eine Riesin. »Morgane, was habe ich gesagt?«
Morganes Herz schlug schneller. Ihre Mutter sagte ihr viele Dinge, die sie tun oder lassen sollte, aber ihr fiel gerade nicht ein, was sie meinen könnte. Doch einfach »Ich weiß nicht« zu sagen war keine Option, denn dieser Satz war für Miche Pétrusse der Stellhebel an der Wutmaschine.
»Dass ich den Abwasch machen soll?«, fragte Morgane vorsichtig und wusste, dass das nicht die richtige Antwort war, denn den hatte sie bereits erledigt und dabei ihre Ärmel nass gemacht, weil die Spüle für ein kaum zehnjähriges Mädchen mit kurzen Beinen und dünnen Ärmchen nicht gemacht war.
»Nein!« Ihre Mutter öffnete ihre Hand. Darin kam eine gelbe Tonmurmel zum Vorschein. Es war Morganes Lieblingsmurmel, die einzige, die keinen Kratzer hatte. »Du sollst deine Murmeln wegräumen, wenn deine Schwester in der Nähe ist! Virginie hat sie gefunden und wollte sie gerade in den Mund stecken. Nicht auszumalen, was passiert wäre, wenn ich nicht aufgepasst hätte. Sie wäre erstickt!«
Erstickt. Eines von Morganes Schreckensworten, neben schneiden, aufschlagen, strangulieren, sterben. Immer drohte eines dieser Schicksale ihrer winzigen Schwester, kaum sechs Monate alt, wenn Morgane nicht aufpasste und ihre Spielsache forträumte, oder wenn sie aufpasste und es ihr trotzdem nicht gelang, dass Virginie ruhig auf ihrer Decke liegen blieb.
»Tut mir leid«, sagte sie kleinlaut und wollte die Murmel an sich nehmen. Doch ihre Mutter steckte sie in die Tasche ihrer Schürze.
»Nein. Die bekommst du nicht zurück, vielleicht lernst du es dann.« Die Gestalt verließ das Gegenlicht, nahm Virginie auf den Arm und verschwand im Kinderzimmer.
Morgane war wieder alleine mit dem Ticken der Wanduhr, die ihre Großmutter hiergelassen hatte, als sie ausgezogen war und der wachsenden Familie das Haus überlassen hatte.
Es waren Sommerferien, aber Morgane freute sich nicht auf die Ferien, seit Virginie geboren wurde. Seitdem schien es, als verfolge sie eine Pechsträhne, als mache sie alles falsch. Sie versuchte sich zu erinnern, ob ihr eine schwarze Katze über den Weg gelaufen war, oder ob sie versehentlich den Weg unter einer Leiter hindurch genommen hatte, aber sie erinnerte sich nicht. Alles drehte sich nur noch um Virginie, doch da war keine Spur Neid, keine Angst, die Liebe ihrer Eltern zu verlieren. Denn die hatte sie nie gehabt.
Die Kinder in ihrer Klasse fuhren manchmal in den Urlaub ans Meer und Morgane stellte sich vor, wie es da aussah. Palmen und Eiskreme, tosende Wellen und warmer Sand.
Ihre Eltern fuhren niemals mit ihr irgendwohin. Die Kinder in ihrer Klasse bekamen an Weihnachten selbstgestrickte Pullover mit Schneeflocken darauf. Morgane wünschte sich sehnlichst einen selbstgestrickten Pullover, in dem man das Parfum ihrer Mutter noch lange riechen konnte, aber sie bekam nie einen. Einmal wünschte sie sich stattdessen selbstgestrickte Socken, weil sie dachte, das sei einfacher zu machen, doch immer, wenn ihre Mutter im Nähzimmer verschwand, strickte sie nur für ihren Vater Arthur. Und neuerdings für Virginie. Winzige Söckchen aus rosa Wolle, Strampler mit Rüschen und gehäkelten Bienen, Mützen mit grünen Bommeln, denn der erste Winter des Babys würde kommen, wenn auch erst in vier Monaten.
Doch es lag nicht an Virginie, das versuchte Morgane sich einzureden. Ihre Schwester war zu niedlich, zu zerbrechlich, um schuld daran sein zu können, dass Miche und Arthur sie mehr liebten als Morgane. Als sie einige Monate nachgedacht hatte, fiel ihr die Ursache ein wie Schuppen vor die Augen: Der Keks.
Als sie fünf Jahre alt gewesen war, hatten ihre Eltern Besuch von Freunden aus Lille bekommen, das ganz in der Nähe von Cassel lag, wo Morgane aufwuchs. Auf dem Tisch stand eine große Schale mit Keksen, die mit gelbem Zuckerguss überzogen waren. Während die Erwachsenen sich unterhielten, war Morgane um den Tisch herum geschlichen und hatte darauf gelauert, dass sie lange genug abgelenkt waren, damit sie ihren Arm ausstrecken, einen der Kekse herausziehen und sich damit unter dem Tisch verstecken konnte. Doch in genau dem Moment, in dem sich ihr Arm wie ein Schlange über den Tisch tastete und die Kekse erreichte, spürte sie einen Schlag. Eine kräftige väterliche Hand.
»Nicht stehlen!«, brüllte er und alle waren schlagartig still. Morgane schloss die Augen und machte sich ganz klein, aber es kam nichts mehr. Kein weiteres Brüllen, kein Klaps. Doch von da an musste es bergab gegangen sein, denn die Sache mit dem Keks war Morganes frühste Erinnerung, die sie rekonstruieren konnte, im Alter von neun Jahren, neunzehnhundertdreiundneunzig.
Es regnete nicht an diesem Ferientag, also schlich Morgane sich nach draußen. Seit diesem Frühling hatte sie einen eigenen Schlüssel, damit ihre Mutter sie nicht mehr von der Schule abholen musste. Sie drehte den Schlüssel so leise wie möglich im Schloss und lief dann über die Grand‘ Place nach draußen, bis sie genug Strecke zwischen das Haus ihrer Eltern und sich gelegt hatte.
Morgane setzte sich auf die Stufen vor der Kirche, die etwas versteckt hinter ein paar gesichtslosen Häuserreihen lag. Morgane sah nie jemanden hinter den Fenstern, deren Glas stumpf geworden war von den ereignislosen Jahren in dem kleinen Dorf. Sie wusste nicht, wer hinter dem roten Backstein lebte, wusste nicht, ob dort Kinder wie sie aufwuchsen und sich wie sie Sorgen um ihre Geschwister machten und um ihr eigenes Scheitern.
Was sie auch tat, sie tat es falsch.
Sie stützte die Ellenbogen auf ihre Knie und stieß kleine Kieselsteine mit dem Fuß weg. Es war ganz still um diese Zeit, nur in der Ferne hörte man die Straße. Hin und wieder würde die Kirchuhr schlagen und Morgane Stunden Zeit mitteilen, die sie hier schon saß. Sie hatte vor, bis zum Abendessen dort zu bleiben, wo sie keinen Schaden anrichten konnte. Wo kein Spülwasser auf den Boden tropfte und vor allem, wo sie nicht drohte, ihre kleine Schwester umzubringen. Sie bemerkte gar nicht, wie die ersten Tränen zu laufen begannen. Erst als sie auf ihre abgewetzten Schuhe tropften und sie dachte, es würde regnen, erschrak sie. Doch zum Glück war es kein Regen, der sie zurück nach Hause gezwungen hätte.
Eine Weile saß sie so da. Dann fischte sie die restlichen Murmeln, die sie noch besaß, aus ihrer Hosentasche und ließ sie eine nach der anderen die Stufen vor der Kirche herunterspringen. Sie sprangen hoch, kleine Tonsplitter platzten ab und die Murmeln kamen irgendwo unten an der Straße zum Halten, vielleicht verschwanden sie in der Kanalisation und landeten im Meer, in Freiheit.
»Entschuldigung?«, fragte eine fremde Stimme. Morgane sah auf. Vor ihr stand ein Mann mit schwarzen Haaren und schwarzen Augen, die sie freundlich ansahen. Er beugte sich zu ihr herunter und sie sah, dass er eine Kette mit einem Anhänger trug, der einen Flamingo darstellte. Ihr Vater fand, dass Männer keine Ketten tragen sollten, weil das tuntig sei. Sie wusste nicht, was das hieß, aber es klang nicht freundlich. Doch dieser Mann hier war freundlich.
»Entschuldigung, junge Dame. Du siehst wie jemand aus, der mir helfen kann, ich kenne mich hier leider nicht aus.« Er setzte sich neben sie auf die Stufe und ließ einen großen Seesack vor seine Füße fallen. Der Wind trug einen Hauch seines Geruchs zu Morgane. Lavendel, wie die gute Seife, mit der ihre Mutter nur Virginie badete. Unauffällig sog sie den Hauch ein, bis er ganz verblasst war.
»Ich weiß nicht, Monsieur«, sagte sie und schaute wieder auf ihre Fußspitzen. In Cassel gab es niemals Fremde und Morganes Herz schlug ein bisschen schneller. Fremde waren gefährlich, hatten ihre Eltern ihr eingeschärft und auch die anderen Leute im Dorf sahen es nicht gern, wenn jemand durch die Gassen strich, der nicht von hier war, denn die Leute, die hier lebten, trieben sich niemals einfach so draußen herum.
»Ich suche jemanden und du siehst aus wie eine kleine Detektivin.« Er zwinkerte ihr zu.
Sie? Eine Detektivin? Sie war Morgane, ein neunjähriges Mädchen mit strähnigen Haaren, Löchern in den Kleidern und Taschen, in denen sie nun nicht einmal den Schatz von Murmeln hatte. Sie hatte nichts und sie war niemand.
»Tut mir leid, Monsieur. Ich weiß nicht, was Sie meinen.«
Der Fremde sagte nichts mehr, sondern kramte in seinem Seesack und holte eine große, grüne Frucht heraus. Morgane hatte so ein Ding erst einmal gesehen, in einem Obstladen in der Nähe, aber ihre Mutter kaufte immer nur abgezählte Äpfel, einen pro Woche und Person. Der Fremde sagte nichts, sondern warf die Frucht wie einen Ball von einer Hand in die andere. Schmiss sie hoch in die Luft, drehte sich einmal um seine Achse und fing sie hinter seinem Rücken wieder auf.
»Wenn ich Pech habe, gibt es gleich Melonenmatsch«, sagte er und balancierte die Melone auf seiner Stirn. Morgane lächelte. Und als sich dann das Lachen nicht mehr in der Kehle halten ließ, hörte der Mann auf und setzte sich zurück neben sie.
»Ich wusste, dass dir das gefällt. Vielleicht trete ich damit mal im Zirkus auf. Magst du Zirkus?«
»Ich war noch nie da.« Manchmal gastierte ein kleiner Zirkus auf einem Festplatz im Nachbardorf, aber Morgane konnte immer nur sehnsüchtig das Zelt anschauen, wenn sie mit ihren Eltern auf dem Weg zu ihrer Oma daran vorbeifuhr.
»Jedes Kind sollte in den Zirkus gehen, so oft wie möglich. Sag das deinen Eltern.«
Morgane seufzte. »Das geht leider nicht. Wir haben kein Geld dafür. Ich habe jetzt eine Schwester.«
Der Mann sah begeistert aus. »Aber das ist ja großartig! In diesem Fall seid ihr zwei Kinder, die unbedingt in den Zirkus gehen müsst, das macht noch viel mehr Spaß.« Er kramte wieder in seinem Seesack und beförderte ein ledernes Etui ans Licht. Darin klimperten Münzen, die er daraus befreite und in Morganes Hände legte. »Sag deinen Eltern, du hast es dir für deine Detektivarbeit verdient. Ich bin mir nämlich sicher, dass du doch eine kleine Forscherin bist und mir helfen kannst.«
Dann erzählte er ihr eine Geschichte, die von einem Boot handelte, das er einmal in der Bretagne besessen hatte und von einem blonden Mädchen, in das er sich unsterblich verliebt hatte. Sie hatten in einer alten Sardinenkonservenfabrik zusammen Pfirsiche und Mandarinen gegessen und stellten sich vor, wie es wäre, zusammen in einem Haus in Südfrankreich zu leben, vor dem Stockrosen wuchsen und wo es jeden Tag Eiskreme gab.
»Leider habe ich sie nie wiedergesehen. Wir haben uns vor zehn Jahren aus den Augen verloren.« Er sah traurig aus und Morgane wollte ihm unbedingt helfen, auch wenn sie nicht wusste, wie. Zehn Jahre, das war unendlich viel, das war mehr, als sie alt war. Damals musste die Welt noch ganz anders ausgesehen haben und Morgane erinnerte sich an die schwarzweiß Fotos aus ihren Schulbüchern. Ob es damals noch keine Telefone gegeben hat? Kein Fernsehen, keine Kühlschränke? Sie fand den Gedanken aufregend und hing an seinen Lippen.
»Ich habe ganz vergessen, dir zu sagen, wer ich bin! Merde, das passiert mir immer wieder. Und ich vergesse auch zu fragen, wie Leute heißen, das ist ganz schön unhöflich.«
Aus Morgane platzte das Lachen heraus. Der Mann hatte das böse M-Wort gesagt, ganz frei von der Leber weg, und das, obwohl er erwachsen war. Wenn Morgane fluchte, so wie die Kinder in der Schule, gab es von ihrem Vater eine Backpfeife.
»Ich heiße Morgane«, sagte sie. Sie war nicht stolz auf ihren Namen, er klang so seltsam aus dem Mund der anderen, so fremd. So hart aus dem ihrer Eltern.
»Potzblitz, ist das ein schöner Name! Weißt du, dass er aus der Bretagne stammt, wo ich mal gelebt habe? Es ist der Name einer keltischen Prinzessin.«
Sie wusste nicht, was ‚keltisch‘ bedeutete, aber das mit der Prinzessin gefiel ihr. Manchmal stellte sie sich vor, eine zu sein, aber der Traum hielt nie lange an. Zu früh fielen ihr immer die Löcher in ihren unförmigen Kleidern auf, die ihrer Fantasie Grenzen setzten.
»Wenn man eine Prinzessin ist«, fuhr der Fremde fort, »darf man das nie vergessen, hörst du? Prinzessinnen dürfen alles und vor allem träumen. Sie sollen spielen, so viel sie wollen und wenn sie sich ein buntes Kleid wünschen, sollen sie es bekommen. Sag das deinen Eltern.«
Unterdessen hatte er ein großes Messer aus dem Sack gefischt und begann, die Melone zu zerschneiden. Morgane hatte nie gesehen, wie sie von innen aussahen, und war ganz überrascht, als knallrotes, duftendes Fleisch zum Vorschein kam. Es roch süß und ließ ihr das Wasser im Mund zusammenenlaufen und von Ferien am Meer träumen. Der Mann schnitt einen Keil heraus, der aussah wie ein großer Mund.
»Ein Melonenlächeln für Mademoiselle«, sagte er und reichte ihr ein Stück, das breiter war als ihr Gesicht. Das rote Fleisch war saftig, klebrig, erfrischend. Der neue Geschmack pflanzte ihr ein Lächelns in Herz. Es kam nicht oft vor, dass sie etwas Neues probieren durfte, das auch noch so gut schmeckte. Der Mann forderte sie dazu auf, die Kerne so weit wie möglich zu spucken.
»Bei uns im Süden pflanzt man Melonen auf diese Weise. So macht es am meisten Spaß.«
Sie aßen die ganze große Melone und Morgane wusste, dass an diesem Tag der beste Ferientag aller Zeiten war.
»Wie kann ich Ihnen jetzt helfen?«, fragte sie und ihre Stirn kräuselte sich.
Der Fremde schwieg einen Moment. »Du bist ein ganz besonderes kleines Mädchen, Morgane, das möchte ich dir noch sagen.« Er schien ihre Frage gar nicht gehört zu haben. »Ich bin hier, weil ich ein anderes Mädchen suche, das mir viel bedeutet. Sie heißt Amandine. Amandine Petit.«
Morgane konnte ihre Enttäuschung nicht verbergen. »Die kenne ich leider nicht.« Sie hatte den Namen noch nie gehört und wenn es in Cassel jemanden mit diesem Namen geben würde, hätte sie es gewusst. Die Frauen hießen Louise oder Chantal, Marguerite oder Marie. Amandine, das klang nach Paris, nicht nach dem Nord-Pas-de-Calais. Aber Petit, so hieß ihr Nachbar mit Nachnamen. Er lebte schon lange allein und hatte einen rothaarigen Sohn, aber keine Tochter, die so hieß.
»Ich hatte es befürchtet, nach so vielen Jahren.« Der Mann sah eine Weile in die Ferne und schien nachzudenken. »Sie war eine Prinzessin, wie du, aber wir haben uns verloren, vor zehn Jahren.« Er erklärte ihr noch, dass er ein Mädchen in seiner Heimat kennengelernt habe, eine junge Frau, die ihn aber nur heiraten wolle, wenn er diese Amandine vergessen konnte. Doch er konnte nicht.
Morgane freute sich, dass der Mann mit ihr redete wie mit einer Erwachsenen und ihr nicht dauernd sagte, dass sie nichts von diesen Dingen verstand. Morgane wollte auch jemand Besonderes für jemanden sein, wollte, dass man sie nicht vergaß, dass man sie so liebte wie dieser Mann die Frau, die es hier nicht gab.
»Weißt du, wo die Camargue ist? Wenn du dir eine Karte von Frankreich vorstellst und von Cassel eine gerade Linie bis ganz in den Süden zum Meer ziehst, triffst du Sainte-Marguerite-les-Flots, wo ich wohne. Dort scheint fast immer die Sonne. Es gibt Palmen und Pinien und Oleander, die in der Wärme des Sommers duften. Die Menschen pflanzen Tomaten und Melonen und fahren am Wochenende aufs Meer hinaus zum Angeln. Ich hätte das gerne mit Amandine geteilt.«
Morgane sagte nichts. Sie träumte. Vom Süden.
»Ich muss weiter«, sagte der Mann. »Vielleicht treffe ich hier jemanden, der sie kennt und mir sagen kann, wo ich sie finde.« Er zog noch eine Melone aus dem Seesack und schenkte sie Morgane. »Wassermelonen sind nicht der praktischste Proviant, aber sie erinnern mich an die Heimat.« Er seufzte und lächelte. »Lass sie dir schmecken und versprich mir, dass du eine Prinzessin wirst und gut auf deine Schwester aufpasst. Schwestern sind das Wichtigste im Leben.«
Er klang so lebendig und alles an ihm strahlte. Sie kannte niemanden hier im Dorf, der so war wie er.
»Versprochen«, sagte sie und wusste, dass man alles für die Menschen tun musste, die man liebte und die einen mit gleicher Kraft zurückliebten. Sie erinnerte sich ihr ganzes Leben an den Fremden, und sie bedauerte es, ihn nicht nach seinem Namen gefragt zu haben. Das Geld, das er ihr für den Zirkus gegeben hatte, hat sie für immer in ein Taschentuch eingewickelt in einer Box unter ihrem Bett aufbewahrt. Auch dann noch, als der Euro den Franc abgelöst hat und die Münzen grünlich anliefen und stumpf wurden, wie die Jahre der Sorgen und des Fehlens, die folgten. Und noch im Dezember lief Morgane jeden Tag zu dem Platz vor der Kirche und sah nach, ob Melonen wuchsen. Vergebens.
Kapitel 2: Virginie 2016, Schlüsselanhänger
Virginie Pétrusse kannte diesen Ort nur zu gut. Lille, Boulevard de la Liberté. Dieser Name kam ihr wie Hohn vor, denn Freiheit hatte sie jetzt mehr als genug. Noch vor einigen Tagen war das blaugraue Gebäude im Zentrum ihr Arbeitsplatz gewesen, aber als sie jetzt durch die Tür unter dem Schild des Pôle Emploi ging, war es nicht mehr dasselbe. Sie musste eine Nummer ziehen und dann den demütigenden Gang in eines der Büros ihrer Ex-Kollegen gehen, die sich nur zu gut an sie erinnerten. Virginie Pétrusse war das Gesprächsthema schlechthin und würde es wohl noch einige Zeit bleiben, denn so ereignisreich war der Bürojob beileibe nicht. Raum genug also für Klatsch und Tratsch. Sie war gefeuert worden, in hohem Bogen.
Virginie ließ sich keine Schwäche anmerken, als sie das Büro von Liliane Dumas betrat, die mit ihren einundzwanzig Jahren zwei Jahre jünger war als sie selber. Formell, als sei sie eine Fremde, wies sie ihr einen Platz zu und musterte sie eindringlich, ihren Kugelschreiber zwischen ihren Fingern drehend. French Nails, professionell gemacht. Ihre dunklen Augen blitzten unter dem Pony hervor, der ihr halb ins Gesicht hing und sich immer wieder in ihren Wimpern verfing. Virginie würde niemals so aussehen wollen.
»Salut Lili, du Miststück«, hätte Virginie sie gerne begrüßt, schwieg aber weise. Sie saß hier auf der falschen Seite des Tisches und das behagte ihr ganz und gar nicht. Während Liliane ihre Personalien durchging, als hörte sie das erste Mal im Leben von Virginie Pétrusse, verschränkte diese die Arme vor der Brust und machte es sich auf dem harten Stuhl so bequem wie möglich. Füße ausstrecken, auf die Vorderkante rutschen und die Spitzen ihrer Chucks ansehen. Sie trug demonstrativ ihr Anarchisten-T-Shirt mit dem großen A darauf und ihre abgewetzte, schwarze Jeansjacke. Ihre Rastazöpfe hatte sie zu einem Dutt oben auf dem Kopf gebunden, so hoch wie möglich, so stolz wie möglich. Zu seinen Ansichten muss man stehen, ebenso zu dem, was man getan hatte.
»Mademoiselle Pétrusse«, begann Liliane Dumas ihren Satz, »ich kann Ihnen keine Leistung gewähren. Ihre Kündigung war nicht betriebsbedingt, sondern verhaltensbedingt, sodass Sie keinen Anspruch auf Leistung haben. Das sollte doch bekannt sein.«
Unter gewöhnlichen Umständen wäre Virginie in ihr lautes Lachen ausgebrochen, verursacht durch die alberne Anrede, die sich Lili offenbar nicht verkneifen konnte, sondern noch genüsslich auskostete. Aber das, was sie danach gesagt hatte, war einfach zu viel.
»Was?!«, entfuhr es ihr und sie sprang auf. »Das glaube ich nicht!«
»Tut mir leid, aber so sind die Regeln. Du kennst sie genau, Virginie. Das hier hast du selber verschuldet.« Liliane hatte sich zurückgelehnt, um mehr Distanz zwischen sich und der bedrohlich vor ihr stehenden Virginie zu schaffen, die sie überragte.
Diese hieb mit der Faust auf den Schreibtisch, sodass Liliane vor Schreck zusammenfuhr.
»Habe ich nicht! Ich habe das Recht zu demonstrieren wie es mir passt und wo ich will! Reicht es nicht, dass ihr mich hier rechtswidrig rausgeworfen habt? Schickt ihr mich jetzt auch noch auf die Straße?«
Der Anflug eines hämischen Lächelns zeigte sich in Lilianes Mundwinkel. »Nun ja, die Straße scheint dir nicht fremd zu sein«, sagte sie und blickte an ihrer ehemaligen Kollegin herab.
»Lieber lebe ich auf der Straße, als von euch Geld zu erbetteln.« Virginie versuchte diesem Satz einen stolzen Tonfall zu geben und das gelang ihr nicht schlecht. Sie sah, dass Liliane mit ihrem Bürostuhl immer weiter vom Tisch abgerückt war, je mehr sie sich vorlehnte. Virginie war von großem Wuchs und ihre Klamotten konnten gar nichts anderes bewirken als Liliane abzustoßen.
»Gut, dann wäre das geklärt. Ich soll dir übrigens noch das hier geben. Das war noch in deinem Schreibtisch«, sagte die junge Arbeitsvermittlerin und holte einen kleinen Karton aus ihrem Büroschrank. Darin befand sich neben unzähligen Schokoriegel-Verpackungen und hart gewordenen Gummibärchen auch ein Buch in rotem Einband. Es war Das Kapital von Karl Marx. Virginie nahm es heraus und steckte es in ihre Tasche, bevor sie den Karton zurück auf den Schreibtisch knallte. »Den Rest schenke ich euch«, sagte sie und drehte sich zur Tür um.
»Hey, Virginie!«, rief Liliane sie zurück. »Zwei Sachen noch, die du wissen solltest. Erstens: Erwarte keine weitere Post von uns. Du bist unvermittelbar. Ich denke, du weißt das. Zweitens: Als Arbeitsvermittlerin und Ex-Kollegin kann ich dir den Rat geben, über eine Laufbahn als Komikerin nachzudenken. Wir haben uns alle köstlich amüsiert, weißt du.« Bei diesem letzten Satz brach Liliane in Lachen aus und bedeute Virginie mit einem Wink ihres Kugelschreibers, ihr Büro zu verlassen.
Natürlich knallte sie die Tür. Natürlich spuckte sie gegen das Glasfenster. Natürlich kam der Sicherheitsdienst und zog sie grob an den Armen hinaus auf das graue Pflaster des Bürgersteigs. Es war Virginie gleich, und ja, ein bisschen gefiel es ihr auch. Es war ihre Rolle, die sie mit Bravour spielte. Fand sie selber.
Es hatte angefangen zu regnen, einen Schirm hatte Virginie natürlich nicht, das war nicht ihr Stil. Eine Revolution kann man schließlich nicht anzetteln, wenn einen schon der Regen in die Knie zwang.
»Hey, das ist mein Revier! Verpiss dich!«, wurde sie grob verscheucht, als sie an der Bushaltestelle wartete. Ein junger Obdachloser mit gelbem Irokesenhaarschnitt und einem Tattoo im Gesicht war auf sie zugekommen. Alle Umstehenden starrten sie an. Eigentlich hätte sie jetzt zurückgeblafft, ob sie etwa aussehe wie eine Bettlerin, aber das konnte sie sich selber mit einem Ja beantworten.
»Alles gut, Mann. Ich warte auf den Bus.«
Der Mann, wohl noch jünger als sie selbst, schaute finster und skeptisch.
»Wirklich, ich mache keine Platte.« Virginie kramte zwanzig Euro aus ihrer Hosentasche und reichte sie ihm. »Hier, wir teilen, Kumpel. Kannst wieder abzischen.«
Er kniff zweifelnd die Augen zusammen, während Virginie bemerkte, wie die Leute um sie herum sich zurückzogen und abwandten. Dann griff er nach dem Schein und schlurfte in dem Moment davon, in dem der Bus vorfuhr.
Virginie setzte ihre Kapuze auf und lehnte den Kopf gegen die Fensterscheibe. Aus ihrer Jackentasche holte sie einen Schlüsselanhänger ohne Schlüssel. Einen jener Sorte, die einem viel zu schade als Schlüsselanhänger sind. Falls der Schlüssel mal verloren ginge, wäre auch der Anhänger verloren. Es war eine kleine silberne Münze, in die das Relief zweier Flamingos gestanzt war, die mit ihren Köpfen und Hälsen ein Herz bildeten. Virginie fuhr in Gedanken verloren mit dem Finger darüber, so wie immer, so wie früher. Als Kind hatte sie darauf herumgekaut und sie erinnerte sich noch gut an den kühlen, metallischen Geschmack des Edelstahls.
»Kein schönes Wetter, nicht wahr?«, riss eine leise aber deutliche Stimme sie aus ihren Gedanken. Ihr gegenüber saß ein Mann in hellbraunem Mantel, dessen Schultern dunkel verfärbt vom Regen waren. Sie musterte ihn aus ihren klaren, hellbraunen Augen.
»Nein«, sagte sie kurz und lehnte den Kopf zurück an die Fensterscheibe. Sie schloss auch die Augen, um sich zurück in ihre Welt zu ziehen. Sie brauchte jetzt Ruhe. Auflehnung kostete Kraft. Aber die Stimme des Mannes zerrte an ihr, seine Blicke saugten sie zurück in das Innere des Busses, dem sie eigentlich entschwinden wollte.
»Ich fand gut, dass Sie dem Jungen das Geld gegeben haben. Das macht nicht jeder, weil die Leute denken, dass er sich damit Drogen kauft. Aber das können sie ja gar nicht wissen und außerdem geht es sie nichts an. Jemand, der arbeitet, bekommt auch einfach Geld, ohne dass man weiß, wie viel davon derjenige für Alkohol und Zigaretten ausgibt, nicht wahr?«
Virginie öffnete ihre Augen wieder und heftete ihren Blick auf das Gesicht des Mannes, der so viel Blödsinn erzählte und an ihren Nerven zerrte.
»Ich bin nicht an einem Gespräch interessiert«, sagte sie scharf und streckte ihre Beine so weit aus, dass der Mann seine Füße zu sich heranziehen musste.
»Das habe ich mir auch gesagt, als ich eine Einladung von Ihnen erhielt und beim Pôle Emploi antanzen musste.« Er lehnte sich so weit vor, dass Virginie jede Falte in seinem Gesicht sehen konnte und die einzelnen grauen Haare an seinen Schläfen.
»Sie...«, brachte sie hervor, die Augenbrauen fragend zusammengekniffen.
Der Mann nickte. »Letztes Jahr. Ich war Bankkaufmann und Sie haben mich ins Altenheim gesteckt. Das war das Beste, was mir passieren konnte.«
Virginie war seltsam erleichtert. »Das… das freut mich, Monsieur. Wirklich«, betonte sie und hoffte, dass ihre Haltestelle bald näher kam.
»Haben Sie schon eine neue Stelle in Aussicht?«, fragte er. Jetzt war es an ihm, sie wissend zu mustern.
»Woher wollen Sie wissen, dass ich dort nicht mehr arbeite?«
Mit seinem Lachen hatte sie nicht gerechnet. »Sie waren gut. Die Besten feuert man zuerst, weil sie eine Gefahr darstellen, nicht wahr? Denke selbst und du hast das letzte Mal selbst gedacht. Man muss mit dem Strom schwimmen. Ich habe die Erfahrung gemacht und Sie jetzt auch. Warum machen Sie nicht etwas ganz anderes?«
Virginie drückte auf den Halteknopf und stand auf. Ihre Geduld war am Ende. Womöglich verfolgte dieser Typ sie auch noch, das passierte ja nicht selten bei Mitarbeitern im Kundenservice, Verrückte gab es überall. »Ich muss jetzt gehen«, sagte sie. Gehen würde sie tatsächlich müssen, ihr Ziel war eigentlich noch einige Haltestellen entfernt.
»Warten Sie!«, rief er sie zurück. »Sie haben etwas verloren.« Er reichte ihr den Schlüsselanhänger. »Wussten Sie, dass Flamingos Nester aus Schlamm bauen?«
Alles hätte gut werden können für Virginie Pétrusse. Studium der Verwaltungswissenschaften, danach ein Job in einer Bibliothek und dann in der Arbeitsagentur, ein halbes Jahr lang. Dreiundzwanzig Jahre alt, hochgewachsen, intelligent. Mit siebzehn hatte sie Thomas getroffen, dessen Lieblingsfarbe weiß war und sie veranlasste, nur noch weiß zu tragen und sich im Sommer Gänseblümchen in die Haare zu stecken. Mit siebzehneinhalb heulte sie sich die Augen aus dem Kopf und schwor sich, nie wieder Gänseblümchen zu mögen und färbte alle ihre Klamotten schwarz. Mit zweiundzwanzig traf sie Lucas, piercte sich die Nase, zerriss ihre Jeans und kaufte im Intermarché ein Päckchen mit Sicherheitsnadeln, um sie wieder zu flicken. Sie ließ sich Rastazöpfe machen und ging zu Demonstrationen der kommunistischen Gewerkschaft. Täglich dachte sie daran, wie sie Lucas kennengelernt hatte, auf dem Pont Napoléon in Lille. Er hatte sich über das Geländer gelehnt und ließ Spuckefäden in das dunkle Wasser tropfen. Eine Sohle war vom Schuh halb abgelöst und klappte rhythmisch, als er mit dem Fuß wackelte.
»Pass auf, dass du nicht hineinfällst«, hatte Virginie ihn angesprochen. »Oder weißt du nicht, dass der Fluss auch durch Hénin-Beaumont fließt, jener Stadt mit einem Bürgermeister des Front National? Aus politischen Gründen würde ich‘s mir zweimal überlegen, bevor ich mich so weit raus lehne.« Die Sonne hatte den Sommerhimmel blau gefärbt und Virginies lange, glatte Haare beinahe rot. In der Zeit zwischen Thomas und Lucas trug sie alles, was sie in Modezeitungen fand und ließ ihre Haare so schneiden wie Jennifer Aniston ihre. Sie hoffte, es gefiel den Leuten.
Lucas starrte sie an und machte eine Kaugummiblase. Grün. Sein Fuß wippte nicht mehr. »Wie bist du denn drauf?« spottete er, aber sie sah das Blitzen in seinen Augen. Virginie wollte weitergehen, aber er ließ sie nicht. »Gefällt mir!«, sagte er und versperrte ihr mit verschränkten Armen den Weg. »Haste Bock, mit zur Demo zu gehen? Diesen Freitag, durch die Innenstadt.«
»Warum nicht?« Es sollte gleichgültig klingen. »Schicke Schuhe übrigens. Heilarmee?«
»Nein, selbst abgespachtelt, die Sohle. Ich mach‘ dir auch so welche, wenn du willst.« Er trat auf ihre Sneaker und hinterließ einen Abdruck auf dem Wildleder. »Und bessere Klamotten kriegst du auch. So lassen sie dich gar nicht rein, Jennifer.«
»Virginie.«
»Virginie… Mag ich nicht. Ich nenne dich Veggie, ok? Du bist doch Vegetarierin?«
War sie nicht.
»Ja klar!«
Sagte sie.
Ein halbes Jahr später, 15. März. Lille trug Nebelgewand und Virginie einen Stoffbanner in ihrem Rucksack. Mit schwarzem Lippenstift hatte sie sich die drei Buchstaben der Gewerkschaft auf die Stirn gemalt und war froh, dass es nicht spiegelverkehrt war, denn dann wären ihr die Blicke der Menschen im Bus unangenehm gewesen, so jedoch sonnte sie sich darin. Das Banner fand sich dank Saugnäpfen später an der Verglasung des Eingangsbereichs des Pôle Emploi wieder und Virginie selber wie immer an ihrem Platz. Sie befreite das Proletariat. Ihre Kunden schauten ihr keine Sekunde in die Augen, sondern wahlweise auf ihre Stirn oder auf ihre eigenen Hände. Es dauerte eine halbe Stunde, bis der Chef durch die Glastür ihres Büros stürmte und beinahe mit seiner Stirn dagegen gestoßen wäre.
»Das Proletariat ist ab sofort von seinen Aufgaben entbunden!« Ungesunde Gesichtsfarbe, gepresste Stimme.
Zehn Minuten später stand Virginie auf der Straße, der Sicherheitsdienst knüllte das Banner zusammen und drängte sie, zu gehen. Sie hatte auf die Presse gehofft, aber wenigstens Lucas stand auf der anderen Straßenseite und machte Fotos. »Großartig, Veggie!«, rief er und streckte den Daumen nach oben. »Du hast das für die Bewegung gemacht, vergiss das nicht. Das Arbeitsamt knechtet das Volk«, sagte er später immer wieder, wenn ihr Zweifel kamen und sie sich daran erinnerte, tatsächlich Menschen geholfen zu haben, ihnen Arbeit besorgt zu haben, während ihr selber Arbeit nichts bedeutete. Sie konnte keine Leidenschaft für irgendetwas aufbringen.
»Was ist schon Arbeit, Veggie? Arbeit ist die Einkommensquelle der Vergangenheit, nicht der Zukunft. Die Zukunft ist, solidarisch zu sein. Denk an Albert Camus, das war der Tag der Rechtfertigung. ‚Le jour de la justification‘, erinnerst du dich? Wir müssen handeln, nicht nur reden. Das Leben ist sowieso absurd, also lehne dich dagegen auf.« Er spielte auf das Theaterstück Die Gerechten an, das sich um russische Untergrundkämpfer drehte.
Virginie konnte immer nur nicken und verlor den Faden, wenn er redete. Sie hörte seiner Stimme zu und redete sich ein, alles würde gut werden.
»Warum machen Sie nicht etwas ganz anderes?« Die Frage hallte in ihrem Kopf nach, während der Schall im Treppenhaus nur ihre Schritte an die Wände warf. Etwas ganz anderes, etwas Unerwartetes, etwas Verlockendes. Der Mensch ist ein Abenteurer, kein Nesthocker. In Virginie keimten Hoffnung und Lust auf Veränderung auf und versuchten die Angst zu verdrängen, die in ihrem Körper wummerte. Noch eine Etage bis zu Lucas‘ Wohnung, die sie für ihn besorgt hatte. Zwei kleine Zimmer im Süden von Lille, doppelt so groß wie das Appartement in der Altstadt, in dem er gehaust hatte, als sie sich kennenlernten. Gehaust, ja. Eine Kammer unter dem Dach, Heimat von Spinnen, Essensresten und Plakaten über den Schimmelflecken an den Wänden. An ihrem ersten Abend hatte sie pudrige Streifen von zerdrückten Motten auf seinem Bettlaken gefunden.
»Wir zwei sollten mit der Umverteilung beginnen«, hatte er ihr zugeraunt und Virginie hörte es nur halb, die andere Hälfte ihrer Sinne war mit dem Ausweichen des Mottenflecks und dem Feuerwerk auf ihrer Haut beschäftigt, das sich unaufhaltsam ausbreitete. »Möchtest du teilen?«, fragte Lucas noch und Virginie konnte nur nicken. Wie auch immer er das gemeint hatte, teilen klang gut.
Nun also floss das Geld von ihrem Konto, ihr Name war in seinen Mietvertrag tätowiert und es waren ihre Tränen, die unaufhaltsam flossen, als sie vor der grünen Tür wartend klingelte. Sie wünschte sich, sie wären zusammengezogen, aber davon hatte Lucas nie gesprochen.
»Ich bekomme kein Geld vom Amt.« Ihre Stimme hatte Mühe, in einer Spur zu bleiben. Hinter dem Vorhang aus Salzwasser erblickte sie Lucas in seinen blauen Boxershorts. Er fuhr sich durchs Haar.
»Wir bekommen kein Geld?«
»Ja, ich bekomme kein Geld. Selbstverschuldete Kündigung, kein Geld.«
»Oh, das...«, stotterte Lucas und schloss die Tür hinter sich. Sie standen beide im Flur. »Das tut mir leid, für uns beide. Ich meine… was ist jetzt mit der Wohnung?«
»Fragst du dich nicht, was jetzt mit mir ist? Dein Plan ging nicht auf.« Virginie hatte sich auf ihn verlassen, auf seine Ideen, seine Vision.
Ein leichtes Kratzen hinter der Tür gegenüber verriet einen neugierigen Nachbarn, der durch das gebogene Glasauge der Tür starrte.
»Kann ich rein?«
Lucas verschränkte die Arme vor der blanken Brust. »Hör mal, Virginie...« Virginie. Der Name klang fremd aus seinem Mund. »Es passt gerade nicht.«
Die Farbe wich ihr aus dem Gesicht. »Was heißt das, es passt gerade nicht?«
Die grüne Tür zur richtigen Antwort öffnete sich auf den Punkt, ein blondes Mädchen mit Handtuch um den schmalen Leib gewickelt störte die Szene. »Lucas, was ist hier los? Oh.. hi!« Sie schaute Virginie von oben bis unten an. Ihr Pony bewegte sich, wenn sie mit den Augen blinzelte.
Lucas deutete ungelenk auf Virginie. »Das ist eine Freundin von mir. Veggie.«
»Veggie? Cooler Name. Ich bin Arlette. Willst du reinkommen?«
»Nein, danke«, quälte Virginie aus ihrer zugeschnürten Kehle heraus. »Ich muss gleich wieder los. Ich wollte noch ein gegrilltes Hähnchen… mit nach Hause nehmen. Das schmeckt frisch am besten und daher… Ich muss mich beeilen.«
Arlette war im Türrahmen erstarrt und Lucas verschwunden. »Alles klar, Veggie… Komm doch mal wieder vorbei, wenn du mehr Zeit hast, ich lerne gerne Lucas‘ Freunde kennen, er kennt ja so aufregende Leute.«
Virginie begann die Treppen herunter zu stolpern, nachdem sie außer Sicht war. Arlette. Arlette. Arlette. Ein vergifteter Name, für alle Zeiten. Ihr Herz brannte, stand lichterloh in Flammen, leckte an ihren Organen, raubte ihr den Atem.
»Virginie!« Lucas musste ihren Namen zweimal rufen, ehe sie ihn hörte. Sie beschleunigte ihre Schritte, so weit es ihre wackligen Knie zuließen. »Virginie, warte doch mal«, rief er ärgerlich. Das Hemd war schlampig zugeknöpft und sie konnte das daran haftende Parfüm bis zu sich hin riechen. »Bitte, Virginie. Sei mir nicht böse. Wir sind so gute Freunde.« Er wollte ihre Hand nehmen, aber sie zog sie weg. »Weine nicht, Veggie. Ich kann nichts dafür, dass du geglaubt hast, dass… naja, du weißt schon. Wir sind gute Freunde, Veggie. Ich möchte dich deswegen nicht verlieren.«
Scham breitete sich als nächstes in ihrem Herzen aus und verdrängte das Feuer, erstickte ihre Stimme, zerstreute Worte. Der Bus kam die Straße hoch und würde sie gleich fortbringen von hier, egal wohin.
»Es tut mir leid.«
Nein, tat es ihm nicht, dachte Virginie.
»Kommst du am Samstag zur Kundgebung?«
Keine Antwort hieß nein.
In der Innenstadt stieg sie aus. Ein eisiger Wind pfiff durch die Straßen und trocknete ihre Tränen, eine weiße Spur hinterlassend. Lucas, Sonne ihres Lebens. Wie sie sich getäuscht hatte und wie sie sich jetzt schämte. Hatte sie wirklich gedacht, sie bedeute ihm etwas? Wie töricht, wie töricht. Ein schönes altes Wort für einen so immergrünen Irrtum. Sie hatte ihre Liebe in den Sand gemalt und die nächste Welle trug sie davon.
Pont Napoléon, das Wasser wirbelte im Flussbett, hinein in schwarze Tiefen. Virginie hätte es romantisch gefunden, sich in die Fluten zu stürzen und sich vorzustellen, wie Lucas ein schlechtes Gewissen bekommen würde. Und wie Morgane um sie weinen würde, ihre Schwester. Aber statt Tränen der Rührung vor Selbstmitleid waren es Tränen des Entsetzens, als sie bemerkte, dass das auch schon alle waren, die ihr Tod etwas angehen könnte.
Virginie war der mutloseste Mensch, den sie selber kannte. Sie trat einen Schritt nach vorne, so weit sie sich traute, lehnte sich über das Geländer, bis ihr Körper einer Waage gleich in der Luft hing und der Stahl ihr hart in den Magen drückte. Wenigstens einen winzigen Moment Gefahr spüren, um das Entsetzen zu verdrängen, dann würde es ihr bessergehen.
»Entschuldigung, ich suche das Rathaus. Können Sie mir helfen?« Eine Stimme direkt hinter ihr.
Virginie erschrak.
Verlor das Gleichgewicht.
Hatte nicht einmal Zeit zu schreien.
In diesem Augenblick brach die Sonne durch ein Wolkenloch und der Fluss trug sie davon, in seinem Nest aus Schlamm.
Kapitel 3: Morgane 2016, Murmeln
Die Sonne brach durch ein Wolkenloch am Abendhimmel Nordfrankreichs und ließ sich durch das kleine Kellerfenster fallen. Marcel sang ein Lied mit Fantasieworten, als er die große Holzkiste ausräumte und den Inhalt in einer Reihe auf den Boden sortierte.
»Mama, der Müllsack knistert.«
»Ja, mein Engel. Der Müllsack knistert.«
»Er ist zu laut.«
Morgane entgegnete nichts mehr, sie räumte weiter angespannt alte Sachen in einen großen Beutel und strich sich hin und wieder eine braune Haarsträhne aus dem Gesicht. »Wollen wir uns nachher Waffeln backen, mein Engel? Wir haben uns eine Stärkung verdient, wenn die Arbeit hier getan ist.« Marcel antwortete nicht, sie drehte sich um. Er stand vor dem weißen Schrank ganz hinten im Keller, den Morgane üblicherweise immer verschlossen hielt. Darin: Kanister. Benzin. Gesammelt, über Jahre. Sie sprang auf und ärgerte sich über ihr Versäumnis.
»Müssen wir hier auch aufräumen, Mama? Was ist das?«
Sie schob den Fünfjährigen vorsichtig aber sichtlich nervös beiseite.
»Nein, hier ist schon aufgeräumt.«
»Was ist das?«, fragte er erneut.
»Nur Putzmittel, das dürfen Kinder nicht anfassen, hörst du? Der Schrank ist tabu.« Den erhobenen Zeigefinger verstand Marcel immer. »Wir haben für heute genug aufgeräumt, das reicht jetzt. Lass uns wieder nach oben gehen und Waffeln backen.«
Unter dem bläulichen Licht der Badezimmerlampe sah sich Morgane als alte Frau, die Falten zu stark, ihr Haar zu dünn und strähnig. Über fünf Jahre hatte sie sich vor dem Keller gedrückt, aber das war jetzt vorbei. Irgendwann muss man seine Vergangenheit wegräumen, forttragen und an die Straße stellen. Als sie aus dem Bad kam, lächelte sie. Die Sonne war zurück im Nord-Pas-de-Calais und die schwere, nasse Erde trug endlich den Frühling in sich. Während Marcel in dem kleinen Wohnzimmer spielte, rührte Morgane den Waffelteig an. Der Duft von Butter und Zucker lullte sie ein und verdrängte jeden dunklen Gedanken.
Morgane, Erzieherin und alleinerziehend. Zweiunddreißig. Klein, zierlich geradezu, was man von ihrer Nase nicht behaupten konnte. Aber ihre braunen Augen waren ansehnlich, wenn auch zu weit auseinander stehend für ihr kleines Gesicht. Sie liebte das Backen und träumte von einem Parfüm aus Wassermelone, Pfirsich und Sommererde, was der einzige Traum war, den sie sich erlaubte. Sie sah gerne Fernandel-Filme und hegte eine Schwäche für den Schauspieler Jean-Pierre Léaud, wie er neunzehnhundertsechsundsiebzig war. Wenn es regnete, fuhr sie den Weg der Tropfen auf der Fensterscheibe mit den Fingern nach und zählte, wie oft sich ihre Wege kreuzten.
Der Teig wirbelte zwischen den Streben des Schneebesens und versprach ein Land, in dem Milch und Honig flossen. Ein lautes Geräusch und ein Schrei ließen sie aufschrecken und binnen Sekunden in das Wohnzimmer stolpern.
»Mama!« Marcel stand auf dem Teppich und hielt seine kleinen Hände auf beide Ohren gepresst, während auf dem Parkett im gesamten Raum Glasmurmeln verteilt waren. Blaue, rote, durchsichtige mit gedrehtem Plastik darin. Tränen des Entsetzens standen in seinen Augen, seine Arme zitterten.
Murmeln bohrten sich in Morganes Fußsohlen, aber sie nahm es kaum wahr. Sie griff nach Marcels schmalem Körper und trug ihn hinaus auf dem Flur.
»Du brauchst nicht weinen, es ist vorbei. Hörst du? Es ist vorbei. Die Stille ist wieder da, hab keine Angst.« Sie drückte ihn an sich und strich ihm über den Kopf, mit seinen feinen dunklen Haaren. Aus einer Kommodenschublade fischte sie seine Ohrenschützer und setzte sie ihm auf. Marcel entspannte sich und fühlte, ob die Schmetterlingssticker, die er auf die harten Schalen geklebt hatte, noch da waren.
Morgane schloss die Tür hinter sich, als sie allein im Wohnzimmer war. Entsetzt starrte sie den Schuhkarton an, der auf dem Teppich stand, ein Gruß aus der Hölle. Die Briefe, die sie darin verpackt hatte, hatte Marcel nicht angerührt, aber das Glas mit Murmeln musste ihn angezogen haben, natürlich. Ein Kinderspiel, Murmeln. Die Hitze stieg ihr ins Gesicht und ließ sie panisch werden, die Murmeln mit dem Fuß zusammenschiebend, wo wie wieder auseinanderstoben und sich erneut auf dem Parkett verteilten wie Lebewesen. Eilig schüttete sie Hand um Hand achtlos in den Karton zurück. Die Kälte des Glases erschreckte sie. Das Wiedererkennen verbarg sich hinter ihrem Tränenschleier und doch glaubte sie sich an die ein oder andere zu erinnern, spürte sie wieder und wieder auf ihrer Haut, hörte den winzigen dumpfen Aufschlag auf ihren Knochen. Murmeln, nur Murmeln. Ein Kinderspiel.
Sie brachte den Karton zurück in den Keller und verschloss ihn in dem weißen Schrank.
Marcel saß in der Küche und ließ die Füße baumeln. Der Geruch von Butter und Zucker ließ ihn ein Lied vor sich hinsummen. Morgane kniete sich vor ihn hin.
»Geht es dir besser? Sind deine Ohren wieder in Ordnung?«
Marcel nickte. »Das Lied hat geholfen. Singst du es mit mir?«
Morgane war erleichtert. »Ja, mein Engel. Nachher. Lass uns erst zusammen Waffeln backen. Und du musst mir versprechen, nie wieder etwas aus dem Keller mit nach oben zu nehmen, ohne mich zu fragen.« Sie wischte sich die letzten Tränen vom Gesicht.
»Du darfst nicht mehr weinen, Mama. Ich nehme nie wieder etwas einfach so.«
Morgane fühlte sich schlecht. »Aber ich weine doch nicht wegen dir. Ich habe mir den Zeh an der Tür gestoßen, nichts Schlimmes. Hörst du? Nicht wegen dir, mein Engel.«
»Aber du hast doch Hausschuhe an, Mama!«
Ihr Engel, ihr besonderer Junge. Noch würde er ihr glauben, aber er wuchs so schnell und sein weiser Blick ging ihr durch und durch.
»Ich habe mir sehr doll den Zeh gestoßen, da hilft der Hausschuh nicht viel.« Sie lächelte ihn an.
»Ich bastele dir neue Schuhe. Ich kann vielleicht welche mit Holz machen. Kann ich die Klebe haben, Mama?«
»Später. Alles später. Erst essen und dann singen wir.« Sie goss eine Portion Teig auf das Waffeleisen.
»Versprichst du mir, nicht böse zu sein?«
Sie hielt inne und drehte sich zu ihm um. »Warum sollte ich dir böse sein?«
»Ich habe noch etwas aus dem Karton herausgenommen. Es sah so schön aus. Mama, was ist das?«
Er öffnete seine linke Faust, die einen silbernen Schlüsselanhänger in Form zweier Flamingos hervorbrachte.
Knapp eine Stunde lag zwischen dem Telefonklingeln mit der fremden Stimme am anderen Ende der Leitung und Morganes Eintreffen im Krankenhaus. Geruch von Desinfektionsmittel, grelles Flurlicht. Nervös schob sie Marcel mit seinen dicken Kopfhörern vor sich her und sie bemerkte erst, dass sie ihre Jacke falsch zugeknöpft hatte, als Virginie sie darauf aufmerksam machte. Morgane weinte.
»Meine kleine Schwester«, brachte sie nur erstickt hervor und Virginie lehnte sich nach vorne, um sie zu trösten.
»Hey, bitte wein doch nicht. Denk an Marcel.«
Der Junge setzte sich in eine Ecke und sah den beiden Frauen zu, seine Hände spielten mit dem Schlüsselanhänger.
»Sag bitte, dass es ein Unfall war.«
Virginie seufzte. »Das habe ich schon erzählt. Den Ärzten.«
»Und was ist die Wahrheit?« Morgane war ärgerlich. Es war nicht das erste Mal, dass sie ihre Schwester in einem Krankenhaus besuchte. Mit zehn hatte sie sich eine brennende Wunderkerze in die Nase gesteckt, mit vierzehn versucht, ihre abstehenden Ohren mit Sekundenkleber anzulegen. Später die Komplettrasur ihrer schönen langen Haare, wobei die Doppelklinge unglücklicherweise ein Ohr erwischte, obwohl es nicht mehr sekundenklebermäßig anlag. Aber in einen Fluss gesprungen war sie nie, die Absicht zu sterben hatte sie noch nie gehabt.
»Immer muss man auf dich aufpassen, immer«, sagte Morgane halb ärgerlich, halb erleichtert. Emotionslos berichtete die ihr von Lucas, Verzweiflung sprach aus ihrem Satz, sie könne das Durchknallen ihrer Leitungen im Kopf nicht kontrollieren.
»Ich schwöre, ich habe nur ganz kurz darüber nachgedacht zu springen, jetzt wo mein Leben sinnlos ist. Aber ich hätte es nie getan. Der Tourist hat mich aus dem Konzept gebracht, ich hatte die perfekte Balance gefunden.« Sie holte Luft und seufzte. »Ich habe mir den kleinen Finger gebrochen, guck.« Virginie hielt Morgane den Verband entgegen. »Kannst du bitte was draufschreiben? ‚Geschieht dir recht, Idiotin‘ würde mir gefallen. Und hast du mir Schokolade mitgebracht?«
Morganes Tränen waren versiegt. »Nein, habe ich leider nicht. Du dummes Kind«, sagte sie und verzog den Mund zu einem kleinen Lächeln.
»Meinst du, ich sollte freiwillig in die Psychiatrie?«
Morganes Lächeln erstarb und hinterließ in ihrem Gesicht nur die leere Hülle dessen. »Nein, natürlich nicht. Du bist nur ein besonderes Mädchen.«
Psychiatrie, das Wort klingelte in ihren Ohren. Der Albtraum dieses Tages endete wohl nie.
»Ich habe mega Kopfschmerzen und ich bin müde wie ein Schwein.«
»Hundemüde?«
»Ja, hundemüde. Bleibst du, bis ich eingeschlafen bin?«
Morgane nickte und griff nach der Hand ihrer Schwester.
Schnell dämmerte Virginie weg und Morgane musste ihr einfach über den Kopf streicheln, so wie sie das bei Marcel tat. Die Rastazöpfe fühlten sich hart an, kein Vergleich zu den weichen, zarten Haaren, die sie mit zehn hatte, ihre Schwester. Ein besonderes Mädchen, das war und ist sie. Und Morgane, das war ihr Mutterersatz und das Wort verletzte sie wie ein Nadelstich. Mutterersatz, wie Kaffee aus Chicorée, Vanillepudding aus Stärke. Nur die zweite Wahl für jemanden sein, eine wandelnde Illusion, ein Besseralsgarnichts.
Morgane dachte an die Kindheit ihrer Schwester zurück, die erst begann, als ihre eigene bereits beendet war. Fast zehn Jahre trennten sie. Sie erinnerte sich an die Dysphonie der klirrenden Weinflaschen hinter der Haustür, die in dem Moment einsetzte, in dem sie nach dem zehnten unbeantworteten Klingeln mit dem Ersatzschlüssel unter der Fußmatte ins Haus eintrat. Sie hatte den beißenden Geruch der zu lange ungewechselten Windel noch in der Nase und das Bild ihrer Mutter im Garten vor Augen. Hauptsache der Garten war in Ordnung. Hauptsache alles sah ordentlich aus. Nichts sah ordentlich aus und auch als ihre Eltern sich entschlossen, nach Lille zu ziehen und das Haus in Cassel Morgane zu überlassen, füllte sich ihre neue Wohnung weiter mit Buntglas, vergrößerte sich die Kronkorkensammlung und der Tränenvorrat ihrer kleinen Schwester. Ein aufgewecktes Kind, klug und unberechenbar zugleich, ausgelassen und traurig, schöpferisch und zerstörerisch. Erst nachdem ihre Eltern sich entschlossen hatten, den Promillerekord einer gelungenen Autofahrt in nie gekannte Höhen zu steigern und diesen Versuch nicht überlebten, nahm Morgane das kleine Bündel aus Angst und Energie bei sich auf. Zu spät, denn Virginie war bereits achtzehn und in ihrer weißen Thomas-Phase, während sie selber bereits in ihrem dunklen Tal wanderte und auch Jahre später nicht herausfand.