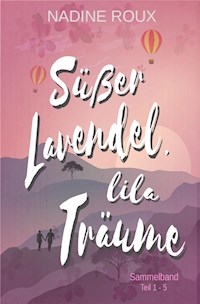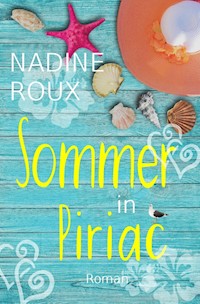
3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Ein Sommer, eine Crêperie und die Geister der Vergangenheit. Julie wollte Paris als Malerin erobern, aber dann verliert sie sogar ihren Job als Mädchen für alles in einer Galerie. Da kommt der nette Paul gerade recht, um ihr Chaos-Leben aufräumen. Doch die Vergangenheit holt Julie schlagartig ein. Oma Lila stirbt, und Julie darf ihr Erbe nur antreten, wenn sie deren Crêperie in der Bretagne einen Sommer lang führt. Häkelnde Damenrunden und der Club zur Rettung bretonischer Salzbutter: Julie hat alle Hände voll zu tun. Und dann trifft sie nicht nur auf ihre Jugendliebe Adrien, wegen dem sie Piriac damals verlassen musste, sondern entdeckt Lilas Geheimnis, das alles ändert. Julie muss sich entscheiden, ob sie bleibt oder geht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Sommer in Piriac
Liebesroman
BookRix GmbH & Co. KG80331 MünchenÜber dieses Buch
Ein Sommer, eine Crêperie und die Geister der Vergangenheit.
Julie wollte Paris als Malerin erobern, aber dann verliert sie sogar ihren Job als Mädchen für alles in einer Galerie. Da kommt der nette Paul gerade recht, um ihr Chaos-Leben aufräumen.
Doch dann holt die Vergangenheit sie ein. Oma Lila stirbt und Julie darf ihr Erbe nur antreten, wenn sie deren Crêperie in der Bretagne einen Sommer lang führt. Häkelnde Damenrunden und der Club zur Rettung bretonischer Salzbutter: Julie hat im Laden alle Hände voll zu tun.
Und dann trifft sie nicht nur auf ihre Jugendliebe Adrien, wegen dem sie Piriac damals verlassen musste, sondern entdeckt Lilas Geheimnis, das alles ändert. Julie muss sich entscheiden, ob sie bleibt oder geht. Doch ihr Herz hat ein Wörtchen mitzureden.
Nadine Roux ist ein Pseudonym. Die Autorin wurde 1988 in Lüneburg geboren und ist neben dem Norden vor allem Frankreich verbunden. Ihre Bücher führten sie in die Normandie, nach Paris, in die Bretagne und in den sonnigen Süden. Sommer in Piriac ist ihr sechster Roman.
Mehr Informationen auf: http://nadineroux.wordpress.com
Kapitel 1
Piriac, 08. September
Liebe Oma Lila,
wenn ich an Piriac denke, denke ich zuerst an die salzige Luft, das Parfum des Meeres, das jeden Tag ein anderes ist und das eine Geschichte erzählt. Mal schwer, von Algen geschwängert, wenn der Sommer dem Herbst Platz macht und der Atlantik als Erstes etwas davon weiß. Mal süßlich frisch, wenn die Sonne die Oberfläche erwärmt und der Frühling versucht, Sommer zu werden. Und oft salzig, sehr oft sogar salzig. In den schweren Stürmen des Winters und in den frühen Morgenstunden des August. So wie in jenem, in dem ich dich verließ.
Denke ich an Piriac, denke ich auch an die Hortensien in den Straßen und Gärten. Natürlich, denn wer denkt nicht an Hortensien, wenn er Piriac im Kopf hat? Der kleine Balkon der Halbinsel Guérande, so hast du unsere Heimat immer genannt und ich erinnerte mich oft daran, wenn ich auf meinem winzigen Balkon in Paris saß, unter mir die brüllenden Autos. Dann rief ich mir Piriac in Erinnerung und die bunten Blumen, die in ihren Farben die Schätze der Erde zeigten. Rote Blüten für eisenhaltigen Boden, rosa für Kalk, Blau für sauren Boden. Ich sehe deinen prächtigen Garten vor mir, über und über mit dicken Blüten geschmückt, an denen es summt und lebt. Wie oft habe ich mir später gewünscht, selber eine dieser Bienen zu sein, deren einzige Hektik das Sammeln von Blütenstaub zu sein schien. Meinen Kopf in eine Blume zu stecken und von dem süßen Nektar zu kosten. Aber ich hatte ja nur Paris mit seinem Lärm und den seltsamen Parks, in die allzu viele Menschen flüchten, um von grüner Luft zu kosten.
Denke ich an Piriac, habe ich aber vor allem dich im Kopf. Deine altmodischen Rüschenblusen, die immer nach Rosenwasser rochen. Deine langen, grauen Haare, in denen sich meine Kinderfinger verfingen und die du stets akkurat zu einem Knoten auf dem Kopf drehtest, immer hoffend, dass sich im Laufe des Tages nicht allzu viele Strähnen daraus lösten. Vergebens. Ich sehe dich hinter den runden Crêpe-Steinen stehen, die Wangen gerötet, voller Wonne große Räder von Crêpes und Galettes für deine Kunden entwerfend wie ein Kunstwerk. Je später der Abend wurde, desto mehr Strähnen lösten sich und umrahmten dein Gesicht wie ein heller Schein auf einem Heiligenbild.
Heute weiß ich es besser, aber als ich klein war, warst du meine Heilige. Du hast mich aufgefangen, als meine Eltern gestorben waren, die ich nie gekannt habe. Du hast mir ein Zuhause in deinem kleinen Häuschen mit dem Hortensiengarten gegeben, du hast mich Dinge gelehrt, die ich nie vergessen habe. Wie man einen bretonischen Pullover strickt zum Beispiel, mit blauen und weißen Streifen und als besonderes Extra einer Tasche auf der Brust, in die die Pfeife eines Fischers passte.
Du hast mir beigebracht, was Sehnsucht ist.
Ich habe verzweifelt versucht, das zu vergessen. Dieser ziehende Schmerz im Herzen, wenn man etwas vermisst. Auf dass sich Leid und Freude so sehr mischen, dass alles an einem voll ist mit diesem einen Gefühl, das mir als das bretonischste aller Empfindungen erscheint. Sehnsucht.
Ich habe sie oft gespürt, nachdem ich Piriac verlassen habe. Und auch, als du dachtest, ich komme darüber hinweg, weil die Sache mit Adrien nur eine Schulmädchenschwärmerei gewesen sei.
Es ging alles sehr schnell, fast wie eine überstürzte Abreise. Du hattest mir Opas ledernen Koffer vom Dachboden geholt. Ich sehe mich noch heute vor deinem Haus stehen, auf den Bus wartend, der mich nach La Baule zum Zug bringen sollte und der Zug mich nach Paris. Es war ein frischer Augustmorgen, einer jener salzigen Tage, an denen das Meer still wie ein Spiegel vor Piriac lag und das Licht golden über das Land floss, bereit für das letzte Aufbäumen des Sommers.
Du hast gesagt, dass Adrien mit einem Fischer hinausgefahren sei, ganz spontan, und sich deswegen leider nicht verabschieden konnte. Ein Kloß saß mir im Hals, aber ich versuchte stark zu sein. Als dann der Bus aus dem Dorf herausfuhr und die letzten Hortensien hinter sich ließ, sah ich ihn auf dem Hügel stehen. Auf der Wiese, auf der wir so oft gespielt hatten, als wir klein gewesen sind. Seine Schultern hingen und sein Hemd war zerknittert und voller Grasflecken, so als habe er die Nacht auf dieser Wiese verbracht. Ich erkannte ihn sofort, seinen dunklen Schopf, die tiefliegenden, schwarzen Augen, die markanten Brauen. Einen Moment nur sah ich ihn, bevor der Bus um die Kurve bog und ihn mir wegnahm, meinen Adrien.
Und da begann ich zu begreifen.
Auch in Paris gibt es diese goldenen Morgen, wenn die Sonne sich nur langsam erhebt und alle Kraft zusammennimmt, um dem Sommer noch einmal Feuer zu geben, unsere Gesichter noch einmal zu erwärmen, wenn wir sie in den Himmel heben. Sommermorgen, an denen die Luft bereits würzig und schwer ist und erste Blätter auf die Boulevards und die Kieswege der Parks fallen. Seit diesem Abschied in Piriac habe ich diese Tage gehasst. Immer musste ich an dich denken, in deiner grauen Strickjacke vor dem Haus, wie du mich umarmtest und gesagt hast, mich bald in Paris besuchen kommen zu wollen. Ich solle Philippe grüßen und es würde schon alles gut werden mit dem Studium, Philippe würde auf mich aufpassen. Ich solle mich melden, wenn ich da bin. Und ja, »ach, beinahe hätte ich es vergessen zu erwähnen«, sagtest du, als ich auch die Uhr sah und auf Adrien wartete, der sich verabschieden wollte. Er sei heute in der Früh mit einem Fischer rausgefahren und komme erst heute Abend zurück. Er bestelle mir schöne Grüße und wünsche mir alles Gute. Es klang wie ein Abschied für immer. Genau das wolltest du damals, einen Abschied für immer. Dass Adrien und ich uns nicht wiedersehen, dass unsere Herzen sich nicht finden.
Ich habe versucht, mich nicht zu erinnern. Bin nie ans Meer gefahren, weil ich den Geruch nicht ertragen konnte. Den Geruch des Verlustes. Als wir uns verabschiedeten, Großmutter, hatte ich das alles noch nicht gewusst. All das, was du mir verschwiegen hast. Und auch nicht, dass ich dich danach nie wiedersehen sollte.
Kapitel 2
Eine Lindenblüte segelte zu Boden, als Julie und ihre Freundin Selima nach Feierabend auf der Place des Vosges saßen und zeitgleich in ein Sandwich bissen. Paris war schon ganz auf Sommer eingestellt, doch der Wind pfiff gelegentlich eisig aus Osten, so wie an diesem Abend.
»Sieh mal, da drüben«, flüsterte Selima und begann zu kichern. »Wenn mich nicht alles täuscht, ist der Typ genau nach deinem Geschmack.« Selima wurde nicht müde, Julie davon überzeugen zu wollen, dass Paris voller schöner Männer war, die nur darauf warteten, dass Julie an ihnen vorbeilief und aus Versehen stolperte, damit sie sie auffangen, ihr tief in die Augen sehen und ihr sogleich einen Heiratsantrag machen würden. Seufzend sah Julie dennoch zu dem Mann auf der Bank gegenüber. Meistens lag Selima ziemlich falsch, was ihren Geschmack betraf, aber das hatte damit zu tun, dass sie selber gar nicht wusste, wer denn nach ihrem Geschmack war. Auf der Bank unter den Linden saß ein schlanker Kerl mit aschblonden Haaren, einer modischen Brille und braunen Lederschuhen, der in einer Zeitung las. Altmodischer Zeitungsleser, das könnte ihr tatsächlich gefallen, aber die Wahrheit war, dass es auf diesem Planeten niemanden gab, der weniger auf der Suche nach einem Partner war als sie.
»No brown in town«, sagte Julie und ahnte, dass Selima sie verständnislos von der Seite anschaute. »Ich übersetze für dich: Keine braunen Schuhe in der Stadt.«
»Ich bin fassungslos! Braune Schuhe hin oder her, der sieht super aus. Und er liest Zeitung. Hast du mir nicht neulich erklärt, dass dein Traummann drei Kriterien erfüllen muss? Erstens Zeitungsleser sein, zweitens bereit sein, mit dir dreimal hintereinander eine Winnie-Puuh-DVD zu gucken und drittens ein tadelloses Soufflé backen zu können. Der da drüben erfüllt sie alle!«
Wieder seufzte Julie. »Woran siehst du, dass er mit mir Winnie-Puuh-Filme guckt und ein Soufflé backen kann?«
»Das steht ihm geradezu auf die Stirn geschrieben.« Selima warf das Papier ihres Sandwisches in den Mülleimer und schlug vor, auf dem Rückweg ganz aus Versehen bei ihm vorbeizulaufen.
»Und wie soll ich ihn deiner Meinung nach ansprechen?«, versuchte Julie ihrer Freundin klar zu machen, dass deren Plan ein Luftschloss war, an dem sie außerdem kein Interesse hatte.
»Frag ihn nach seiner Telefonnummer.«
Julie lachte auf. Wenn Direktheit einen Namen hatte, dann Selima. Dabei war sie es gewesen, die damals Marcel ansprechen musste, weil Selima sich nicht getraut hatte, auf der Vernissage einfach zu diesem schlaksigen Kerl mit den braunen Locken zu gehen, der immer ein wenig von seinem Champagner verschüttete, wenn er vor einem Bild stand und es gestikulierend bewunderte.
Julie gehörte nicht zu der Spezies Mensch, die sich schnell schämte. Sie hatte sogar ein ziemlich dickes Fell und Selima meinte, das müsse ihr bretonisches Erbe sein, obwohl sie noch nie zuvor eine Bretonin gekannt hatte. Julie neigte zu Schusseligkeit, die mit dem Gefühl von Scham ein gutes Duo gebildet hätte. Sie sah es pragmatisch, wenn sie in der Metro mal wieder ihren Rucksack jemandem ins Gesicht donnerte oder ihr im Supermarkt ein Glas mit Erbsen und Möhren auf den Boden fiel. Also fiel es ihr auch diesmal nicht schwer, einfach aufzustehen und mit Selima im Schlepptau zu dem Mann auf der anderen Seite der Allee zu schlendern.
»Oh mein Gott, du sprichst ihn wirklich an!« Selimas Augen glänzten, aber sie versuchte gleichzeitig, sich im Hintergrund zu halten.
Julie räusperte sich. »Entschuldigung«, begann sie. Der Mann sah auf, er hatte blaue Augen und dürfte so um die dreißig gewesen sein, genau wie sie. »Meine Freundin und ich hatten gerade eine lebhafte Diskussion um einen Film, den wir in unserer Kindheit gesehen haben. Sie als Zeitungsleser sehen aus wie jemand, der Allgemeinbildung hat und sich vielleicht erinnert.« Eine Windböe zupfte eine weitere Lindenblüte ab und ließ sie in Julies Haar segeln, ohne dass sie es bemerkte.
Der Mann schien überrascht, aber auf freudige Weise. Er klappte rasch die Zeitung zu. »Oh, tatsächlich? Dann will ich mal sehen, ob ich helfen kann.«
»Es geht um Winnie Puuh. Sie wissen schon, dieser tapsige Bär mit den vielen tierischen Freunden. Da gibt es eine Eule, die ganz besonders schlau ist. Klar, ist ja auch eine Eule. Aber uns ist der Name entfallen. Sie kennen es sicher, wenn einen etwas quält, das man mal wusste und jetzt nicht mehr. Man findet den ganzen Tag keine Ruhe.«
Der Mann stand von der Bank auf, so als sei es ihm unangenehm, in Gegenwart einer Dame auf einer Bank zu sitzen. Er war ein ganzes Stück größer als Julie. »Ähm, ja, das kenne ich. Nur kenne ich diesen Film leider nicht, pardon.«
»Das macht doch nichts«, lächelte Julie ihn an. »Trotzdem vielen Dank und einen schönen Abend noch.« Selima hatte sich mittlerweile bei ihr eingehakt und versuchte, sie am Gehen zu hindern. Aber Julie war entschlossen, denn immerhin hatte sie gerade den Beweis angetreten, dass Selima mal wieder falsch lag und dieser Typ nicht der Traumprinz sein konnte, als den sie ihn ihr verkaufen wollte.
»Moment!«, hörte sie eine Männerstimme hinter sich. Dann Schritte auf dem Kies. »Sie… Sie haben da etwas im Haar.«
»Tatsächlich?« Julie schüttelte ihre langen schwarzen Haare. Vergebens.
»Ich glaube, es steckt fest. Eine Blüte von diesen Bäumen hier.«
»Linden, es sind Linden.«
»Damit kenne ich mich leider nicht aus«, sagte er und Julie sah, wie sich seine Wangen unterhalb der Brille ganz leicht erröteten. »Ich bin übrigens Paul.«
»Danke für deine Hilfe, Paul«, lächelte Julie. »Ich muss jetzt gehen. Meine Quiz-Show beginnt gleich.« Sie hörte, wie Selima neben ihr scharf Luft einsog.
Als sie außer Hörweite waren, prasselte es auf Julie ein.
»Wie konntest du nur? Er war so nett zu dir und er sieht so fantastisch aus und du lässt ihn so auflaufen! Du hast ihn bloßgestellt mit deiner blöden Winnie-Puuh-Sache. Die Eule hat gar keinen Namen!«
»Doch, sie heißt Eule.«
»Wie konntest du nur?«, wiederholte Selima vorwurfsvoll. Bis sie bei der Metrostation Bastille angekommen waren, herrschte Schweigen zwischen den beiden Frauen. Julie mochte Selimas Art, aber ihr Engagement, Julies Lebensglück auf der Straße zu suchen, war zu viel des Guten. Sie musste ihr möglichst bald und möglichst schonend klarmachen, dass sie nicht auf der Suche nach irgendwem war, sondern dass sie einfach ihre Ruhe wollte. Ihre Arbeit in der Galerie, für die Selima Homepage und Flyer designte und in der sie selber eine mäßig erfolgreiche Verkäuferin war, genügte ihr vollkommen. Abends hatte sie Pizza und Fernsehen und genoss den Blick aus ihrer Dachkammer auf Paris. Das Leben hatte es gut genug mit ihr gemeint, sie wollte ihr Glück nicht herausfordern.
Als Julies Metro kam und sie nach Montmartre bringen sollte, drückte Selima ihr einen Zettel in die Hand. »Ruf ihn an, er ist nett.«
Julie fiel es wie Schuppen vor die Augen. »Du hast ihn in den Park bestellt!« Die Türen der Bahn öffneten sich und eine Menschenhorde stieg mechanisch aus.
»Ich habe ihn mal irgendwo getroffen und wie beiläufig fiel das Gespräch auf dich«, sagte Selima rasch und schob Julie in die Bahn. »Er passt zu dir, glaub mir. Bis Morgen, Schätzchen!« Sie warf ihr noch Luftküsse zu, als sich die Türen schlossen und die Metro anfuhr.
Julie warf Selimas Zettel in den Klappmülleimer und dachte dann wieder über ihren Job nach, das Einzige, was sie zur Zeit interessierte. Das zweite Jahr in der Galerie Jacobsen, Dumas & Poirot war beinahe überstanden, ohne dass sie gefeuert worden war. Bisher hatte sie noch keine falschen Preise genannt und sich auch bei der allerhässlichsten Kunst, die insbesondere von dem Dänen Jacobsen kam, nicht verplappert. Kein ‚Ich an Ihrer Stelle würde das nicht kaufen‘ oder ‚Wenn Sie dieses Bild in Ihr Wohnzimmer hängen wollen, kann ich für Ihren Ehefrieden nicht garantieren‘. Jacobsen konnte sie nicht leiden und sie ihn auch nicht.
Studium der Kunstgeschichte, so wie Oma Lila das eingefädelt hatte. Unterstützt von Philippe, der ausgerechnet in dem Jahr in Piriac aufgetaucht war, in dem sie die Liebe zu Adrien hatte aufblühen sehen wie die Hortensien in Lilas Garten. Ein mäßig abgeschlossenes Studium und dann jedes Jahr Philippes Wasserstandsmeldungen, auf die sie gerne verzichtet hätte.
»Entschuldige, Julie, aber ich denke, der Job ist nichts für dich. Ich hätte da noch was in der Buchhaltung.«
Noch ein Jahr später: »Sag mal, hast du im Studium nicht mal einen Sprachkurs gemacht? Du könntest die Angebote für unsere ausländischen Kunden übersetzen.«
Noch ein Jahr später: »Die Bilderrahmen müssten mal wieder abgestaubt werden. Machst du das, Julie?«
Dann der Knall. »Hör mal… Ich habe da jemanden kennengelernt und würde ihr gerne eine Stelle in meiner Galerie anbieten. Du hast doch nichts dagegen, oder?« Philippe hatte mit einem exzellenten Zeugnis gewedelt und ihr das Visitenkärtchen von Jacobsen, Dumas & Poirot zugesteckt, Montmartre, Kunst für Touristen und stinkreiche Amerikaner, die keine Ahnung hatten.
Und da war sie jetzt. Morgen war die Vernissage für Jacobsens neue Serie. Porträts in Blätter gekleideter Frauenkörper. Künstlich, billig, geschmacklos. Julie musste Morgen früh unbedingt noch den rosafarbenen Champagner besorgen, den Jacobsen ausgeschenkt haben wollte. Nicht gerade die typische Aufgabe einer Galeristin, aber die war sie ja auch eigentlich nicht. Ein Leben zwischen den Stühlen. Und vor dem Fernseher, denn immerhin das war sicher.
Zu Hause zog Julie als Erstes ihre Schuhe aus. Sie war der Überzeugung, dass die meisten Frauen nur Stöckelschuhe trugen, weil es ein so erleichterndes Gefühl war, sie wieder ausziehen zu können. Ein Griff zur Fernbedienung und das wohlige Geräusch sprechender Menschen erfüllte ihr Wohnzimmer, das zugleich Schlafzimmer und Küche war. Sie öffnete das Fenster und sah für einen Moment auf Paris herab. Das Paris der Hinterhöfe, der versteckten Gärten und der metallenen Dächer.
Als die Quiz-Sendung beendet war, schob Julie eine Pizza in den Ofen und sah dabei zu, wie sich der Käse hob und senkte wie ein Lebewesen. Manchmal dachte sie, dass die Pizza lebendiger war als sie, aber nach der ein oder anderen Träne, die sie darüber vergoss, ging es ihr meistens besser und es gelang ihr wieder, ihren Alltag zu schätzen.
Doch an diesem Abend war etwas anders. Wer auch immer vor ihrer Tür stand, er musste zweimal klingeln, damit Julie es wahrnahm. Das kam ihr äußerst ungelegen, denn die Pizza war nur so lange gut, wie sie heiß war.
»Ja bitte?«, fragte sie, als vor der Tür ein Blumenstrauß erschien und hinter dem wiederum ein Mann, den sie schon einmal gesehen hatte.
»Guten Abend, Julie. Selima hat gesagt, dass ich dich abholen soll.«
»Pierre?«
»Fast. Paul.«
»Stimmt, ich erinnere mich.« Sie hatte die unfreiwillige Begegnung im Park beinahe wieder vergessen. Und es wäre noch besser gewesen, auch das Öffnen der Tür einfach vergessen zu haben, aber nun stand er da. Wortlos trat sie einen Schritt zur Seite und Paul verstand es als Einladung.
»Danke«, sagte er und drückte ihr die Blumen in den Arm. »Eine… hübsche kleine Wohnung hast du. Wirklich, ganz niedlich.«
»Tja.« Julie stellte die Blumen in ein Glas, denn eine Vase besaß sie nicht. »Entschuldige mich einen Moment.«
»Nur zu, bitte«, sagte dieser Paul nervös und verschränkte die Hände über dem Bauch, so wie jemand Achtzigjähriges am Samstagabend vor dem Fernseher saß und das Große Schlagerfestival schaute.
Julie schloss sich im Bad ein, sicher war sicher. Selimas Handy klingelte dreimal, viel zu oft, bis sie endlich abnahm.
»Spinnst du?!«, brüllte Julie in den Hörer. Von der anderen Seite kam nur ein Lachen.
»Ich wusste, dass du anrufst. Glaub mir, ich tue dir einen Gefallen, du weißt das nur noch nicht zu schätzen.«
»Das Einzige, was ich schätze, ist, dass du den Verstand verloren hast!«
»Paul ist ein ganz Netter. Soll ich dir vorlesen, was er auf die Anzeige geantwortet hat?«
Julie war dem Herzinfarkt nahe. Eine Anzeige? »Eine Anzeige!«
»Habe ich dir das nicht gesagt? Ups.« Selima sagte zwar ‚Ups‘, aber sie klang nicht nach ‚Ups‘, sondern eher nach ‚Ich tue so, als habe ich es dir sagen wollen, aber ich wusste genau, dass du dagegen sein würdest.‘
»Ich fasse es nicht! Du hast allen Ernstes eine Kontaktanzeige in meinem Namen aufgegeben? Womöglich auch noch im Internet und mit Bild.«
»Das… ist durchaus möglich. Aber es ist ein hübsches Bild von dir mit roten Sandalen, der schwarzen Flatterbluse, die so schön zu deinen Haaren passt.«
»Das ist mein Büro-Outfit, Selima! Ich sehe damit aus wie eine pseudoseriöse Handleserin vom Astrologie-TV.«
»Also Paul hat‘s gefallen.«
Schweißperlen standen auf Julies Stirn, noch dazu wurde es in dem winzigen Bad immer stickiger und wenn sie sich nicht täuschte, hörte sie vor der Tür schleichende Schritte.
»Wäre ich eine bessere Köchin, würde ich Hackfleisch aus dir machen, Selima. Ich rufe dich später wieder an und wehe, du nimmst nicht ab! Wir sind noch nicht fertig.«
Als Julie die Badezimmertür mit Schwung öffnete, fuhr Paul zusammen. Er saß immer noch auf dem Sofa, zum Glück. Für ihn. Er sah sie aus seinen großen blauen Augen an, erwartungsvoll und beinahe bettelnd wie ein Hundebaby.
»Ich...«, begann Julie, wusste aber nicht, wie sie den Satz weiterführen sollte. Sie hasste Überraschungen, die passten nicht in ihren geliebten Alltag.
»Du musst nichts sagen«, nahm Paul ihr das Reden ab. »Ich habe es geahnt. Selima hat mir geschrieben, dass du von der Anzeige nichts weißt, aber ich dachte mir, vielleicht habe ich Glück und wir verbringen einen netten Abend zusammen. Es ist okay, wenn du mich jetzt fortschickst.« Er machte Anstalten aufzustehen.
Ohne dass sie es wollte, erweichte Pauls Satz ihr Herz. Das Fortschicken hatte sie am eigenen Leib erfahren, vor zehn Jahren und zwar von ihrer geliebten Oma Lila.
»Ich schicke dich doch nicht fort.« Ihre Stimme war wieder ganz ruhig. »Also… was hattet du denn geplant?«, fragte sie und holte ein Glas Wasser aus der Küchenecke, während ihr Blick immer wieder zu der erkaltenden Pizza ging. Sie war definitiv verdorben, jede Minute machte sie ungenießbarer.
Paul grinste. »Da gibt es ein besonderes Restaurant.«
»So weit ich weiß, ist Paris voller besonderer Restaurants«, seufzte Julie. In der Hauptstadt aß man völlig anders als in der Bretagne und auch das Ambiente war anders.
»Aber es gibt nur eines auf dem Eiffelturm.«
Julie ließ die Schultern hängen. »Das Jules Verne.« Ein Luxusrestaurant. Nichts war weniger Julie als Luxus.
»Ja, genau. Selima hat mit erzählt, dass du gerne isst.«
Na toll. Wie das klang. Als wenn sie daran arbeitete, kugelrund zu werden, was sie niemals werden würde. Klein und zierlich lag in der Familie. Trotzdem zog sie Schuhe und Jacke an und folgte ihm.
»Was machst du eigentlich beruflich? Bist du Banker?«
»Nein«, lachte Paul. »Sehe ich so aus?« Ja, dachte Julie. Und nur so jemand kam auch die Idee, sie ins Jules Verne zu schleppen. »Ich bin Mathematiklehrer.«
Oh. Mein. Gott. Paul war nicht der harmlose Dackel, der sich dafür fürchtete, von ihr fortgeschickt zu werden, er war der wandelnde Albtraum.
»Okay...« murmelte sie und versuchte zu lächeln, was nicht ganz gelang. »Dann… lass uns mal losgehen.« Desto schneller würde sie wieder hier sein, fügte sie in Gedanken an.
Sie fuhren mit der Metro zum Eiffelturm. Nichts könnte unpassender sein als mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu einem Luxusrestaurant zu fahren, aber Paul schien es nicht zu stören. Ein Glück, dass sie beide stehen mussten und so jedes Gespräch unterbunden wurde. Erst als sie aus dem Pariser Untergrund ans Licht der Champs du Mars kamen, lächelte er sie wieder an. »Schön, nicht?«
Julie fühlte sich wie die reinste Touristin. Kein Pariser bestieg freiwillig einfach so den Eiffelturm, genauso wenig wie ein New Yorker Selfies an der Freiheitsstatue machte.
»Ja, schönes Wetter«, sagte Julie. »Immerhin müssen wir nicht anstehen.« Schon von weitem sah sie die Schlangen an den Füßen des Turms, die geduldig auf Einlass warteten. Das Jules Verne hatte einen Privataufzug, was man für die Menü-Preise ja wohl auch erwarten konnte.
Als sie auf der zweiten Plattform ausstiegen, blieb Julie die Luft weg. Sie hatte geglaubt, von ihrer Wohnung einen Blick auf Paris zu haben, aber wenn etwas Blick auf Paris hatte, dann das hier. Goldenes Abendlicht überzog die Stadt und machte sie zu einem Meer aus Edelsteinen. Hier oben war es still bis auf das Rauschen des Windes. Und dann war da die Seine. Eine goldene Lebensader, flüssiges Licht, das Paris durchzog und es zu dem machte, was es war: Paris, Stadt des Lichts.
»Toll, nicht?«, fragte Paul, dessen Augen ebenfalls golden leuchteten. Julie merkte gar nicht, wie er ihre Hand nahm und sie zum Restaurant führte. Er nahm ihr die leichte Jacke ab wie ein Gentleman und überließ ihr den Platz mit dem Rücken zum Raum, sodass sie nach draußen sehen konnte. Hier oben, über Paris schwebend, fiel es Julie schwer, nicht romantisch zu werden.
Es gab zwei Menüs zur Auswahl, eines mit fünf und eines mit sieben Gängen. Unwillkürlich suchten Julies Augen nach einem P für Pizza als Hauptgang, aber sie fanden nur H für Hummer und K für Kaviar. Und B für Bretonisch.
»Bretonischer Hummer«, las sie. Wo sie auch war, ihrer Heimat konnte sie doch nicht entkommen, auch wenn es seltsam anmutete, dass man dieses Meerestier hier als teure Delikatesse aß, während sie das bodenständige Ambiente bretonischer Crêperien und Fischrestaurants am Hafen gewohnt war. Bestimmt sah man es nicht gerne, wenn die Gäste das letzte Fleisch aus der Kruste lutschten, so wie sie es kannte.
»Wir nehmen die fünf Gänge«, bestellte Paul und fragte sie, ob das in Ordnung sei.
»Klar. Ich bin es nur nicht gewohnt, dass mein Essen mehr Gänge hat als mein Fahrrad«, flüsterte sie. »Dieser Luxus...«
»… ist nichts für dich«, vervollständige Paul flüsternd ihren Satz. »Da bin ich aber sehr froh. Ich dachte, wer in einer Galerie arbeitet, ernährt sich hauptberuflich von Champagner und Kaviar.«
»Ich kaufe beides hauptberuflich ein, aber kredenzt wird das nur den Kunden«, seufzte Julie. Gleichzeitig hoffte sie, dass im Gegenzug nicht er von seiner Arbeit berichtete. Der Ausblick hier oben war zu schön, um über das Grauen des Mathematikunterrichts zu sprechen.
»Das heißt, eine Pizza hätte dir gereicht.«
»Oh ja, ich bin große Expertin. Mit Schinken und Käse, das reicht vollkommen, um mich glücklich zu machen.«
Paul lachte und Julie musste zugeben, dass es gar nicht übel klang. Er wieherte nicht, er grunzte nicht, er klang nicht wie ein kaputter Föhn. Sie hatte viel Zeit damit verbracht, das Lachen der vornehmen Kunden in der Galerie zu studieren, aber Paul klang absolut okay.
Als das Essen kam, hatte keiner von ihnen auch nur die leiseste Ahnung, was sie vor sich auf den Tellern hatten, nur die Karte verriet, worum es sich handeln könnte.
»Oh, ich glaube, das hier ist ein Stück Orangenschale«, sagte Paul und pulte etwas Oranges heraus.
»Ich erkenne Karottenhäcksel, wenn ich sie sehe«, antwortete Julie lachend. »In der Bretagne kriegen das die Kaninchen.«
Wider Erwarten amüsierten sich sich prächtig. Einmal ernteten sie den strengen Blick eines eleganten Pärchens am Nachbartisch, was Julie nur noch mehr losprusten ließ. Als schließlich das Dessert serviert wurde, das ganz simpel als ‚Schokolade‘ angepriesen wurde, machten sie sich einen Spaß daraus, ihre Servietten in den Kragen zu stecken und möglichst oft »deliziös« und »bonfortionös« fallen zu lassen.
Der Abend war äußerst nett gewesen und Paul hatte sich als angenehmer Gesprächspartner erwiesen. Dabei stürzte er sich selber in Unkosten, nur um ihr dieses besondere Essen zu ermöglichen. Aus dem Augenwinkel nahm sie wahr, wie er immer hektischer in seiner Jackentasche kramte, auch die Hosentaschen durchsuchte und schließlich den Fußboden um den Tisch herum.
»Mein Portemonnaie! Ich finde es nicht.« Wieder durchsuchte er alle Taschen, aber darin waren nur Kassenbons und Cent-Münzen, die er achtlos auf den Tisch warf. »Ich bin mir ganz sicher, dass ich es eingesteckt habe, zu einhundert Prozent! Ich würde fast sagen zu tausend Prozent, aber das gibt es natürlich nicht.« Nun wurde er doch noch mathematisch. Julie seufzte.
»Man muss es mir in der Metro gestohlen haben.« Bei dem Stichwort ‚Metro‘ sah das Paar nebenan wieder auf und diesmal nahm Julie ein herablassendes Lächeln wahr.
»Ich zahle«, sagte sie, um dem Theater ein Ende zu bereiten. Ihr Konto war zwar leer, aber da waren noch fünfhundert Euro von ihrem Dispo übrig. Der Ober kräuselte die Lippen kaum merklich, als sie ihm ihre Bankkarte hinhielt. Crédit Agricole, wohl nicht glamourös genug
Als sie draußen waren, durchsuchte Paul immer noch seine Taschen und hatte keinen Blick mehr für die sanft hereinbrechende Nacht, in der die alten gusseisernen Laternen die Stadt aus dem Dunkel hoben.
»Lass doch gut sein«, sagte Julie. »Du meldest es der Polizei und mit Glück bekommst du irgendwann deinen Ausweis zurück. So ist es bei mir immer.«
»Du wurdest bestohlen? Mehrfach?«
»Nein, aber ich verliere gerne Dinge. Man sagt mir nach, der größte Schussel unter der Sonne zu sein.«
»Also… bisher wirkst du ganz normal.«
»Danke. Du auch.« Sie war froh, dass er Normalsein genauso als Kompliment auffasste wie sie selber.
Paul brachte sie bis vor ihre Haustür, ganz altmodisch, und verabschiedete sich mit Handschlag.
»Es war schön, dich kennengelernt zu haben, Julie. Ich wünschte, wir hätten uns unter anderen Umständen kennengelernt. Und ich hoffe, es war nicht allzu schlimm. Es würde mich daher erleichtern, wenn du deine Freundin nicht zusammenfaltest, sie meinte es ja nur gut.« Julie bemerkte ein leichtes Stottern. Er war nervös und das gefiel ihr seltsamerweise, weil endlich mal nicht sie die Nervöse war.
»Mache ich nicht«, lächelte sie und meinte es so. »Ich fand es auch ganz okay.«
»Okay ist prima!«, entfuhr es Paul erleichtert.
Und dann tat Julie etwas, das sie noch nie einfach so gemacht hatte. Ohne nachzudenken. Sie küsste ihn.
Kapitel 3
Der Wecker klingelte pünktlich wie immer, aber Julie schaffte es nicht, ebenso pünktlich ihre Augenlider hochzuklappen. Sie träumte, dass sie aufstand, sich anzog und zur Arbeit ging, aber in Wirklichkeit drehte sie sich noch einmal um und schlief weiter. Bis der Wecker wieder klingelte.
Sie schreckte hoch, sprang aus dem Bett, verschluckte sich an der Zahnbürste, griff sich zwei Schuhe, die im Halbdunkel ihrer Wohnung zusammen zu passen schienen und stürmte nach draußen.
Dicke Wolken hingen über Paris, und tatsächlich geriet sie in einen Schauer aus Bindfäden, die ihr weißes Kostüm schneller durchnässten, als sie gucken konnte. Erste Besucher warteten unter Regenschirmen draußen auf der Straße. Vor ihren Augen musste Julie ihr Fahrrad anschließen und sich an ihnen vorbei in die Galerie schieben.
»Entschuldigung, ich muss hier mal durch.« Sie spürte die spöttischen Blicke der Kunden und wäre am liebsten in einen Gulli gesprungen oder gestorben. Sie ahnte Schreckliches für den heutigen Morgen. Nichts war demütigender als ein Regenschauer auf dem Weg zur Arbeit.
Drinnen bauten Selima und der Praktikant Denis das Buffet auf, während Jacobsen in Denkerpose daneben stand.
»Die Häppchen etwas weiter nach hinten, sonst fällt noch etwas herunter.« Er rückte seine Brille zurecht. Heute mit violettem Rahmen, passend zu seinen Wildlederschuhen.
Und dann lagen alle Blicke auf Julie. Sie sah, wie Selima die Augen weit aufriss und wie Denis sich ein Losprusten gerade noch verkneifen konnte.
»Julie, sind Sie in die Seine gefallen?« Jacobsen eilte auf sie zu und drehte sie um, begutachtete ihre ebenfalls nasse Rückseite. »Wie wollen Sie denn so arbeiten?«
Selima ließ die Platten mit den Schnittchen stehen und zog Julie am Ärmel fort. Die Menschen draußen vor der Glasfront starrten neugierig herein.
»Ich kümmere mich um sie, Chef.«
»Aber fix. Sie sollten sich eigentlich um die Grafiken für die Herbstausstellung kümmern.«
Nur Julie hörte, wie ihre Freundin knurrte: »Ja, und stattdessen stecke ich Löffel in Kaviardosen.«
Im Spiegel sah Julie das ganze Ausmaß des Unglücks. »Merde! Das bekomme ich nie und nimmer in zehn Minuten trocken.« Nass klebte die Hose an ihren Beinen, die rosafarben durch den weißen Stoff hindurchschauten. »Ich hätte auch gleich gar nichts anziehen können.«
Selima kramte in ihrer Tasche und zog schließlich einen Föhn heraus. »Voilà, so müsste es gehen.«
»Meine Schuhe! Ich habe die falschen an!«
»Als wenn deine Schuhe jetzt dein größtes Problem wären, meine Liebe.«
»Sind sie. Einer ist schwarz und einer braun.«
Selima entfuhr ein kleiner Aufschrei, als sie hinabsah und dabei den Föhn aus Julies Füße fallen ließ.
»Au! Verdammt! Heute geht mal wieder alles schief. Was soll ich denn jetzt machen? Ich kann doch nicht barfuß arbeiten!«
Die beiden Frauen hörten, wie in der Galerie die Tür geöffnet wurde und Jacobsen den Applaus der Menge einforderte. Die Apparate der Fotografen klickten und unter der Tür sah man sogar das Blitzlichtgewitter hindurch scheinen.
»Du hast nur eine Wahl, Herzchen. Du musst den Chef bitten, nach Hause fahren zu können, um dich umzuziehen.« Selima sah sie mitleidig an.
»Dann bin ich erledigt!«
»Das bist du bereits. Gib mir den Champagner für die Gäste und ich tue mein Bestes, für dich einzuspringen.«
Julies Herz setzte einen Moment aus. Der Champagner. Sie hatte ihn nicht gekauft. Im Büro standen bereits die Gläser aufgereiht auf Tabletts, aber Julie hatte nichts eingekauft. Sie ließ die Schultern hängen.
»Oh mein Gott! Nicht das auch noch!« Selima schlug die Hände über dem Kopf zusammen. In dem Moment klopfte es an der Tür.
»Meine Damen, den Champagner bitte.« Jacobsen klang genervt und Julie war sich bewusst, dass er es zurecht war.
Für eine Sekunde sahen Julie und Selima sich an, erschrocken und planlos.
»Improvisieren«, flüsterte Selima und begann, die Champagnerflöten mit Wasser aufzufüllen. »Wenn du eine Chance haben willst, springst du jetzt aus dem Fenster, fährst nach Hause und bist in fünf Minuten wieder da. Ich schwöre dir, du musst schneller sein als Lance Armstrong. Ich versuche alles, um Jacobsen hinzuhalten und fasele etwas von Wasser sei der neue Champagner, exklusiv aus den Tiefen der Vulkane der Auvergne, von blinden Mönchen mit Holzeimern geschöpft.«
Julie fiel ihr um den Hals, völlig egal, ob sie Selima damit ebenfalls Regenwasserflecken verpasste. Dann öffnete sie das Fenster und sprang in den Hinterhof, wo ihr Rad stand.
Oder stehen sollte.
Denn ihr Schloss hing noch am Eisengitter, aber das Fahrrad fehlte. Der Schlüssel steckte. Eine Einladung. Nehmt mich mit, meine Besitzerin ist ein verplanter Nichtsnutz.
Sie sank gegen das Gitter. Der asphaltierte Boden fühlte sich kalt an und noch mehr Feuchtigkeit drang in ihre Hose. Das war das Ende, der tragische Schlusspunkt einer tragischen Karriere. Sie könnte weglaufen und ein Ticket nach Tadschikistan buchen, wo Jacobsen sie nie finden würde. Oder sie könnte ihr eigenes Ableben inszenieren und eine Todesanzeige im Figaro aufgeben, den er jeden Tag las. Alles erschien ihr erträglicher, als zurück auf die Vernissage zu gehen.
Sie atmete tief durch. Vielleicht war es das letzte Mal, dass sie überhaupt atmen würde. Und dann ging sie zum Haupteingang, mit raschen Schritten. Besser ein schnelles Ende als gar keines. Die Tür öffnete sich und Julie schloss sie mit einem lauten Knall. Sofort hatte sie alle Blicke auf sich liegen. Jacobsen stand mit einem Mikrofon vor einem seiner Bilder, vor sich eine Menschentraube.
Sie hob einen Arm. Erst vorsichtig, aber Jacobsen schien sie gar nicht zu sehen. Er wischte mit Gesten über das Bild einer feenhaften Frau in einem Birkenblatt. Julie räusperte sich.
»Monsieur?« Nur ein Mann direkt vor ihr drehte sich zu ihr um, musterte sie von oben bis unten und blieb an ihren Beinen hängen, die immer noch rosa durch die nasse Hose schienen. Dann marschierte sie auf die Bühne, direkt auf Jacobsen zu.
»Was ist?«, fauchte er sie an und hielt das Mikrofon zu.
»Ich muss mit Ihnen sprechen, jetzt sofort.«
»Sind Sie von allen guten Geistern verlassen? Jetzt?!« Er deutete auf die Kunden, die sie beide fragend anstarrten. Es war schlagartig still geworden, nur vereinzelt hörte man amüsiertes Kichern. Die Lust am Desaster. Julie schnappte sich das Mikrofon aus Jacobsens Händen.
»Mesdames et Messieurs«, begann sie mit erstaunlich kräftiger Stimme. »Dass Sie keinen Champagner in Ihren Gläsern haben, ist mein Fehler. Ich habe ihn vergessen zu kaufen. Und dass ich hier tropfnass vor Ihnen stehe, ist auch mein Fehler, weil ich verschlafen habe und mit dem Fahrrad fahren musste. Sie sehen, ich selber bin ein einziger Fehler.« Dann wandte Sie sich an Jacobsen, dem das Entsetzen ins Gesicht geschrieben stand. »Ich habe Ihre Vernissage verbockt und es tut mir leid.« Als ihr Chef sich immer noch nicht rührte, und bereits ein Raunen durch die Menge ging, drückte sie ihm das Mikrofon wieder in die Hand und schlich von der Bühne herunter. Dann wartete sie im Büro darauf, dass er sie in Stücke riss.
Als sie die Tür hinter sich schloss, bemerkte sie erst, wie sie in ihren nassen Klamotten zitterte. Das letzte Mal, dass der Regen sie überrascht hatte, war in Piriac gewesen und sie mit Adrien zum Pêche à pied am Strand unterwegs. Jeder von ihnen hatte einen Eimer dabei, um Muscheln und Krebse zu sammeln, die Großmutter Lila am Abend mit viel Knoblauch und Salzbutter zubereiten würde. Adrien wollte ihr zeigen, wie man mit einem Salzstreuer die Muscheln aus dem Watt lockte.
»Sie denken dann, die Flut sei gekommen und sie können auftauchen.«
»Weiß ich doch«, sagte Julie trotzig und schwenkte den Eimer hinter ihrem Rücken hin und her, sah nach unten, als sich der Wind in ihrem Haar verfing und ihr Gesicht verdeckte. Natürlich kannte sie den Trick mit dem Salzstreuer, ihr Großvater war immerhin Fischer gewesen, wie Adrien nur zu genau wusste, denn er war auch sein Großvater und hatte die beiden gemeinsam in die Geheimnisse des Pêche à pied eingeweiht. Aber Adrien spielte gern den Erwachsenen, den großen Bruder. Selbst zu diesem Zeitpunkt noch, als sie achtzehn Jahre alt war, ihr Abitur bestanden hatte und noch nicht wusste, was sie mit ihrem Leben anfangen sollte. Adrien hingegen war in den Gartenbaubetrieb seines Vaters eingestiegen und hatte auf das Gymnasium verzichtet.
Es war der Sommer, den Julie als Erwachen wahrnahm, als Aufbruch ins Ungewisse, das ihr verlockend und neu schien. Ihr Herz schien für sie zu entscheiden und klopfte ohne ihr Zutun, wenn Adrien sie aus seinen dunklen Augen ansah. Wenn er ihre Hand nahm, um sie über einen mit Algen bewachsenen Stein zu führen, damit sie nicht ausrutschte. Das hatte er schon getan, als sie Kinder gewesen waren, aber in diesem Sommer bekam das alles eine andere Bedeutung.
Die dunklen Wolken waren aus dem Nichts gekommen, wie so oft in der Bretagne. Sie ließen kalten Regen über ihre Haut laufen, der Kleidung und Haare durchnässte. Ein warmer Sommerregen, der Himmel und Meer verschmolz.
»Es reicht jetzt«, rief Julie Adrien zu. »Mein Eimer ist voll und ich bin nass bis auf die Knochen.«
Adrien schien der Regen nichts auszumachen. »Bist du Bretonin, oder was?«, neckte er sie und wischte sich Wasser aus dem Gesicht. Seine Haare erschienen noch dunkler als sie sowieso schon waren. Ein Regentropfen blieb am Kinn hängen.
»Du wusstest, dass es regnen würde?« Julie war verblüfft.
»Klar«, behauptete Adrien. »Ein bisschen Regen hat noch niemandem geschadet.« Er kam auf sie zu. »Und ich wollte sehen, wie der Regen Spuren auf deinem Gesicht zeichnet.« Er stand direkt vor ihr und lächelte schief, so wie immer. Halb spöttisch, halb liebevoll. Nur das Glänzen in seinen Augen war neu gewesen.
Julie zitterte. »Ich will jetzt gehen, mir ist kalt.«
»Warmer Sommerregen und meine Cousine friert«, sagte Adrien und legte einen Arm um sie. Warm. Aufregend. Auf halbem Weg blieb er plötzlich stehen. Sah sie an, studierte ihr Gesicht.
»Was ist?«, fragte Julie ungeduldig, als sie bemerkte, dass sich unter dem Regenfilm auf ihrer Haut ein Hauch Röte ausbreitete.
»Du hast einen Tropfen auf den Wimpern und er sieht aus wie eine Glasperle«, sagte Adrien leise und berührte sie, ganz zart.
Für Julie war es der romantischste Moment ihres bisherigen Lebens gewesen.
Und jetzt saß sie pitschnass im Büro ihres Chefs und wartete auf sein Urteil. Das war das andere Ende der Romantik-Skala und ohne Zweifel ebenfalls ein einschneidender Moment ihres Lebens.
Doch es war Selima, die zuerst durch die Tür stürmte.
»Bist du von allen guten Geistern verlassen?«, kreischte sie fast und wurde sich dann bewusst, dass die Wände dünn waren.
Julie seufzte. »Mir ist, als hätte ich das gerade schon einmal gehört.«
»Er wird dich feuern!« Selima rüttelte sie. »Ohne dich halte ich es hier nicht aus. Wie konntest du nur? Du hättest dich einfach krankmelden können oder verschwinden oder was weiß ich. Jacobsen ist es doch völlig egal, was in den Gläsern der Gäste schwappt, Hauptsache sie kaufen. Und was deine Klamotten angeht – mein Gott, warum bist du nicht einfach nach Hause gefahren und hast dir was Neues angezogen? Wir hatten das doch ausgemacht. Und dann muss in deinem Hirn irgendwo der Märtyrermodus angesprungen sein und du kommst auf die Schnapsidee, dich selber hinzurichten!« Bei dem letzten Wort verschluckte Selima sich an ihrer eigenen Zunge.
»Mein Fahrrad wurde geklaut«, sagte Julie tonlos. Es machte jetzt auch keinen Unterschied mehr.
»Das kann auch nur dir passieren. Du bist der größte Unglücksrabe unter der Sonne.«
»Die nicht scheint«, führte Julie den Satz fort. Sie war einmal das größte Sonnenkind gewesen, glücklich bis in die Zehenspitzen. Bis sie Piriac verlassen musste.
Erneut flog die Tür auf. Diesmal war es wirklich Jacobsen. Die Klinke krachte gegen die Wand und ließ ein Stück Putz herausbröckeln. Selbst Jacobsens Wutausbrüche waren ein Kunstwerk. Dazu gehörte auch, dass er dann trotzdem nie das tat, was man von ihm dachte. Statt sie anzubrüllen, brachte er mit erstaunlich sanfter Stimme Sätze zustande, die Julie wie Eiswürfel den Rücken herunterliefen.
»Mademoiselle Marvaux«, begann er. Julie sank so weit zusammen wie möglich. »Mademoiselle Marvaux, ich muss nicht erwähnen, dass Ihr Auftritt dort draußen der letzte auf Ihrer Abschiedstournee war.«
Na toll, jetzt deutete er ihre mickrige Karriere schon als Abschiedstournee und hatte zu allem Überfluss auch noch Recht damit.
»Ich weiß«, sagte sie und wollte aufstehen, doch er bedeutete ihr ungeduldig, sich nicht vom Fleck zu rühren. Julie sah, wie Selima sich auf Zehenspitzen aus dem Büro schlich und ihr wortlos viel Glück wünschte. So viel Glück man eben haben konnte, wenn man durch den Fleischwolf gedreht wurde.
»Sie bleiben, wo Sie sind. Fahren Sie den Computer hoch.« Er verschränkte die Arme vor der Brust. Julie hatte keine Wahl. »Rufen Sie ein Word-Dokument auf und schreiben Sie als Überschrift bitte ‚Kündigung‘.«
Julie schluckte. Das war die Krönung der Demütigung. Er diktierte gleich ihr Zeugnis mit und Julie brachte es nicht über die Lippen, ihm zu sagen, dass es positiv klingen musste, damit sie wieder Arbeit fand.
»Machen Sie die Tür bitte zu, wenn Sie gehen«, sagte er vollkommen neutral und ging wieder hinaus zu seinen Kunden.
Eine Weile blieb Julie noch sitzen, bis sie sicher war, dass ihre Beine sie trugen. Ihre Hose war mittlerweile angetrocknet, wenigstens das. Selima schlich auf sie zu und umarmte sie. Wortlos, tröstend. Als sie die Tür erreicht hatten, flüsterte sie: »Draußen wartet jemand auf dich, er kam einfach vorbei. Ich freue mich so, dass es mit euch geklappt hat.« Dann gab sie Julie einen Knuff.
Paul.
Sie hatte ihn vollkommen vergessen. Und auch, dass sie mit Selima noch ein Hühnchen zu rupfen hatte wegen der ganzen Geschichte mit der Anzeige. Doch Selima war schon wieder in der Menge verschwunden.
»Julie, du siehst wunderbar aus«, sagte Paul zu allem Überfluss und gab ihr zwei Küsschen. Hektisch drehte Julie sich noch einmal zur Galerie um und sah Selima, die strahlend lächelte und beide Daumen in die Luft reckte. So, als habe Julie nicht gerade ihren Job verloren und stand vor den Scherben ihrer Existenz. So, als drehe sich alles im Leben nur um die Liebe. Und so, als wenn Paul der Märchenprinz war, auf den Julie immer gewartet hatte.
Und dann weinte sie einfach. Sie weinte nie, sie hatte seit Ewigkeiten nicht mehr geweint, sondern so kalt wie möglich alles hingenommen, was ihr in Paris widerfahren war, aber diesmal kam es einfach über sie. Erst jetzt bemerkte Paul, dass etwas nicht stimmte.
»Oh, entschuldige«, sagte er und legte ihr hektisch sein Jackett um ihre Schultern. »Du zitterst ja.« Er strich ihr eine nasse Strähne aus dem Gesicht.
»Mein - mein Fahrrad wurde geklaut«, stotterte sie, als sei das die wichtigste Nachricht des Tages.
»Das tut mir leid. Diese Schweine! Haben keinen Respekt vor einem Damenfahrrad.«
»Und – und – und - und in meinem Zeugnis steht jetzt, dass ich nicht einmal einen Autoreifen wechseln kann«, schluchzte sie und stellte fest, dass es sich gut anfühlte, wie er seinen Arm um ihre Schultern legte und ganz nah neben ihr ging.
»Ich wusste gar nicht, dass du als Mechanikerin angestellt bist.«
»War ich auch nicht, aber Jacobsen hatte mal eine Installation mit einem Auto. Ein riesiges Teil, das aussah, als sei es durch die Decke gebrochen. Der Schrottplatz hatte nur eines mit Michelin-Reifen, er wollte aber Pirelli, also musste ich sie wechseln.«
»Du solltest ihm gleich morgen sagen, dass das unfair war.«
Julie blieb stehen. Sie war irritiert. Hatte er etwa nicht verstanden, dass sie gekündigt worden war? Hatte sie es ihm nicht gesagt oder zumindest zu Verstehen gegeben? Sollte er sie nicht ohne Worte verstehen können, wenn er etwas von ihr wollte?
»Ich wurde gekündigt.«
Paul schreckte zusammen. »Oh mein Gott!«
Sie kannte keine Männer, die ‚Oh mein Gott‘ sagten, Paul war der erste. Als sie ihm alles erzählt hatte, wurde ihr bewusst, dass sie ziellos durch Paris streiften. Paul war ehrlich betroffen, er fluchte vor sich hin und überzog ihren Chef in Abwesenheit mit Schimpfworten, für die er sich sogleich entschuldigte.
»Dieser Mistkerl! Verzeih den Ausdruck. Wie konnte dieser connard nur? Ich muss für meine rüde Sprache um Entschuldigung bitten, aber es kommt so über mich.«