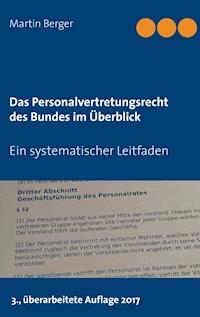7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schwarze-Zeilen Verlag
- Kategorie: Erotik
- Serie: Jahrhundert der Grausamkeiten
- Sprache: Deutsch
Wie viele Europäer wandert Noel Trautwein Anfang des 20. Jahrhunderts nach Argentinien aus, um für die berüchtigte Zwi-Migdal zu arbeiten, einem skrupellosen Zuhälter- und Menschenhändlerring. Die Nachfrage nach Frauen, die bereit sind, die abartigsten Wünsche der Freier zu erfüllen, ist enorm. Immer mehr Frauen, oft Jüdinnen, werden aus Europa nach Argentinien geschleust – die weißen Sklavinnen. In diesem Roman aus der Reihe »Jahrhundert der Grausamkeiten« zeigt der Autor die Schrecken und den Alltag dieser Frauen und ihrer Zuhälter aus der Perspektive eines Zuhälters. Der fiktive Charakter ist eng mit der Realität verwoben. Extreme Sexvarianten und BDSM-Szenen unterstreichen die Brutalität des Milieus der damaligen Zeit. Vieles in diesem Buch ist real, vieles Fiktion – doch wer weiß schon, was hier was ist? Tauchen Sie ein in eine Geschichte voller Spannung und Entsetzen. Erleben Sie die gefährliche Gratwanderung zwischen Macht und Unterwerfung, und lassen Sie sich von der düsteren Atmosphäre dieses Romans in den Bann ziehen. Eines ist sicher: Diese Geschichte wird Sie nicht mehr loslassen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 405
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Martin Berger
1930
Die weißen Sklavinnen von Argentinien
ISBN 978-3-96615-031-6
(c) 2024 Schwarze-Zeilen Verlag, Konstanz
1. Auflage 2024
www.schwarze-zeilen.de
Alle Rechte vorbehalten.
Für Minderjährige ist dieses Buch nicht geeignet. Bitte achten Sie darauf, dass das Buch Minderjährigen nicht zugänglich gemacht wird.
Die auf dem Cover abgebildeten Personen stehen in keinem Zusammenhang mit dem Inhalt dieses Buchs!
Vorwort
Dieser historische Roman ist nur für Erwachsene geeignet. Es handelt sich, bei der vorliegenden Geschichte, um ein reines Fantasieprodukt, eingebettet in einen historisch, korrekt dargestellten Kontext. Historische Fakten sind kursiv dargestellt. Der restliche Text ist fiktiv, auch wenn darin Personen, Gruppen oder bekannte Orte der Geschichtsschreibung anzutreffen sind.
Die Sprache ist, der Zeit und Handlung entsprechend, oft unverblümt und sehr derb. Der Text enthält Szenen sexueller Darstellungen und es werden einvernehmlich ausgelebte Formen von Sadismus und Masochismus beschrieben. Teils findet Sexualität – im weitesten Sinne - nicht einvernehmlich statt. Dies ist dem historischen Hintergrund geschuldet und dient der Veranschaulichung der alltäglichen Gewalt, die das der Handlung zugrundliegende Millieu des frühen 20. Jahrhunderts prägten. Anders als in der historischen Realität, gibt es jedoch keine dauerhaften Verletzungen und keine Toten. Dennoch ist der Text für sensible Leser ungeeignet. Insbesondere ist es möglich, dass Opfer von sexueller oder sexualisierter Gewalt getriggert werden.
Der Verlag und der Autor distanzieren sich von jeglichen realen rassistischen und unterdrückenden oder gewalttätigen Handlungen, Worten und Gedanken und verurteilen es, wenn solche stattfinden.
Die Ansichten des Protagonisten sind historisch geschuldet, die Geschichte wird aus der Sicht eines Mannes erzählt, der selber als Zuhälter tätig ist. Wir haben den Text weitgehend von diskriminierenden Begriffen bereinigt. Dabei haben wir uns dafür entschieden Schwarz immer groß zu schreiben, selbst dann, wenn das Wort als Adjektiv verwendet wird. Schwarz ist dabei kein biologisches Merkmal und bezeichnet keine Hautfarbe. Dieser Begriff wird verwendet, um Personen einer Gruppe zuzuordnen, denen in der Vergangenheit ähnliches widerfahren ist und die, auch heute oft noch, Erfahrungen mit Diskriminierung machen.
Schwieriger war es mit den Begriffen Indianer und Indios. Wir sind uns der Problematik und der diskriminierenden Wirkung dieser Begriffe, insbesondere für die betroffenen Bevölkerungsgruppen, bewusst. Daher haben wir den Text, soweit möglich, angepasst, um diese Begriffe zu vermeiden, ohne die Authentizität zu beeinträchtigen. Leider war dies nicht in allen Fällen möglich, ohne die Glaubwürdigkeit des Textes zu mindern.
1. Auswanderung nach Amerika
Zwischen 1815 und 1930 verlassen 63 Millionen Europäer ihre Heimat. Sie wandern aus nach Amerika. Armut, Arbeitslosigkeit und wachsender Antisemitismus treiben immer mehr Menschen in die Neue Welt. Von diesen 63 Millionen sind alleine 4 Millionen Juden aus Osteuropa.
***
Millionen Menschen kamen als Einwanderer nach Nord-, Mittel- und Südamerika. Unter diesen waren viel mehr Männer als Frauen. In Amerika lebten weit mehr Europäer als Europäerinnen. Und nicht wenige, dieser Frauen waren nicht ganz freiwillig in Übersee.
***
1894 August Bebel, der Vorsitzende der SPD hält im Reichstag eine Rede. Er bedauert darin die »fortgesetzten Transporte von Mädchen, die für Lustzwecke nach außerdeutschen Landen« verschleppt werden.
***
Schlepper in Deutschland und in Osteuropa - vor allem in Polen und Ungarn - tarnen sich als Arbeitsvermittler, die Hausmädchen fürs Ausland suchen. In Russland bieten Mädchenhändler, den Eltern der jungen Frauen, eine Vorauszahlung von 8 Rubel, was etwa sechs Monatslöhnen entsprach. Für viele, der armen Familien ein guter Grund, ihre Töchter diesen Männern anzuvertrauen. Die jungen Frauen aus Osteuropa waren bestimmt für die Bordelle und Tanzlokale in Amerika.
***
1900 werden junge Frauen, die vorhaben auszuwandern, vor Mädchenhändlern gewarnt. Das »Deutsche Nationalkomitee zur internationalen Bekämpfung des Mädchenhandels« druckt derartige Warnungen vor Mädchenhändlern auf Plakate und hängt sie überall in Deutschland auf.
***
Hauptumschlagplätze des Mädchen- oder Frauenhandels waren die Hafenmetropolen. So zum Beispiel Bremerhaven in Deutschland, New York in den USA, Rio de Janeiro in Brasilien und vor allem Buenos Aires in Argentinien.
2. Waisen-Junge
1903 beschloss der modern denkende Papst Pius X., das Verbot der Kastration von Knaben. Bis dahin sangen Kastraten in vielen kirchlichen Chören.
***
Auch die katholische Kirche in Danzig hielt sich an dieses Gebot des Stellvertreters Christi. Aus dem Heim für verwaiste Jungen wurde nun niemand mehr, für Kirchenchöre, operativ optimiert. Glück für mich. Der Herr Pastor sagte mir, ich wäre 1890 geboren. Demnach bin ich wohl mit zwei Jahren ins Heim gekommen. Der Herr Pastor, der Heimleiter, war mein Erzieher.
Unser Herr Pastor war ein freundlicher, wenn auch, bisweilen strenger Heimleiter. Er sprach am Sonntag in unserer Kirche St. Joseph. Er sprach mit Gott, mit den Gläubigen in den vollen Kirchenbänken und mit uns Knaben. Wir Burschen mochten und respektierten ihn. Und dass, obwohl er mit Gott redete. Er war halt religiös. Problematischer war seine Behauptung, dass auch Gott mit ihm redete. Ich hielt ihn für ziemlich verrückt. Ich hielt nichts von Gottesdiensten. Ich wollte Gott nicht dienen. Noch nicht. Später dann schon. Als sein Berater. Aber mit mir sprach Gott nie.
Der verrückte und strenge Herr Pastor half mir, wenn mich die größeren Burschen hänselten. Das taten sie zum Beispiel, weil mein Penis nicht so aussah, wie der ihre. Sie nannten mich »Jude«. Obwohl ich keiner war. Ich schämte mich für mein Anders-Sein. Bis mein Pastor es mir - und den anderen - erklärte. Ich hatte als Kleinkind eine Vorhautverengung, die operiert wurde. Sie nannten mich trotzdem »Jude«. Aber ich wurde größer und stärker. Dann hörten die Hänseleien auf.
***
Als ich 13 Jahre alt war, hatte ich meine dreijährige Schulzeit beendet. Ich konnte meine »Muttersprache geläufig lesen« und hatte »einen Anfang im Schreiben gemacht«. Das war damals die Voraussetzung, um zur Arbeit zu gehen. Also musste ich das Waisenhaus verlassen. Mein Herr Pastor besorgte mir eine Anstellung auf einer Werft, den Schichau-Werken.
Die damalige Industrialisierung in Danzig sorgte für einen Anstieg der Bevölkerung. Viele Zuwanderer aus Osteuropa kamen auf die Werften. Ich arbeitete täglich 10 Stunden. Ich tat es gerne. Ich brachte den Schweißern ihr Trinken und Essen. Und ich fegte die Hallen. Der Hallenwart glaubte, beliebt zu sein, dabei hatten wir uns nur an seine Art gewöhnt. Mich mochte er ganz gerne. An meinen gleichaltrigen Kollegen störte ihn ihr fehlendes Interesse an der Arbeit. Er nannte es Trägheit. Sie kümmerte es nicht.
Wie jeder vernünftige und empfindsame Mensch, verabscheute auch ich die harte körperliche Arbeit. Aber der gütige Gott, der mich sicher nicht erschaffen hatte, damit ich Hallen fegte, gab mir die Klugheit mich zu verstellen. Der Hallenwart glaubte, mir läge die Werft am Herzen.
Und er mochte es, dass ich in meinen Pausen und am Abend gerne las. Wahrscheinlich hatte er Mitleid mit mir - dem fleißigen Waisenkind. Als Kind, als Knabe und als junger Bursche war ich ein Freund des Lesens. Das bisschen Geld, das mir in die Hände kam, gab ich für Bücher aus. Abenteuer. Romane. Mit Karl Mays Indianern. Später lernte ich die Balladen von Schiller kennen. Ich lernte sie auswendig. Das verstand mein Gönner, der Hallenwart schon weniger. Dass ich den »Tell« und die »Räuber« las, fand er nicht gut. Kleine Geister verurteilen vieles, was sie nicht verstehen können.
***
Nach zwei Jahren bekam ich eine bessere Arbeit. Ich schleppte Metallteile zu den wachsenden Schiffen, lernte den Umgang mit dem Niethammer und sogar das Lichtbogenschweißen. Ich schlief, wie viele andere Jungs, auf der Werft in den Lagerhallen. Ein durchschnittlicher Monatslohn in Deutschland betrug circa 65 Mark. In den USA lag damals der Durchschnittslohn bei 37 US-Dollar. Ich träumte von einem Leben in den USA.
***
Als ich 16 Jahre alt wurde, durfte ich nachts nicht mehr unentgeltlich in der Fabrik schlafen. Ich musste mir ein eigenes Nacht-Quartier suchen. Dabei hoffte ich auf kirchlichen Beistand. Als ich meinen Herrn Pastor am Sonntag nach der Kirche, um seine Hilfe bat, musste ich erkennen, wie knapp Wohnraum in meiner Heimatstadt geworden war. Mein guter Pastor stieß an seine und an meine Grenze. Ich war arm. In dieser Nacht sprach ich lange mit dem frommen Mann.
Damals als ich zwölf war, hatte ich meinen Pastor für so dumm gehalten, dass ich ihn manchmal kaum ertragen konnte. Jetzt, da ich 16 war, war ich sehr erstaunt, wie viel der alte Mann in den vier Jahren dazugelernt hatte. Ich sagte es ihm. Er lachte. Er verstand Spaß. Er schenkte uns Wein ein. Er sprach mit mir, wie mit einem Mann. Ich sagte: »Gott, der Herr ruht seit dem siebten Tag.«
Er versuchte, mich davon zu überzeugen, dass ich mich irrte. Das gelang ihm nicht. Aber ich durfte den Rest der Nacht im Gästezimmer des Heimes schlafen.
Am anderen Morgen schaute ich müde und betrübt in meinen Tee. Ich verabschiedete mich und schaute müde und betrübt auf die Welt. Ich ging zur Werft. Müdigkeit und Resignation wichen Entsetzen. Es hatte gebrannt. Mehrere Hallen waren abgebrannt und eingestürzt. Überall war Rauch und Feuerwehr. Ich fragte den Mann an der Pforte: »Tote?«
»Ja.«
»Viele?«
»Ja sicher. Viele sind verbrannt. Zwei Dutzend. Und ein paar Zerquetschte.«
Ich sah ihn entsetzt an. Ob dies Absicht war?
Sein Gesicht zeigte keine Regung. Ich betrat das Werksgelände. Das Erste, was ich sah, war eine rauchgeschwärzte Glasscherbe. Und die nächsten 499 Dinge, die mir in die Augen stachen, waren weitere rauchgeschwärzte Glasscherben. Die ehemaligen Scheiben der Fabrikhallen waren durch die Hitze des Brandes aus den Rahmen geplatzt und auf den Wegen verteilt worden. Warum fielen alle Fensterscheiben bei einem Brand nach außen?
Überall war Feuerwehr und Polizei. Aber ich wagte nicht zu fragen. Überall rauchte es aus den Trümmern. Von einigen Hallen waren nur Mauerreste und einzelne Eisenträger übrig. Ich suchte meinen Chef. Die Halle, in der ich geschlafen hätte, war auch zerstört. Was für ein Glück, dass ich im Heim geschlafen hatte?
Nun sprach ich doch zu Gott. Nur ein Wort: »Danke!«:
Mein Chef sagte, dass aus unserer Halle drei Kollegen gestorben waren. Viele Verletzte. Die älteren Männer halfen beim Bergen der Leichen. Wir Jüngeren räumten Trümmer weg. Am Nachmittag wurde früher Schluss gemacht. Ich kümmerte mich wieder um eine Schlafstelle. Für eine anständige Unterkunft fehlte mir das Geld. Also brauchte ich eben eine unanständige Unterkunft.
3. Jüdische Vermieterin
1906 dürfen in Russland Jüdinnen nur dann vom Dorf in die Stadt umziehen, wenn sie sich als Prostituierte registrieren lassen. Anstelle ihrer Personalpapiere müssen diese Jüdinnen nun einen gelben Schein bei sich tragen. Auf diesem Schein müssen sie ihre wöchentlichen Gesundheitsuntersuchungen dokumentieren lassen.
***
Kollegen aus dem Werk hatten mir geraten, mich im jüdischen Viertel nach einer Schlafstelle umzusehen. Das jüdische Viertel lag zwischen dem lauten Bahnhof, den stinkenden Gerberei-Betrieben und dem Hafen an der toten Weichsel. Damals bot Deutschland den Juden und Jüdinnen noch vergleichsweise gute Bedingungen. Zumindest besser als in Russland, Polen oder Ungarn. Hier, im jüdischen Viertel, wohnten und arbeiteten fast nur Juden. Sie gehörten natürlich nicht zur jüdischen Oberschicht. Bankiers, Ärzte und Apotheker suchte man hier vergebens. Es waren arme Vertreter des Volkes Israel, die es hierher verschlagen hatte.
Flache Baracken aus rotem Backstein, ehemalige Hafen-Lager, verunstalteten die Gegend. Um sich die Miete für eine solche Baracke leisten zu können, suchten viele der Bewohner einen Untermieter. Zwischen den niedrigen Baracken verliefen Wege ohne Schotter oder gar Pflastersteinen. Bei Regen verwandelten sich diese Pfade in knöcheltiefen Schlamm. Bächlein gruben sich dann ihre Betten. Mäanderten gemütlich auf den großen Kanal zu, der sie zum Meer führte. Im Schlamm lag Müll. Zerbrochene Flaschen, Fetzen alter Zeitungen und politische Flugblätter.
Ich zog meine Hosen hoch, damit sie vom Schlamm unberührt blieben. In einigen der Baracken konnte man Kinder auf Jiddisch oder Polnisch krakeln hören. Hier hausten arme, jüdisch-polnische Familien. In anderen Baracken wurde Wäsche für Arbeiter gekocht und gebügelt. An einem Gebäude lud ein Schild dazu ein, am Abend ein billiges Bier zu trinken und Musik aus Quetschkommoden und Fideln zu hören. Einige der Baracken trugen Nummern und Symbole. Hier wohnten offensichtlich, käufliche Frauen. Die meisten der Jüdinnen kamen aus Polen. Viele wurden von ihren Verwandten zur Prostitution gezwungen. Viele sprachen meine Sprache schlecht oder gar nicht.
***
1906 ist das Gründungsjahr eines jüdischen Zuhälter-Ringes, der sich später Zwi-Migdal nennen wird. Diese Zuhälter organisieren die Beschaffung von europäischen, also hellhäutigen, Prostituierten für ganz Amerika.
***
Ich klopfte an einer grün gestrichenen Tür mit einem gelben Kreuz. So hatte man es mir, im Werk gesagt. Dort würde eine Jüdin einen Untermieter suchen. Die grüne Farbe war ganz frisch aufgetragen. Nirgendwo platze sie ab. Etwas Intaktes in dieser vom Zerfall bedrohten Welt. Auch die Scheiben an den winzigen Baracken-Fenstern hatten keine Sprünge. Ich klopfte ein zweites Mal. Die grüne Tür öffnete sich einen Spalt. Etwa auf Brusthöhe schauten mich die Augen einer Frau an.
»Ja bitte?«, fragte sie mit deutlich polnischem Akzent.
»Ich komme wegen des Bettes«, antwortete ich, »ich will es mieten. Ich haue Nieten beim Schichau, hab also gutes Geld.«
Sie sah mich lange an. Dann öffnete sie den Türspalt ein wenig weiter.
»Ziech dir de Schuch aus. Un komm rein«, sagte sie, ohne zu lächeln.
Ich behielt meine verdreckten Latschen in der Hand. Ich machte mit nackten Sohlen einen einzigen Schritt und stand auf ihrem Teppich. Sie deutete auf ein Brett am Boden und ich stellte meine Schuhe darauf ab.
»Bubele, biste ne Jidd?«, fragte sie mich.
Ich verneinte. Sie schüttelte bedeutungsvoll ihr Haupt.
»Also a Goi (Nichtjude). Massel (Glück) gehabt. Ich nehme keine Juden, als Untermieter«, sagte sie, »haste kejn Eltern? Biste arm?«
Ich nickte zwei Mal.
***
1907 gründet Bertha Pappenheim in Neu-Isenburg, nahe Frankfurt am Main, ein Mädchenwohnheim für Jüdinnen, die von Mädchenhändlern und Zuhältern aus ihren Familien gerissen wurden. Der Bedarf an derartig geschütztem Wohnraum für gefallene Judenmädchen ist groß. 1908 leben erst 10 Frauen in diesem Heim. 1928 sind es bereits 152 Schutzbedürftige. Die Bewohnerinnen sollen wieder in die jüdische Tradition und Kultur - und die jüdischen Gemeinden - eingebunden werden. Allerdings sehen viele reiche und einflussreiche Juden, das Heim, als einen Ort der Schande, wo Unmoral toleriert und womöglich gefördert wird.
***
Meine künftige Vermieterin war auf ihre Glaubensbrüder offenbar nicht gut zu sprechen. Dass auch sie, die Jüdin, keine Juden mochte, verstand ich nicht. Später erfuhr ich, dass Juden sie - vor Jahren - aus ihrem Dorf in Polen nach Deutschland gelockt hatten. Sie musste Deutsch lernen. Nun lebte sie hier im Judenviertel. Umgeben von armen polnischen und deutschen Juden. Die reichen Juden lebten in der Innenstadt. Studierte Männer und wohlhabende Kaufleute, die mit ihr und ihrem Gewerbe nichts zu tun haben wollten. Zumindest nicht bei Tageslicht. Doch von alldem ahnte ich damals noch nichts.
***
1908 bzw. 1910 ist Juden und Jüdinnen selbst die Mitgliedschaft im Alpenverein (Sektion Wien bzw. München) verboten. Eine Teilnahme am öffentlichen Leben ist, in großen Teilen Europas, erschwert oder gar unmöglich gemacht.
***
Seit einigen Jahren spürte man in Deutschland eine zunehmende Ablehnung gegenüber Juden. Auch hier, bei uns in Danzig. In der Werft sprachen die christlichen Vorarbeiter schlecht über die Juden. Ob sie wohl wussten, dass Jesus ein Jude war? Selbst die reichen Juden klagten über ihre Ausgrenzung vom öffentlichen Leben. Am schlechtesten hatten es sicher die armen, jüdischen Frauen, die aus dem Osten nach Deutschland kamen.
***
1908 prangert Bertha Pappenheim, die Heuchelei der Reichen und Mächtigen mit diesen Worten an: »Landarbeit und Industriearbeit ist ihnen versagt, höhere Berufe verschlossen, aber in den Hotels, in den Bordellen, Bädern, Varietés, da duldet man die jüdischen Mädchen als Prostituierte. Und die jüdischen Mädchenhändler duldet man, wo ein ehrlicher und anständiger Jude mit seiner Familie niemals geduldet würde.«
***
Meine künftige Vermieterin sagte: »Sibn Mal schlafen, die Woche. Ejn eigener Eingang. Ejn eigenes Klo im Hof. Wasser aus nem Wasserhahn. Kostet dich zwelf Mark den Monat. Haste das Bubele?«
Meine Augen wanderten an ihr auf und ab. Sie hatte stark geschminkte Augenlider. Kein Lippenstift. Ein aufgemalter Schönheitsfleck. Sie war vielleicht fünfunddreißig. Ihre Haare waren schwarz und lang. Das war nicht modern. Sie trug ein einfaches rotes Kleid. Es reichte ihr bis kurz unter die Knie. Ihre nackten Füße steckten in roten Pantöffelchen. Schick.
Jetzt lächelte sie. Vielleicht war sie auch erst dreißig. Eine Strickweste verbarg den Ausschnitt. Ihr Busen war groß. Sie war fast so groß wie ich. Schlank. Sie musste lachen: »Gefällt dir wohl, die große Ische (Frau, Mädchen)? Ich frag dich noch mal. Hast du genug Geld?«
Sie konnte besser Deutsch, als ich dachte. Der Akzent war kaum noch da.
»Ja, genug. Ich hau Nieten beim Schichau«, antwortete ich, »ich habe sogar etwas gespart. Ich kann zwei Monate im Voraus zahlen.«
Sie schaute mir in die Ohren und auf meine Hände.
»Gefällt mir, eine saubere Kluft (Kleidung), ein sauberer Leib. Ein sauberes Bubele. Probieren wir es. Ich vermiete dir das Bett. Du zahlst einen Monat im Voraus. Bekomme ich die Miete, nur ein einziges Mal, nicht pünktlich, fliegst du raus. Verstanden?«
Ich nickte.
Sie sagte: »Hier dein Schlüssel. Dein Eingang is' hinten. Wir müssen da raus und ums Haus rum. Komm mit junger Goi. Ziech dir de Schuch widder an.«
Sie ging voraus. Auf die Gasse und in den Hof. Sie passte auf, dass ihre Pantoffeln nur die Steinplatten berührten, die hier im Dreck lagen. Wir gingen in den Hof hinter dem Haus. Eine Tür verband den Hinterhof mit meiner ersten eigenen Wohnung. Die Frau mit den zu stark geschminkten Augen ließ mich zum ersten Mal meinen Hausschlüssel probieren. Ich schloss auf und sie zeigte mir meine künftige Kammer. Ein Bett, ein Tisch, ein Stuhl, ein kleiner Schrank, ein Öllämpchen. Vielleicht acht Quadratmeter. Ein kleines Fenster in den Hinterhof. Im Hof ein Waschbecken, direkt an der Backsteinwand. Ein paar Meter entfernt ein Klo-Häuschen aus Holz. Nein zwei. Sie hatte ein eigenes. Steinplatten im Schrittabstand führten auch zu den Holz-Häuschen.
»Haste das Geld für den ersten Monat dabei?«, wollte sie wissen.
Ich hatte. Und ich bezahlte sie. Sie bedankte sich, drehte sich um und zog meine Haustüre hinter sich zu. Ich schloss mein Zimmerchen von innen ab. Nun war ich allein in meinem neuen Reich. Vorbei waren die Tage unbeschwerter Kinderzeit. Nun war es so weit. Ich war erwachsen geworden. Eine eigene Wohnung. Ich schlief in meinem eigenen Bett. Ich ging zur Arbeit. Schlafen und Arbeiten. Tag für Tag.
In die Kirche ging ich nicht mehr. Stattdessen ging ich sonntags gerne in die Stadt und gönnte mir ein feines Essen. In einem Restaurant. Fleisch. Und Reis. Und Gemüse. Gewürze. Einmal rieb der Kellner sogar Pfeffer auf mein Essen. Ich kostete Currypulver. Und Zimt. Ich liebte Süßspeisen. Ich ging auch gerne mit den Kollegen aus. Auf ein Glas Bier. Viele von ihnen gingen, danach noch gerne ins Judenviertel. Zu einer der »Polacas«. Ich schämte mich, zu einer der polnischen Huren zu gehen. Mein Penis sah doch so gänzlich anders aus.
Als ich im Jahre 1908 meinem achtzehnten Geburtstag feierte, war ich noch immer Jungfrau. Wichsen tat ich fleißig. Ich hatte Postkarten aus Paris. Und ich las fleißig. Fleißig und gerne. Ich kannte Schiller und Goethe. Jetzt lernte ich Sokrates kennen. Er sagte: »Es ist keine Schande, nichts zu wissen, wohl aber, nichts lernen zu wollen.«
Ich wollte lernen. Sokrates sprach mir auch aus der Seele, wenn er sagte: »Wie zahlreich sind doch die Dinge, derer ich nicht bedarf.«
Ich brauchte Bücher. Ich las viele Bücher. Auch auf der Arbeit, im Werk, war ich fleißig. Ich durfte Schweißer werden. Ich bekam nun schon ganze 50 Mark im Monat. Noch nicht der durchschnittliche Monatslohn in Deutschland. Der lag damals bei 70 Mark. Aber mir reichte es dicke. In den USA, so hörte ich, lag das Durchschnittseinkommen bei 47 US-Dollar.
Von dem vielen Geld leistete ich mir einen schönen Sonntagsanzug. Und gute Schuhe. Ich konnte sogar Geld sparen. Es lag in einem doppelten Boden in meinem Schrank. Meine Vermieterin wechselte mir die Laken und putzte mein Zimmer. Selbst wenn sie in meinem Schrank geschnüffelt hätte - der doppelte Boden war völlig unsichtbar.
Vom ersten Tag an hörte ich meine Vermieterin, wenn ich abends im Bett lag und im Licht der Öllampe las. Ich las jeden Abend. Ich lieh mir die Bücher aus. Ich hörte die Vermieterin. Sie bewegte ihren Stuhl oder klapperte mit den Töpfen. Manchmal glaubte ich, sie auch im Schlaf zu hören. Sie schnarchte. Ob sie mich auch hörte?
Und weil die Wände so dünn waren, blieb auch das Geheimnis, womit sie ihr Geld verdiente, nicht lange ein solches. Sie war eine »Polaca«, eine polnische Juden-Hure. An manchen Tagen kamen zwei oder drei Männer. Dann wieder ein paar Tage lang keiner. Wenn einer da war, war ich ganz Ohr. Ich widmete mich intensiv der Betrachtung der Innenseiten meiner Augenlider und lauschte. Die Geräusche ihrer Geilheit. Ich wichste dabei. Ich war voller Neid. Ich musste lernen, meine Begierde zu zügeln. Aber wir alle müssen lernen, mit unseren Enttäuschungen leben. Ich musste mit meiner Enttäuschung einschlafen.
Der erste Monat im neuen Heim war vergangen. Einmal kam ein Kollege aus der Werft zu ihr. Ich hörte ihn sprechen. Ich erkannte seine Stimme. Ich hörte, dass die beiden Sex hatten. Ich zog mich an, lauschte und wartete, bis er fertig war. Als er befriedigt aus der grünen Tür ins Freie trat, passte ich ihn ab und sprach ich ihn an. Wir lachten herzlich. Wir teilten kleine Peinlichkeiten. Er ging zu einer Hure. Ich logierte bei einer. Frau Lena, so nannte ich meine Vermieterin, hatte mein Gespräch mit dem Kollegen vor ihrem Haus wohl mitbekommen. Als der Kollege von dannen zog, öffnete sie ihre grüne Türe, winkte mir zu und rief: »Komm mal her, Bubele.«
Ich näherte mich der Frau im roten Kleid. Barfuß war sie.
Sie lächelte mich an und sagte: »Da zchoket (lacht) ihr. Nu wisst ihr beide, was für ejne Frau ich bin.«
Sie deutete an, ich solle in ihre Wohnung kommen.
»Brauchst keinen Bammel haben«, beruhigte sie mich.
Ich trat ein. Frau Lena wies mir einen Stuhl am Tisch zu. Ich setzte mich.
»Wenn de a Geld hast, will ich dir auch ne scheene Zeit machen«, sagte sie verführerisch.
»Frau Lena«, antwortete ich verlegen, »Geld habe ich schon. Aber ich will es nicht für so was ausgeben.«
Sie lächelte und blieb auf Distanz.
»Du bist ein chocher (kluger) Goi (Nichtjude). Ein schlauer, berechnender Bub. Ein ausgekochter Kerl.«
Sie lächelte und fragte: »Oder hast du bloß noch nie ne Ische (Frau, Mädchen) gehabt?«
Woher wusste sie das? Sie sah mich mit ihren großen, braunen Augen an. So stark geschminkt, war sie. Sie stand seitlich neben meinem Stuhl. Dann musste sie, wohl gerade ganz dringend, das Tischtuch eben ziehen. Dabei berührte sie, wie zufällig, meine Hand. Es kitzelte wie Strom.
»Ja, Frau Lena. Noch nie«, gestand ich.
»Ein großer, prächtiger Kerl, wie du? Schön und sauber. Mit einer guten Arbeit. Und gutem Geld. S'is aa Schand.«
Sie legte zwei Finger auf meine Hand.
»Ejnmal probieren? Bechdej (damit) du mitreden kannst.«
Ihre Hand lag auf der meinen.
»Mein scheenes Bubele. So jung. So stark.«
Sie setzte sich neben mich. Auf den Tisch. Sie stellte mir ihren nackten Fuß auf den Oberschenkel. Das rote Kleid glitt dabei über ihr Knie.
»Gib mir einen Kuss«, befahl sie.
Ich hob mein Gesicht zu ihrem hoch, doch sie sagte. »Mein Bubele, nicht auf den Mund. Auf meinen Fuß.«
Sie hob ihn etwas von meinem Schenkel an. Ich nahm ihn in die Hand. So kühl. So lange Zehen. Ich hob ihn an meine Lippen und küsste ihn.
»Leck meine Zehen. Meine Fußsohle«, befahl sie.
Ich tat es. Es roch nach Kernseife und schmeckte an der Sohle ein wenig nach Staub. Sie hob nun den zweiten Fuß auf meinen anderen Schenkel.
»Magst du mal ne Muschi sehen? Schieb doch mein Kleid hoch«, lachte sie.
Offenbar mochte sie meine Unschuld und Naivität. Offenbar hatte sie mich gern. Ziemlich ungeschickt schob ich den leichten, roten Stoff in Richtung ihrer Hüfte. Sie hob kurz ihren Hintern, dass das Kleid nach oben rutschen konnte. Ihr nackter Unterleib war nur eine Handspanne von meinem Gesicht entfernt.
»So ist es dufte (gut)«, lobte sie mich, »streichel de Muschi.«
Zaghaft berührte ich ihr schwarzes, krauses Haar. Es war weicher, als es aussah. Sie legte ihre Hand auf die meine und führte meine Finger. Sie schob sich meinen Zeigefinger zwischen die Schamlippen und bewegte ihn hin und her.
»Kesser (flotter, frecher), kleiner Goi«, hauchte sie, als ich mich auf ihren Kitzler konzentrierte.
Meine theoretischen Kenntnisse der weiblichen Anatomie übertrafen meine praktischen Fähigkeiten bei Weitem. Ihr schienen meine Bemühungen aber trotzdem zu gefallen. Sie stöhnte leise. Ich rieb schneller. Mein Zeigefinger polierte ihre kleine Perle.
»So ist es recht, kleiner Shayget (nichtjüdischer Junge, Lump). Wichs mich. Spür wie ich feucht werde«, keuchte sie.
Sie zog sich ihr Kleid über den Kopf und hockte nun nackt vor mir auf dem Tisch. Sie ließ sich verwöhnen. Die Füße auf dem Tisch, die Knie angewinkelt, lag sie rücklings auf dem Tischtuch. Stöhnend genoss sie meine unerfahrenen Finger. Ich spreizte ihre Schamlippen und sah ihr rosafarbenes Inneres. Die kleinen Schamlippen, den runde Kitzler, die winzige Harnöffnung.
»Jetzt leck se, de Muschi!«, befahl sie.
Es roch ein wenig nach Urin. Und schmeckte ein wenig nach Salz und Fisch. Beides störte mich nicht. Ich vergrub mein Gesicht in ihrer Scham. Meine Lippen, meine Nase, ja selbst mein Kinn wurden feucht. Von meinem Speichel und ihren Säften. Sie lief förmlich aus. Sie war geil. Sie genoss die neue Rolle. Einmal war sie nicht die bezahlte Liebesdienerin. Die Frau, die Wünsche zu erfüllen hatte. Gerade konnte sie bestimmen. So viel älter als ich, war sie die Lehrerin. Die Herrin der Situation. Herrin über einen kleinen Goi, der tat was sie verlangte.
»Steck mir die Zunge in mein Loch«, kommandierte sie.
Und ich gehorchte. Ich leckte ihren Scheideneingang. Und konzentrierte mich auf ihren Kitzler. Ich gab mir Mühe. Frau Lena bedankte sich mit wohligem Schnurren.
Nach einer Weile sagte sie: »Hagam (obwohl) de nicht zahlst, will ich dir ne Fraid machen. Steh auf und ziech dich aus. Ganz nackt.«
Ich gehorchte und sie half mir beim Entkleiden.
»Nu komm, mejn Großer«, sie griff nach meinem halbsteifen Penis, sah ihn an und fragte, »du bist ja doch a Jidd?«
»Nein, Frau Lena«, erklärte ich, »das musste operiert werden. Die Vorhaut war zu eng. Schon als Baby.«
»Joi, was et nett all gibbt. Na da wollen wir mal sehen, ob er überhaupt funktioniert«, grinste sie und zog mich in ihr kleines Schlafzimmer.
Wie viele Liebhaber sie hier schon glücklich gemacht hatte?
»Ich frai mich immer, nen neuen Haberer (Freund, Kumpel, Liebhaber) ins Bett zu kriegen. Und einen so hübschen noch dazu.«
Wir legten uns nebeneinander und sie wichste sanft meinen Penis. Ihre langen Fingernägel reizten meine entblößte Eichel. Ich wurde steif.
Sie lachte zufrieden: »Nix, kleiner Goi. Ganz schön groß biste, für dein Alter.«
Ich lag auf dem Rücken. Sie kuschelte sich, Bauch an Bauch, auf mich. Sie rieb ihre haarige Scham an meinem Penis. Er wurde hart. Und stand nun schräg nach oben. Ich wollte ihn greifen und versuchen, ihr Loch zu treffen. Aber sie zog meine Hand weg und rieb ihn weiter mit ihrer Scham. Endlich hatte sie Erbarmen und zwängte meine Eichel zwischen ihre Schamlippen. Es war so warm. Langsam senkte sie sich über mich. Sie federte zurück und ließ sich erneut tiefer sinken. Und noch ein Stückchen tiefer. Sie sah mir in die Augen.
»Gut so kleiner Goi?«, wollte sie wissen.
»So gut«, stöhnte ich.
»Du wirst aber nicht schon spritzen«, ermahnte sie mich, »beiß dir gefälligst auf die Lippen. Ich will dich ein Weilchen reiten. Hörst du?«
Ich hörte sie wirklich kaum.
»Ja, ja. Gut«, keuchte ich.
Ich war schließlich schon kurz vorm Abspritzen. Ich biss mir kräftig in die Lippen. Und sie ritt los. Erst langsam, dann schneller und schließlich in einem irrsinnigen Tempo. Ihr langen Haare flogen. Ihre schon ziemlich schlaffen Titten wippten auf und ab. Ich griff nach ihnen.
»Pack mich kräftig. Halt mich fest. Ja! Fester!«, befahl sie.
Das ließ ich mir nicht zweimal sagen und knetete ihre Titten. Ich zog und kniff ihre Brustwarzen, während sie ihren Galopp fortsetzte.
»Oh je! Frau Lena!«, rief ich, »ich kann nicht mehr. Ich muss jetzt spritzen!«
Meine Reiterin reagierte blitzschnell. Sie rollte sich zur Seite, packte meinen zuckenden Penis und wichste mich, bis der letzte Tropfen auf meinem Bauch und meiner Brust gelandet war.
Sie lachte und fragte: »War klasse, nicht wahr? Mein Großer?«
Ich nickte dankbar. Ich atmete noch heftig.
»Nächstes Mal wird es aber länger dauern. Auch wenn du rechtschaffen geschlaucht (erschöpft) bist. Ich will es auch genießen. Leck mich jetzt. Bis ich komme. Verstanden?«
Gerne wollte ich gehorchen. Sie kroch mit ihrem Unterleib zu meinem Gesicht und senkte ihren Schoß auf meinen Mund.
»Leck mich!«, sagte sie.
Ich züngelte an ihrem Loch und steckte meine Zunge tief hinein. Ich saugte und leckte. Ich gab mir große Mühe; streckte die Zunge, so weit wie möglich, in ihr Fleisch. Sie ließ sich, sicher fünf Minuten lang, lecken. Ich arbeitete beharrlich. Dann kam es ihr. Sie zitterte ein wenig und stöhnte laut. Ich war ganz stolz. Wie sehr sie zitterte? Ich hatte es offenbar gut gemacht. Wir lagen heftig atmend nebeneinander. Noch ein Weilchen durfte ich ihre Po-Backen streicheln, dann sagte sie: »Jetzt geh!«
Meine Lehrerin hielt den Zeitpunkt für gekommen und um Lebewohl zu sagen. Sollte ich mich für ihre Arbeit bedanken? Ich wagte es nicht.
Leise und ganz förmlich sagte: »Frau Lena, auf Wiedersehen.«
Sie lächelte nicht einmal.
Wie sich doch alles verändert. Der erste Schnee fiel, und ich war nun ein richtiger Mann.
In der darauffolgenden Woche rief sie mich noch zweimal zu sich. Sie wollte meine Zärtlichkeit. Dafür lehrte sie mich die Spiele der Erwachsenen. Das Küssen, das Streicheln und den richtigen Sex. Das Normale, wie es die Missionare verlangten und die Stellung, wie es die Tiere machten. Ich liebte es, ihr Becken an mich zu ziehen, auf ihre Hinterbacken zu sehen, wie mein Steifer dazwischen rein und raus sauste.
Einmal brachte ich ihr auf dem Heimweg von der Arbeit ein paar Pralinen mit. Getrieben von der Hoffnung auf eine weitere Lektion, brachte ich ihr mein Geschenk. Doch sie nahm die Schokolade einfach entgegen und schickte mich wieder weg. Sie sagte nur: »Heute nicht.«
Vielleicht hatte sie heute schon zu viele Freier gehabt? Oder sie wollte, in meinem Falle, einfach die Kontrolle über ihren Körper nicht abgeben?
Ein paar Tage später durfte ich Frau Lena wieder besuchen. Wir trieben es wie rollige Marder. Es war so wild. Ich musste bald abspritzen.
Lena lachte und schimpfte: »Du warst schon wieder erster.«
Ich merkte, dass sie ein Späßchen machte, obwohl sie wirklich enttäuscht war.
»Lena, was kann ich dagegen machen. Ich beiße mir schon ganz kräftig in die Lippe.«
»Um deine Gier zu zügeln? Denk ans Sterben«, sagte sie, blickte kurz ernst und lachte dann laut.
Ich sah sie verwundert an.
Sie sagte: »Weißt du, Bub; Frauen die richtig herzhaft lachen, die nehmen ihn auch in den Mund.«
Lena tat das eine wie das andere. Sie lachte laut und nahm meinen Penis in den Mund. Es war toll. Und ihre Regel war keine schlechte. In diesen Wochen lernte ich viel von ihr. Wie Frauen einen Orgasmus vortäuschen. Und Männer eine ganze Liebes-Beziehung. Ich hörte von Männern, die zu Lena gingen und ihrer Frau auf dem Nachhauseweg, Pralinen kauften. Ob es auch männliche Huren gab? Ich wagte es sie nicht zu fragen? Mir fehlte ein nettes Wort für Prostituierte.
Ich lag in meiner Kammer auf dem Bett. Ich studierte eine Zeitung. Ich wollte bald von meinem Ersparten eine Aktie kaufen. Vielleicht gelänge es mir auf diesem Weg – so wie es die Reichen taten – ein wenig Gewinn zu machen. Wahrscheinlich war es ein Glücksspiel. Andererseits boomte der Schiffsbau. Vielleicht sollte ich in Krupp-Stahl investieren?
Ich war wohl beim Studium der Aktienkurse eingeschlafen. Plötzlich – es muss spät am Abend gewesen sein - hörte ich Lena schreien. Ich zweifelte an meinen Sinnen. War es real? War es ein Traum? Es war kein Traum. Sie schrie. Anhaltend. Barfuß und in meinem Nachthemd rannte ich aus meinem Zimmer. Schnell über den Hof und vor auf die Gasse. Ich eilte zu der grünen Tür. Und trat ein. Ohne anzuklopfen. Meine Vermieterin lag rücklings auf dem Tisch. Sie war splitternackt und schrie. Zwischen ihren gespreizten Beinen stand ein junger Mann. Warum schrie sie so?
Erst jetzt sah ich, dass ihre Arme und Beine an den Tisch gefesselt waren. Der Kerl, der ihr das angetan hatte, war blond und trug einen teuren Anzug. Als ich hereinplatzte, drehte er sich zu mir um. Jetzt sah ich, was er ihr antat. Er zog seine Hand aus dem Unterleib meiner Lena. Augenblicklich hörte ihr Schreien auf. Er hatte ihr wehgetan. Ich machte zwei Schritte vorwärts. Auf den jungen Mann zu. Meine Faust schnellte vor und - zertrümmerte ihm, mit einem Schlag, sein Unterkiefer.
Wer über Jahre hinweg, jeden Tag Metall trägt, wird recht kräftig. Ohne eine weitere Reaktion kippte er bewusstlos zur Seite um. Hart schlug er auf den Boden auf.
»Lena, ich helfe dir«, rief ich und fühlte mich, wie ihr Retter.
Wie erstaunt war ich, als sie mich - aus ihrer peinlichen Position heraus - entsetzt ansah und rief: »Mein Gott, so hilf ihm doch auf. Was hast du nur getan?«
Ich verstand kein Wort. Ich öffnete die simplen Knoten, mit denen ihre Arme am Tisch gefesselt waren. Dann befreite ich ihre Füße und Beine. Sie setzte sich sofort auf, sprang vom Tisch, beugte sich - nackt wie sie war - zu dem ohnmächtigen, jungen Mann.
»Was hast du nur getan?«, schrie sie mich an, »er ist doch der Sohn vom General.«
Nackt wie sie war, eilte sie in die Küche und kam mit einem nassen Handtuch wieder. Sie presste es ihm - abwechselnd und hektisch - an Stirn und Schläfen. Allmählich begriff ich, was passiert war. Jeder, der in Danzig lebte, wusste, dass der General des 27. Armee-Korps einer der einflussreichsten Männer in Danzig war. Und ich hatte seinen Sohn angegriffen. Und offensichtlich schwer verletzt. Er rührte sich nicht. Bewegungslos lag er da. Ganz bleich. Blut rann aus seinem Mund. Es floss auf den Boden. Und der kleine See aus Blut wuchs schnell.
»Du Schmock (Dummer)!«, schrie Lena mich an, »was für ein Schlamassel (Unglück, Sorgen)!«
Sie rieb das nasse Tuch an seinen Schläfen. Er stöhnte nur kurz und versank wieder in tiefe Bewusstlosigkeit. Das Blut quoll weiter aus seinem Mund auf den Boden.
»Ich wollte dir doch nur helfen. Er tat dir doch weh«, versuchte ich meine Rettungsaktion zu rechtfertigen.
Lena war den Tränen nahe und rief: »Helfen wolltest du? Du Idiot. Er bezahlte dafür. Und zwar sehr gut. Du Schmock! Jetzt stecken wir in einem schönen Schlamassel. Der Kerl geht zu seinem Papa und wir werden eingesperrt. Wenn wir Glück haben. Du Schmock!«
Lena tupfte wieder an seinen Schläfen. Vergeblich.
Dabei schimpfte sie mich weiter aus: »Er rührt sich noch immer nicht. Vielleicht stirbt er. Oh Himmel!«
Und tatsächlich. Die Blutlache war inzwischen riesig. Sein Unterkiefer lappte deformiert nach unten. Die verzweifelte Lena ließ sie von dem leblosen Körper ab und stand auf.
Sie keuchte: »Wir müssen weg. Raus aus Danzig. Weit weg!«
Sie sah sich im Zimmer um und versuchte Klarheit in ihr Denken zu bekommen.
Sie sagte: »Pack alles ein, was du hast. Alles. Hörst du. Deine Papiere. Dein Geld. Alles«!
Ohne die Bedeutung ihrer Worte zur Gänze zu durchschauen, gehorchte ich. Ich rannte in meine Kammer, packte all meine Habe in meinen Seesack und kam wieder zu ihr. Sie hatte sich inzwischen angezogen. Sie befahl mir, ihr beim Packen zu helfen. Sie füllte einen Koffer und eine große Umhängetasche.
»Wir müssen weg. Sofort«, jammerte sie, »wir gehen sofort zum Bahnhof. Vielleicht geht morgen früh ein Zug. Nur weg von hier. Sein Alter bringt uns um.«
»Aber meine Arbeit?«, versuchte ich einzuwenden.
»Idiot. Die Maloche (Schwerstarbeit) ist jetzt deine kleinste Sorge. Du bist, seit gerade, ein gesuchter Schwerverbrecher. Wie viel Geld hast du?«
Ich nannte ihr den Betrag: 274 Mark. Immerhin 4 Monatslöhne. Sie war zufrieden.
»Komm mit. Zum Bahnhof. Wir lassen ihn liegen.«
Sie warf sich die Tasche über die Schulter und sagte: »Ich krieg ne Gänsehaut, wenn ich an den Kerl denke.«
»Aber er ist dein … ähm, Gast.«
»Nicht der. Der andere Kerl. Sein Vater.«
Sie nahm den Koffer und flüsterte: »Vielleicht bist du meine Nemesis (Strafe, Vergeltung).«
4. Bremerhaven und Lenas Geschichte
Es war zwei Uhr in der Nacht, als wir im Bahnhof von Danzig ankamen. Ich kaufte Bahnsteigkarten und wir gingen in den Wartesaal. Außer uns, verbrachten hier noch ein halbes Dutzend Menschen die Nacht. Sie hingen auf den langen Holzbänken und schliefen. Eingemummelt in ihren Mänteln. Neben ihrem Gepäck. Müde und resigniert schaute ich auf diese düstere Welt. Ich sah nur Müdigkeit und Resignation. Wir verbrachten eine unruhige Nacht. Am frühen Morgen kaufte ich zwei Karten für den ersten Zug. Der Zufall - und die preußische Eisenbahn - brachten uns nach Hamburg. So früh am Morgen waren noch nicht viele Reisende im Zug.
Lena und ich waren alleine in dem Abteil. Ich seufze tief. Das war die Welt, wie ich sie kannte. Keineswegs freundlich zu mir. Ich war den Tränen nahe.
»Meine Arbeit. Wer sagt es dem Chef? Und meine Bücher. Ich muss sie doch zurückbringen. In die Bibliothek.«
Lena versuchte mich mit Zitaten zu beruhigten: »Komm morgen - bring mir Unglück - denn ich habe heut gelebt.«
»Lena, was redest du da für einen Unsinn.«
»Das ist aus dem Talmud«, sagte sie empört, besann sich dann und meinte, »vielleicht auch von der Wand in einem Bahnhofsklo in Danzig.«
Der Zug ratterte und ich dachte darüber nach, wie es zu wäre ein wenig zu weinen. Nur ein wenig Wimmern. Wie ein Kind.
Voll Selbstmitleid seufzte ich: »Weh mir.«
»Wehe uns«, sagte Lena und bot mir eine weitere Portion Talmud, »nimm das Leben nicht so ernst, du kommst eh nicht lebend davon.«
Ich hörte kaum zu. Ich weinte. Mir fiel auf, dass sie kaum noch Jiddisch sprach. Warum passte man sich im Dialekt seinem Gesprächspartner an? Egal.
Ich rieb mir die Tränen aus den Augen. Nun war ich also ein gesuchter Verbrecher. Ich hatte die Leihbücher nicht zurückgegeben. Egal. Ich hatte den Kerl niedergeschlagen. Ich war auch niedergeschlagen. Vielleicht war ich ein Mörder. Ein Bücherdieb und ein Mörder. Dieses endlose Rattern.
Lena zauberte einen Schnaps aus der Umhängetasche. Wir tranken aus der Flasche. Lena erzählte mir flüsternd von unseren Plänen. Ich war froh, dass sie das Kommando übernommen hatte.
Ich würde in Hamburg neue Bahnfahrkarten kaufen müssen. Lena wollte, dass wir von dort aus, weiter nach Bremerhaven reisten. Dort würden wir bei ihren Chaverim (Freunden) in einem Beisel (Kneipe) untertauchen. Sie kannte scheinbar den Wirt. Ein Jude aus Polen. Wir würden uns dort verstecken müssen. Und warten bis ein erster Passagier-Dampfer nach Übersee fuhr. Ich dachte an Amerika. Sie erklärte, dass wir falsche Pässe brauchten. Für die Ausreise. Und darin eingetragen, jeweils ein Visum. Vielleicht für Brasilien oder Argentinien. Lena erklärte mir, dass auch Mexiko oder die Vereinigten Staaten infrage kämen. Ich hörte kaum zu. Ich dachte an die Leihbücher und den Sohn des Generals. Lena erklärte mir alles noch einmal.
***
Zwei Tage später hatten wir uns, im Obergeschoss einer Hafenkneipe in Bremerhaven, einquartiert. Hier, sagte Lena, könnten wir in Sicherheit, vor Strafverfolgung, warten. In vier Tagen würde der Passagierdampfer »Petropolis« ablegen. Sein Zielhafen war Buenos Aires in Argentinien. Mir wären die USA lieber gewesen. Aber ich hatte keine Wahl. Lena besorgte schließlich die falschen Papiere.
***
In diesen Tagen erklärte Lena mir so einiges. Dass sie kein Kies (Geld) hatte. Nichts gespart. Dass alleine ich die Schuld an dem ganzen Schlamassel trug. Dass es somit nur recht und billig wäre, dass ich hen Überfahrt, hen Pässe (hen bedeutet sowohl, als auch) und auch die Visen bezahlte. Andererseits erfuhr ich auch, dass sie Deutschland schon lange verabscheute und dies auch für sie eine Gelegenheit wäre, ein neues Leben zu beginnen. Und - was mich am meisten erstaunte - sie wäre, als junge Frau schon einmal in Argentinien gewesen. Lena versicherte mir, dass sie fließend Spanisch sprach. Als ich sie fragte, wieso sie schon in Argentinien war, antwortet sie nur: »Eine sehr lange Geschichte. Später werde ich sie dir erzählen. Aber nicht jetzt.«
In Bremerhaven verließen wir unser Zimmer nur für Lenas krumme Geschäfte. Der polnische Kneipenwirt gab Lena einen Kassiber (Brief) von ihrem Onkel Levin. Darin stand, wo, wir was, von wem, bekämen. Woher sie wohl alle diese Ganoven (gannaw, stehlen) kannte? In den nächsten Tagen sah ich mehr Lumpenpack als in meinem ganzen vorherigen Leben. Lena führte mich zu vielen ihrer seltsam, zwielichtigen Bekannten.
Lena sagte: »Ich will nur dein Bestes.«
Dann sagte sie: »Geld her.«
Ich bezahlte alles: die Bahnkarten, die Übernachtungskosten, die Verpflegung in der Kneipe, die Tickets für unsere Überfahrten nach Argentinien, die falschen Pässe und die Visen. Alleine die beiden Karten für den Dampfer kosteten zwei Mal 55 US-Dollar. Mein schönes Gespartes löste sich rasch in Nichts auf.
Lena und ihr Onkel Levin - den ich noch nicht einmal gesehen hatte - bestanden darauf, eine Doppelkabine in der zweiten Klasse zu nehmen. Ich kaufte also zweimal die viel teurere zweite Klasse. Eine Karte in der dritten Klasse, im Unterdeck, hätte man schon für 32 US-Dollar bekommen. Aber der mysteriöse Onkel Levin bestand auf der zweiten Klasse. Warum wohl? Jedenfalls war mein ganzes Erspartes weg. In wenigen Tagen - einfach alles weg – wofür ich jahrelang gespart hatte. Und ganz plötzlich hatte Lena nun doch Geld gefunden. Geld, um neues Essen und Bier aufs Zimmer kommen zu lassen. Ob alle Huren derart logen?
Ich klagte Lena meine Sorgen vor der so gänzlich, ungewissen Zukunft. Sie riet mir zu Gelassenheit und zitierte offenbar wieder aus dem Talmud: »Sorge dich nicht zu sehr um morgen - wer weiß, was dir heute noch widerfahren mag.«
Wieder so ein schwacher Trost. In meiner näheren Zukunft würden Lena und ich, als Mutter und Sohn reisen. Auf unseren Papieren standen die neuen Namen: Mein Name war nun Noel Trautwein, ich war Jude. Geboren, 1890. Meinem wirklichen Geburtsjahr. In Danzig. Sie war meine Mutter Lena Trautwein, geboren in - ich war verblüfft - Buenos Aires.
***
Den polnischen Wirt und seine lichtscheuen Gäste störte es nicht, dass wir laut waren. Dass aus dem Zimmer von Mutter und Sohn, recht häufig, recht unzweideutige Geräusche auf den Hotelflur drangen interessierte hier niemanden. Wir vertrieben uns nämlich die Zeit mit Sex. Wir trieben es oft und lange. Ein lehrreicher und spaßiger Zeitvertreib. Lena benutzte mich zu ihrer Entspannung. Am liebsten ließ sie sich lecken. Oder sie ritt auf mir. Ihr Gesicht in Richtung meiner Füße. So mochte sie es am liebsten. Ich mochte es am liebsten nach Art der Hunde.
Inzwischen durfte ich oft erfahren, wie wunderbar es war, wenn Lena meinen Penis in den Mund nahm. Sie leckte und saugte an meiner Eichel. Sie meinen Steifen zwischen ihren eng geschlossenen Lippen. Sie züngelte entlang des Schaftes. Ihre Zunge zupfte an meinem Bändchen. Ihre Zungenspitze tupfte gegen meine Harnöffnung. Einmal durfte ich sogar in ihren Mund entladen. Sie schluckte mein Sperma, ohne mit der Wimper zu zucken. Ich dachte an ihre Regel mit dem Lachen. Lena lachte herzlich und sie nahm den Mund ganz voll. Ihre neuste Regel war wohl nicht ernst gemeint: »Es gibt zwei Sorten von Frauen. Ganz-Schwierige und Schwanz-Gierige.«
Oft durfte ich meiner erfahrenen Gefährtin mit meiner Zunge dienen. Dazu setzte sie sich aufs Sofa. Ganz vorne an die Kante der Sitzfläche. Sie hatte die Beine weit gespreizt und ihre nackten Füße lagen auf dem Tisch. Meine Aufgabe war es, ihr in dieser Position, die Scheide zu lecken. Ich machte es gerne. Sie bekam röchelnd und stöhnend einen Orgasmus. Das liebte ich. Während sie noch zuckte, musste meine Zunge ganz langsam ihre Klitoris liebkosen. Am dritten Tag im gemeinsamen Hotelzimmer kniete ich wieder einmal zwischen den Beinen meiner »Mutter«. Sie war relativ unbeeindruckt von meinen Diensten. Nur manchmal ein leises Seufzen. Diesmal war sie in Gedanken.
»Lena, mache ich es nicht gut«, fragte ich und spuckte ein paar ihrer Schamhaare auf den Teppich.
Sie unterbrach ihre offenbar düsteren Gedanken und seufzte: »Doch Schatz, ich mache mir nur Sorgen, wie alles werden wird. Weißt du? Drüben in Argentinien. Leck mich bitte noch ein wenig. Es tut mir wirklich gut.«
Ich konzentrierte mich darauf, tief durch ihre Spalte zu lecken. Meine Finger suchten nach ihrem Kitzler. Klein, wie er war, fand ich ihn nicht so leicht. Gleichzeitig leckte meine Zunge ihre Säfte. Heute wurde Lena nur langsam feucht. So kannte ich sie nicht. Normalerweise wurde sie unter der Behandlung meiner Zunge rasch geil. Sie schien sich wirklich Sorgen zu machen. Es dauerte einige Minuten, bis ihre Erregung hörbar wurde. Mit der aufkeimenden Lust wurden auch ihre Geräusche lauter. So kannte ich Lena. Mein Finger streichelte sanft ihre kleine Perle. Ganz wenig nur, schwoll sie an. Jetzt benutzte ich meine Zunge. Ich kreiste flink mit der Zungenspitze über den kleinen Knubbel. Dann sauge ich kräftig an ihrer Klitoris. Lena entspannte sich. Sie seufzte zufrieden. Und ich wechselte die Frequenz, mit der ich sie leckte. Mal schnell, mal langsam. Ich spielte mit ihr. Es machte mir Spaß, ihre Erregung zu kontrollieren. Ihr Seufzen wurde zu einem Grunzen. Jetzt wollte sie kommen. Und ich verhalf ihr zu einem gepflegten Orgasmus. Heute nicht wild und von Kreischen begleitet, sondern sanft und gemütlich. Sie stöhnte nur leise. Wir kuschelten. Ihr war nach Zärtlichkeit zumute gewesen. Später trieben wir es wieder, wie die Kaninchen. Noch später schliefen wir.
Wir aßen auf dem Zimmer. Wir lasen in einer einzigen alten Zeitung. Es war langweilig. Wir sahen aus dem winzigen Fenster. Ich zählte die Ziegel auf dem gegenüberliegenden Dach. Lena bestellten ein paar Flaschen Bier aufs Zimmer. Das Bier konnte unsere trübe Laune nicht verbessern. Lena klagte: »Also werden wir Deutschland eben den Rücken kehren. Uns ein neues Leben aufbauen. In Argentinien.«
Mir war die Situation klar. Ich dachte an die Römer der Antike. Sie nannten Silber »Argentum«. Später gaben die spanischen Eroberer dem Land in Südamerika den wohlklingenden Namen »Land des Silbers«. Ich sagte nichts. Ich sah Frau Lena an. Vorläufig waren wir Komplizen. Und Reisegefährten. Wir würden - zumindest vorläufig - beide für ihren Onkel Levin arbeiten.
Inzwischen wusste ich, was Namen und Ausweise in dieser Gesellschaft bedeuteten. Nichts. Sie erzählte, dass Onkel Levin eigentlich nicht ihr richtiger Onkel wäre. Hier war nichts, wie es schien. Alles war Schein und Fälschung. Ich hasste diese zwielichtige Welt da draußen. Acht Reihen zu je zwölf Dachziegeln. 96 Ziegel. Ich schwieg.
Lena hatte mir längst erklärte, dass dieser Onkel Levin ein hochrangiges Mitglied einer jüdischen Verbrecher- und Zuhälter-Organisation war. Eine Bande namens Zwi-Migdal. Hier in diesem Hotelzimmer hörte ich diesen Namen zum ersten Mal. Er stand für eine Bande jüdischer Männern – und einigen Frauen. Verbrecher, die ihr Geld mit Mädchenhandel, Prostitution, Raub und Erpressung verdienten.
Dieser Onkel Levin war also ein Mädchenhändler. Er wird uns bald in unserem Hotel besuchen. Und er wird mit uns die Reise nach Übersee unternehmen. Nach Buenos Aires, der Hauptstadt von Argentinien. Lena erklärte mir, dass wir zu tun hätten, was er uns auftragen würde. Aufmerksam und schweigend hörte ich zu. Sie erzählte mir, dass sie Skrupel habe, für den Mädchenhändler zuarbeiten. Sie sagte, es bereite ihr Unbehagen, irgendwelche Mädchen zu Prostituierten zu machen. Andererseits würde Onkel Levin uns gut bezahlen. Und wir würden das Geld dringend brauchen. Drüben. In Argentinien. In unserem neuen Leben.
Ich trank einen Schluck Bier, schaute in ihre großen, dunklen Augen und fragte sie: »Lena, wieso hast du Hemmungen davor, Frauen in die Prostitution zu bringen? Du hast doch selbst so dein Geld verdient?«
Lena wurde ernst und berichtete mir erstmals von ihrer Jugend. Es wurde ein langer Bericht.
»Ich war - gerade 18 Jahre alt - aus Polen nach Hamburg gekommen. Dort überzeugte mich ein Mann davon, für ihn als Hure zu arbeiten. Ich liebte ihn und er wurde mein Zuhälter. Jens, das Schwein. Ich musste am Hafen anschaffen. Und ich musste das Geld an Jens abliefern. Jens war Abschaum. Abschaum, der unter Steinen glibbert. Gemeiner, madenverseuchter Schlamm. Er hat mir alles Geld genommen. Später kaufte mich ein netter Jude meinem Zuhälter Jens ab. Zumindest hielt ich ihn am Anfang für nett. Der Jude nahm mich mit nach Brasilien. Ich war damals so naiv. Ich glaubte wirklich, er würde mich dort zu seiner Frau machen. Aber er war ein Mädchenhändler. Einer von der Zwi-Migdal-Bande. Er verkaufte mich an einen Bordellbetreiber in Rio de Janeiro. Wieder war ich eine Hure. Eine von vielen Polacas. Polnisch-jüdisches - vor allem aber, junges und weißes - Frischfleisch. Ich lernte von meinem Besitzer und von den Freiern die portugiesische Sprache. Und ich lernte, wie es ist, als Hure für die Zwi-Migdal