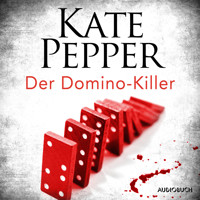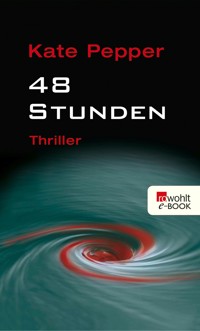
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Er ist schon einmal entwischt. Jetzt wird er wieder töten. Nach einem Streit mit ihrer Schwester Susan verschwindet die vierzehnjährige Lisa spurlos. Susan und ihr Mann Dave, ein New Yorker Polizist, suchen vergeblich nach ihr. Als am nächsten Tag ein rätselhafter Brief eintrifft, wird klar: Lisa ist entführt worden. Und der Brief stammt offenbar von demselben Täter, der schon einmal ein Mädchen entführt hat – dem einzigen Mörder, den Dave nie gefasst hat …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 438
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Kate Pepper
48 Stunden
Thriller
Deutsch von Tanja Handels
In inniger Liebe für Oliver, Eli und Karenna, die mich bei allem inspirieren.
DANKSAGUNG
Ein neues Jahr, ein neuer Roman – doch die Liste der üblichen Verdächtigen, die mir auch diesmal wieder mit Hilfe und Unterstützung zur Seite gestanden haben, hat sich nicht entscheidend verändert. Komplizen im Hintergrund waren mein Agent Matthew Bialer und meine Lektorin Clair Zion, die mich mit ihrer Kreativität und ihrem Zuspruch über zahlreiche Fassungen ans glückliche Ziel des fertigen Manuskripts geführt haben. Ich danke all den einfallsreichen Menschen bei New American Library und Penguin, die an diesem Roman gefeilt und ihn auf dem Weg zur Veröffentlichung vorangebracht haben. Außerdem danke ich Detective Robert Burke, Planning Officer Sal Ferrante und den anderen Beamten aus der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des 84.Reviers in Brooklyn für ihre Liebenswürdigkeit, ihre Klugheit und die Bereitschaft, mir ihre Zeit zu widmen und fiktiven Problemen harte Fakten entgegenzusetzen. Mein größter Dank schließlich gilt meinem Mann, Oliver Lief, für den messerscharfen redaktionellen Blick, mit dem er meine Rohfassungen immer und immer wieder liest, und dafür, dass er die Fackel so unermüdlich hochhält.
PROLOG
Er beobachtete sie, als sie die Water Street entlangging, ganz und gar gefangen im Teleobjektiv seiner Kamera. Kein Teil von ihr blieb seinem Blick entzogen. Sie ging wie immer schnell, die Tasche mit dem Paisleymuster über der Schulter – sie trug keinen Rucksack wie andere Teenager. Das lange blonde Haar, so luftig wie Zuckerwatte, schien sie zu umfließen, und ihre Haut war weiß wie die einer Porzellanpuppe. Aus dieser Entfernung konnte er ihre Augen nicht sehen, doch einmal hatte das Teleobjektiv sie erfasst. Sie waren grün. Er folgte ihr mit der Kamera, während sie sich dem Gebäude näherte. Das war jeden Morgen auf dem Weg zur Schule dasselbe. Sie schien größer zu werden, als sie direkt unter seinem Beobachtungsposten vorbeiging, und dann wieder kleiner, je weiter sie sich entfernte.
Heute machte sie ihm ein ganz unerwartetes Geschenk: Sie blieb stehen, stellte ihre Tasche auf das Kopfsteinpflaster des Gehsteigs, wo die Asphaltschicht dünn geworden war, und trat mitten hinaus auf die Straße. Ein einzelner Wagen fuhr vorbei, dann war sie wieder allein… oder glaubte das zumindest. Ohne auch nur einen Augenblick zu zögern, drehte sie eine Jazzdance-Pirouette, kam mit ausgestreckten Armen auf und verbeugte sich leicht vor dem Beifall eines imaginären Publikums. Er fotografierte sie und verspürte dabei eine Welle der Erregung: Jetzt könnte er es tun, genau jetzt, kein Mensch würde ihn sehen. Dann kam ein Mann in Anzug und Krawatte vorbei, lächelte sie an und applaudierte, und sie verbeugte sich noch einmal. Es schien ihr überhaupt nicht peinlich zu sein – das gefiel ihm so an ihr. Sie hob ihre Tasche auf und ging beschwingt und lächelnd weiter. Dann verschwand sie aus der Reichweite seines Objektivs, wie jeden Morgen, und er verspürte tiefe Traurigkeit.
Er schraubte das Teleobjektiv von der Kamera und legte es auf das Fensterbrett mit den Pflanzen, vor dem das Stativ stand. Heute war es schlimmer als sonst, er wusste gar nicht recht, warum. Er fühlte sich hoffnungslos. Seit drei Monaten wartete er schon, ohne dass der richtige Augenblick gekommen wäre.
Als er die Fotocollage betrachtete, die eine ganze Wand einnahm, blieb sein Blick an einem alten Fotostreifen mit vier Bildern hängen. Er hob eine Schere vom Boden auf, schnitt sorgfältig das letzte Foto ab und steckte es in die Tasche. Ein auf Film gebannter Augenblick: ein unschuldiger Kuss. Der Beweis, dass er mehr war als nur das Ungeheuer, für das man ihn halten würde, wenn alles vorbei war.
KAPITEL 1
Dienstag, 6.33Uhr
Susan Bailey-Strauss saß in ihrem gelben Chenille-Bademantel auf einem Barhocker in der Küche und hörte, wie sich Lisas Zimmertür mit vernehmlichem Quietschen öffnete. Ihre kleine Schwester nahm ihren neuen Status als Neuntklässlerin der besten New Yorker High School für Darstellende Kunst offenbar sehr ernst und stand noch früher auf als nötig. Susan warf einen Blick auf die runde Uhr, die neben dem Kühlschrank an der Wand hing, und rechnete rasch aus, dass Lisa wohl eine halbe Stunde zu früh zum Unterricht kommen würde, falls die U-Bahn keine Verspätung hatte. Sie hörte sie im Bad verschwinden und die Tür hinter sich schließen.
Neben ihr an dem schwarzen Granittresen in der Küche ihres Lofts saß Dave, ihr Mann. Er war in die Morgenzeitung vertieft, schien die Geräusche von draußen gar nicht wahrzunehmen. Normalerweise genoss Susan sein morgendliches Schweigen, den langen Weg, den er zurücklegen musste, um richtig wach zu werden und in den Tag starten zu können. Doch heute spürte sie eine leichte Nervosität, die unter der behaglichen Oberfläche des gemeinsamen Alltags vibrierte. Sie hatte ihm etwas Schwieriges zu sagen und wusste nicht recht, wie sie es anfangen sollte. Sie hätte sich gewünscht, dass er sie ansah, wollte ihn von den weltpolitischen Ereignissen ablenken und mit ihm über die Scharniere von Lisas Zimmertür reden, die er trotz aller Versprechungen wieder nicht geölt hatte, sie wollte ihre jeweiligen Pläne für den Tag durchsprechen und ihm noch einmal für die wunderschönen Geburtstagsgeschenke danken, die er ihr am Abend zuvor gemacht hatte: die Kette mit dem tropfenförmigen Diamanten, die faustgroßen blutroten Rosen und die Parkettplätze für die Broadway-Aufführung, für die man so schwer Karten bekam. Sie wollte sich mit belanglosem Geplauder ablenken und schließlich genau den richtigen Moment abpassen, um es ihm zu sagen – «Ich will ein Kind, Dave» – und anschließend gemeinsam mit ihm den erlösenden Moment seiner Freude zu erleben. Schließlich flehte er sie praktisch auf Knien um Kinder an, seit sie vor anderthalb Jahren geheiratet hatten. Das Dumme war nur, dass sie ihm vorher noch etwas anderes sagen musste.
Sie hatte ein Geständnis zu machen. Zuerst musste sie es Lisa sagen, wenn sie das nächste Mal mit ihr allein war. Und dann Dave.
Doch der frühe Morgen, bevor sie zur Arbeit und zur Schule aufbrachen, war ein schlechter Zeitpunkt für wichtige Gespräche, das wusste Susan. Und während sie alles zum hundertsten Mal im Kopf durchging, sagte sie sich, dass es wohl besser sein würde, allein und einzeln mit ihnen zu reden, nach Möglichkeit sogar, wenn der andere nicht da war. Eins nach dem anderen, zügelte die kleine Stimme in ihrem Innern ihre Ungeduld, es ist nur fair, wenn Lisa es zuerst erfährt. Dabei sehnte sie sich doch so danach, Dave zu sagen, dass sein Wunsch bald in Erfüllung gehen würde.
Susan trank einen Schluck Orangensaft und griff dann nach ihrem BlackBerry, um zu sehen, ob vielleicht neue E-Mails gekommen waren, seit sie vor fünf Minuten das letzte Mal nachgesehen hatte. Nichts. Dabei kam es gar nicht selten vor, dass ihr elektronischer Draht zur Welt schon so früh am Morgen zum Leben erwachte. Die ersten Arbeiter starteten ihre Schicht in der kleinen Fabrik um sechs, um mit der Herstellung der wichtigsten Pralinen anzufangen und die ersten Lieferungen entgegenzunehmen. Susans kleine, feine Chocolaterie, die sie vor drei Jahren eröffnet hatte, war sehr viel schneller gewachsen, als sie sich je hätte träumen lassen: Inzwischen versorgte Water Street Chocolates die besten Restaurants von New York mit raffinierten Leckereien. Seit Lisa im letzten Jahr zu ihnen gezogen war, hatte Susan sich schweren Herzens daran gewöhnt, die tägliche Öffnung des Betriebs ihrer fähigsten Mitarbeiterin zu überlassen – sie war, wie Susan selbst, Absolventin des French Culinary Institute. So konnte Susan zu Hause bleiben, bis Lisa zur Schule aufbrach. Es war ein ganz natürlicher Schritt, mehr Verantwortung abzugeben, und im Grunde sollte sie sich nicht so viele Gedanken machen, schließlich hatte sie dieselbe Ausbildung durchlaufen und war durch die Selbständigkeit überraschend früh zum Erfolg gelangt. Aber sie neigte einfach dazu, sich Sorgen zu machen. Wieder rief sie ihre E-Mails ab, wieder ohne Ergebnis.
Jetzt lugte Dave doch über den Rand seiner Zeitung, ein Grinsen auf dem markanten, unrasierten Gesicht. «Und, ist jetzt was gekommen? Oder jetzt vielleicht? Am besten schaust du nochmal nach. Achtung! Da kommt eine Mail, ich spür’s genau!» Er rieb sich im Scherz den Arm. «Ich glaube, die hat mich gestreift. Hast du ein Pflaster da, Süße?»
«Sehr witzig, Dave.» Sie trat ihm mit ihrem rosa Plüschpantoffel gegen das Schienbein. «Irgendwer muss es ja wettmachen, dass du nie deine Mails checkst.»
Um seine dunkelbraunen Augen bildeten sich Lachfältchen. «Wegen des universellen Gleichgewichts?»
«Genau.»
«Ich bin eben das Yin zu deinem Yang.»
Er beugte sich von seinem Barhocker zu ihrem hinüber und küsste sie. Früher am Morgen, als es noch dunkel war, hatten sie miteinander geschlafen, und jetzt blieben seine salzigen Lippen lange auf ihren. Sie ließ die Hand über sein weiches schwarzes T-Shirt gleiten und schob zwei Finger durch die Gürtelschlaufe seiner Jeans. Der Geschmack seines Mundes erinnerte sie an ihre erste Begegnung vor drei Jahren, bei einer gemeinsamen Schicht im Park Slope Food Coop, der Lebensmittelkooperative, in der sie beide Mitglied waren. «Probier mal», hatte er zu ihr gesagt und ihr eine der knoblauchgefüllten grünen Oliven hingehalten, die sie gerade zum Verkauf in Tüten packten. Dieser Augenblick, der würzige Geschmack der Olive, war für sie zum Talisman geworden, hatte ihr Leben verändert. Sie küssten sich noch einmal und lösten sich erst voneinander, als sie die Badezimmertür hörten und Lisas Schritte auf dem Gang.
Lisa kam herein, lief barfuß über die Holzdielen und ging direkt zum Kühlschrank. Sie hatte sich bereits geschminkt und das lange Haar gebürstet, das ihr in einem hellen Strang über den Rücken fiel. Ihr heutiger Aufzug war grenzwertig: eine enge, tief auf der Hüfte sitzende Jeans und ein kurzes Batiktop, unter dem ein Bauchnabelpiercing mit einem kleinen Glasstein hervorschaute. Susan war sich durchaus darüber im Klaren, dass sie auch Piercings tragen würde, wenn sie noch im Teenageralter wäre. Aber sie war kein Teenager mehr; sie war erwachsen und trug die Verantwortung für Lisa.
«Ich weiß ja, dass das hip ist», sagte sie deshalb so ruhig wie möglich. «Aber du bist erst vierzehn, und es ist vielleicht keine so gute Idee, dich so… aufreizend anzuziehen. Vor allem nicht hier in der Großstadt.»
«Danke für den Tipp, Suzie. Hat Dave dir eigentlich gesagt, wie scharf diese Hüfthose aussah, die du gestern anhattest?» Lisa öffnete den Kühlschrank und warf einen Blick hinein.
Dave schien wieder in seine Zeitung vertieft, doch Susan hörte das unterdrückte Lachen und sah seinen rechten Mundwinkel zucken.
«‹Mama never told me…›» Ein Lied, wie immer. Lisas süße Stimme verklang in einem Summen. Sie nahm sich einen Trinkjoghurt mit Pfirsichgeschmack und machte den Kühlschrank wieder zu. «Tut mir ja leid, Suzie, aber…» Achselzuckend drehte sie den Verschluss von der Joghurtflasche und warf das blaue Stück Plastik quer durch die schmale Küche in den Mülleimer. «Tor!»
Waren eigentlich alle Teenager solche Meister des Halbsatzes, des bedeutungsschweren Anfangs, des unausgesprochenen Refrains zur immer gleichen Melodie? Susan wusste, wie der Satz weiterging:… aber du bist nicht meine Mutter. Lisa trank einen großen Schluck Joghurt, und auf ihrer Oberlippe blieb ein heller Streifen zurück, wie ein geisterhafter Nachhall. Susan widerstand der Versuchung, nach einer Serviette zu greifen und Lisas herbes und zugleich schmerzlich schönes Gesicht wieder sauber zu wischen.
«Weißt du, was mir gerade einfällt?» Lisa trank einen weiteren Schluck Joghurt. «Das war, als du achtzehn warst und ich vielleicht zwei.»
«Drei», verbesserte Susan und presste dann die Lippen zusammen, um nicht auszusprechen, was sie dachte: dass sich kein Mensch so weit zurückerinnern konnte.
«Du hast mit Mommy über deine Klamotten gestritten. Und ich dachte, du darfst so frech zu ihr sein, weil du ihr leibliches Kind bist, aber für mich gelten andere Regeln, weil ich eben adoptiert bin.»
«Das hast du tatsächlich gedacht?»
Am letzten Wochenende hatte Lisa verkündet, dass sie sich auf die Suche nach ihren leiblichen Eltern machen wolle. Das machte Susan Sorgen. Das Verhältnis zwischen ihr, Lisa und ihrer Mutter Carole war nie frei von Problemen gewesen. Carole hatte sich stets sehr bemüht, das zu verbergen, und Susan war ihrem Beispiel gefolgt. Doch Lisa war nicht so anpassungsfähig. Wenn sie etwas wollte, ließ sie nicht locker.
Das vergangene Jahr hatte Susan gezeigt, was für Opfer ihre Mutter gebracht, wie viel Frust sie ertragen hatte – und noch einiges mehr. In letzter Zeit hatte sie angefangen, sich mit fast narzisstischem Eifer mit ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen, als wäre sie selbst wieder in der Pubertät. Sie schob die Schichten ihres sorgsam konstruierten Erwachsenseins beiseite, erinnerte sich an ihre frühe Jugend und überdachte die alten Entscheidungen noch einmal mit kristallklarer Schärfe. Manchmal hatte sie den Verdacht, dass ihre Mutter Lisa genau aus diesem Grund zu ihr geschickt hatte.
«Was hast du heute vor?», fragte sie Dave.
Er hob die dunklen, ein wenig zu dicht beieinanderstehenden Augen von der Zeitung. «Ich wollte erst mal ins Fitnessstudio und später am Vormittag in die Bibliothek.» Sie checkte Mails für sie beide, dafür las er für zwei. Susan litt unter einer zu spät erkannten Legasthenie, das Lesen machte ihr keinen Spaß, und anfangs hatte sie es richtig befremdlich gefunden, mit welchem Eifer Dave Bücher, Zeitschriften und Zeitungen verschlang. «Ich muss erst um vier auf dem Revier sein.»
Susan mochte es gar nicht, wenn er in seiner Polizeidienststelle die Spätschicht zugeteilt bekam. Ihr eigener Arbeitstag begann früh am Morgen, und abends war sie völlig erschossen. Wenn er so spät nach Hause kam, sahen sie einander kaum.
«Kannst du vielleicht irgendwann ein Stündchen für den gelben Streifen erübrigen?» Sie bat ihn schon seit Monaten darum, den Parkverbotsstreifen auf die Straße zu malen. «Gestern waren wir gleich doppelt zugeparkt, und Jackson hat sich mit einer Lieferung nach Manhattan um zwei Stunden verspätet. Schon zum zweiten Mal. Das hätte mich fast den Kunden gekostet.»
«Ich versuche, es heute noch hinzukriegen, Liebling.» Er faltete die Zeitung zusammen, stand auf, beugte sich zu ihr und gab ihr einen Kuss. «Versprochen.»
«‹Versprochen, versprochen!›», schmetterte Lisa in dem Ton, den sie als ihr «Broadway-Blöken» bezeichnete. Auf der spezialisierten High School, die sie besuchte, lernte sie alle möglichen Gesangstechniken und setzte diese Errungenschaften gern auch zu Hause ein. Meist hatte Susan nichts dagegen, aber manchmal war sie doch überrascht, wie laut Lisas Sangeskünste sein konnten.
Dave ging lachend durch den Flur ins Schlafzimmer. Als die Tür hinter ihm zugefallen war, senkte Susan die Stimme. Sie hatte schon häufiger festgestellt, dass das der beste Weg war, Lisas volle Aufmerksamkeit zu bekommen.
«Glaubst du, wir können uns heute irgendwann mal unterhalten?»
«Wie wär’s mit gleich?» Lisa kam um den Tresen herum und setzte sich auf den Barhocker, von dem Dave gerade aufgestanden war.
«Jetzt habe ich keine Zeit. Ich muss in die Fabrik… wir haben eine Bestellung von tausend Schokoladentrüffeln für eine Benefizveranstaltung morgen Abend im Museum of Modern Art. Aber nach dem Abendessen?»
«Ich habe um sieben Probe. Danach vielleicht?»
«Wann immer du willst. Ich bin hier.»
«Cool.» Lisa überflog die Titelseite der Zeitung, fand aber offenbar nichts Interessantes darauf. «Ich bin spätestens um zehn zu Hause. Weißt du was? Während du auf mich wartest, kannst du doch mit dem Puzzle anfangen, das ich dir geschenkt habe.»
In dem knallig bunt verpackten Päckchen war eine weiße, unbedruckte Schachtel gewesen. Das Puzzle hatte fünfhundert Teile, und es gab keinerlei Hinweis darauf, was für ein Bild daraus entstehen würde.
«Mache ich», sagte Susan. «Und wenn du wieder da bist, reden wir.»
Die Uhr auf dem steinernen Kaminsims zeigte 22.02Uhr. Susan saß zwischen den beiden großen Wohnzimmerfenstern, die nach Westen zum Fluss hinausgingen, vor dem zusammenklappbaren Spieltisch – der allerdings immer dort stand, weil sie ständig mit irgendwelchen Puzzles oder anderen Spielen beschäftigt waren – und versuchte, den einfachen blauen Rand von Lisas Geschenk zusammenzusetzen. Am anderen Ende des Zimmers lief der Fernseher. Der Nachrichtensprecher hatte gerade die Hauptthemen des Abends angekündigt: Kriege, Überschwemmungen, ein Vulkan, der auszubrechen drohte – globale Katastrophen, vor denen die eigenen Problemchen eigentlich nichtig erscheinen sollten. Als sie hörte, wie die Wohnungstür geöffnet wurde, ging Susan durchs Zimmer, nahm die Fernbedienung vom Couchtisch und schaltete die Nightly News aus.
Lisa warf ihre Stofftasche mit dem lila- und rosafarbenen Paisleymuster gleich an der Tür von sich. Sie streifte die Jeansjacke ab, zog die Turnschuhe aus, kam dann in den Wohnbereich, wo Susan es sich bereits auf dem Sofa gemütlich gemacht hatte, und drapierte sich auf der Armlehne eines plüschigen Sessels.
«Meinetwegen musst du nicht ausmachen.»
«Ist doch sowieso immer dasselbe», sagte Susan. «Mord und Totschlag, Chaos und Zerstörung. Ich habe keine Lust, mir das anzuschauen.»
«Hat Dave die Welt also noch nicht vom Verbrechen befreit?» Wenn Lisa lächelte, verschwand das Grübchen an ihrem Kinn.
«Noch nicht. Wie war die Probe?»
«Gut.» Lisa drehte ihren schmalen, biegsamen Körper so, dass sie von der Lehne auf den Sitz des Sessels glitt. Sie legte den Kopf in den Nacken und schaute zur hohen Decke hinauf. «Aber lang.»
«Hör mal, Schatz…»
Lisa hob den Kopf und sah Susan an. Die Sehnen an ihrem Hals waren angespannt, ließen sie noch zerbrechlicher aussehen als sonst. «Du brauchst gar nichts zu sagen», erwiderte sie. «Ich habe mich schon entschieden, ein für alle Mal.»
«Nein, Lisa, hör mir doch erst mal zu.»
Lisa schüttelte den Kopf. «Natürlich werde ich Mommy davon erzählen, bevor ich anfange, aber ich bin mir ganz sicher, dass es sie nicht stören wird, wenn ich meine leiblichen Eltern suche. Mommy weiß schließlich, dass ich sie liebe. Sie weiß, dass sie immer meine eigentliche Mutter bleiben wird.»
«Darum geht es doch gar nicht.»
«Ich muss endlich wissen, wer ich bin, wer ich wirklich bin.»
«Du bist einzigartig, Lisa. Kein anderer Mensch ist so wie du.»
«Wie wahr.» Lisa grinste, dann verzog sie das Gesicht. «Aber das ist nicht der Punkt.»
«Ich verstehe ja…»
«Nein, tust du nicht. Kannst du gar nicht. Das kann man nur verstehen, wenn man selbst adoptiert ist.»
«Ich werde dich jetzt nicht fragen, ob du dich immer geliebt und aufgehoben gefühlt hast», sagte Susan, «weil ich weiß, dass das so war.»
«Wie gesagt, das ist nicht der Punkt.»
«Und ich verstehe auch, dass du deine leiblichen Eltern finden willst… dass du sie finden musst.»
Lisa schwieg. Jetzt hörte sie ihr zu.
«Ich will, dass du glücklich bist. Und ich will, dass du sie findest. Ich werde dir dabei nicht im Weg stehen.»
Lisas helle Augen schienen ein wenig dunkler zu werden. «Worüber wolltest du denn dann mit mir reden, Suzie? Über etwas anderes?»
«Nein, schon darüber.»
«Dann findest du das also gut?»
«Ich finde es unvermeidlich», erwiderte Susan. «Und ich finde es wichtig.»
«Und?»
«Und… ich will dir dabei helfen.»
«Cool! Ich habe schon ein bisschen im Netz gesurft und eine richtig gute Seite gefunden, mit der man anfangen könnte. Außerdem dachte ich, vielleicht kann Dave uns mit den offiziellen Dokumenten und dem ganzen Kram helfen, weil er doch Polizist ist.»
Lisa war bis an den äußersten Rand des Sessels gerutscht. Ihr Eifer brach Susan fast das Herz.
«Wir werden keine Hilfe brauchen», sagte sie behutsam.
«Aber…»
«Ich weiß, wer deine Eltern sind.»
Lisas Miene schien einen Moment lang wie erstarrt, als hätte sie jemand auf ein Foto gebannt. Alles, was sie ausmachte, schien sich auf dieser Oberfläche zu sammeln: all das Großartige, was noch vor ihr, all das Abnorme, was hinter ihr lag.
«Du weißt, wer sie sind? Hast du das immer schon gewusst?»
Susan nickte. «Du musst jetzt stark sein, Schätzchen.»
«Sag’s mir einfach.»
Susan beugte sich vor und verschränkte die Hände auf den Knien. Sie hatte heute absichtlich eine weite Hose angezogen, eine dreiviertellange rote Cargo-Hose, obwohl es eigentlich schon zu kühl war für nackte Beine.
«Deine leibliche Mutter bin ich.» Hatte sie das wirklich gesagt, nach all den Jahren? «Und ich habe dich nicht weggegeben, wir haben dich bei uns behalten. Verstehst du? Du warst von Anfang an gewollt.»
Lisas Unterkiefer klappte herunter, der Mund blieb ihr offen stehen. Sie war sprachlos – ganz untypisch für ein Mädchen, das sonst nie um einen geistreichen Kommentar verlegen war. Ein Schleier schien sich über ihre Augen zu senken, dann wurde ihr Blick plötzlich wieder ganz klar.
«Du?»
Susan nickte.
«Aber du bist doch meine Schwester.»
«Ich habe dich zur Welt gebracht», sagte Susan. «Da war ich fünfzehn.»
Die verhängnisvolle Aussage hing zwischen ihnen wie eine scharfgeschliffene Waffe, die sich jederzeit in die eine oder die andere Richtung drehen konnte.
«Weiß Dave davon?»
«Noch nicht. Aber ich werde es ihm sagen.»
«Er wird dich verlassen.»
Da war es also: Die Strafe ließ nicht lange auf sich warten.
«Das werden wir sehen.»
«Du hättest es doch auch für dich behalten können», sagte Lisa. «Du hättest uns weiter belügen können.» Ihr Blick irrte durch das große Zimmer und richtete sich dann wieder direkt auf Susan. «Mich und Dave und dich selbst.»
Sie sprang auf. Die Kurven ihres Körpers, die sie schon wie eine junge Frau wirken ließen, schienen zu verschwimmen, sie war wieder das zierliche kleine Mädchen, das Susan immer so vergöttert hatte.
«Ich habe dich so lieb», sagte Susan. Sie stand ebenfalls auf, überwand den Abstand zwischen ihnen und streckte die Arme aus, um Lisa zu berühren. Lisa, ihre Tochter. Da war sie, die Wahrheit.
Lisa wandte sich brüsk ab und ließ die Arme hängen.
«Wir haben nur getan, was wir für das Beste hielten, Lisa.»
«Das Beste für wen?»
«Für dich.»
«Mommy und Daddy haben mich auch belogen.»
«Wir waren uns alle einig, dass es so am besten ist.»
«Und wer ist mein Vater? Oder weißt du das gar nicht?»
«Das ist gemein.»
«Ach, jetzt bin ich also gemein? Guter Witz!»
Susan kam noch ein wenig näher, ihr ganzer Körper ein einziges Flehen, doch Lisa wich ihr aus. Sie rannte zur Wohnungstür, zog ihre Turnschuhe an und stürmte türenschlagend nach draußen. Susan fröstelte bei der Vorstellung, wie Lisa draußen frieren würde, ganz allein, so spät am Abend.
KAPITEL 2
Dienstag, 22.29Uhr
Draußen war es dunkel und kalt. Lisa lief die Washington Street entlang, wo unter der dünngewordenen Asphaltschicht an vielen Stellen handverlegtes Kopfsteinpflaster hervorschaute. Als sie an die alten Bahngleise kam, die sich wie zwei metallene Nähte zwischen den unebenen Steinen hindurchzogen, sprang sie mit ihren hellblauen Wildleder-Turnschuhen zielsicher darauf. Sie balancierte auf dem alten, blankpolierten Gleis entlang und setzte dabei einen Fuß vor den anderen, wie eine Seiltänzerin, die Arme zur Seite gestreckt, um das Gleichgewicht zu halten.
Deine leibliche Mutter bin ich.
Das konnte einfach nicht wahr sein. Es entsprach so gar nicht Lisas Tagträumen. Sie hatte sich ihre leibliche Mutter immer hochtalentiert, verwegen und einsam vorgestellt, als Außenseiterin, als Rebellin, die die Sprache und die Regeln des Alltags nicht beherrschte. Eine Frau, deren Seele am Gestank schmutziger Windeln zugrunde gegangen wäre, obwohl das Erlebnis der Geburt sie zutiefst verändert hatte – eine Frau, die selbst nicht nach Lisa suchte, weil das für sie einen viel zu großen Aufwand bedeutet hätte, die aber dennoch seit vierzehn Jahren darauf wartete, gefunden zu werden.
Ihre Mutter war eine Revoluzzerin. Ihre Mutter war ein Genie, sie stand weit über den normalen Sterblichen. Und Lisa hatte das Genie ihrer Mutter geerbt, diese unauslöschliche Flamme.
Früher hatte sie sich immer vorgestellt, Joni Mitchell sei ihre Mutter, und in dem Lied «Little Green», der musikalischen Beschwörung eines verlorenen Frühlings, sei von ihr, Lisa, die Rede. Mit diesem Traum war es aus, als Jonis leibliche Tochter die Mutter aufspürte und sie sich vor den Augen der Öffentlichkeit wiedertrafen: zwei erwachsene Frauen, die einander unglaublich ähnlich sahen. Und im Grunde hatte Lisa gewusst, dass es zeitlich nicht hinkommen konnte. Der falsche Zeitpunkt, aber der richtige Gedanke. Und so trieben Jonis Stimme und ihr Geist Lisa zu ihrer nächsten Überzeugung: Für jedes Mädchen gab es eine Mutter, für jeden Jungen einen Vater. Irgendwo wartete die Antwort auf sie.
Wie sie selbst besaß auch ihre Mutter ein besonderes Talent und war überzeugt, dass ihr das zustand.
Ihre Mutter konnte doch keine verunsicherte Studienabbrecherin sein, die in Brooklyn Edelpralinen herstellte.
Ihre Mutter war zierlich und blond wie Lisa selbst und strahlte vor innerer Schönheit. Sie steckte voller Begabungen, war ihre verlorengeglaubte Zwillingsschwester.
Und sie war auf keinen Fall eine sportliche, dunkelhaarige Frau mit praktischem Kurzhaarschnitt. Ihre Mutter stand nicht im weißen Kittel, mit einer Plastikhaube auf dem Kopf, in einer Fabrik und formte Trüffel, bis ihr die Finger wehtaten.
Ihre richtige Mutter würde niemals über ihre Kleider oder ihre Freunde meckern und darüber, dass sie zu spät nach Hause kam. Sie würde Lisa ganz intuitiv verstehen. Ihre richtige Mutter konnte ihr unmöglich die Windeln gewechselt, ihre intimsten Gerüche aus solcher Nähe wahrgenommen, ihr tränenreiches, untröstliches Babygeschrei erlebt haben. Ihre wahre Mutter hatte sie nicht ertragen müssen, sie war frei von allem Wissen um ihre Fehler. Ihre wahre Mutter würde begeistert sein, sie endlich kennenlernen zu dürfen.
Lisa hatte sich ihre leibliche Mutter auf so viele verschiedene Weisen vorgestellt: als Königin, gefangen in ihrem goldenen Käfig, als misshandelte, siebenfache Mutter, die nicht wusste, wie sie ein weiteres Mäulchen stopfen sollte, als Trickbetrügerin aus Monte Carlo. In jedem Fall aber stand sie im Zentrum irgendeines großen Dramas. Sie war eine Zauberkünstlerin, die sich selbst in- und auswendig kannte, und es war für sie die einzig mögliche Entscheidung gewesen, ihr Kind fortzugeben.
Aber doch nicht Susan. Ihre Schwester. Eine Frau, die alles haben wollte und das durch Lügen erreicht hatte.
Lisa balancierte die alten Schienen entlang, immer einen Fuß vor den anderen. Hinter der grünen Rasenfläche und den kurvigen Steinwegen des Empire-Fulton Ferry State Park hörte sie Wellen ans Ufer schwappen. Als sie klein war, hatte es den Brooklyn Bridge Park – einen Themenspielplatz, bei dem sich alles um Schiffe drehte – noch nicht gegeben. Wie gern hätte sie einen richtigen Platz zum Spielen gehabt, als sie mit fünf zum ersten Mal hier war! Damals blieb in diesem Viertel alles der Phantasie überlassen. Sie wusste noch, wie sie mit sehr viel kleineren Füßen auf ebendiesen Schienen entlangbalanciert war, zu Besuch bei ihrer großen Schwester in deren großem Loft in der großen Stadt, wo alles so ganz anders war als in ihrem Heimatort Carthage in Texas.
Susans Loft mit den riesigen Fenstern und dem Blick auf das glitzernde Manhattan war Lisa wie ein Palast vorgekommen. Damals interessierte es sie noch nicht, dass es immer zu wenig heißes Wasser gab und die Heizung im Winter nicht funktionierte. Susan war eine Prinzessin für sie, die fern der Heimat ein märchenhaftes Leben führte. Auf den Straßen war damals noch nicht viel los: Dumbo – «Down Under the Manhattan Bridge Overpass», wie das Viertel zwischen Manhattan und Brooklyn Bridge genannt wurde – war gewissermaßen die Großstadtprovinz, ein heruntergekommenes Viertel mit zahlreichen leerstehenden Lagerhäusern zwischen zwei lärmenden Brückenauffahrten. Inzwischen waren all die gespenstischen, widerhallenden Gebäude Sanierungsprojekte mit klar umrissenen Vorgaben, und in die Verkehrsgeräusche von oben mischte sich fortwährend Baulärm. Tagsüber herrschte ein ohrenbetäubender Krach im Viertel, das von dem plötzlichen Wachstum etwas überrumpelt schien. Doch abends, wenn die Bauarbeiter nach Hause gegangen waren und die Galerien und Patisserien Sicherheitsgitter vor die glitzernden Schaufenster gezogen hatten, war Dumbo wieder genauso seltsam, unmöglich und aufregend wie damals: ein fliegender Elefant, ein magischer Ort, ein ungelüftetes Geheimnis.
Lisa erinnerte sich noch gut an die Mienen ihrer Eltern, als sie Susans Loft zum ersten Mal betraten. Sie hatten ihren Schock, ihr Entsetzen nicht verbergen können. Susan, damals zwanzig, hatte rasch nach unten geschaut, den verzauberten Ausdruck im Gesicht ihrer kleinen Schwester gesehen und sich dann mit neu erwachter Zuversicht wieder den fassungslosen Blicken ihrer Eltern zugewandt.
Sosehr Lisa es auch zu schätzen wusste, dass Susan und Dave die Wohnung inzwischen gekauft und luxussaniert hatten: Unter all den polierten Holz- und Steinoberflächen spürte sie immer noch die primitiven Gegebenheiten des ursprünglichen Lofts. Allen heroischen Versuchen zum Trotz machte der Loft heute einen etwas unglücklichen Eindruck, wie eine aufgedonnerte, altjüngferliche Tante, die in letzter Minute noch einmal alle Register zu ziehen versucht. Nur der Geruch, dieses jahrzehntealte Aroma, war noch derselbe. Wenn man ganz still in dem eleganten Wohnbereich saß und die Augen zumachte, fühlte man sich um zehn Jahre zurückversetzt: Es war wieder kalt und aufregend in dem leicht heruntergekommenen Raum, und man war Spiderwoman, Cinderella und Little Green in einem.
Am Eingang zum Park sprang Lisa von den Schienen herunter. So spät am Abend war es friedlich hier, am Wasser gingen nur ein paar Leute spazieren: ein Pärchen, das seinen Hund von der Leine gelassen hatte, und ein einsamer blonder Mann mit schütterem Haar. Susan und Dave erlaubten ihr sonst nicht, nachts allein unterwegs zu sein – nur wenn sie auf dem Heimweg war, und selbst dann musste sie sich noch für jede Minute rechtfertigen. Wenn sie nicht genau zur vereinbarten Zeit zu Hause war, klingelte sofort ihr Handy. Gut, dass sie ihre Tasche samt Telefon in der Wohnung gelassen hatte. Sie ging in den Park und atmete tief durch. Man vergaß so leicht, dass New York City eine Insel war, doch jedes Mal, wenn es ihr wieder einfiel, verspürte Lisa ein Glücksgefühl. Im Nordosten von Texas, wo sie aufgewachsen war, war man von allen Seiten vom Land umschlossen.
Sie setzte sich auf eine Bank und verschränkte die Arme vor der Brust, was allerdings auch nicht viel gegen die kühle Nachtluft half. Der East River floss ruhig dahin, man sah kaum eine Welle, alle Schiffe waren zur Nacht am Ufer vertäut. Der Himmel war klar und samtig schwarz, besetzt mit kleinen weißen Sternen. Weißt du, wie viel Sternlein stehen an dem blauen Himmelszelt? Lisa kamen die Tränen. Sie war ganz plötzlich kein Kind mehr, denn sie hatte etwas erfahren, was schlicht und einfach eine Tatsache war.
Susan war ihre Mutter.
Susan war ihre Mutter.
Susan war ihre Mutter.
Der Hund, ein rotbrauner Terrier, wetzte an ihr vorbei, das Paar folgte ihm langsamer. Sie schauten nicht zu Lisa hin, und sie sah auch nicht zu ihnen hinüber, sondern blickte nur starr auf das Wasser, das sanft an das steinige Ufer schwappte. Auf einer Seite lag ein Stapel verrottender Holzpfähle. Dann ließ ein leises Pling sie aufblicken. Der einsame Mann versuchte erfolglos, Steinchen auf dem Wasser springen zu lassen. Schließlich sprang einer zweimal, bevor er unterging. Er versuchte es erneut, und diesmal hüpfte der Stein gleich dreimal – pling, pling, pling – über die dunkelglänzende Wasseroberfläche. Lisa konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen. Wäre er nicht ein Fremder gewesen, hätte sie ihm etwas zugerufen, «Glückwunsch!» oder so.
Sie überlegte, ob es mit der Liebe vielleicht auch so war: Man hörte plötzlich ein Pling am späten Abend und schaute auf. Vielleicht war Susan ja auf diese Weise schwanger geworden. Ein paarmal pling, dann war der Stein untergegangen.
Ihr wurde klar, dass sie wohl ziemlich albern aussah, wie sie da halb weinend und halb lachend auf einer Parkbank am steinigen Ufer des Flusses hockte. Allein in der Großstadt, spät am Abend. Albern. Sie stand auf und folgte dem kurvigen Weg, der aus dem Park hinaus auf die Main Street führte.
Im Restaurant am Anfang der Straße herrschte noch reger Betrieb, der Gehweg war hell erleuchtet. Die Fassade des Gebäudes war eingerüstet, und Lisa wollte nicht darunter durchgehen – sie war überzeugt, das Gerüst werde zusammenbrechen, wenn sie das tat. Also ging sie weiter auf den Schienen entlang, die sich auch hier wie eine Naht mitten durch die Straße zogen. Immer einen Fuß vor den anderen, vorbei am Main Performance Space, einem kleinen, kirchenähnlichen Gebäude mit lindgrünem Garagentor, und um die Ecke in die Water Street.
Die rechte Seite der Water Street bestand aus lauter kleinen Ziegelhäusern – frisch renovierte neben halb verfallenen–, bis man schließlich zum alten Lagerhaus der Empire Stores kam, einem riesigen Ziegelmonstrum, das im Augenblick noch leer stand. Selbstverständlich war längst eine aufwändige Renovierung geplant. Auf der anderen Straßenseite befanden sich ein Theater, eine Galerie, ein Café, das bereits geschlossen hatte… und Susans Laden, Water Street Chocolates.
Lisa blieb vor der hübschen, europäisch anmutenden Chocolaterie stehen, die ihre Schwester… nein, ihre Mutter… also, Susan vor drei Jahren hier eröffnet hatte. Das große Schaufenster mit seiner flachen Scheibe war von einem dunklen Holzrahmen eingefasst und bereits herbstlich dekoriert, mit buntem Laub und Zweigen mit Beeren daran. Als Lisa die Nase an die Scheibe drückte, sah sie, dass in dem Holzregal gleich neben der Tür schon die ersten Äpfel aus dunkler Schokolade, die ersten Halloween-Kürbisse aus Vollmilch und die ersten Gespenster aus weißer Schokolade standen. Die Zellophanpackungen waren mit glitzernden orangefarbenen Bändern verziert. Lisa spürte ein schmerzliches Ziehen in der Brust. Das alles fehlte ihr jetzt schon, dabei war sie noch gar nicht fort.
Sie hatte den ganzen Sommer über mit Susan hier gearbeitet, hatte ausgeholfen, abwechselnd im Laden und in der angeschlossenen Schokoladenfabrik. Die Angestellten waren alle sehr nett zu ihr gewesen und hatten sich die Zeit genommen, ihr auch noch die nebensächlichste Kleinigkeit zu erklären. Manchmal hatte sie ihnen etwas vorgesungen, damit sie nur ja nicht auf die Idee kamen, sie hätte vor, ihr Leben in diesem Laden zu verbringen. Aber wenn sie ganz ehrlich war, gefiel es ihr dort sehr gut. Sie mochte die Leute, die für Susan arbeiteten, sie mochte den gemütlichen, kleinen Laden und auch die kühlen Stahltische in der Fabrik, die großen Steingutmaschinen, die ordentlich gestapelten Formen. Außerdem liebte sie inzwischen den Geruch guter Schokolade, diesen Duft nach verbranntem Kaffee. Sie war richtig süchtig danach. Es war ihr, als rieche sie ihn auch jetzt, hier vor dem Geschäft.
Wenn Susan sie mit fünfzehn bekommen hatte, war sie nur ein Jahr älter gewesen als Lisa jetzt. Es war tatsächlich gemein von ihr gewesen, Susan zu unterstellen, dass sie nicht wusste, wer der Vater ihres Kindes war. Lisas Vater. Wie sie Susan kannte, war es bestimmt die ganz große Liebe gewesen. Oder aber jemand, den Mommy und Daddy nicht mochten. Vielleicht auch beides. Lisa begann darüber nachzudenken, was für eine Geschichte sich wohl dahinter verbarg. Vielleicht war Susan ja genau die Mutter, die sie sich immer vorgestellt hatte – nur eben ein bisschen anders. Vielleicht stand sie damals ja wirklich im Mittelpunkt eines Dramas. Plötzlich kam ihr der Gedanke, dass Susan sie auch hätte abtreiben können. Lisas Freundinnen schworen alle Stein und Bein, das zu tun, falls sie jemals schwanger werden sollten – was natürlich nicht passieren würde, weil keine von ihnen je Sex gehabt hatte. Und trotzdem. Es war ein großer Unterschied, ob man vierzehn oder fünfzehn Jahre alt war, fünfzehn oder sechzehn, sechzehn oder dreißig. Da konnte alles Mögliche passieren.
Vielleicht war Susan damals ja sehr mutig gewesen.
Vielleicht waren auch Mommy und Daddy sehr mutig gewesen.
Und vielleicht sollte sie ihnen erst einmal die Möglichkeit geben, ihr alles zu erklären.
Möglicherweise war es sogar ein Riesenglück, dass Susan ihre Mutter war. Immerhin hieß das, dass Lisa niemals in ihrem Leben ungewollt gewesen war. Nicht einen Augenblick lang.
Lisa hockte sich vor dem Laden auf den Randstein, zog die Knie an die Brust und trocknete sich die Augen an der Jeans. Sie hatte Susan doch immer geliebt, richtig geliebt.
Dann war es also Susan. Susan.
Hieß das, dass sie von nun an nicht mehr Mommy und Daddy um Erlaubnis fragen musste, wenn sie etwas tun wollte? War Susan jetzt die letzte Entscheidungsinstanz bei… nun ja, bei allem? Lisa verspürte einen Anflug freudiger Erregung, als sie an das Tattoo dachte, einen kleinen Sternenregen, das sie sich gern unten am Rücken machen lassen wollte. Susan würde ihr das bestimmt viel eher erlauben als Mommy und Daddy. Trotzdem war das alles äußerst verwirrend. Waren sie denn nicht immer noch ihre Eltern? Konnte man ernsthaft von ihnen erwarten, dass sie einfach so alle Kontrolle an ihre Tochter abgaben? An Susan? Nach allem, was sie für Susan und Lisa getan hatten?
Lisa presste die Handballen an die Augen und schüttelte den Kopf, um all die Fragen zu vertreiben, die sie ohnehin nicht beantworten konnte. Auf dem Kopfsteinpflaster näherten sich Schritte: Ein Grüppchen von fünf Frauen kam lachend die Main Street entlang und bog nach links ab, in den anderen Teil der Water Street, wo es zur U-Bahn ging. Dann war es wieder still. Lisa fand es ein bisschen unheimlich, so allein auf der Straße. Sie stand auf und überlegte, ob es nicht vielleicht Zeit war, heimzugehen und mit Susan zu reden, die inzwischen sicher schon mindestens ein Dutzend Nachrichten auf ihrer Mailbox hinterlassen hatte.
Doch als sie gerade beschlossen hatte, nach Hause zu gehen, fiel ihr etwas auf: Der Randstein vor Susans Garageneinfahrt war noch genauso grau wie schon das ganze Jahr. Dave hatte sein Versprechen nicht gehalten. Er hatte keinen gelben Streifen dorthin gemalt.
Lisa suchte an ihrem Schlüsselbund, den sie immer in der Hosentasche trug, nach dem Ladenschlüssel. Sie schob das Sicherheitsgitter nach oben, schloss dann die Tür auf und schaltete die Alarmanlage mit dem Zahlencode aus, den sie sich im Sommer gemerkt hatte. Als sie das Licht anknipste, fand sie sich Auge in Auge mit einem riesigen, grinsenden Schokoladenkürbis auf einem kunstvoll verzierten Metallständer. Er war ein echtes Meisterwerk und sah aus wie ein richtiger Kürbis, bis hin zur knubbeligen Schale und dem kecken Stiel oben dran. Dazu hatte er sternförmige Augen, ein exaktes Dreieck als Nase und einen zu einem verzückten Lächeln verzogenen Mund. Ein weißes Schild verkündete einen saftigen Preis, und Lisa fragte sich, wer Susans erste große Halloween-Kreation des Jahres wohl bekommen würde. Mit diesem glücklichen Kind hätte sie gern getauscht. Aber vielleicht würde sie es ja sogar selbst sein. Sie beugte sich vor, bis sie die Zellophanhülle fast mit der Nase berührte, und stibitzte ein wenig Schokoladenduft.
Die Verbindungstür zur Fabrik stand offen, und Lisa ging hindurch, ohne Licht zu machen. Vor der Garagentür lag nur ein einfacher Riegel, den sie anhob und beiseite schob.
Die kleine Garage beherbergte den altmodischen cremefarbenen Lieferwagen, auf dessen Türen in brauner Farbe WATER STREET CHOCOLATES stand. In einer Ecke stand ein robuster Kunststoffschrank mit Werkzeugen und allem möglichen anderen Krimskrams, darunter auch eine kleine Dose mit gelber Farbe. Susan hatte sie schon vor längerer Zeit gekauft, damit Dave den gelben Streifen malen konnte, der fremde Wagen davon abhalten sollte, direkt vor der Garageneinfahrt zu parken. Oben auf der Dose lag ein nagelneuer Pinsel, der noch in seiner Plastikhülle steckte.
Im Lauf des Sommers hatte Lisa mehrfach angeboten, den Streifen zu malen. Susan hatte jedes Mal gezögert und war bereits drauf und dran gewesen, das Angebot anzunehmen, hatte sich dann aber doch anders entschieden.
«Dave hat doch gesagt, er macht es.»
Lisa fragte sich, warum Susan nicht einfach jemand anderen bat, den Streifen zu malen. Genügend Angestellte hatte sie ja. Wahrscheinlich wollte sie Dave einfach die Möglichkeit geben, sein Versprechen zu halten. Doch inzwischen war der Sommer verstrichen, der kühle, farbenfrohe Herbst hatte begonnen, und Dave war immer noch nicht dazu gekommen.
Jetzt würde Lisa es tun, und zwar sofort. Sie würde den gelben Streifen malen, nicht um ein Versprechen zu halten, sondern um eines zu geben. Sie versprach Susan damit ihre Liebe.
Es war sicher keine allzu gute Idee, so spät in der Nacht noch das Garagentor aufzumachen, sodass alle Welt Susans Lieferwagen und drinnen die offene Tür zur Fabrik sehen konnte. Lisa nahm die Farbdose, einen Schraubenzieher, um den Deckel zu öffnen, einen Stab, um die Farbe umzurühren, und den Pinsel und ging damit durch die Fabrik und den Laden zurück nach draußen. Sie machte die Eingangstür hinter sich zu, schloss aber nicht ab. Abgesehen vom fernen Brummen des Verkehrs auf der Brücke hörte sie nur ihre eigenen Schritte in der Straße, als sie sich dem abgeflachten, kahlen Randstein näherte, der schon bald in warnendem Gelb erstrahlen würde.
Die Ölfarbe ließ sich dick und sämig auftragen und floss in die Ritzen und Fugen des Randsteins. Lisa genoss den säuerlichen Geruch und die Anstrengung, die es erforderte, den Pinsel über das alte, abgelaufene Pflaster zu ziehen. Der Streifen war schon zu zwei Dritteln fertig, als sich in das eintönige Verkehrsgeräusch plötzlich Schritte mischten, die näher kamen. Langsame, zögernde Schritte. Lisa hob den Kopf: Es war der einsame Mann aus dem Park, der die Steinchen geworfen hatte. Jetzt fiel ihr auf, dass er eine hellbraune Windjacke trug, wie sie in den Outdoor-Katalogen angeboten wurde, die zu Hause in Texas stapelweise in den Zeitschriftenregalen lagen. Daddy hatte so eine in Blau. Der Einsame ging mitten auf der Fahrbahn und spielte mit einem Stein, der deutlich größer war als die, die man auf dem Wasser springen ließ. Obwohl er nicht direkt zu ihr hinsah, hatte Lisa doch das Gefühl, dass er sie wahrnahm. Sie hob den tropfenden Pinsel vom Randstein und schaute ihm misstrauisch entgegen.
KAPITEL 3
Dienstag, 22.45Uhr
Susan beugte sich aus dem offenen Fenster, von dem aus sie beobachtet hatte, wie Lisa um die Ecke in den Park gegangen war. Dorthin ging sie oft, wenn sie allein sein, in Ruhe lesen oder Gitarre spielen wollte. Fünfzehn Minuten waren vergangen, seit Susans geliebte Tochter… ihre Tochter!… auf den alten Schienen entlangbalanciert war, immer einen Fuß vor den anderen, genau wie damals, als sie noch ein kleines Mädchen war. Es hatte Susan Hoffnung gegeben, sie da wie eine Seiltänzerin entlanggehen zu sehen; es hatte sie daran erinnert, dass sich heute nur die Bezeichnungen geändert hatten, nicht die Gegebenheiten. Das Wort Mutter würde das Wort Schwester ersetzen, und wenn Lisa das klarwurde, wenn sie begriff, dass sich eigentlich nichts verändert hatte, würde sich alles andere für sie beide wie von selbst klären.
Fünfzehn Minuten, ein kleiner Teil einer Stunde. Die Zeit schien verlangsamt, wie im Traum, wo eine Minute ein Jahr und ein Jahr eine Minute dauern oder die Zeit ganz stillstehen konnte. Lisa war von den Schienen heruntergesprungen und in den Park gegangen, sie war dem kurvigen, asphaltierten Weg gefolgt, bis Susan sie nicht mehr sehen konnte.
Auch als sie sich jetzt aus dem großen Fenster in die kalte Nacht hinausbeugte, konnte Susan Lisa nirgendwo entdecken. Auf der anderen Straßenseite gähnten die dunklen Fenster eines ausgehöhlten Lagerhauses, nur hier und da erhellt von einem staubigen Streifen Mondlicht. Es war still auf der Straße, im Park waren nur wenige Leute unterwegs.
Von Audrey McInnis, der Mutter von Lisas bester Freundin Glory, hatte Susan gelernt, dass elf Uhr die magische Grenze war, ab der man sich als Eltern offiziell Sorgen machen durfte. Solange es noch nicht elf geschlagen hatte, musste man sämtliche Ängste um die abgängigen Teenager unterdrücken. Susan hatte unglaublich viel lernen müssen, seit Lisa vor einem Jahr zu ihnen gezogen war. Als Erziehungsberechtigte eines jungen Mädchens galt es, das perfekte Gleichgewicht zwischen Freiheiten und Verboten zu finden, und Susan hatte feststellen müssen, dass das sehr viel leichter gesagt als getan war.
Lisa war normalerweise nett und benahm sich gut, doch manchmal brach ihre starke Persönlichkeit durch, und dann merkte man schnell, dass man eigentlich nur noch beiseitetreten und ihr den nötigen Raum geben konnte. Die Grenzen im Hinblick auf Kleidung und andere Vorschriften wurden unweigerlich variabel und mussten immer wieder neu ausgehandelt werden. Es gab eine Reihe von Freundschaftskrisen und unerwiderten Lieben zu bewältigen, doch die waren ein Kinderspiel im Vergleich zu den Machtkämpfen. «Ihr seid nicht meine Eltern!» – dieser Satz fiel mit schöner Regelmäßigkeit, und nach allem, was Lisa wusste, traf er ja auch zu. Bis heute. Susan plagte sich schon seit Jahren mit der Frage, ob sie Lisa nicht alles sagen sollte, hatte unzählige Male der Versuchung widerstehen müssen, einfach damit herauszuplatzen. Die Entscheidung, dass es jetzt an der Zeit war, war sorgfältig durchdacht und letztlich unvermeidlich gewesen. Doch während die Zeiger sich unendlich langsam in Richtung elf Uhr bewegten, bereute Susan ihren Entschluss bereits aus tiefster Seele.
Das Warten war grauenvoll, aber sie musste Lisa die Zeit geben, die ihr zustand. Dann kam ihr der Gedanke, dass die Elf-Uhr-Grenze ja vielleicht nicht für E-Mails galt.
Falls Lisa bei Glory war, hockten sie jetzt sicher gemeinsam vor dem Computer und chatteten mit ihren Freundinnen aus der achten Klasse, die inzwischen auf andere High Schools gingen. Susan nahm ihren Black-Berry vom Couchtisch und adressierte eine neue Mail an Glory, deren Adresse sie gespeichert hatte, seit Lisa ihr zuletzt eine Mail von Glorys Computer geschickt hatte. Lisa, bist du da? Wenn du das liest, schreib mir doch kurz zurück, damit ich weiß, dass es dir gutgeht. Wir müssen über so vieles reden, aber das muss gar nicht gleich sein. Ich habe dich einfach furchtbar lieb. Und das alles tut mir so wahnsinnig leid. Ich will nur wissen, dass alles okay ist.
Sie schickte die Mail ab. Dann ließ sie sich in die weichen Sofakissen sinken und rief sich ins Gedächtnis, dass Lisa schon mehrmals nicht zur vereinbarten Zeit nach Hause gekommen war. Einmal, als sie und Glory einander gerade kennengelernt hatten, war Lisa abends sehr lange bei ihrer neuen Freundin geblieben, um die Regeln auszutesten, die Susan und Dave aufgestellt hatten. Ein anderes Mal waren die beiden Mädchen mit drei anderen Freundinnen ins Kino gegangen und hatten sich nach dem abgesprochenen Film in einen anderen Saal des Multiplex-Kinos geschmuggelt, um eine weitere Vorstellung umsonst zu sehen. Sie hatten ihre Handys ausgeschaltet und erst um halb zwölf wieder Kontakt zu ihren Eltern aufgenommen, die inzwischen fast verrückt waren vor Sorge. Und dann war da noch der Abend im vergangenen Juni, als Lisa die Middle School abgeschlossen hatte.
Nach einem Tag der offiziellen Veranstaltungen und Feiern war Lisa abends mit Freunden ausgegangen und hatte die auf zehn Uhr festgelegte Sperrstunde um zwei Stunden überschritten. Die Pufferzone, wie Susan die Stunde zwischen zehn und elf nannte, war quälend langsam vergangen. Die Stunde bis Mitternacht, in der man sich Sorgen machen durfte, war die reinste Hölle gewesen. Selbst Dave hatte eine gewisse Unruhe an den Tag gelegt, obwohl er durch seine Arbeit an aufgelöste Eltern gewöhnt war, die ihre Teenager als vermisst meldeten, während die einfach nur gegen die Regeln verstießen. Sie hatten Lisas sämtliche Schulfreunde und dann noch ein paar mehr angerufen. Sie hatten Carole und Bill Bailey, Susans und Lisas Eltern und jetzt Lisas Großeltern, die für die Abschlussfeier angereist waren, in ihrem Hotel aus dem Schlaf geklingelt, und die beiden waren bereits drauf und dran, mit dem Taxi zum Loft zu kommen. Im Lauf dieser einen Stunde waren alle Vorbereitungen für eine ausgedehnte Nachtwache getroffen worden. Und dann, Schlag Mitternacht, spazierte Lisa herein wie Cinderella, von der der Zauber genommen war, und hatte über die ganze Aufregung nur den Kopf geschüttelt.
Susan entspannte sich ein wenig, als sie an all diese sorgenvollen Abende zurückdachte. Sie hatten sich gestritten, Lisa war aufgebracht und hatte auch allen Grund dazu. Sie würde bald wieder da sein. Jetzt ging es darum, die quälende Zeit bis dahin zu ertragen: eine Minute, dann noch eine und noch eine. Susan war fest entschlossen, bis elf zu warten, ehe sie zum Telefon griff.
Sie stand auf, ging zum Spieltisch hinüber und nahm wahllos ein Puzzlestück in die Hand, merkte aber rasch, dass sie viel zu unruhig war, um still zu sitzen und sich zu konzentrieren. Also ging sie in die Küche und räumte die Spülmaschine aus. Sie wischte die Arbeitsfläche ab, obwohl sie gar nicht dreckig war. Dann säuberte sie mit Fensterputzmittel und Küchenrolle das Kochfeld aus Edelstahl, die Ofentür und die Schrankgriffe. Sie arbeitete langsam und sorgfältig und spürte förmlich, wie die Minuten durch sie hindurchflossen. Sie sah auf die Uhr: immer noch zu früh. Sie griff zum Telefon und drückte die Kurzwahltaste für Daves Handy. Er würde ihr die Kraft geben, ruhig zu bleiben und weiter zu warten. Doch sie erreichte nur seine Mailbox und hinterließ die Nachricht, dass er sie zurückrufen solle.
Dann ging sie durch die Wohnung und schaltete sämtliche Lichter ein. Das alles gefiel ihr ganz und gar nicht: Lisa weg, Dave unerreichbar, und das mitten in der Nacht. Seit letztem Oktober, fast auf den Tag genau vor einem Jahr, als Daves Handy-Akku durch eine Verkettung unglücklicher Umstände ausgerechnet in der schlimmsten Nacht seiner Polizeilaufbahn den Geist aufgegeben hatte, war Susans automatische Reaktion, wenn sie ihn nicht erreichte, von leichtem Unbehagen in hemmungslose Sorge umgeschlagen. Vierzehn Stunden später hatte er endlich angerufen und ihr von einem Vermisstenfall erzählt, der wenig später die halbe Stadt in Angst und Schrecken versetzen sollte. Als Susan jetzt an das verschwundene Mädchen dachte, verwandelte sich ihre Sorge in handfeste Angst.
Sie hieß Becky Rothka. Ihre Mutter hatte auf dem 78.Revier angerufen und war zur Einsatzzentrale weitergeleitet worden, Dave hatte den Anruf entgegengenommen, und so, durch reinen Zufall, war es sein Fall geworden. Die dreizehnjährige Becky war eines Nachmittags auf dem Heimweg von der Schule verschwunden und nicht wiederaufgetaucht. Kurz vorher war Lisa zu ihnen gezogen, und weil es in Dumbo keine guten Schulen gab, war sie eine Zeit lang in Park Slope auf dieselbe Schule wie Becky gegangen. Bei zehn Klassen pro Jahrgang hatten die beiden Mädchen einander allerdings nie kennengelernt. Irgendwann hatte Dave ihr erzählt, wie ähnlich sich Becky und Lisa waren: gleich alt, beide zierlich, mit hellem Teint, langem blondem Haar und grünen Augen. Rein äußerlich hätte man sie für Schwestern halten können. Da war er allerdings längst an dem Fall gescheitert. Er hatte Becky nicht gefunden, und alles schien ihn an sie zu erinnern. Bis heute ertappte Susan ihn von Zeit zu Zeit dabei, wie er Lisa versonnen betrachtete. Sie vermutete, dass er dann an Becky dachte, das Mädchen, das verschwunden geblieben war, den einen großen Fall, den er nicht hatte aufklären können. Obwohl er kaum noch darüber sprach, wusste sie, dass die Sache ihn immer noch verfolgte.
Beim Gedanken an Becky war es mit Susans Entschlossenheit vorbei. Es war inzwischen 22Uhr 54, sechs Minuten noch bis elf, aber sie konnte einfach nicht länger warten. Sie schob die Flasche mit dem Fensterputzmittel und die schmutzigen Papiertücher beiseite, nahm das Telefon und drückte die Kurzwahltaste für Lisas Handy.
Erst nach und nach bemerkte sie das stetig lauter werdende Klingeln, das irgendwo aus der Wohnung kam. Susan legte das Telefon auf den Küchentresen und ließ es weiter klingeln, um verfolgen zu können, wo es herkam. Im Wohnzimmer war das Klingeln am lautesten, und dort sah sie Lisas Paisley-Tasche auf dem Boden stehen. Nachdem sie sich durch den Wust aus zerknüllten Papiertüten, Stiften und Lippenstiften in der Tasche gewühlt hatte, fand sie schließlich das Handy. Sie nahm es heraus und sah ihm einen Moment lang beim Klingeln zu, bevor sie es aufklappte, ihren eigenen Anruf entgegennahm und wieder auflegte. Ohne diesen elektronischen Anker wuchs Lisas Verletzlichkeit für Susan ins Unermessliche.
Sie ging in die Küche zurück und rief bei Glory McInnis an. Glorys Mutter Audrey nahm ab, und Susan erklärte ihr rasch, dass sie sich mit Lisa gestritten habe – ohne allerdings auf den Grund für den Streit einzugehen – und Lisa noch nicht wieder zu Hause sei. Sie hörte Schritte am anderen Ende der Leitung, als Audrey in Glorys Zimmer ging. Eine Tür wurde geöffnet, Stimmen ertönten, dann kam Glory selbst ans Telefon und sagte: «Ich habe nichts mehr von Lisa gehört, seit sie von der Probe nach Hause ist. Das war um kurz vor zehn, glaube ich.» Susan war enttäuscht, aber auch irgendwie erleichtert, dass Glory noch nichts von ihrem Geständnis wusste, das ja erst nach zehn stattgefunden hatte. Die Wahrheit war noch zu frisch, um zur Neuigkeit zu werden. Lisa und sie mussten erst selbst in Ruhe darüber reden, ehe sie gesellschaftsfähige Häppchen daraus machen konnten.
Susan rief nacheinander Lisas sämtliche Freundinnen an, und sie sagten ihr alle nacheinander, dass sie den ganzen Abend nichts von Lisa gehört hätten. Niemand wusste, wo sie stecken konnte. Susan legte auf und überlegte, was sie als Nächstes tun sollte.
Natürlich konnte sie selbst auf die Suche gehen, aber es war spät, und sie war allein. Und wozu sollte das auch gut sein? Was brachte es, durch ein Großstadtviertel zu laufen, wenn Lisa theoretisch überall sein konnte? Sie hatte eine U-Bahn-Karte, sie war schlau und unternehmungslustig und kannte sich aus. Allerdings war sie auch erst vierzehn und wohnte gerade einmal ein Jahr hier. Es war auf keinen Fall gut für sie, nachts allein und völlig aufgelöst durch die Straßen zu irren.
Susan wählte noch einmal Daves Handynummer, erreichte aber wieder nur seine Mailbox. Diesmal gab sie sich nicht so schnell geschlagen. Sie rief auf dem Revier an und erfuhr, dass er vor einiger Zeit zu einem Einsatz gerufen worden war. Vermutlich war er gerade in einem Tunnel oder einem Kellergeschoss oder sonst einer Art von Funkloch. Oder er hatte wieder einmal vergessen, sein Handy aufzuladen, eine schlechte Angewohnheit, die er einfach nicht ablegen konnte. Sie wartete eine knappe Minute und versuchte es dann noch einmal. Beim sechsten Versuch kam sie schließlich durch.
«Hallo, Süße!», meldete er sich.
«Störe ich?» Das fragte sie immer, wenn er im Einsatz war.
«Gar nicht. Ich bin mit Morgan Schnall im Prospect Park. Betrunkener Ruhestörer.»
Im Hintergrund hörte Susan Officer Schnall lauthals gegen Daves Bemerkung protestieren. Er kam nur selten mit zu Routineeinsätzen, aber manchmal, nach einer ruhigeren Schicht, verband er das mit dem Heimweg.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: