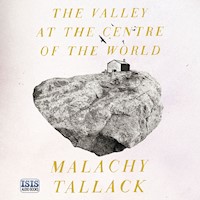2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Die wahre Stärke dieses Buches liegt in Tallacks Blick: Es ist der Blick eines Poeten.« New York Times / Die besten Reisebücher der Saison
Malachy Tallack begibt sich auf eine Reise entlang des 60. nördlichen Breitengrades, einmal rund um die Welt, und er beginnt und endet in Shetland, wo er den Großteil seines Lebens verbracht hat.
Das Buch erzählt von den Landschaften – in Grönland, Alaska, Sibirien, Finnland - und den Menschen dort, ihrer Geschichte und der wechselseitigen Prägung durch Mensch und Natur. Es ist jedoch auch eine intime Reise: Malachy Tallack hat den Verlust seines Vaters zu betrauern, und er hadert mit seiner Heimat. Durch die Auseinandersetzung mit den Themen Wildnis und Gemeinschaft, Isolation und Dialog, Exil und Gedächtnis, durch seinen klaren, kritischen Blick und die offene Selbsterforschung wird der Reisebericht des schottischen Autors zu einem anschaulichen, spannenden und sehr persönlichen Memoir.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 349
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Zum Buch
»Entlang des 60. Nördlichen Breitengrads liegen Regionen, deren Bewohner herausgefordert sind von den Orten, in denen sie leben. Sie sind herausgefordert vom Klima, von der Landschaft, der Abgeschiedenheit. Und doch haben diese Bewohner sich entschieden, zu bleiben. Sie machen ihren Frieden mit den Inseln und den Bergen, der Tundra und der Taiga, dem Eis und den Stürmen, und sie bleiben. Die Beziehungen zwischen Mensch und Ort – die Spannungen und die Liebe und die Formen, die diese Spannungen und diese Liebe annehmen können – sind das Hauptaugenmerk dieses Buchs.« – Malachy Tallack
Der schottische Ausnahmeautor Malachy Tallack erzählt von wilden und geheimnisvollen Landschaften – von Grönland, Alaska, Sibirien und Finnland – und den Menschen dort, ihrer Geschichte und der wechselseitigen Prägung durch Mensch und Natur. Eine erstaunliche, sehr persönliche und beeindruckende Reise entlang des 60. Grads nördlicher Breite, einmal rund um die Welt.
Zum Autor
MALACHY TALLACK, geboren 1980, ist Schriftsteller, Singer-Songwriter und Journalist. Er zählt zu den wichtigsten jungen Stimmen Schottlands und gewann 2014 den New Writers Award des Scottish Book Trust sowie 2015 das Robert Louis Stevenson Fellowship. Sein Debütroman »Das Tal in der Mitte der Welt« kam 2018 auf die Shortlist des Highland Book Prize und wurde für den Royal Society of Literature Ondaatje Prize nominiert. Malachy Tallack ist in Shetland aufgewachsen und lebt zurzeit in Stirlingshire.
Malachy Tallack
Von der Faszination des Nordens und der Suche nach einem Zuhause
Aus dem schottischen Englischvon Klaus Berr
Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel Sixty Degrees North bei Polygon, einem Imprint von Birlinn Ltd.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstausgabe Dezember 2022
btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Copyright © der Originalausgabe 2016 Malachy Tallack
Copyright © der Fotos 2016 Malachy Tallack, außer den genannten anderen Quellen
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2022 btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, München
Umschlaggestaltung: buxdesign | München
Covermotiv: © Getty Images/Gabriel Gersch
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
JT · Herstellung: sc
ISBN 978-3-641-24954-0V001www.btb-verlag.de
facebook.com/btbverlag
INHALT
Nach Hause gehen
Shetland
Grönland
Kanada
Alaska
Sibirien
St. Petersburg
Finnland und Åland
Schweden und Norwegen
Nach Hause kommen
Danksagungen
Anmerkung des Autors
Bildteil
Karten
NACHHAUSEGEHEN
Ich erinnere mich noch gut an den Tag: ein silbergrauer Himmel, schwer von Regen. Es war Frühwinter, und ich war eben siebzehn geworden. Den Vormittag hatte ich krank und schlaflos im Bett verbracht, aber gegen Mittag trieb mich die Langeweile heraus. Ich stand auf, zog mir einen Bademantel über die Schultern und schlurfte zum Fenster. Das Haus, in dem ich meine Teenagerjahre verbrachte, schaute nach Osten auf den Hafen von Lerwick, der Hauptstadt Shetlands. Von meinem Zimmer im Obergeschoss sah ich hinunter in unseren kleinen Garten mit der grünen Picknickbank und dem Spalier am niedrigen Mäuerchen. Dahinter sah ich Fischerboote am Pier und die blau-weiße Fähre, die zwischen Lerwick und der Insel Bressay hin- und hertuckerte.
Shetland liegt sechzig Grad nördlich des Äquators, und die Weltkarte an unserer Küchenwand hatte mir gezeigt, dass ich, wenn ich nur weit genug sehen könnte, von diesem Fenster aus über die Nordsee nach Norwegen und Schweden, dann über die Ostsee nach Finnland, nach St. Petersburg und dann nach Sibirien, Alaska, Kanada und Grönland schauen könnte. Wenn ich weit genug sehen könnte, würden meine Augen mich schließlich wieder zurückbringen, quer über den Atlantik zu dem Punkt, wo ich jetzt stand. Ich dachte über diese Reise nach, als ich, halb angezogen und bibbernd, auf den Hafen hinunterschaute. Obwohl ich auf dieser Breite noch nie irgendwohin gereist war, stellte ich mir vor, dass ich diese Orte von oben sehen konnte. Ich fühlte mich um den Breitengrad getragen, wie von einem Draht angehoben und gezogen. Die Welt drehte sich, und ich drehte mich mit ihr, umkreiste sie von zu Hause wieder zurück nach Hause, bis ich schließlich, unvermeidlich, auf meinen eigenen Hinterkopf traf. Ein Schwindel stieg in mir auf wie ein Schwall Bläschen, mir wurde kurz schwarz vor Augen, und ich landete, mit einem Ruck, auf den Knien auf dem Schlafzimmerboden. Erschöpft stemmte ich mich wieder hoch und schleppte mich ins Bett, wo ich einschlief und meinen Weg um den Breitengrad noch einmal träumte. Der Traum dieses Tages hat mich nie mehr verlassen.
Ein paar Monate zuvor war mein Vater gestorben. Er setzte mich eines Morgens an einem See in Sussex ab, ganz in der Nähe seines Wohnorts, und ich vertrieb mir die folgenden Stunden mit Fischen in der Augustsonne. Es war einer dieser stillen, gewöhnlichen Tage, an denen eigentlich nichts Außergewöhnliches passieren sollte. Aber es passierte etwas. Als der Nachmittag in den Abend überging und ich mich allmählich fragte, warum er noch nicht zurückgekehrt war, war er bereits tot – getötet bei einem Autounfall auf dem Weg zum Krankenhaus, wo er meine Großmutter besuchen wollte. Während ich dort alleine wartete, klammerte ich mich an die Hoffnung, so lange es ging, hatte mir aber bereits das Schlimmste vorgestellt. Und auch wenn ich irgendwann wegging, um jemanden zu suchen, der mir sagen konnte, was passiert war und wo ich die Nacht verbringen konnte, blieb doch ein Teil von mir an diesem See. Ein Teil von mir hat nie aufgehört zu warten.
An diesem Abend fanden alle Pläne, die ich hatte, ein Ende, und in der folgenden Woche kehrte ich ohne jede Aussicht nach Shetland zurück. Meine Eltern hatten sich schon vor Jahren getrennt, und während ich mit Mutter und Bruder in Shetland lebte, war mein Vater im Süden Englands, am anderen Ende der Britischen Inseln. In diesem Sommer hatte man mir einen Studienplatz in Musik an einer Schule für darstellende Kunst in Südlondon angeboten, deshalb zog ich zu meinem Dad. Ich hatte einen Weg gefunden und folgte ihm. Mit Dads Tod kurz vor Beginn des ersten Semesters war diese Richtung für immer verloren. Ich hatte keine andere Wahl, als wieder in den Norden zu gehen, und dort hatte ich dann keine Ahnung, was ich tun sollte. An dem Tag, als ich am Fenster stand und vom Breitengrad träumte, war ich bereits seit Monaten gestrandet, verloren und fast ausgehöhlt vor Trauer. Ich suchte nach etwas Sicherem. Ich suchte nach einer Richtung.
Im Lauf der Jahre hat Shetland viel Aufhebens um seinen Breitengrad gemacht. Als ich noch in der Highschool war, hieß unser Jugendclub 60 Nord. Später gab es eine Fischerei-Zeitung mit demselben Namen. Und einen Radiosender für Touristen. Und ein Online-Magazin. Und einen Container-Verleih. Und ein in Lerwick gebrautes Bier.
Diese Allgegenwart ist zum Teil zurückzuführen auf mangelnde Fantasie, zum Teil auf eine Art Markenmentalität: Wir verkaufen unseren nördlichen Exotismus, so in der Richtung. Aber ich glaube, es steckt noch mehr dahinter: Sechzig Grad nördlicher Breite ist eine Geschichte, die wir erzählen, sowohl uns selbst als auch anderen. Es ist eine Geschichte darüber, wo – und vielleicht auch wer – wir sind. »Shetland liegt auf gleicher Höhe wie St. Petersburg«, erfahren Touristen, »und wie Grönland und Alaska.« Und man sagt ihnen das, als würde es etwas bedeuten. Es scheint zum Beispiel mehr zu bedeuten als die Tatsache, dass Shetland auf demselben Längengrad wie Middlesbrough oder auch Ouagadougou liegt. Auf sechzig Grad Nord zu sein bedeutet, verbunden zu sein mit einer Welt, die interessanter und geheimnisvoller ist als die Welt, mit der man die Inseln normalerweise in Beziehung setzt. Damit betont man, dass Shetland nicht nur ein vergessener Zipfel der Britischen Inseln ist, sondern auch zu etwas anderem, etwas Größerem gehört. Einst war es das geografische Herz eines nordatlantischen Reichs, ins Nordische verwebt auf eine Art, die auch jetzt noch Nostalgie hervorruft, mehr als fünfhundert Jahre nachdem der König von Dänemark und Norwegen die Inseln an Schottland verpfändete. Im Gegensatz zu politischen oder kulturellen Geografien ist der sechzigste Breitengrad etwas Sicheres und Entschiedenes, immun gegen die Launen der Geschichte. Shetland gehört zum Norden, liegt auf dieser Linie, da gibt es keine Winkel, in die man es schieben könnte. Auf sechzig Grad nördlicher Breite ist Shetland so zentral wie jeder andere Ort.
Aber was ist mit diesen Orten, die wir für die Touristen aufzählen? Was haben wir mit ihnen gemeinsam, über den Breitengrad hinaus? Was genau ist dieser Club, zu dem wir mit einer solchen Begeisterung gehören? Wenn man auf die Karte schaut, könnte man behaupten, dass der sechzigste Breitengrad eine Art Grenze ist, an der der Fast-Norden und der Norden aufeinandertreffen. In Europa durchquert er die äußerste Spitze der Britischen Inseln und den unteren Rand von Finnland, Schweden und Norwegen. Diese Linie streift die untere Spitze Grönlands und das südliche zentrale Alaska. Sie schneidet die große Weite Russlands in zwei Hälften, und in Kanada tut sie dasselbe, markiert die offizielle Grenze zwischen den nördlichen Territorien und den südlichen Provinzen. Entlang des Breitengrads liegen Regionen, deren Bewohner in gewisser Weise herausgefordert sind von den Orten, in denen sie leben. Sie sind herausgefordert vom Klima, von der Landschaft, der Abgeschiedenheit. Und doch haben diese Bewohner sich entschieden zu bleiben. Sie machen ihren Frieden mit den Inseln und den Bergen, der Tundra und der Taiga, dem Eis und den Stürmen, und sie bleiben. Die Beziehungen zwischen Mensch und Ort – die Spannungen und die Liebe und die Formen, die diese Spannungen und diese Liebe annehmen können – sind das Hauptaugenmerk dieses Buchs.
Es dauerte mehr als ein Jahrzehnt nach diesem Tag am Fenster, als ich meinen Weg um die Welt erträumte, bis ich mich wirklich zu dieser Reise aufmachte. Die Hälfte dieser Jahre hatte ich außerhalb von Shetland verbracht. Ich war auf der Universität gewesen, in Schottland und in Kopenhagen, dann hatte ich in Prag gelebt und gearbeitet. Ich hatte neue Richtungen gefunden und sie verfolgt. Und dann war ich zurückgekommen, endlich aus freien Stücken und nicht aus Notwendigkeit. In diesen Jahren dazwischen hatte ich so oft über den Breitengrad nachgedacht, mir die Linie vorgestellt und neu interpretiert, dass ich, als ich schließlich beschloss, ihr zu folgen, kaum innehielt, um mich zu fragen, warum. Doch jetzt glaube ich, die Gründe zu kennen.
Zunächst war da die Neugier. Ich wollte den Breitengrad erkunden und diese Orte sehen, mit denen mein eigener Ort verbunden war. Ich wollte mehr darüber erfahren, wo ich war und was es bedeutete, dort zu sein. Ich wollte, beladen mit diesem Wissen, zurückkehren und es niederschreiben.
Dann die Ruhelosigkeit, dieser brodelnde Druck im Innern, der meine Sehnsucht weckt – nach allem, was woanders ist, nach allem, was weit weg ist. Diese Ruhelosigkeit, zugleich Segen und Fluch, die ich fast mein ganzes Leben lang kenne, bringt Unbehagen, wenn ich zufrieden sein sollte; sie bringt Zufriedenheit, wenn mir unbehaglich sein sollte. Sie schickt mich hinaus in die Welt, fast gegen meinen Willen.
Doch letztlich war es Heimweh, was mich gehen ließ – das vielleicht mächtigste Motiv. Es war der Wunsch, dorthin zurückzukehren, wo ich hingehörte. Mein Verhältnis zu Shetland war immer angespannt und von meiner eigenen Vergangenheit geprägt gewesen, und irgendwie stellte ich mir vor, dass mein Aufbruch – meine Expedition entlang des Breitengrads um die Welt – dies ändern könnte. Eine solche Reise zu unternehmen, deren letztes Ziel die Heimat sein musste, war ein Akt der Treue. Es war eine Verpflichtung, die ich, zum ersten Mal in meinem Leben, einzugehen bereit war.
Und so zog ich los, besuchte ein Land auf dem sechzigsten Breitengrad nach dem anderen. Ich reiste nach Westen, mit der Sonne und mit den Jahreszeiten, nach Grönland im Frühling, Nordamerika im Sommer, Russland im Herbst und die nordischen Länder im Winter. Doch ich fing damit an, die Linie zu suchen.
SHETLANDzwischen dem Hügel und dem Meer
Auf der Fahrt durch die Dörfer von Bigton und Ireland am Südende der Hauptinsel Shetlands war die Sonne eisig strahlend und der Himmel ein poliertes, kaum von Wolken getrübtes Blau. In einer halben Meile Entfernung lag der Atlantik da wie eine Wüste, der Horizont war eine weiche, stumpfe Grenze, die einen Blick unterbrach, der ansonsten um die ganze Erde hätte reichen können. An Tagen wie diesem ist es schwer, ans Weggehen zu denken. Tage wie dieser löschen alle anderen Tage aus.
Die schmale Straße, auf der ich fuhr, senkte sich zur Küste hin und ging dann über in einen unbefestigten Weg. Etwa eine Meile hinter dem letzten Haus hielt ich an, parkte das Auto und stieg aus. Die Luft war ruhig und still und so warm, dass ich meine Jacke zurücklassen konnte. Es fühlte sich gut an, hier zu sein, den Tag zu bewohnen. Irgendwo an diesem Küstenstreifen verband der sechzigste Breitengrad den Ozean mit der Insel, verlief unmarkiert zwischen Land und Wasser. Nach ein paar Meilen in östlicher Richtung würde er wieder auf den Ozean treffen und Shetland mit Norwegen verbinden. Als ich die Klippenkuppe erreichte, zog ich die Karte aus meiner Tasche und faltete sie auf, um den Raum zwischen dem Ort, wo ich war, und dem, wo ich sein wollte, zu erkunden. Die Linien auf der Karte waren solide und klar und trennten das blaue Wasser vom weißen Land. Alles auf der Seite war seiner selbst gewiss, aber die Welt direkt vor mir war nichts dergleichen. Ich brauchte einen Augenblick, um diese zwei Bilder zusammenzubringen, sie zu verschmelzen und mir vorzustellen, wie sie miteinander versöhnt werden könnten.
Ich stand auf dem Klippenrand einer Bucht mit steilen Flanken, einem geo, vielleicht dreißig Meter über dem Wasser. Von hier aus fiel das Land nahezu senkrecht zu einem felsbestreuten Strand ab und dann zum Wasser, wo eine dicke Matte Seetang vom Rückfluss der Ebbe verwirbelt wurde. Ein halbes Dutzend Seehunde verließen, aufgeschreckt von meiner Silhouette, ihre Plätze auf den Felsen und schleppten sich zurück ins Wasser. Sobald sie in Sicherheit waren, drehten sie sich um, um sich diese Gestalt hoch über ihnen genauer anzuschauen, unfähig, ihre Neugier zu zügeln. Knapp vor der Küste lagen drei Schären, übersät mit Kormoranen, die ihre schwarzen Flügel streckten, während um sie herum das Meer im Sonnenlicht zitterte und schwappte. Weit dahinter im Nordwesten lag die Insel Foula wie eine große Welle am Horizont. Wenn ich meinen Kartenlesefähigkeiten trauen konnte, waren diese Schären die Billia Cletts, also befand ich mich ein paar Hundert Meter weiter südlich der Stelle, wo ich sein wollte. Während ich vorsichtig am Klippenrand entlangging, waren die Seehunde unter mir noch sichtbar, ihre dicken Körper dunkel im klaren Wasser. Ich setzte einen Fuß vor den anderen, auf grauen Felsen, die strotzten vor Farben; jeder Stein war mit gelb-orangen Flechten gesprenkelt, in jedem Riss und jeder Spalte prangten rosafarbene Grasnelken.
Die Klippen an diesem Küstenstreifen sind durchlöchert von Höhlen, Grotten und geos, extrem schmalen Einbuchtungen. Im Winter spürt diese Seite Shetlands die volle Wucht des Atlantiks und der südwestlichen Stürme, die über das Meer donnern. Wellen, die ihr Leben Tausende Meilen entfernt begannen, finden den Weg an diese Küsten und werden unterwegs größer und mächtiger. Wasser gräbt sich ins Land, wirft riesige Felsbrocken die Klippen hoch wie Murmeln. Bei der Betrachtung der vielen zerklüfteten Küsten dieser Welt schloss Rachel Carson in ihrem Buch Geheimnisse des Meeres: »Es ist unwahrscheinlich, dass irgendeine Küste wütender von den Wellen des Meeres heimgesucht wird als die der Shetlands und der Orkneys.« Sommergäste mögen denken, dass diese Inseln nur ein zaghafter Norden sind, ein Ort, der geschützt ist vor den klimatischen Härten anderer nordischer Länder. Aber bringt man diese Besucher mitten in einem Wintersturm zurück, würden sie ganz anders empfinden. Dies ist einer der windigsten Orte Europas, und das Erzählen von Geschichten vergangener Stürme ist eine der Lieblingsbeschäftigungen der Insulaner. Da war zum Beispiel der »Hogmanay-Hurrikan« von Silvester 1991, in dem Böen von 173 Meilen pro Stunde aufgezeichnet wurden, bevor der Windmesser aus dem Boden gerissen wurde. Dann ist da noch der Januar 1993, der rekordverdächtige fünfundzwanzig Tage lang Stürme brachte und den Öltanker Braer an der Küste knapp südlich des Breitengrads verunglücken ließ. Wind ist das dominante und extremste Element des Shetland-Klimas. Manchmal kann er so absolut unnachgiebig sein, dass die Luft selbst zu einer körperlichen Präsenz wird, solide wie eine geballte Faust. Und an den seltenen ruhigen Tagen kann sein Fehlen schockierend und wunderbar sein.
Diese Gewalt des Winds und des Meers und seine Gletschervergangenheit machen Shetlands Küstensaum zu dem, was er ist: eine zerklüftete, fraktale Form. »Man kann sich kaum etwas vorstellen«, schrieb John Shirreff im Jahr 1814, »das unregelmäßiger ist als der Umriss dieser Insel.« Nach der Ordnance Survey, der topografischen Karte, umfasst Shetlands Küstenlinie mit 1700 Meilen 16 Prozent von Schottlands gesamter – und ein Blick auf die Karte zeigt, warum. Die größte der Inseln – als Mainland, Hauptinsel, bekannt – ist von Süden nach Norden fünfzig Meilen lang und von Westen nach Osten maximal nur zwanzig Meilen breit. Aber nirgendwo ist man weiter als drei Meilen vom Meer entfernt. Das südliche Ende ist eine Halbinsel, fast dreißig Meilen lang und kaum drei breit, die wie ein Finger von der Faust des zentralen Mainland nach unten ragt. Weiter nördlich ist die Küste eine Ansammlung von Stränden, schmalen Einbuchtungen, steilen Klippen und engen Meeresarmen, voes genannt. Diese voes sind wie Minifjorde, tiefe Täler, die nach der letzten Eiszeit vom steigenden Meer geflutet wurden. Sie fressen sich ins Land, erzeugen Entfernung und machen den Ozean immer und überall unentrinnbar.
Als Shetland vor 12 000 Jahren aus dem Eis auftauchte, war es ein leerer Ort. Es gab keine Vegetation, keine Vögel, keine Säugetiere, überhaupt kein Leben. Es war ein kahler Raum, der darauf wartete, gefüllt zu werden. Und als das Klima sich stetig verbesserte, setzte dieser Füllungsprozess ein. Flechten, Moose und niedrige Sträucher waren die ersten Kolonisten, gefolgt von Seevögeln, die das überreiche Nahrungsangebot des Nordatlantiks nutzten. Immer mehr Vögel kamen, und sie brachten die Samen anderer Pflanzen mit sich, an ihren Füßen und in ihren Mägen.
Die ersten Landsäugetiere in Shetland waren Menschen, die vor etwa 6000 Jahren ankamen. Die Inseln, die diese ersten Einwanderer antrafen, sahen ganz anders aus als die heutigen Inseln. Niedrige Wälder dominierten – Birke, Wacholder, Erle, Eiche, Weide – wie auch hohe Kräuter und Farne, vor allem in Küstennähe. Es war ein üppiger, grüner und milder Ort, und der Mangel an jagdbaren Landtieren, Rotwild vor allem, wurde mehr als wettgemacht durch das Fehlen von Raubtieren und anderen Konkurrenten. Es gab weder die Wölfe noch die Bären, die die Siedler in Schottland zurückgelassen hatten. Hier fanden sie eine Überfülle von Vögeln, die Fleisch und Eier lieferten, wie auch Seehunde, Walrösser, Wale und Fische.
Die frühe Besiedelung Shetlands fiel zusammen mit den späteren Phasen einer bedeutsamen Veränderung der Lebensweise im nördlichen Europa. Die Landwirtschaft, die im »Fruchtbaren Halbmond« des Nahen Ostens ihren Anfang genommen hatte, breitete sich immer weiter nach Westen und nach Norden über den Kontinent aus, da sich das Klima verbesserte und stabilisierte. Land, das einst vom Eis blank gescheuert und vernarbt worden war, verwandelte sich unter den Händen der Menschen. Wälder wurden gefällt und verbrannt, und der frei gewordene Raum wurde Haustieren übergeben. Die frühen Shetlander waren auch frühe Bauern, und es ist schwer, von ihren Leistungen nicht beeindruckt zu sein. Dass es ihnen gelang, die gefährlichen Gewässer zwischen Britannien und den Inseln in ihren zerbrechlichen mit Häuten bespannten Booten zu überqueren, und zwar in ausreichender Zahl, um größere Siedlungen zu bilden, ist erstaunlich genug. Aber dass sie es auch schafften, beträchtliche Mengen Vieh mitzunehmen – Schweine, Schafe, Ziegen und Rinder –, ist doppelt beachtlich. Diese Tiere sowie die Menschen, die sie mitbrachten, sollten sich als der wichtigste Faktor in der Veränderung und Umgestaltung des Landes nach Rückzug des Eises erweisen.
Für die Siedler lag Shetland am äußersten Ende der Welt. Es war so weit nördlich, wie man von Britannien aus nur kommen konnte, und die Leute, die sich dafür entschieden, gingen enorme Risiken ein. Warum machten sie sich die Mühe? Was zog sie nordwärts? Konnte es sein, dass es die reine Abenteuerlust war – dass die Klippen Shetlands, die von Orkney aus am Horizont gerade noch sichtbar waren, die Leute so sehr reizten, dass sie nicht länger widerstehen konnten? Wollten da Menschen ganz einfach nur die Grenzen des Möglichen erkunden?
Es ist verlockend zu vermuten, dass es so gewesen sein könnte. Aber es gibt Alternativen. Da ist vor allem die Möglichkeit, dass die Entwicklung der Landwirtschaft selbst die Siedler weitergetrieben haben könnte. Veränderungen der Landnutzung im nördlichen Britannien übten Druck auf den verfügbaren Raum aus und erzeugten Spannungen und Konflikte zwischen benachbarten Stämmen. Eine Gesellschaft ohne Mauern oder Grenzen entwickelte sich zu einer, in der sie wesentlich waren. Vielleicht war es genau diese Spannung, die die Leute in den Norden nach Shetland trieb.
Jetzt wehte eine leichte Brise, sie stieg die Klippen hoch und blies über den Rand, Sturmvögel klammerten sich daran und ritten wie Karussellpferde auf der flirrenden Luft auf und ab. Ein Vogel stieg höher, fast bis zu meinem Kopf, und hing einen Augenblick lang im Wind. Er schien dort beinahe zu schweben, und als ich ihm zusah, war ich mir sicher, dass er den Blick direkt erwiderte. Einige Sekunden lang betrachteten wir einander fasziniert: ich seine erhabene Missachtung der Schwerkraft, er meine plumpe Masse und das merkwürdige Verhaftetsein an der Erde. Sturmvögel müssen die wissbegierigsten aller Seevögel sein. Sie scheinen Klippenwanderer nicht ignorieren zu können, belästigen sie mit ihrem neugierigen Vorbeifliegen und demonstrieren ihre akrobatischen Fähigkeiten. Sie sind anmutig, verströmen aber auch eine gewisse Bedrohlichkeit. Irgendetwas an ihnen – vielleicht ihre lodernden schwarzen Augen, vorne verschattet, mit einem Komma-Flackern dahinter, oder ihre knolligen, stumpfen Schnäbel – gibt ihnen einen unheimlichen Ausdruck. Die Erscheinung wird noch verstärkt vom scharfen Gackern dieser Vögel, wenn sie in ihren Nestern hocken, und ihrer Gewohnheit, eine übelriechende ölige Substanz auf diejenigen zu spucken, die das Pech haben, ihnen zu nahe zu kommen.
Ein Stückchen weiter an der Klippe entlang erreichte ich den Burn of Burgi Stacks, einen Bachlauf, an dem Steinschmätzer aufflatterten, als ich mich näherte, alle klackernd wie Kiesel in einem Rupfensack. Während ich weiterging, blieben sie auf Distanz, hüpften bei jedem Schritt, den ich machte, ein Stückchen weiter weg. Der Bach hier sprang eilig zum Meer hinab, einen felsigen Hang hinunter und dann über einen kurzen Wasserfall, gesäumt von triefendem grünem Moos. Jenseits des Bachs lagen die Burgi Stacks selbst. Und dann war ich, nach der Karte, fast schon am Breitengrad.
Ich blieb stehen und schaute mir die Konturen der Landschaft eingehend an. Es war schwerer, als ich erwartet hatte, einen Punkt vom anderen zu unterscheiden und genau zu wissen, wo ich war. Die Karte zeigte eine Höhle, die meine Linie zu überqueren schien, aber von meinem Standpunkt aus war die Höhle nicht zu sehen. Ich ging nach Norden, bis ich mir sicher war, den Breitengrad überschritten zu haben, und kehrte dann denselben Weg zurück. Als ich über die Kante eines steilen Geröllhangs spähte, zerbrachen die klaren Linien der Karte zu Steinen und Gras und Wellen. Der Winkel der Klippe und die vorspringenden Felsen verhinderten jede Art von Sicherheit.
Nun war ich in Versuchung, den Hang zum Wasser hinunterzuklettern, weil die Dinge dort vielleicht klarer waren. Wie es aussah, gab es eine gangbare Route nach unten. Aber sie würde mich in die Nähe von zwei fetten Sturmvogelweibchen bringen, die sich zweifellos die Chance nicht entgehen lassen würden, ihre Spuckkünste zu trainieren. Es war eine blöde Idee, und ich ließ es sein. Stattdessen setzte ich mich ins kühle Gras, faltete die Karte auf und fuhr die Linien mit dem Finger nach.
Ich schwitzte und war durstig, und ich ärgerte mich über mich selbst, weil ich kein GPS mitgenommen hatte, mit dem es einfacher gewesen wäre. Einen Augenblick lang wirkte alles willkürlich und sinnlos, so konnte es keine wirkliche Sicherheit geben. Aber ich wollte noch immer einen festen Punkt, einen Startblock, von dem ich loslaufen konnte. So schaute ich noch einmal auf diesen Bogen Papier, las jedes Wort der näheren Umgebung: der Süden, die Burgi Stacks, die Höhle, dann der Seat of Mandrup und der Sheep Pund im Norden. Genau östlich war das Green of Mandrup, die Wiese hinter mir.
Und dann sah ich ihn: Fast völlig verdeckt von diesen Wörtern – »Green of Mandrup« –, doch zu beiden Seiten gerade noch herausragend, zeigte die Karte eine solide gerade Linie. Ein Zaun. Seine gesamte Länge bis zum Klippenrand stimmte mit dem Breitengrad überein. Ich stand auf, drehte mich nach Osten und entdeckte die Pfosten, die durch die Wiese und auf den Hügel führten, schaute dann zurück zu der Stelle, wo der Zaun in einem Gewirr aus Draht und Holz endete, das über den Klippenrand hing. Das war es also: 60 Grad nördlich des Äquators. Das war meine Startlinie.
Geografie beginnt an dem einzigen Punkt, dessen wir uns ganz sicher sein können. Sie beginnt in unserem Inneren. Und dort, im Inneren, erhebt sich eine einzige Frage: Wo bin ich?
Stellen Sie sich vor, Sie stehen auf einem Hügel. Oder besser, stellen Sie sich vor, Sie stehen auf einem hohen Hügel auf einer kleinen Insel, und der Horizont ist in allen Richtungen sichtbar – eine perfekte, undurchbrochene Linie. Von frühmorgens bis spätabends stehen Sie da. Sie sehen die Sonne auf der einen Seite der Insel aufgehen, sich ihren Weg über den Himmel bahnen, sich langsam und vorhersehbar bewegen, bis sie den gegenüberliegenden Horizont erreicht, hinter dem sie dann langsam verschwindet. Während ihr Licht schwindet, sprenkeln Sterne die tiefer werdende Dunkelheit. Auch sie drehen sich um Sie, auf einer Achse, die am Polaris, dem Nordstern, verankert ist. Diese große Arena von Nacht und Tag scheint über die stillstehende Welt zu rollen und sie mit ihrer Bewegung zu umfassen. Und diese Frage erhebt sich: Wo bin ich?
Das Universum, das wir sehen können, ist ein Ort der Spiegel und Illusionen, Augen- und Verstandestäuschungen, und man muss schon viel wissenschaftlichen Glauben aufbieten, um mit den Fakten, wie wir sie kennen, zurechtzukommen: dass nichts stillsteht; dass sowohl unser Universum und unser Planet unaufhörlich in Bewegung sind. Nach oben zu schauen und sich dies einzugestehen, bedeutet, mit seiner Vorstellungskraft einen schwindelerregenden Satz zu machen. Es bedeutet, überwältigt zu sein von Gefühlen nicht nur der Bedeutungslosigkeit, sondern auch der Angst, der Verletzlichkeit und der Heiterkeit. Bei all dieser Bewegung, dieser unermesslichen Entfernung erscheint es irgendwie unmöglich, dass wir überhaupt irgendwo sein können.
Aber unser Begriff davon, wo wir auf dieser Welt sind, entstand nicht, weil wir diese Himmelsbewegung im Sinn hatten. Seit die Menschen anfingen, die Sonne und die Sterne als Navigationshilfen zu benutzen, haben sie es getan, indem sie diese desorientierenden Fakten entweder nicht kannten oder ignorierten. Dass der Nordstern kein fixer Punkt im Universum ist, ist unwichtig, solange er als fixer Punkt erscheint. Dass die Sonne sich nicht um die Erde dreht, macht nichts, solange es weiterhin so aussieht, als würde sie es tun, und ihr Auftauchen vorhersehbar ist. Denn die Wurzeln dieser Frage – wo bin ich –, sind nicht so sehr philosophisch oder unbedingt wissenschaftlich, sie sind zweckorientiert. Wo wir sind, ergibt nur dann wirklich einen Sinn, wenn es in Beziehung steht dazu, wo wir waren und wo wir sein wollen. Um sich auf zielgerichtete Art zu bewegen, um zu vermeiden, dass wir Zeit verschwenden oder unser Leben riskieren, müssen wir uns ein Bild unseres Aufenthaltsorts machen, ein Bild davon, wo wir in unserer Umgebung stehen. Wir müssen Karten zeichnen.
Ich schaute hinaus auf den ruhigen Ozean, auf die Tidenlinien, verflochten wie Strähnen weißer Haare. Ich schaute zum Horizont – Blau mit Blau verbunden – und dahinter zu unsichtbaren Orten: nach Grönland, nach Nordamerika, nach Russland, Finnland, Skandinavien und dann über die Nordsee hierher zurück. Mehrere Minuten schaute ich in die Ferne, dann war ich bereit zu gehen. Ich drehte mich um und ging den Hügel hoch, am Zaun entlang. Von meinem Startpunkt am Klippenrand ging ich am Breitengrad den langen Weg zurück, froh, wieder in Bewegung zu sein.
Bald wich das üppige Grün, das die Küste gesäumt hatte, niedrigem Heidekraut und dunkler torfiger Erde. Das Land ebnete sich zu einem Plateau aus Dunkelrot und Oliv, zerfurcht und terrassiert, wo man den Torf abgebaut hatte. Weiße Büschel Wollgras lagen auf dem Hügel verstreut. Flache Pfützen mit schwarzem Wasser stauten sich unter den Torfreihen und in den schmalen Gräben dazwischen. Ich sprang von Insel zu Insel festen Bodens und versuchte, meine Füße trocken zu halten, während über mir lautstark eine Lerche schwebte, getragen von der Leichtigkeit ihres Lieds.
Nach nur etwa zehn Minuten ging ich schon wieder hügelabwärts, hinein in das üppige Tal, das den Loch of Vatsetter und den Burn of Maywick umgibt, flankiert von leuchtend gelben Schwertlilien. Das dichte Heidekraut wich einem helleren, lichteren Grün, und der Gegenhang war eine Wiese, gestreift von geschnittener Silage. Ein Schwarm Goldregenpfeifer flog plötzlich vom Boden auf und wand sich durch das Tal. Zwei Kiebitze kreuzten ihren Weg über dem Loch und flatterten mit linkischer Anmut aufs Meer zu. Ich schaute den Vögeln nach, bis sie nicht mehr zu sehen waren, und ging dann weiter zu dem Bach unter mir.
Der steile Abstieg bedeutete einen ebenso steilen Wiederanstieg, auf einem Kiespfad, der laut Karte den Breitengrad ein paarmal kreuzte, bevor er sich im Nichts verlor. Ich ging weiter und war bald wieder mitten im Torf. Der Hügel stieg 200 Meter scharf an, ich schwitzte vom Marschieren, aber es war die Mühe wert. Als ich die Kuppe erreichte, weitete sich ohne Vorwarnung die Luft, und ich konnte von einem Ende Shetlands zum anderen sehen: den Atlantik hinter mir und die Nordsee vor mir. Über mir wurden Büschel Zirruswolken über einen prächtigen Himmel gekämmt, der so weit war, wie ich ihn noch nie gesehen hatte.
Menschen haben sich schon immer von hier nach dort bewegt, von einem Ort zum anderen, mit einer Mischung aus Erinnerungen, erlerntem Wissen und Neugier. Meistens haben wir innere Karten benutzt – erinnerte Routen von einem wichtigen Punkt zu einem anderen: ein Ort zum Essen, ein Ort für Obdach, ein Ort der Gefahr. Elemente dieser Karten wurden von einer Generation zur nächsten weitergegeben, in Liedern und Geschichten. Sie wurden ausgeschmückt, aktualisiert und wenn nötig auch verworfen. Das sind lebendige Karten, in denen Ort und Richtung abgeschottet und von der Außenwelt getrennt wurden. Sie können so verschachtelt und geheimnisvoll sein wie die Liedzeilen der australischen Aborigines oder so einfach, wie sich zu erinnern, wie man von der eigenen Haustür zum nächsten Laden kommt.
Um sich ein konkreteres Bild davon zu machen, wo wir sind, war es nötig, unsere Karten zu externalisieren, sich Bilder von der Welt zu machen. Die ersten sichtbaren Karten waren die der Sterne, wie die an den Wänden der Höhlen bei Lascaux in Frankreich, die vor mehr als 16 000 Jahren gezeichnet wurden. Aber es ist einfach, in den Himmel zu schauen. Ein Bild zu zeichnen, das einen speziellen Ort auf Erden umfasst oder sogar den ganzen Planeten, ist eine viel größere Herausforderung. Der Kartenmacher ist gezwungen, ein anderer als er selbst zu werden, sich die Vogelperspektive vorzustellen. Der Kartenmacher muss von oben herabschauen und gottgleich werden, indem er seine eigene Welt neu erschafft.
Im Gegensatz zu internen oder »Erzählungs«-Karten waren frühe Weltkarten gedacht als wissenschaftliche oder philosophische Übung und weniger als Navigationshilfen. Ihre Praxistauglichkeit wurde durch zwei wichtige Faktoren beschränkt. Zum Ersten hatten die alten Griechen als Pioniere der Kartografie nur beschränkte geografische Kenntnisse. Deren Karten konzentrierten sich auf den Mittelmeerraum und reichten in östlicher Richtung nur bis Indien, im Westen war die Meerenge von Gibraltar die Grenze. Die Welt jenseits dieser Grenzen war mehr oder weniger unbekannt, doch Spekulationen über die grotesken Barbarensiedlungen in Nordeuropa und in Afrika waren weit verbreitet. Das andere große Problem der griechischen Kartenmacher war ihr Mangel an praktischen Mitteln zur präzisen Darstellung von Entfernung und Form. Was dazu nötig war, war eine Art Maßstab oder Raster, das nicht nur auf die kugelförmige Oberfläche der Erde anwendbar war, sondern potenziell auch auf einen Globus oder eine flache Karte. Ein solches Raster stand erst ab dem zweiten Jahrhundert vor Christus zur Verfügung, als Hipparchos von Nicäa das System entwickelte, das wir auch heute noch benutzen: die Vermessung der Welt in Bogengraden. Auch wenn ähnliche Methoden schon früher von den Babyloniern vorgeschlagen wurden, bestand Hipparchos’ Leistung darin, einen Kreis in 360 Bogengrade zu unterteilen und damit den Grundstein für die Trigonometrie zu legen.
Ein Grad war das Maß eines Winkels im Zentrum eines Kreises, zwischen einem Radius und dem anderen, wie die Zeiger einer Uhr. Wenn es drei Uhr ist, ist der Winkel zwischen den Zeigern 90 Grad: ein Viertel eines ganzen Kreises. Die beiden Punkte, wo die Radii, oder Zeiger, den Außenrand des Kreises treffen, sind nach Definition ebenfalls 90 Grad voneinander entfernt. Dieses Maß kann des Weiteren auf Kugeln wie die Erde angewandt werden, wobei der nord-südliche Winkel mit einem Maß – dem Breitengrad – und der ost-westliche Winkel mit einem anderen – dem Längengrad – bezeichnet wird. Nun war es, zumindest theoretisch, möglich, Koordinaten für jeden beliebigen Ort auf der Erde anzugeben, und diese Information konnte darüber hinaus benutzt werden, um geografischen Raum präzise auf einer Karte darzustellen. Das war ein revolutionärer Schritt für die Navigation und die Kartografie.
Während Längengradlinien, oder Meridiane, von gleicher Länge sind, durch beide Pole laufen und den Planeten unterteilen wie in Segmente einer Orange, sind die Kreise der Breitengrade parallele Linien, die fortschreitend an Größe abnehmen, vom vollen Planetenumfang am Äquator zu einzelnen Punkten an den Polen. Sie sind dargestellt als Winkel bis zu 90 Grad nördlich oder südlich des Äquators. Bei 60 Grad nördlicher Breite, wo ich stand, ist die Parallele nur halb so lang wie die am Äquator und verläuft bei zwei Drittel des Abstands bis zum Pol.
Für die Griechen kam der Höhepunkt ihrer kartografischen Tradition Mitte des zweiten Jahrhunderts nach Christus im römischen Alexandria. Dort schuf Claudius Ptolemäus seine Geographia, eine Arbeit, die das geografische Wissen der Griechen und der Römer zusammenfasste. Ptolemäus gab Koordinaten für 8000 Orte an, die sich zwischen seinem Nullmeridian bei den Glücklichen Inseln (vermutlich Cap Verde) im Westen, nach China im Osten, Zentralafrika im Süden und Shetland, das er Thule nannte, im Norden erstreckten. Das war die bekannte Welt, die in der Länge 180 Grad und 80 in der Breite erreichte, und Shetland lag an ihrem äußersten Rand. Auch wenn dieses Buch für mehr als tausend Jahre so gut wie in der Versenkung verschwand, war sein Einfluss letztendlich immens.
Um heute etwas über unseren Aufenthaltsort zu erfahren, müssen wir nur in eine Karte schauen oder auf unserem Handy oder mobilen GPS-Gerät einen Knopf drücken, dann erfahren wir unsere Länge und Breite in Graden, Bogenminuten und -sekunden. Dennoch fühlt sich diese Frage noch immer irgendwie unbeantwortet an, nagt an unserer Gewissheit. Wo bin ich?
Es ist ein merkwürdiger Ort hier oben, diese Landschaft aus Torf und Heidekraut. Oft verallgemeinernd einfach nur »der Hügel« genannt, bildet er den Kern Shetlands, der mehr als fünfzig Prozent des Landes bedeckt. Von dieser Stelle aus könnte ich vierzig Meilen in den Norden der Hauptinsel gehen, ohne den Hügel wirklich zu verlassen. Es ist ein Ort, der getrennt ist von den Orten der Menschen, ein halbwildes Moorland, durch Zaun und Deich vom Ackerland darunter abgesetzt. Außerdem war es – und ist es in vielen Teilen Shetlands immer noch – ein gemeinsam genutzter Ort, eine Allmende, mit Weide- und Torfstechrechten für alle Kleinbauern der umliegenden Gemeinden.
In Beschreibungen des Hügels durch Reisende tauchen gewisse Begriffe häufig auf: öde, einsam, gesichtslos. Man betrachtet das Land, als würde ihm etwas fehlen, sowohl an ästhetischem Reiz wie an landschaftlichem Nutzen. Die Encyclopaedia Britannica von 1911 beschrieb Shetlands Inneres als »kahl und trist, bestehend aus baumlosen und öden Flächen aus Torf und Felsen«. Es ist wogendes, welliges Terrain ohne die Dramatik einer Gebirgslandschaft oder die Stille eines Tals. Es ist ein Ort, der weder zahm noch wild genug ist, um als wertvoll betrachtet zu werden. In vielerlei Hinsicht ist es ein Zwischenland. Auf der Karte ist wenig zu sehen außer Höhenlinien und das sich schlängelnde Gekrakel der Bäche, in denen schwarzes Wasser aus der Trägheit des Moors seewärts gluckst. Wenn man sich umsieht, sucht das Auge Stellen, an denen es innehalten, auf die es sich konzentrieren kann, aber nichts unterbricht das schwere Wogen des Landes. Der Hügel zeigt eine Fläche des Immergleichen, die den Wanderer in sich hineinzieht und ein Gefühl des Abgeschiedenseins von der Welt darunter erzeugt. Da ist leerer Raum, eine Weite, die bei einem so eng umgrenzten Land irgendwie überraschend ist. Die Torflandschaft öffnet und entfaltet sich in »aktiver Ausdehnung«, wie Robert Macfarlane es nennt. Der Horizont, die Kuppel des Himmels und die Klarheit der Luft, all das wird Teil von Maß und Masse des Landes. Zusammen erzeugen sie in dieser Arena eine Illusion von Entfernung und machen Shetland zu einem größeren Ort, einem Ort, in dem man sich verirren kann. Hier kann man sich selbst als abgeschieden von anderen Menschen fühlen und alleine dasitzen, inmitten einer unvertrauten Stille.
Wie Menschen, die im Schatten der Berge wohnen, leben Shetlander mit der beständigen Präsenz des Moors und des Hügels. Es ist eine Präsenz, so glaube ich, die für den Charakter der Insulaner so zentral ist wie für die Inseln. Denn so, wie wir in der Landschaft wohnen, wohnt die Landschaft in uns, im Denken, in den Mythen und in der Erinnerung; und irgendwie lädt die Offenheit des Landes uns dazu ein, uns zugehörig zu fühlen, oder anders, es macht sich uns zugehörig. Unser Verständnis von Raum und unsere Beziehung zu diesem Raum sind betroffen, und damit auch unser Verständnis von Zeit.
Wir sind es gewohnt, uns Zeit als feststehende Dimension vorzustellen, durch die wir uns stetig und unerschrocken bewegen. Aber es gibt Orte, an denen diese Vorstellung unangemessen wirkt, wo die Zeit selbst sich in einem anderen Tempo zu bewegen scheint. Es gibt Orte, an denen wir die Augenblicke vorbeieilen spüren, ungehindert, so schnell und so dicht hintereinander, dass wir ihren Atem spüren, wenn sie vorbeirasen. Und dann wieder gibt es Orte, wie etwa hier auf dem Hügel, wo die Zeit sich zu sammeln scheint, sich zugleich zusammenzieht und ausdehnt. Hier ist die Vergangenheit näher. Wir finden ihr Andenken in die Erde eingebettet, wie die so unheimlich erhaltenen Leichen, jahrhundertealt, die in ganz Europa aus Torfmooren gezogen werden, Kleidung, Haare und Haut intakt. Oder der Torf selbst, ein biologisches Tagebuch der Geschichte der Inseln. Hier bewegen sich die Dinge langsamer. Der Wandel wird stur, feierlich aufgezeichnet. Will man das Land genauer untersuchen und dabei sein eigenes Leben und das Leben auf ihm und mit ihm berücksichtigen, sieht man sich einer Vielzahl von anderen Zeiten und anderen Welten gegenüber. Hier auf dem Hügel, wo Land und Himmel sich öffnen, tun Vergangenheit und Gegenwart das Gegenteil, sie ziehen sich eng in sich zusammen. Hier herrscht ursprüngliche Zeitlosigkeit.
Es ist deshalb kaum überraschend, dass der Hügel in der Mythologie der Inseln eine so wichtige Rolle gespielt hat. Vor allem ist er seit Langem, und wird es bleiben, die Heimat des »Hügelvolks«, der Trows. Es sind nächtliche trollähnliche Wesen, manchmal gutmütig und manchmal Schabernack treibend, und die bekanntesten Geschichten über sie erzählen von Musikern, die in die Erde unter dem Heidekraut gelockt werden. Dort müssen sie in einer Welt auftreten, in der das menschliche Maß der Zeit nicht mehr zutrifft. Der Geiger unterhält seinen Gastgeber am Abend, bekommt Essen und Getränke, vielleicht sogar einen Schlafplatz angeboten; doch wenn er dann nach der nächtlichen Vorführung wieder auftaucht, kann es sein, dass seine Kinder erwachsen sind und seine Frau tot oder wieder verheiratet. Ein unglücklicher Geiger, Sigurd o’ Gord, verlor unter dem Hügel ein ganzes Jahrhundert. Mit einem neuen Lied, das er unter der Erde gelernt hatte, »Da Trows’ Spring«, kehrte er nach Hause zurück, musste aber erkennen, dass sich in seiner Abwesenheit alles verändert hatte; sein Zuhause gehörte jemand anderem, seine Familie war längst nicht mehr.
Die Popularität dieser Geschichten schwindet nicht. Sie werden endlos wiederholt, aufgenommen und veröffentlicht, sie überschatten so gut wie jede andere einheimische Folklore, und ich bin mir sicher, es gibt immer noch einige Shetlander, die behaupten, einem dieser Wesen bei einer Wanderung über den Hügel begegnet zu sein. Ein Trow kann plötzlich aus dem Nebel auftauchen oder hinter einem Felsen hervorspringen, er kann aber auch aus dem Fels selber herauswachsen. Sie sind, so scheint es, ein wesentlicher Bestandteil der Landschaft, in der sie leben, und ihre sture Beharrlichkeit als Einzelwesen und als Art muss zum Teil zumindest an der ebenso sturen Beharrlichkeit ihres Habitats liegen. Ich glaube, sie sind auch eine Manifestation der andauernden Ambivalenz unserer Beziehung zu diesem Habitat, eine Ambivalenz, die ihren deutlichsten Ausdruck in den Debatten findet, die jahrelang über den Bau von Windparks im zentralen Mainland gewütet haben.
Das Unbehagen, das die Torflandschaften auslösen können, hat tiefe kulturelle Wurzeln. Die menschliche Gesellschaft in Shetland entwickelte sich mit und nicht nur neben dem Hügel, und diese Entwicklung zeigt sich in der Beziehung zwischen den beiden. Als die ersten Menschen auf die Inseln kamen, hatte sich der Torf noch nicht über große Flächen ausgebreitet. Er existierte an isolierten, schlecht entwässerten Stellen, aber das flächendeckende Moor, das sich jetzt über weite Teile des Lands erstreckt, war einfach noch nicht da. Die Ankunft der Menschen in Shetland fiel jedoch mit einer Verschlechterung des Klimas zusammen. Die Temperaturen sanken, Regenmengen schwollen an, und in einer durchfeuchteten, sauren Erde, in der Pflanzenmaterial sich nicht richtig zersetzen konnte, sammelte es sich stattdessen als Torf an. Der Prozess war zwar primär ein natürlicher, aber anhaltende Entwaldung und die landwirtschaftliche Entwicklung spielten eine wichtige Rolle. Eine weitere Klimaverschlechterung beschleunigte das Torfwachstum und verbreitete das Moor über neue Gebiete. Mehr und mehr waren die Shetlander gezwungen, ehemals nützliches Land aufzugeben, da es gesättigt, sauer und unfruchtbar geworden war, und sie wurden in einem dünnen bewohnbaren Keil zwischen Hügel und Meer zusammengepfercht. Vor zweitausend Jahren sah das Land vermutlich ganz ähnlich aus wie heute.