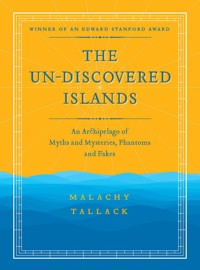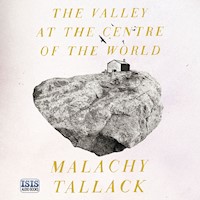22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Konrad Theiss Verlag GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Sie heißen Atlantis und Thule, Kibu und Fusang. Schon der Klang ihrer Namen verzaubert. Doch niemand hat die sagenhaften Inseln je gefunden. Jahrhunderte lang glaubte man fest an ihre Existenz. Heute sind sie auf keiner Seekarte mehr verzeichnet. Malachy Tallacks Entdeckungsreise führt zu den merkwürdigsten Orten der Welt. Mit viel Witz und leidenschaftlicher Neugier erkundet er zwei Dutzend Eilande rund um den Globus, von der Antike bis in unsere Zeit. Er erzählt von versunkenen Reichen, betrügerischen Mönchen und Paradiesen unter dem Wind. Die geheimnisvollen Inseln sind bloße Schöpfungen der menschlichen Fantasie und haben doch in Mythen und Erzählungen überdauert. Den Atlas der imaginären Inseln, Legenden und Wunder hat die großartige Katie Scott fabelhaft illustriert und mit leuchtenden Farben in Szene gesetzt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 131
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
MALACHY TALLACK
VonInseln,die keinerje fand
Illustriert von Katie ScottÜbersetzt von Gisella M. Vorderobermeier
Impressum
Die englische Originalausgabe erschien unter dem TitelThe Un-Discovered Islands. An Archipelago of Myths and Mysteries, Phantoms and Fakes.
Copyright © 2016 Malachy TallackCopyright der Illustrationen © 2016 Katie ScottAutorisierte Übersetzung der englischen Ausgabe
Diese Ausgabe erscheint in deutscher Erstübersetzung bei der WissenschaftlichenBuchgesellschaft, Darmstadt.Copyright der deutschen Übersetzung © 2018 Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;detaillierte bibliografische Daten sind im Internet überhttp://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt.Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig.Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen,Mikroverfilmungen und die Einspeicherung in und Verarbeitungdurch elektronische Systeme.
Der Theiss Verlag ist ein Imprint der WBG.
© 2018 Wissenschaftliche Buchgesellschaft, DarmstadtDie Herausgabe des Werkes wurde durch die Vereinsmitglieder der WBG ermöglicht.Satz: Textbüro Vorderobermeier, MünchenUmschlaggestaltung: Jutta Schneider, Frankfurt am Main
Besuchen Sie uns im Internet: www.wbg-wissenverbindet.de
ISBN 978-3-8062-3675-0
Elektronisch sind folgende Ausgaben erhältlich:eBook (PDF): ISBN 978-3-8062-3677-4eBook (epub): ISBN 978-3-8062-3678-1
Menü
Buch lesen
Innentitel
Inhaltsverzeichnis
Informationen zum Buch
Informationen zum Autor
Impressum
Inhalt
Einleitung
Inseln des Lebens und des Todes
Im Aufbruch
Die Zeit der Entdeckungen
Versunkene Länder
Trügerische Inseln
Widerrufene Entdeckungen
Andere Inseln auf Widerruf
Zitierte Literatur
Weiterführende Literatur
Einleitung
Gut kann ich mich an das Motto am Eingang der Anderson High School in Lerwick auf den Shetlandinseln erinnern: „Dö weel and persevere“, ein Rat, den einst der Schulgründer, der von der Insel stammende Reedereigründer und Philanthrop Arthur Anderson, als junger Mann erhalten hatte. Genau genommen war dieses „Tue Gutes und sei beharrlich“ ja kein ganz so spektakulärer Ratschlag, aber Andersons Aufstieg aus ärmlichen Verhältnissen zu einer Position, die ihm seine philanthropische Tätigkeit erlaubte, war Teil der Insel- und Schulgeschichte und sollte junge Shetländer inspirieren und ihnen vor Augen halten, dass auch sie alles erreichen konnten.
Das Motto war begleitet von drei Wikinger-Wahrzeichen – einer Axt, einem Langschiff und einer brennenden Fackel – und einer anderen, weniger eindeutigen Inschrift. Auf einem gelben Spruchband, das über die Mitte des Wappens verlief, standen drei Worte in Latein, die auf einen ganz anderen Teil unserer Geschichte verwiesen. „Dispecta est Thule“: Thule ward gesehen.
Obwohl ich jene Pforte in meinen Schuljahren unzählige Male passierte, erklärte uns kein Lehrer je die lateinischen Worte darauf, und ich machte mir nie die Mühe, nachzufragen. Ich hatte eine vage Vorstellung davon, dass man Thule für den Rand der Welt hielt, und glaubte, Shetland sei irgendwie damit identisch oder dies zumindest irgendwann einmal gewesen. Aber in meinem jugendlichen Gemüt verband sich dieses Wort am engsten mit der Thule-Bar unten am Hafen, für einen Teenager ein Ort, der weitaus geheimnisvoller und lockender war.
Erst viele Jahre später, als die Schulzeit längst hinter mir lag, erfuhr ich etwas über den Ursprung dieses Mottos. Thule war tatsächlich der Rand der Welt, aber es war mehr als das. Es war eine Insel, die einst für real gehalten worden war, aber nun auf den Karten fehlte. Es war ein Ort, der kein Ort mehr war. Die Worte selbst stammten von dem römischen Historiker Tacitus, dessen Schwiegervater Agricola gegen Ende des ersten Jahrhunderts n. Chr. Statthalter von Britannien war. Nördlich des schottischen Festlands segelnd, hatte Agricola Shetland am Horizont erblickt und es für Thule gehalten, den nördlichsten Punkt der antiken Welt. Er verpasste den Inseln dieses Label, aber es blieb nicht lange hängen. Thule ward gesehen und dann verschwand es wieder.
Bei genauerer Betrachtung erscheint es seltsam, dass so ein Satz als geeignete Ausschmückung für jene Tore gegolten haben soll, kollidierte seine Botschaft doch so unübersehbar mit derjenigen, welche er begleitete. Folgte man dem Motto der Schule, so war Shetland ein Ort, der so bedeutsam war, wie wir, seine Söhne und Töchter, ihn zu gestalten vermochten. Arthur Anderson war ein wichtiger Mann – seine Schiffe hatten die Weltmeere befahren –, und wie er konnten wir überall hingehen und alles tun. Aber in jenen drei Worten von Tacitus verlor Shetland seine Identität völlig. Ja, als Anhängsel der Idee von Thule existierten wir kaum. Ein eigenartiger Widerspruch, aber irgendetwas an dieser irrealen Geografie übte eine gewisse Anziehungskraft auf mich aus.
Später stellte ich fest, dass die Meere voll sind von solchen Orten: Inseln, die „entdeckt“ wurden und bei denen sich später herausstellte, dass da gar nichts zu entdecken war. Es gab sie in allen Teilen der Welt und manche erschienen viele Jahrhunderte auf Karten, ehe sie schließlich von diesen getilgt wurden. Diese Inseln sind nicht durch Überflutungen oder Erdbeben verloren gegangen, sie sind keine Opfer von Naturkatastrophen. Diese Inseln sind menschlichen Ursprungs, Produkte der Fantasie und von Fehlern.
In diesem Buch ist eine ganze Schar von solchen Inseln versammelt, unterteilt in sechs Kapitel. Bei den ersten handelt es sich um Inseln des Lebens und des Todes: mythische Orte, die ausschließlich innerhalb von Erzählungen vorkommen. Das Kapitel Im Aufbruch stellt Inseln vor, die von frühen Reisenden im Atlantik und Pazifik gefunden wurden, zu einer Zeit, als wenige Menschen die Welt jenseits ihrer eigenen Ufer kannten. Die dritte Gruppe von Inseln tauchte während der Zeit der Entdeckungen auf, als europäische Seeleute den Globus allmählich mit einer gewissen Regelmäßigkeit zu durchqueren begannen. Die vierte sind Versunkene Länder, von denen man annahm, sie seien einst untergegangen, während das fünfte Kapitel Trügerischen Inseln gewidmet ist, erfunden von Scherzbolden und Schwindlern. Bei der sechsten und letzten Gruppe handelt es sich um Widerrufene Entdeckungen, die in das 20. und 21. Jh. fallen.
Jeder dieser Orte hat seine je eigene Geschichte und keiner gleicht so ganz dem anderen. Manche waren an der Ausbildung ganzer Kulturen beteiligt, während man von anderen kaum Notiz nahm. Manche sind seltsam und märchenhaft, während andere völlig glaubwürdig sind. Alle spiegeln sie auf die ein oder andere Art und Weise die Werte ihrer Zeit wider und alle haben sie die Geografie des Geistes bereichert. Dieses Buch möchte jene „weg-entdeckten“ Inseln feiern und durch sie die Geschichte erzählen, wie wir unser Bild von der Welt geformt haben.
Inseln des Lebens und des Todes
Die Inseln der Seligen
Kibu
Hawaiki
Hufaidh
Inseln des Lebens und des Todes
WENN WIR IN DEN HIMMEL blicken, stellen wir uns Götter vor, wenn wir auf das offene Meer blicken, Inseln. Abwesenheit ist etwas Furchterregendes, und so füllen wir die Lücken mit Erfundenem. Dies bringt uns seelischen Komfort, kollidiert aber auch mit unserem Wunsch nach Gewissheit und Verstehen. Und manchmal führt uns dieser Wunsch gerade die Abwesenheit dessen vor Augen, was wir ausfüllen wollten.
Seit die Menschen Geschichten erfinden, erfinden sie auch Inseln. Von jeher begegnen wir ihnen in der Literatur wie in der Legende. Für Gesellschaften, die am Meer leben, ist der Traum von anderen Ufern der natürlichste Traum überhaupt. Polynesier, Marsch-Araber, die alten Griechen und die Kelten: Sie alle haben sich Länder jenseits ihres Horizonts vorgestellt. Sie alle erzählten Geschichten von Inseln.
Diese Orte glichen nicht der Welt des Alltags. Es waren übernatürliche Gefilde, wo die Grenze zwischen Leben und Tod verschwamm. Das Meer trennt uns von anderen Ländern, so wie uns der Tod von den Lebenden trennt. Ein Übergang ist möglich, aber nur ein einziges Mal. Inseln sind also ideale Metaphern für andere Welten und das Nachleben. Sie stehen für sich und sind doch nicht unverbunden, weit entfernt und doch greifbar. Das Meer des Todes ist übersät von imaginären Inseln.
Heutzutage versuchen wir, eine rigide Grenze zwischen Fakten und Fiktionen zu ziehen. Aber Mythos, Aberglaube und Religion waren immer schon Teil des menschlichen Lebens. Sie haben unser Denken geformt und unsere Taten gelenkt. Wie wir unser Dasein begreifen, ist untrennbar mit den Geschichten verbunden, die wir uns erzählen. Und so mögen die Inseln in diesem Kapitel vielleicht dem Bereich der Mythologie angehören, weniger real waren sie deswegen aber nicht.
DIE VORSTELLUNG von einem Paradies auf Erden ist seit langem fester Bestandteil der europäischen mythologischen Tradition. In Homers Odyssee finden wir eine der ältesten bekannten Versionen, die elysischen Gefilde, wohin die Günstlinge der Götter gelangen. Nach Proteus, dem Alten vom Meer, „verläuft das Leben der Menschen“ dort „ganz ohne Mühe; es gibt dort keinen Schneefall, wenig Sturm und nie Regen, sondern ständig schickt Stöße des schneidend wehenden Westwinds Okeanus herauf, um abzukühlen die Menschen“. Kein Totenreich also, sondern eine Alternative zu ihm.
Doch die alten Griechen kannten nicht nur eine Fassung der Geschichte, die Idee war wandelbar und facettenreich. Zu Platons Zeiten, im 4. Jh. v. Chr., stellte man sich das Elysium zumeist als Insel oder Archipel im Westlichen Ozean vor. Es war als Weiße Insel oder Insel der Seligen bekannt und galt so manchem als ein Ort, nach dem alle streben konnten.
In Platons Dialog Gorgias umreißt Sokrates seinen Glauben auf eine Art, die deutlich die christliche Religion vorwegnimmt: Nach dem Tod werden Körper und Seele getrennt, doch behält jeder den Charakter, der ihm auch als Lebendem zu eigen war. Die Dicken bleiben dick, die Narbigen narbig. Zumindest für eine gewisse Zeit. Auch liegt alles „klar zutage an der Seele, wenn sie des Körpers entledigt ist, sowohl ihre natürliche Beschaffenheit wie auch die Eigentümlichkeiten, die der Mensch durch seine jeweiligen Beschäftigungen der Seele eingepflanzt hat“. Im Gegensatz zum Körper muss sich die Seele nach dem Tod dem Richtspruch der drei Söhne des Zeus unterwerfen. Aiakos urteilt über diejenigen aus dem Westen und Rhadamanthys über die aus dem Osten, während Minos die endgültige Entscheidung trifft. Jeder, der „ein ungerechtes und gottloses Leben geführt“ hat, kommt „in die Gefängnisstätte der Buße und Strafe … die sie Tartaros nennen“, während „derjenige, der sein Leben in Gerechtigkeit und Frömmigkeit vollbracht hat, nach seinem Tode nach den Inseln der Seligen versetzt [wird] und dort in voller Glückseligkeit [wohnt], fern von allem Leid“.
Sokrates wusste, dass dies für seine Zuhörer – die Rhetoriker Gorgias, Kallikles und Polus – ein Mythos war. Aber er regte sie an, dies zu überdenken. Er selbst habe ein wohlgefälliges Leben geführt und sei „beflissen“, dem Richter seine Seele „in möglichst gesundem Zustande vorzuführen“. Ob sie dasselbe Selbstvertrauen hätten? Man müsse sich, sagte ihnen Sokrates, mehr „vor dem Unrechttun als dem Unrechtleiden“ hüten und darum bemühen, „nicht gut zu scheinen, sondern gut zu sein, im persönlichen wie im öffentlichen Verkehr“. Nur dann sei das Paradies sicher.
Auch bei den Kelten gab es frühesten Überlieferungen nach eine gelobte Insel, ja sogar mehrere, darunter Tír na nÓg, das Land der ewigen Jugend. Dorthin brannte der junge Dichter-Krieger Oisín mit Niamh durch, der Tochter eines Meeresgottes namens Manannán mac Lir. Bei seiner Rückkehr nach Connemara drei Jahre nach der Heirat stellte Oisín fest, dass ein Jahr in Tír na nÓg einem Jahrhundert in Irland entsprach. Seine Familienangehörigen waren längst nicht mehr unter den Lebenden.
Auch andere solche Gefilde konnten synonym dafür stehen. Da gab es die Insel Mag Mell, Homers Elysium ähnelnd, wo Gottheiten und auserwählte Sterbliche ohne Schmerzen oder Krankheiten lebten. Dann war da Emhain Ablach und sein walisisches Pendant Ynys Afallon, die Apfelinsel. Fruchtreichtum war für die Kelten ein wesentliches Merkmal des Orts.
Im Mittelalter erlangte die Apfelinsel als Avalon Berühmtheit. Dort wurde das Schwert Excalibur von König Artus geschmiedet und dorthin auch sollte er sich nach seiner Verwundung in der Schlacht von Camlann zurückziehen. Geradeso wie bei den frühen Griechen hatte sich der heroische Artus seinen Platz dort verdient und seine Reise dorthin war eine Alternative zum Tod. Der Legende nach würde er eines Tages aus Avalon zurückkehren, um für sein Volk zu kämpfen: eine Art keltischer Messias.
Ein Großteil der Artussage stammt von Geoffrey von Monmouth. In seiner Vita Merlini (12. Jh.) beschreibt der Geistliche Avalon mit einigem Detailreichtum:
Die Apfelinsel wird auch die „glückliche Insel“ genannt, weil sie alle Dinge aus sich selbst erzeugt … Freiwillig schenkt sie dort Korn und Wein, und in den Wäldern wachsen Apfelbäume im stets geschnittenen Grase. Aber nicht nur schlichtes Gras, sondern alles bringt der Boden in Fülle hervor, und hundert Jahre und darüber währt dort das Leben.
In der Kartografie wurden die Glücklichen Inseln mit den Kanaren assoziiert und mittelalterliche Karten kannten sie als Insula Fortunata. Aber die mythischen Ursprünge des Namens gerieten keineswegs in Vergessenheit. Obwohl die christliche Lehre darauf beharrte, dass das Paradies in einer übernatürlichen Sphäre liege, entschwand die Vorstellung von einem gelobten Land auf Erden nie aus der Vorstellungswelt der Europäer. In England war das glückselige Land von Cockaigne Gegenstand zahlreicher Erzählungen und Gedichte, in Deutschland war es das Schlaraffenland, wo Milch und Honig fließen, und in Spanien Jauja, ein Name, der nunmehr eine kleine Stadt in Peru bezeichnet.
Als europäische Entdecker im 14. und 15. Jh. weiter in den Atlantik vordrangen, erwarteten viele, dort draußen irgendwo ein solches Idyll zu finden. Später, nach Kolumbus, schien diese Erwartung eine Zeitlang eingelöst worden zu sein und Sprache und Bildwelt, die einst mit den Inseln der Seligen verbunden waren, wurden auf den neu entdeckten Kontinent übertragen. Das gelobte Land war gefunden, wie es schien, und es trug den Namen Amerika.
NACH IHREM TOD wurden die Körper der Bewohner der in der Torres-Straße gelegenen Insel Mabuiag im Freien auf ein Podest gelegt. Klanmitglieder des Ehepartners des Verstorbenen wachten über sie, um sicherzustellen, dass der Geist (mari) den Körper auch tatsächlich verlassen hatte. Außerdem schützten sie ihn vor den hungrigen Mäulern von Echsen.
Nach fünf bis sechs Tagen wurde der Kopf in ein Termitennest gelegt oder in Wasser, um das Fleisch abzulösen. Der Rest des Leichnams blieb in Gras gehüllt auf dem Podest, bis nur noch Knochen übrig waren.
Einmal gesäubert, wurde der Schädel rot gefärbt und, mit Federn und Haaren geschmückt, in einen Korb gelegt. Die angeheirateten Verwandten des Verstorbenen, welche für diese Rituale verantwortlich waren, vollführten dann ein ausgefeiltes Zeremoniell vor der Familie des Verstorbenen. Dazu bemalten sie sich schwarz und bedeckten ihre Häupter mit Blättern, bevor sie den Schädel dem am nächsten stehenden Verwandten übergaben. Ein Trostgesang für die Trauernden wurde angestimmt:
Wenn der Wind aus Norden kommt, ist der Himmel wolkenschwarz und es gibt viel Wind und strömenden Regen, aber es dauert nicht lange und die Wolken lösen sich auf und wieder ist schönes Wetter.
Andere Inseln der westlichen Torres-Straße hatten Rituale, die sich leicht davon unterschieden. Mancherorts wurde der Körper in einem flachen Grab beigelegt oder mumifiziert, anderswo der Schädel mit Bienenwachs und Muscheln geschmückt. Auf einer Insel – Muralug – wurde von der Witwe erwartet, dass sie den Schädel ihres Ehemanns ein Jahr lang in einer Tasche bei sich trug, während andere Familienmitglieder seine Knochen als Schmuck tragen durften.
Doch ein Element hatten sie alle gemein: den Glauben an eine Insel der Geister. Diese Insel namens Kibu lag jenseits des nordwestlichen Horizonts, und sobald sie dem Körper entschlüpft war, wurde die mari von den vorherrschenden Südostwinden dorthin getragen. Bei ihrer Ankunft wurde die Seele vom Geist eines Bekannten empfangen – normalerweise dem zuletzt verstorbenen Freund –, welcher sie bis zum nächsten Neumond verbarg. Dann kam sie wieder zum Vorschein und wurde den anderen Geistern vorgestellt, von denen ein jeder sie mit einer Steinkeule auf den Kopf schlug. Diese scheinbar nicht sehr freundliche Aufnahme war im Kern ein Initiationsritus und von da an war der mari ein markai: ein richtiger Geist.
Manche glaubten, die markai würden ihre Zeit weinend in Baumwipfeln zubringen, vielleicht in Gestalt von Fledermäusen. Aber die meisten stimmten darin überein, dass sich das Leben im Jenseits nicht so sehr von dem im Diesseits unterschied und die Geister ihre menschliche Gestalt behielten. Untertags würden sie mit Speeren nach Fischen jagen und am frühen Abend womöglich am Strand tanzen. Sie konnten auch Schildkröten und Dugongs (eine mit dem Manati verwandte Seekuhart) fangen, indem sie Wasserhosen produzierten, in deren Sog die Tiere gerieten.