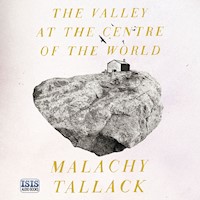12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das neue Buch des gefeierten schottischen Autors Malachy Tallack (»Das Tal in der Mitte der Welt«)
In »Die Kraft von Wasser« erzählt Malachy Tallack vom Reiz des Angelns: Von der beruhigenden Wirkung des Wassers, der meditativen Betrachtung von Natur und Landschaft, den intensiv empfundenen Freuden und kleinen Frustrationen. Er schreibt über Angelausflüge an die berühmten Lochs seiner schottischen Heimat, an die unzähligen Kanäle der britischen Inseln, an Wasserfälle in Neuseeland und die großen Seen Kanadas. Tallack reflektiert dabei über die kulturelle Bedeutung des Angelns und den damit einhergehenden moralischen Fragen bis hin zu den Feinheiten des Fliegenfischens.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 329
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Zum Buch
In »Die Kraft von Wasser« erzählt Malachy Tallack vom Reiz des Angelns: Von der beruhigenden Wirkung des Wassers, der meditativen Betrachtung von Natur und Landschaft, den intensiv empfundenen Freuden und kleinen Frustrationen. Er schreibt über Angelausflüge an die berühmten Lochs seiner schottischen Heimat, an die unzähligen Kanäle der Britischen Inseln, an Wasserfälle in Neuseeland und die großen Seen Kanadas. Tallack reflektiert dabei über die kulturelle Bedeutung des Angelns und die damit einhergehenden moralischen Fragen bis hin zu den Feinheiten des Fliegenfischens.
Zum Autor
Malachy Tallack ist der preisgekrönte Autor von drei Büchern. Sein erstes, 60 °Nord, war ein BBC Radio Book of the Week und auf der Shortlist für den Saltire Book Award. Sein zweites, Von Inseln, die keiner je fand, war ein Stanford Travel Writing Awards’ Illustrated Book of the Year, während sein Debütroman Das Tal in der Mitte der Welt auf der Shortlist für den Highland Book Prize und auf der Longlist für den Royal Society of Literature Ondaatje Prize stand. 2001 erhielt er vom Scottish Book Trust den New Writers Award und 2015 das Louis-Stevenson-Stipendium. Als Singer-Songwriter hat er drei Alben und eine EP veröffentlicht. Malachy wuchs auf den Shetland Islands auf und lebt aktuell in Zentralschottland.
Malachy Tallack
Die Kraft von Wasser
Eine Liebeserklärung an tiefe Seen, sprudelnde Bäche und das Fischen
Aus dem Englischenvon Klaus Berr
Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel
»Illuminated By Water« im Verlag Transworld Publishers Ltd., London
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Autor und Verlag danken der University of Chicago Press für die Erlaubnis, aus A River Runs Through It von Norman Maclean zu zitieren, © 1976 by the University of Chicago
Deutsche Erstausgabe Dezember 2024
Copyright © 2024 btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Copyright © der Originalausgabe 2022 by Malachy Tallack
Dieses Werk wurde vermittelt durch die
Literarische Agentur Kossack, Hamburg.
Covergestaltung: Semper Smile, München, nach einem Entwurf
von Marianne Issa El Khoury/TW
Covermotiv: © Chris Wormell
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
JT · Herstellung: han
ISBN 978-3-641-29672-8V001
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/penguinbuecher
Einführung
Von der gedrungenen Betonbrücke aus, über die der samstägliche Verkehr brauste, nahmen wir den Treidelweg entlang des Forth and Clyde Canal. Es war mitten am Vormittag, Mitte November, und die Luft war kühl und feucht. Ich nahm an, dass wir Regen bekommen würden, bevor unsere Wanderung zu Ende war. Die Wolken sahen danach aus. Dunkel an den Rändern. Wie Augen, die Schlaf brauchen.
Hinter einem geschäftigen Hafen voller Jachten und Kanalboote, einige von ihnen bewohnt, andere für den Winter mit Planen abgedeckt, wurde es stiller. Ein paar Jogger waren unterwegs, Leute, die ihre Hunde ausführten, und ein oder zwei Radfahrer, doch ansonsten waren wir so gut wie allein. Schulter an Schulter marschierten wir auf dem schmalen Pfad, Roxani, meine Partnerin, auf der Seite mit den Bäumen und der grasbewachsenen Uferböschung, und ich auf der Wasserseite.
Im Allgemeinen mag ich Kanäle. Ich mag die Art, wie sie weder das eine noch das andere so richtig sind. Von der Form her sehen sie aus wie Flüsse, doch im Wesen und als Lebensraum sind sie Seen, die sich über die Landschaft erstrecken. Nur wenige Dinge, die wir Menschen für unsere Bequemlichkeit bauen, sind der Natur von Nutzen. Aber Kanäle, sofern sie gepflegt sind, bilden da eine Ausnahme. Insekten, Amphibien, Fische, Vögel und Säugetiere, siedeln sich im und am Wasser an. Früher förderten Kanäle die industrielle Wirtschaft des Landes. Jetzt fördern sie andere Lebensformen.
Dieser hier verbindet, wie der Name schon sagt, den Firth of Forth im Osten mit den Firth of Clyde im Westen und durchschneidet Schottland damit an seiner schmalsten Stelle. Mit seinen fünfunddreißig Meilen Länge wurde er 1790 eröffnet und führt Meer mit Meer und Stadt mit Stadt zusammen. Glasgow liegt an einem Ende, Falkirk am anderen, und bis 1933 bot der Union Canal mittels einer Reihe von Schleusen noch eine weitere Verbindung zu Edinburgh. Heute übernimmt diese Aufgabe das weltberühmte Falkirk Wheel, allerdings sehr viel dramatischer.
Am Wasserrand bietet dichter Bewuchs aus Rohrkolben und Schilf Vögeln Schutz. Nicht viele waren es an diesem Tag, nur einige Stockentenpärchen, die im Seichten dümpelten, und ein grau gesprenkelter junger Schwan, der um Brot bettelte. Auf dem gegenüberliegenden Ufer staksten Sumpfhühner, die immer wieder in der Vegetation verschwanden und sich gereizt mit blechernem Schreien und Pfeifen meldeten.
Wie viele der Wanderungen, die Roxani und ich unternehmen, war auch diese eine Ausrede, um am Wasser sein zu können, und diese Nähe war eine Ausrede dafür, das Leben darin zu suchen und zu bestaunen. Fast alles entlang des Kanals leitet den Blick in die Gegenrichtung. Die Bäume deuteten nach oben, wie auch die Stängel der Binsen und vertrockneter Engelwurzen. Da waren die Schwärme der Wacholderdrosseln, die wie in Böen umherflogen; da war der junge Bussard, der in die eine Richtung flatterte, und das Sperberweibchen, das in die andere segelte. Sogar das Wasser schaute von sich weg, die stille Oberfläche spiegelte die nackten Äste am anderen Ufer und den fahlen Himmel darüber.
Hinter einer zweiten Brücke warf ein Mann, der zwei Ruten am Ufer stehen hatte, die Leinen bereits im Wasser, eine dritte aus, als wir an ihm vorbeigingen. Daran befestigt war ein klobiger weißer Schwimmer, und darunter hing ein Fisch. Silbrig und fingerlang, wahrscheinlich schon lange tot. In diesem Kanal gab es Hechte, gierige Räuber, immer auf der Suche nach einer einfachen Mahlzeit – für so einen wäre dies der perfekte Köder. Der Mann schnippte die Rute leicht über die Schulter, und Fisch und Schwimmer landeten mit einem Platschen.
Ein Stückchen weiter kamen wir an einem zweiten Angler vorbei, der eben aufbaute. Er war in Begleitung einer jungen Frau, die am Wasserrand nach vorne gebeugt auf einem Segeltuchstuhl saß und auf ihr Handy starrte. Er fädelte unterdessen gemächlich die Schnur durch die Ringe seiner Rute, einen Karton mit Maden offen vor seinen Füßen und einen Joint zwischen den zusammengebissenen Zähnen. Er grinste uns zu, und der süßliche Geruch von Marihuana waberte über den Treidelpfad.
Ich hatte recherchiert, bevor wir hierherkamen. Ich wollte wissen, welche Fischarten in dem Kanal lebten, auch wenn ich nicht fischen würde. Ich wollte es mir vorstellen können, wollte aufs Wasser schauen und spekulieren. Tatsächlich wäre ich sehr gerne stehen geblieben, um einem der Angler zuzuschauen, einfach nur dastehen und eine Stunde oder zwei warten, um zu sehen, was sie fingen; aber ich befürchte, keiner der beiden (und wahrscheinlich auch Roxani nicht) wäre damit einverstanden gewesen. Unterwegs suchte ich jedoch nach Hinweisen, nach Lebenszeichen unter der Wasseroberfläche. Ein einzelnes, unauffälliges Steigen: die konzentrischen Kräuselungen, die erscheinen, wenn ein Fisch sich Nahrung – meistens ein Insekt – von der Oberfläche pickt. Ein Halsband aus Bläschen, gerülpst von einer Schleie oder einer Brasse. Ein Zittern im Schilf, das eigentlich alles sein könnte. Jeder Hinweis, jedes Detail brachte eine kurzfristige Erregung, einen Kick, der mich wie ein Reiher ins Trübe starren ließ.
Dieses Drängende des fast Gesehenen packt mich immer, wenn ich am Wasser bin. Es ist wie das Nachglühen einer Sternschnuppe, wenn die Augen an der Dunkelheit kleben auf der Suche nach einer anderen, oder wie die letzten Augenblicke des Wartens auf eine lange verzögerte Nachricht. Es ist Warten, Zweifeln, Sehnen.
Der Reiz des Angelns wird manchmal wegerklärt als Jagdinstinkt, als wäre so etwas, wenn es tatsächlich existiert, eine einfache Sache. Aber ich bin nicht überzeugt. Für mich ist der Wunsch, einen Fisch zu fangen, das genaue Gegenteil von einfach, und an seiner Wurzel steht absolut nicht die Gier, zu töten oder Beute zu machen. Wenn ich gezwungen bin zu reduzieren, würde ich auf einen ganz anderen Instinkt verweisen: eine intensive, konzentrierte Neugier. Was ich neben dem Wasser fühle, ist der Drang, das Versteckte zu entdecken, der Drang, zu betrachten und in Händen zu halten, worauf man sonst nur einen flüchtigen Blick erhascht, oder was überhaupt nicht zu sehen ist. Es ist die Sehnsucht, durch diese spiegelnde Oberfläche zu schauen und sicher zu wissen, was dort unten ist. Diese Sehnsucht kann ein Leben verändern. Sie kann jedes Gewässer in einen Ort des Staunens verwandeln.
Zwischen einer und zwei Millionen Menschen gehen im Vereinigten Königreich jedes Jahr zum Angeln, und in den Vereinigten Staaten sind die Zahlen noch viel höher: nach Angaben des US Fish and Wildlife Service etwa fünfunddreißig Millionen Angler jährlich. Das ist ein bedeutsamer Teil der Bevölkerung dieser beiden Länder, für den die Verlockungen des Wassers zumindest gelegentlich unwiderstehlich sind. Einige dieser Leute sind natürlich nur Einmal-Angler, mitgeschleift von einem begeisterten Elternteil oder Partner. Doch für viele von ihnen ist Angeln etwas wirklich sehr Wichtiges.
Ich bin Angler, und das seit früher Jugend. Wenige andere Bezeichnungen passen so hervorragend auf mich. Nur wenige treffen wie diese ohne Einschränkungen zu. Angeln steckt tief in meinen Erinnerungen, meinen Tagträumen, meinen Ambitionen. Es hat geformt, wie ich die Welt betrachte und registriere, und was ich über meinen Platz in ihr denke. Es ist der Kindheitsspleen, der nicht nachgelassen hat, die Leidenschaft der Jugend, die mich nie richtig losgelassen hat. Während fast alles andere sich verändert hat in den Jahren, seit ich das erste Mal zum Angeln ging, kann ich noch immer diesen Ruf des Abenteuers spüren, der mich anzog und fesselte, vor mehr als drei Jahrzehnten. Das Angeln – und das Nachdenken übers Angeln – war eine kostbare Konstante in meinem Leben, auch zu Zeiten, in denen ich viel weniger angelte, als ich eigentlich wollte. Als würde man sich die Songs wieder anhören, die man als Teenager liebte, fühlt jede Rückkehr ans Wasser sich an wie eine Rückkehr zu mir selbst.
Der Dichter und Romanautor Jim Harrison schrieb einmal, Angeln sei die Tätigkeit, die ihm seine geistige Gesundheit garantiere, und ich weiß ziemlich gut, was er damit meinte. Angeln hat auf mich beruhigende Wirkung, nicht nur, wenn ich irgendwo bin und auswerfe oder fange, sondern auch zu anderen Zeiten, wenn ich mich daran erinnere oder es mir vorstelle. Es bietet eine Verbindung zu einem Ort, die sich intimer und facettenreicher als die meisten anfühlt, und ein Einlassen auf die natürliche Welt, das komplex und zwingend ist. Es ist mit Sicherheit eine Investition von Aufmerksamkeit, aber auch eine Beteilung am Leben – und manchmal am Tod – der Kreaturen, auf die es der Angler abgesehen hat.
Wie alle Hobbys ist Angeln sowohl Zeitverschwendung und zugleich eine Möglichkeit, diese Zeit mit Sinn zu füllen. Die Fliegenfischerin und Autorin Ailm Travler hat geschrieben, das Angeln Torheit sei: nutzlos, unvernünftig, irrational und ohne Ziel. Aber sie meint das nicht als Kritik. Denn wie viele von den großen Freuden des Lebens sind ebenfalls nutzlos? Wie Travler schreibt, ist Angeln genau deshalb Torheit, weil es das Überleben schwieriger macht, als es bereits ist, und indem es das tut, macht es aus dem Überleben eine Kunst. Es ist nicht nötig, sich bei diesem Wort, Kunst, ganz sicher zu sein, um zu verstehen, was sie meint: Dass Angeln seinen eigenen Sinn erschafft, seine eigene Bedeutung. Travler schließt, dass es sinnstiftend über das Denken hinaus ist – die Wasserringe nach dem Steigen eines Fisches.
Dieses Buch ist ein Versuch, einigen dieser Dinge nachzuspüren, ihnen nach draußen zu folgen, um zu sehen, wohin sie gehen. Es ist ein Versuch, etwas von diesem Sinn und dieser Bedeutung zu begreifen. Es ist ein Buch übers Angeln, aber es ist auch über Flüsse, Seen und Kanäle, und über die Dinge, die in und an ihnen leben. Es ist über Schönheit, über Hoffnung und darüber, wie Freiheit gesucht und manchmal gefunden wird. Es ist ein Buch nicht nur für diejenigen, die bereits angeln und deshalb verstehen, was es heißt, eine Leine auszuwerfen, sondern für diejenigen, die neugierig sind und mehr erfahren wollen über die Orte, an die das Angeln einen führt.
Es gibt eine schon lange bestehende Beziehung zwischen Angeln und Schreiben, und das Endprodukt dieser Beziehung sind die zahllosen Bücher, die zu dem Thema veröffentlicht wurden und weiter veröffentlicht werden. Nur sehr wenige Steckenpferde haben im Lauf der Jahrhunderte so viele Wörter erzeugt. Das berühmteste dieser Bücher ist ohne Frage Izaak Waltons Der vollkommene Angler, das 1653 erstveröffentlicht wurde und das angeblich nach der Bibel und dem Book of Common Prayer das am meisten nachgedruckte Buch in englischer Sprache ist. (Den Beweis für diese oft wiederholte Behauptung muss ich aber erst noch sehen.)
Waltons Abhandlung wurde geschrieben in den Nachwehen des Englischen Bürgerkriegs, in dem er, als Anglikaner und Royalist, auf der Verliererseite stand. Es war eine gewalttätige, turbulente Zeit, und Walton hatte sein Leben riskiert, weil er nach er Schlacht von Worcester im Jahr 1651 eine der Kronjuwelen nach London schmuggelte. Doch in seinem Buch wandte er sich ab vom Chaos der Welt und widmete sich dem Frieden und der Freude, die er am Wasser fand. »Kein Leben, mein redlicher Schüler«, schrieb er, »kein Leben so glücklich und so angenehm wie das Leben eines gut angeleiteten Anglers.«
Walton glaubte, Angeln sei eine tugendhafte Tätigkeit – die ehrlichste, aufrichtigste, stillste und harmloseste Kunst – und befördere daher die Tugendhaftigkeit der Ausübenden. Kein Wunder, argumentierte er, dass Jesus vier Fischer zu seinen Jüngern erwählte, denn es waren Männer von sanftem, gnädigem und friedfertigem Geist. Und tatsächlich lautet der endgültige Schluss der vielen (und gelegentlich etwas ermüdenden) philosophischen und theologischen Abschweifungen des Buchs, dass Ehrfurcht vor dem Fisch gleich nach der Gottesfurcht kommt. Oder so in der Richtung. Und der Ursprung der Tugendhaftigkeit des Angelns, wie Walton es sah? Es ist eine Tätigkeit, die das Nachdenken fördert und die tatsächliche das ideale Gleichgewicht zwischen Körper und Geist liefert.
Ich weiß nicht so recht, ob das Angeln einen besseren Menschen aus mir gemacht hat, ob es meine Moral auf eine bedeutsame Art erhöht hat. Ich würde das natürlich gerne glauben, aber ich fürchte, Walton hat sich geirrt. Vielleicht sogar verrannt. Seine Bemühungen, den Sport zu rechtfertigen, haben eine eindeutige Tendenz zur Verteidigung und auch zur Scheinheiligkeit, auch wenn sie abgemildert sind durch die fröhliche Bescheidenheit, die sein Markenzeichen war. Walton war ein Mann, der, nachdem er eben einen Krieg verloren hatte, unbedingt eine Diskussion gewinnen wollte. Oder sich zumindest selbst überzeugen wollte, dass Gott auf seiner Seite stand.
Was das Nachdenken angeht, hat er sich jedoch nicht geirrt. Wie jeder Angler weiß, passiert mit dem Geist etwas, wenn der Körper mit Angeln beschäftigt ist, eine merkwürdige Verbindung von Konzentration und frei schweifendem Geist, die der Achtsamkeit nicht ganz unähnlich ist, wie ich mir vorstellen kann. Die Gedanken wandern, und man holt sie zurück. Jeder Augenblich gewinnt seine eigene Art innerer Ausdehnung.
Der kontemplative Aspekt des Angelns ist, wie ich annehme, der Hauptgrund, warum diese Tätigkeit so viele Bücher inspiriert hat. Beim Angeln hat man viel Zeit zum Nachdenken. Viel Zeit, um sich zu fragen, was um alles in der Welt man da eigentlich tut, um sowohl über das Lächerliche wie das Erhabene nachzudenken. Die tiefe Konzentration ist auch förderlich. Sie bietet sich direkt und ganz pragmatisch zum Schreiben an. Der Dichter Ted Hughes hat einmal gesagt, dass er die Fähigkeiten, die nötig sind, um die Gedanken auf ein Gedicht zu konzentrieren, nicht in der Schule gelernt habe. Stattdessen habe er sie beim Angeln gelernt, den Blick auf den Schwimmer gerichtet, die Gedanken diese helle Schnur umkreisend, diese zitternde Fliege, an der sich das Reale und das Imaginäre treffen.
Zeit, Konzentration, Neugier: Das sind die wesentlichen Bestandteile sowohl des Angelns wie des Schreibens. Und auch des Lesens.
Bücher übers Angeln drehen sich meistens um eine von zwei Fragen: Wie oder Warum. Sie liefern praktische Ratschläge oder raffinierte Selbstrechtfertigungen. Auch diejenigen, die reine Angelgeschichten sind, berichten darüber, was wo gefangen wurde, sind eigentlich Geschichten über Motivation. Nur einige wenige – und Der vollkommene Angler gehört dazu – haben etwas über beides zu sagen, aber meistens halten die Autoren diese Fragerichtungen getrennt.
Dieses Buch passt bequem in letztere Kategorie. Auch wenn sie nicht permanent direkt gestellt wird, steht diese Frage, Warum, hinter allem darin. Warum bringt diese Aktivität so vielen Leuten so viel Freude, so viel Faszination? Warum suche ich mir aus den unendlichen Möglichkeiten der Zeitverschwendung gerade diese aus? Warum kann das Angeln die Welt für mich größer, reicher und komplexer machen?
Ich habe anfangs geschrieben, dass meine Identität als Angler keine Einschränkungen braucht, das heißt aber nicht, dass keine Einschränkungen gemacht werden können. Zum einen bin ich vorwiegend Fliegenfischer, und ich werfe häufiger nach Bachforellen aus als nach anderen Arten. Außerdem bin ich unbestreitbar ein Angler mäßigen Talents. Ich angle nun schon lange Zeit, und ich bin kompetent in einer begrenzten Anzahl von Umständen, doch darüber hinaus verfalle ich schnell, und manchmal nicht ungern, in Untauglichkeit.
Ich habe mich deshalb entschieden, Warum anstelle von Wie zu fragen, zum Teil weil es notwendig war, denn es ist die einzige Frage, die zu beantworten ich wenigstens einigermaßen in der Lage bin. Das wenige, was ich an praktischen Ratschlägen zu bieten habe, lohnt des Niederschreibens nicht und dürfte wahrscheinlich ignoriert werden. Aber Warum ist auch die Frage, die mir selbst am wichtigsten ist, diejenige, zu der ich immer und immer wieder zurückkehre.
Ich habe dieses Buch aus zwei einfachen Gründen geschrieben. Erstens interessiert mich das Angeln. Es beschäftigt, fasziniert und verwirrt mich. Wenn mein Geist nicht anderweitig beschäftigt ist, wandert er meistens zum Wasser, und normalerweise gestehe ich ihm das gerne zu. Diese Bewegung, zum Wasser und von ihm weg, ist einer der grundlegenden Rhythmen meiner Tage, und sie hallt in diesen Seiten wider. Dieses Buch springt willkürlich zwischen Orten und Zeiten hin und her, von meiner Kindheit zur Gegenwart; doch das Organisationsprinzip ist dieser Rhythmus. Die Kapitel beschäftigen sich abwechselnd mit einem Ort oder einer Idee beziehungsweise einem Objekt. Es ist eine Art Auswerfen und Einholen, wenn Sie so wollen, vor und zurück, von der Aktion zur Kontemplation.
Mein zweiter Grund für das Schreiben wurde sehr prägnant von dem Romancier und Angelautor W. D. Wetherell formuliert. Ich schreibe übers Fischen, erklärte er in One River More, weil ich gerne über Freude schreibe. Ich begann dieses Buch im Sommer 2020, sechs Monate nach Beginn der Covid-19-Pandemie, einer Zeit, in der Freude nur schwer zu bekommen und deshalb ersehnter denn je schien. Beim Schreiben wandte ich mich einem Thema zu, das die beständigste Quelle der Freude und des Trostes in meinem Leben ist, und plötzlich fragte ich mich: Warum?
Scaland Wood
East Sussex, 1989
Alle Angler haben Ursprungsgeschichten, über einen Ort und eine Zeit, die den Grundstein für ihr Interesse, ihre Obsession weckten. Einige sind öde wegen ihrer Unausweichlichkeit: die bekannte Geschichte eines Hobbys, das von einem Elternteil an ein Kind weitergegeben wurde. Aber die besten Geschichten sind völlig unwahrscheinlich; Ereignisse, die eigentlich gar nicht hätten passieren dürfen. Diese Geschichten beharren auf der bizarren Vorstellung, dass, wäre es anders gelaufen, wäre dieser spezielle, zufällige Augenblick nie gekommen, ein ganzes Leben hätte anders sein können.
Dass diese Geschichten so verbreitet sind und sie so viel Gewicht haben, liegt daran, dass Angeln nicht ist wie Fußball; es ist kein Teil der alltäglichen Hintergrundgeräusche der Populärkultur. Es ist auch nicht wie Tennis oder Golf, mit allseits bekannten Wettbewerben, die viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und auch wenn es Ähnlichkeiten zwischen den beiden Steckenpferden gibt, ist Angeln auch nicht wie Vogelbeobachtung. Ob wir sie nun bewusst wahrnehmen oder nicht, sind Vögel ein Teil unseres Lebens (und das bewusste Wahrnehmen ist der erste Schritt zum Vogelbeobachter). Im Gegensatz dazu bleiben die Objekte der Begierde von Anglern meistens unsichtbar. Um sich einen Fisch richtig anzusehen, muss man ihn in die Hand nehmen. Daraus ergibt sich ein gewisses Paradox: Um vom Angeln verzaubert zu werden, muss man angeln gehen.
Was normalerweise bedeutet, dass jemand einen mitnehmen muss.
Viel weiß ich nicht mehr über den Mann, der alles ins Rollen brachte, diese jahrzehntealte Fixierung. Man nannte ihn Paddy, da bin ich mir ganz sicher. Aber ich bin mir ähnlich sicher, dass das nicht sein richtiger Name war. Er war ein Mann aus Nordirland, der Ende der Achtziger in England lebte, und damals nannten die Leute ihn einfach Paddy.
Ich erinnere mich, dass er einen Schnurrbart hatte und Pfeife rauchte. Wenigstens sehe ich ihn jetzt so, und ich hoffe, diese Erinnerung ist korrekt. Er war ein Bekannter meiner Eltern, aber keiner, den sie gut kannten. Es ist möglich, dass meine Mutter ihn kennenlernte, weil sie der einzige andere Mensch aus Nordirland in der Stadt war. Sicher weiß ich aber noch, dass Paddy an dem Tag, als er uns – meinen Bruder Rory und mich, sieben und acht Jahre alt – zum Angeln mitnahm, so gut wie ein Fremder war, ein Mann, mit dem wir noch nie Zeit verbracht hatten. Ich habe mir vorzustellen versucht, wie es dazu kommen konnte, zu diesem unwahrscheinlichen Szenario, aber mir fällt nichts ein, was mich wirklich zufriedenstellt. Ich könnte natürlich meine Mutter fragen, wie es dazu kam. Aber manchmal ist es besser, den Nebel der eigenen Erinnerungen nicht mit der abgestandenen Luft von denen eines anderen Menschen zu kontaminieren.
Warum auch immer, jedenfalls holte Paddy uns an diesem Morgen ab und fuhr mit uns durch Jarvis Brook, ein Dorf am Rand von Crowborough in East Sussex, wo er wohnte. Wir erreichten Scaland Wood und suchten uns eine Stelle an einem kleinen See, dessen Ufer dicht von Bäumen bestanden war. Es gab gerade genug Platz für Paddy auf seinem Klappsitz und Rory und mich links und rechts von ihm auf der Erde. Sonst war absolut niemand am See.
Ich sehe die Stelle vor mir, umrahmt von Ästen, und den Blick hinaus über lehmbraunes Wasser, mit einer Klarheit, die nach mehr als dreißig Jahren unvorstellbar erscheint. Was ich noch sehe, sind die Seerosenblätter links der Stelle, wo wir auswarfen, den schmalen Schwimmer mit der orangenen Spitze, unter dem unser Haken mit Köder hing, und die Fische, die wir fingen: silbrige Rotaugen mit hellroten Flossen und Karauschen, so goldbraun wie Nussbutter. Was für glitzernde, bezaubernde Dinger diese Fische waren, wenn sie an unserer Angel die trübe Oberfläche durchbrachen. Sogar ihre Namen schienen fast Magie zu besitzen: Crucian carp (auf dt.: Karausche, Anm. d.- Übers.) – was für ein erhabenes Wort.
Doch woran ich mich noch deutlicher erinnere, ist ein Gefühl, das ich zuvor noch nie erlebt hatte, ein Gefühl gespannter Erwartung, prickelnder Stille. Während ich diesen Schwimmer anstarrte, darauf wartete, dass er eintauchte und verschwand, hatte ich das Gefühl, dass gleich etwas Monumentales passieren würde. Zum ersten Mal schien ich zu begreifen, dass die Welt erstaunliche Geheimnisse in sich barg, und wenn ich meine Zeit darauf verwenden könnte, sie zu suchen, wäre ich glücklich. Dieses Wissen, diese Empfindung hat mich nie verlassen.
Wir beide, Rory und ich, waren ekstatisch, als wir nach Hause zurückkehrten, und von diesem Tag an war ich von einer glühenden Leidenschaft gepackt. Fruchtlose Versuche, unseren Erfolg zu wiederholen, mit Bambusstecken, gebogenen Nadeln und dünnen Schnüren, konnten uns nicht entmutigen, und deshalb nahm mein Onkel Joseph mich mit, um mir meine erste richtige Angelrute zu kaufen, in einem Antiquitätengeschäft in seiner Straße. Es war ein komisches Gebäude, drinnen immer dunkel, ganz egal wie hell der Tag auch war, und an der Rückseite gab es einen Innenhof, mit durchsichtigen Plastikplanen, die innen von außen trennten. Ich erinnere mich an Dreck auf den Böden und ein nahezu chaotisches Durcheinander. In einer düsteren Ecke am hinteren Ende des Ladens stand ein Fass mit einem halben Dutzend Ruten wüst durcheinander. Eine davon nahm ich mit nach Hause. Gefertigt aus schlammbraunem Fiberglas, war sie schwer und unhandlich – und ich hätte mich nicht mehr über sie freuen können.
Es ist merkwürdig, dass diese Sachen jetzt zu mir zurückkommen, dass ich eine so deutliche Erinnerung bewahrt habe an eine Zeit, die ansonsten so gut wie verschwunden ist. Normalerweise ist mein Gedächtnis nicht besonders gut. Eigentlich ist es eher ein Netz, das mehr durchlässt als zurückhält. Und doch erinnere ich mich ans Angeln. Ich erinnere mich an Seen, die ich seit fast dreißig Jahren nicht mehr gesehen habe. Ich erinnere mich an Nachmittage auf Booten und Stegen und felsige Küsten und Ufer unter Heidegestrüpp. Ich erinnere mich an unzählige Tage, an denen nichts Bemerkenswertes passierte, außer dass ich Fische suchte. Rückblickend ist mein Leben von Wasser erleuchtet.
Wenn ich angle, spüre ich eine Präsenz, die nicht vergleichbar ist mit anderen Präsenzen. Sogar wenn meine Gedanken schweifen, wie sie es gern tun, ruhe ich doch völlig in einem speziellen Augenblick und an einem speziellen Ort. Und an jedem Tag beim Angeln gibt es immer Zeiten – ein paar Minuten, eine Stunde, vielleicht mehr –, da sich alle Aufmerksamkeit in ihrem eigenen Augenblick in meinem Inneren konzentriert, wenn Gefühl und Gedanken genau dort und genau dann gehalten werden. Wenn das passiert, gibt es nichts anderes mehr.
Diese tiefe Achtsamkeit für Zeit und Ort, diese ungeteilte Präsenz, ist einer der Gründe, warum sogar ereignislose Tage einen so tiefen Eindruck hinterlassen können. Die Details, die sich in solchen Augenblicken ansammeln, geben ihnen eine Masse, die die reine Dramatik überstrahlt. Was sie haben, diese Erinnerungen, ist eine üppige Spezifität, verbunden mit einem Frieden, der tiefer ist als jeder, den wir in unserem Leben erfahren. Die Tage, die wir mit Angeln verbringen, wie Ted Leeson schreibt, sind kleine Stillen in der Unaufhörlichkeit unserer Zeit. Diese Stille und diese Spezifität dauern an.
Natürlich hilft auch die Leidenschaft. Und die Besessenheit. Das totale Vertieftsein, das Wiedererleben von Fängen und Verlusten. Das endlose Träumen. In diesen ersten sechs Jahren, nachdem ich mit Angeln angefangen hatte, war ich darauf fixiert. Ich richtete fast meine gesamte kindliche Inbrunst darauf. Ich las übers Angeln, redete übers Angeln, dachte übers Angeln nach, und sooft ich konnte, ging ich angeln.
Inzwischen ist es nicht mehr ganz so. Diese Inbrunst überlebt die Pubertät nicht. Sie schwächt sich ab – bei mir war das auf jeden Fall so. Die Besessenheit reduziert sich auf schlichten Enthusiasmus, mit gelegentlichen Rückfällen im Lauf der Jahre. Schätze, das passiert den meisten von uns. Kindliche Leidenschaft wird zusammengequetscht von der Unsicherheit der Teeanger-Jahre, dann noch weiter gequetscht von den verschiedenen Lasten des Erwachsenenlebens. Wenn wir Pech haben, wird sie völlig ausgelöscht.
Obwohl ich nie aufgehört habe zu angeln, spüre ich das Fehlen dieses zielstrebigen Eifers. Wie andere Dinge, die ich unterwegs verloren habe, ist er noch da, er wartet auf mich, wenn ich zurückschaue. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist das ein Teil dessen, was Angeln für mich bedeutet: ein Zurückschauen, ein Sehnen, ein Greifen nach Unerreichbarem. Es ist eine aktive, körperliche Nostalgie. Chris Yates hat gesagt, dass alle Angler noch Kinder sind, aber das ist eine Wunschvorstellung. Zutreffender müsste man sagen, dass Angeln ein Versuch ist, etwas neu zu entfachen, was in der Kindheit am hellsten gelodert hat. Es ist ein Versuch – ein vergeblicher natürlich, aber dennoch unwiderstehlich – zu dem Augenblick zurückzukehren, in dem ein Angler sich zum ersten Mal verzaubert sah, diesem Augenblick, in dem er zum ersten Mal überwältigt wurde vom Mysterium dessen, was unter der Wasseroberfläche liegt, und dem Wunsch, dieses Mysterium aufzudecken und sich ihm zu unterwerfen. Immer wenn man als Erwachsener auswirft, ist das ein Wurf rückwärts.
In meinem ganzen Leben habe ich versucht, etwas von dieser ersten Begegnung mit dem Wunder zurückzuholen, dieses überwältigende Gefühl der Erregung, der Entdeckung, der Möglichkeit, der Ehrfurcht. Immer wenn ich eine Angelrute zur Hand nehme, auch jetzt noch, versuche ich, zurückzukehren in den Scaland Wood, noch einmal den Kick zu erleben, der einen trifft, wenn man erkennt, dass der Welt eine so wundervolle Offenbarung entlockt werden kann.
Flüchtiges
Es gibt einen See, an den ich manchmal denke: eine lange, schmale Wasserfläche, eingezwängt zwischen Bergen, irgendwo im Norden von Vancouver Island. Ich war nur ein einziges Mal dort, mit vierzehn, als wir zum ersten Mal die kanadischen Verwandten meiner Mutter besuchten.
Der See lag hoch oben in den Hügeln, weit weg von der nächsten Stadt, und der einzige sichtbare Hinweis auf menschliche Behausung, an den ich mich erinnern kann, war ein Campingplatz an einem Ende, wo wir für ein paar Tage übernachteten, die drei Erwachsenen in einem Caravan, mein Bruder und ich in einem Zelt. Die Cousine meiner Mutter brachte ihre Katze mit. Einen Teil des Tages wanderte sie furchtsam zwischen den Bäumen umher, und den Rest der Zeit starrte sie aufs Wasser hinaus.
Die Kanadier waren gut ausgestattet für das Leben in der Wildnis (wie Kanadier das meistens sind). Zusätzlich zu Caravan und Zelt hatten sie all die Grillausrüstung, die man sich nur erhoffen konnte, und ein Ruderboot mit einem winzigen Außenbordmotor, sodass wir aufs Wasser hinauskonnten. Für meinen Bruder und mich war das Boot etwas Erstaunliches. Gas geben, spüren, wie die Luft unsere Gesichter peitscht, während wir über die Wellen schnellen – es konnte nichts Aufregenderes geben. Nicht einmal die kleinen orangenen Rettungswesten, die so eng saßen, dass es uns den Atem nahm, konnten unsere Freude trüben.
Wir hatten natürlich Angelruten auf diesem Ausflug dabei – eine für meinen Bruder und eine für mich, und es gab Forellen zu fangen. Jeden Abend kamen sie an die Oberfläche, und ihr Steigen durchstach die Stille. Doch sosehr wir es auch versuchten, wir konnten sie nicht fangen. Wir konnten sie nicht vom Boot aus fangen und auch nicht vom Ufer aus. Ich erinnere mich, wie wir eines Abends nebeneinanderstanden und in die Dämmerung auswarfen, und während unsere Fliegenleinen vor- und zurückzischten, flatterten Fledermäuse über das Wasser. Wir fürchteten, sie könnten unsere künstlichen Fliegen für echte halten, und wir überlegten uns, was wir tun würden, wenn wir tatsächlich eine an den Haken bekämen. Aber wir hätten uns keine Sorgen machen müssen. Die Fledermäuse waren nicht anfälliger für unsere Bemühung als die Forellen. Zu der Zeit lernten wir beide noch Fliegenfischen, und unsere Technik ließ viel zu wünschen übrig. Wir hatten ein paar Ideen, wie wir diese Fische überlisten könnten, aber keine davon funktionierte.
Doch es machte nichts. Rein gar nichts. Wir hätten nicht glücklicher sein können. Und dieses Glück kam nicht nur von den Freiheiten, die uns hier gewährt wurden, sondern auch von dem Ort selbst, der sicherlich der schönste See war, den ich je gesehen hatte. Vielleicht ist er es immer noch, wenn ich mich entscheiden müsste.
Ich weiß nicht so recht, ob Schönheit etwas ist, worüber Kinder so viel nachdenken. Sie ist nicht wirklich ein Teil davon, wie sie die Welt beurteilen. Sie spüren natürlich den inneren Drang des Staunens, und sie entwickeln ein Sensorium für Hübschheit, das zumindest zum Teil beeinflusst ist von der Populärkultur – und vor allem vom Fernsehen. Aber das Gespür für Schönheit kommt langsamer. Es baut auf diesen beiden Wahrnehmungen auf und kombiniert sie mit etwas wie Geschmack, einer allmählichen Anhäufung von Reaktionen auf das jeweils Gesehene, die sich letztendlich zu Gewissheit verfestigt.
Ich kann mich nicht erinnern, vor diesem Ausflug je derart ergriffen gewesen zu sein von der Gewissheit, dass ein Ort schön ist. Aber damals ergriff sie mich, und zwar heftig. Warum? Na, wer weiß? Vielleicht war hier irgendein goldener Schnitt aus Berg, Himmel und Wasser im Spiel, eine Formel, die sogar mein jugendliches Auge erkennen konnte. Wahrscheinlicher jedoch sprach dieser See irgendetwas an, das bereits in mir war, eine Sehnsucht nach Wildheit und nach Landschaften, die ganz anders waren als alles, was ich bis dahin kannte. Dies und das Wissen, dass unser Aufenthalt nur kurz sein würde und wir diesen Ort vielleicht nur einmal in unserem Leben sehen würden, gab dem Ganzen eine ätherische Qualität, eine Perfektion, die nur den Dingen gewährt wird, die nicht von Dauer sein können. Doch während das Urteil nach außen gerichtet war – der See ist schön –, sagte der Gedanke in Wahrheit genauso viel über mich aus wie übers Wasser.
Diese Erfahrung, diese Gewissheit, hat mich geformt. Auf die eine oder die andere Art habe ich jeden Ort, den ich seitdem besucht habe, an diesem gemessen. Und auch wenn es keine klare Meinung war, die ich sofort artikulieren konnte, hat dieser Ausflug bei mir den merkwürdigen Gedanken hinterlassen, dass Schönheit etwas mit Angeln zu tun haben könnte, oder dass Angeln etwas mit Schönheit zu tun haben könnte. In all den Jahren, die seitdem vergangen sind, hat mich noch nichts vom Gegenteil überzeugt.
Kurz bevor wir unser Zelt wieder zusammenpackten, machte ich ein Foto. Genau das tut man, wenn man sich mit Perfektion konfrontiert sieht, man versucht, ein Stück davon mit nach Hause zu nehmen. Ich habe es immer noch: ein kleines, rechteckiges Bild, dessen untere Hälfte aus Wasser besteht. Darüber zwei kiefernbestandene Hänge, einer auf jeder Seite, wie die Zungen von Gletschern, die sich in der Mitte fast treffen. Dahinter der gezackte Umriss eines Berggipfels und ein Keil aus blau-weißem Himmel. Erst vor ein paar Tagen habe ich das Foto aus einem Karton gezogen und mich gefreut zu sehen, dass es ein wenig verblasst war, das ganze Bild verhüllt von diesem Schleier des Alters, der den Abstand zwischen damals und heute nur zu beweisen scheint.
Es gibt auch noch ein größeres Bild von diesem Wochenende, in Öl gemalt von der Cousine meiner Mutter. Die Ansicht auf dieser Leinwand ist fast identisch mit der auf dem Foto: der See, die Hügel, der Berg. Der Unterschied zwischen ihrem und meinem – vom Medium abgesehen – liegt in dem Boot, das sie aufs Wasser gemalt hat, und den beiden kleinen Jungen darin, beide in orangenen Rettungswesten. Im Vordergrund sitzt eine Katze und betrachtet die Szene.
Wie bei der Vogelbeobachtung, beim Wandern, beim Klettern kann der Reiz des Angelns nicht losgelöst werden von den Orten, wo das Angeln passiert. Für bestimmte Personen sind die Orte die schönsten, die Wasser enthalten, und das schönste Wasser eines, das Fische enthält. Auch wenn es nicht jeder Angler genau so formulieren würde – und einige auch schon bei dem Gedanken die Nase rümpfen –, ist doch die Jagd nach Fischen zumindest zum Teil eine Jagd nach Schönheit.
Das heißt natürlich nicht, dass Angeln nur eine Ausrede dafür ist, sich schöne Landschaft anzuschauen. Es ist keine feuchte Form des Sightseeings. Was Angeln eher bietet, ist ein Eintauchen in diese Landschaft, ein Umfasstwerden von einem Ort. Es bietet Schönheit nicht als etwas, das zu bewundern ist, wie ein Gemälde, oder in Ehrfurcht anzugaffen, wie ein romantischer, dunstverschleierter Ausblick, sondern als etwas, das zu bewohnen, kennen zu lernen, zu erfahren ist.
Ich kann die Bücher nicht mehr zählen, die ich gelesen habe, in denen der Autor seine Leser ernsthaft aufruft, sich mit der Natur »zu verbinden« oder sich auf einen Ort »einzulassen«, um ihrer geistigen Gesundheit willen oder der Umwelt zuliebe, oder beidem. Diese zwar wohlmeinenden Ermahnungen werden nur selten begleitet von einer grundsätzlichen Erklärung, wie diese Verbindung oder dieses Einlassen tatsächlich aussehen könnte, wie es sinnvoll umgesetzt werden kann. Reicht es, draußen zu sein? Sollte man auch die Namen von Vögeln und Käfern lernen? Falls ja, wie vieler Namen bedarf es? Ist es wirklich nötig, in eiskalte Bäche zu springen, um zu schwimmen?
Für mich wird das Einlassen handfest, wenn ich längere Zeit die Anwesenheit eines Ortes spüre. Ein Ort enthüllt sich nur allmählich. Das kann bei wiederholten Besuchen passieren, bei denen man ihn kennen lernt, wie man es bei einer Person tun würde. Aber vorhersehbarer entsteht es durch lange Zeitspannen beinahe stummer Nähe. Während Minuten und Stunden vergehen, wird meine Aufmerksamkeit von Dingen angezogen, die ich bis dahin noch nicht bemerkt hatte. Die Geschöpfe, die durch meine Ankunft gestört wurden, kehren vielleicht langsam zurück, akzeptieren meine Anwesenheit oder vergessen, dass ich da bin. Die Zeit bringt die Schichten eines Ortes ans Licht, enthüllt, was auf einen flüchtigen Blick nicht gesehen werden kann. Es ist größtenteils eine stille Offenbarung.
Ich erfahre dieses Einlassen am häufigsten, wenn ich angle. Aus keinem anderen Grund würde ich sechs oder sieben Stunden an einem Ort verbringen, ohne zu reden, ohne aufs Handy zu schauen, und den Ort einfach sein lassen; es ist deshalb keine Überraschung, dass ich in diesen Stunden mehr sehe, mehr höre und mehr bemerke als zu anderen Zeiten draußen. Es ist keine Überraschung, dass ich das Gefühl habe, der Ort und ich werden miteinander bekannt. Aber Angeln bietet mehr als nur eine Gelegenheit zum Einlassen. Es liefert auch eine tatsächliche Verbindung, eine direkte Leitung zur natürlichen Welt. Der Angler schaut nicht nur und lauscht, der Angler interagiert. Er lernt einen Ort durch jeden seiner Sinne kennen und kann, durch Berührung, das Unsichtbare wie das Sichtbare kennen lernen.
Das letztendliche Ziel des Angelns ist es, eine Verbindung einzugehen. Es ist, sich vom Leben eines Ortes umringen und absorbieren zu lassen. Es ist, die Hand auszustrecken und zu merken, dass etwas es ebenfalls tut. Wenn das passiert – wenn der Haken sein Ziel trifft und der Angler mit der Welt verbunden ist –, »wird man zum Fisch«, wie Tracy K. Smith es in ihrem Gedicht »Astral« formuliert hat. Sehnsucht mit Sehnsucht verbunden. Die ganze Beschäftigung gipfelt in diesem intensiven Augenblick der Verbindung, wenn ein Ort ein weiteres Stück seiner Schönheit preisgibt.
Der Ort, den ich am besten kenne, an dem ich die meiste Zeit meines Lebens verbracht habe, und auf jeden Fall die meiste Angelzeit, ist Shetland: der verstreute Archipel weit im Norden der Britischen Inseln. Als ich neun war, zogen wir aus dem Süden Englands dorthin – meine Mutter, mein Bruder und ich. Es war etwa ein Jahr nach unserem allerersten Angelausflug, aber ich hatte mich in der Zwischenzeit nicht sehr verbessert. In Wirklichkeit war ich immer noch ein völliger Anfänger.
Dieser Umzug hatte, was das Angeln anging, Vor- und Nachteile. Der Nachteil war, dass die Arten der Fische und des Angelns, die ich bisher kannte, hier nicht existierten. Auf den Inseln gibt es, abgesehen von Aalen, keine Grobfische, die im Gegensatz zu den Lachsfischen bzw. Edelfischen weniger begehrt in der Küche sind. Es gibt keine Karpfen, keine Schleien, keine Barsche. Das meiste dessen, was ich bis dahin gelernt hatte, war nutzlos. Doch die Problemlosigkeit des Fischens hier machte diesen Nachteil mehr als wett. Wir wohnten damals in Lerwick, nur eine oder zwei Gehminuten vom Hafen entfernt, und an der Küste gab es zahllose Stellen, wo man Meeresfische fangen konnte. Man musste auch nicht in Begleitung eines Erwachsenen sein, ich konnte alleine fischen, wenn ich wollte, oder mit meinem Bruder, wenn ich musste. Und was alles noch einfacher machte, war die Tatsache, dass es in Shetland viele Leute gab, die mir helfen konnten, wenn ich Hilfe brauchte. Einige meiner neuen Klassenkameraden angelten; der Untermieter, den wir in unserem ersten Jahr auf den Inseln hatten, angelte; unser direkter Nachbar angelte. War Angeln mir bis dahin als esoterische Aktivität erschienen, die Ausübenden eine mysteriöse Gemeinschaft, zu der ich Zutritt wollte, gab es hier Angler wie Sand am Meer. Auch wenn das Angeln nach Grobfischen auf die Sommerferien in England warten musste, wo mein Vater noch immer lebte, gab es für die Zwischenzeit keinen Mangel an anderen Optionen.
Am Anfang angelte ich vorwiegend im Meer. Es war der am einfachsten zugängliche Ort, und der nachsichtigste gegenüber meinen beschränkten Fähigkeiten. Ich musste nur meine Leine von der Mole ins Wasser werfen und warten. Wenn mich der Ehrgeiz packte, konnte ich metallene Blinker oder Fliegenköder auswerfen. Ich fing winzige Kohlfische (die wir in Shetland sillocks nannten), Flundern (die wir flukes nannten), Seeteufel (die wir plucker nannten) und gelegentlich Makrelen (die wir Makrelen nannten).