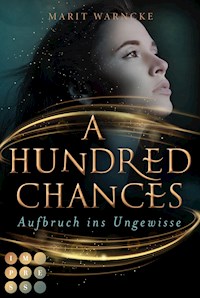
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
**Eine Liebe, die weiter ist als die Welt** Floras Leben ist alles andere als einfach. Seit sie und ihre Schwester Alice ihre Eltern verloren haben, müssen sie in der rauen Megacity allein für sich sorgen. Das bequeme Leben ist der Elite vorbehalten. Alles, was die Schwestern noch haben, ist einander. Doch plötzlich scheint sich eine Chance auf den direkten Weg nach oben zu bieten: als Freiwillige für ein Besiedlungsprogramm jenseits der ihnen bekannten Welt. Leider gibt es ein Problem. Je Familie ist nur eine Person zugelassen. Ohne zu zögern, überlässt Flora ihrer begabten Schwester den Platz und geht selbst unter falscher Identität an Bord. Nun muss sie vorgeben, ein Elite-Mitglied zu sein – und das auch noch vor dem faszinierenden Aaron. Doch selbst er scheint nur eine Rolle zu spielen ... Unendlich sehnsuchtsvoll und rasant Eine Reise ohne Wiederkehr, zwei Schwestern, die alles füreinander opfern würden, und eine Liebe, die bis zu den Sternen reicht. //»A Hundred Chances. Aufbruch in die Dunkelheit« ist ein in sich abgeschlossener Einzelband.//
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Impress
Die Macht der Gefühle
Impress ist ein Imprint des Carlsen Verlags und publiziert romantische und fantastische Romane für junge Erwachsene.
Wer nach Geschichten zum Mitverlieben in den beliebten Genres Romantasy, Coming-of-Age oder New Adult Romance sucht, ist bei uns genau richtig. Mit viel Gefühl, bittersüßer Stimmung und starken Heldinnen entführen wir unsere Leser*innen in die grenzenlosen Weiten fesselnder Buchwelten.
Tauch ab und lass die Realität weit hinter dir.
Jetzt anmelden!
Jetzt Fan werden!
Marit Warncke
A Hundred Chances. Aufbruch ins Ungewisse
**Eine Liebe, die weiter ist als die Welt**Floras Leben ist alles andere als einfach. Seit sie und ihre Schwester Alice ihre Eltern verloren haben, müssen sie in der rauen Megacity allein für sich sorgen. Das bequeme Leben ist der Elite vorbehalten. Alles, was die Schwestern noch haben, ist einander. Doch plötzlich scheint sich eine Chance auf den direkten Weg nach oben zu bieten: als Freiwillige für ein Besiedlungsprogramm jenseits der ihnen bekannten Welt. Leider gibt es ein Problem. Je Familie ist nur eine Person zugelassen. Ohne zu zögern, überlässt Flora ihrer begabten Schwester den Platz und geht selbst unter falscher Identität an Bord. Nun muss sie vorgeben, ein Elite-Mitglied zu sein – und das auch noch vor dem faszinierenden Aaron. Doch selbst er scheint nur eine Rolle zu spielen …
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Vita
Danksagung
Das könnte dir auch gefallen
© privat
Marit Warncke, geboren 1995 in Hamburg, liebt es, sich in kreative Projekte zu stürzen. Nach ihrem Abschluss in Modedesign gründete sie ihre Firma »Make Ma!«, eine Onlineplattform für Näh- und Stickbegeisterte mit großer YouTube Community. Nebenbei produziert sie Imagefilme für Unternehmen, illustriert und schreibt leidenschaftlich. Romane zu veröffentlichen war von Kindheit an ihr größter Traum.
EUROPA
2086
1
Ich drücke mich ganz dicht an die Barriere und lehne meinen Oberkörper weit über das Geländer. Unter mir erstreckt sich ein schwindelerregender Abgrund. Ganz kurz durchströmt mich kribbelnde Aufregung, ganz kurz fühle ich mich nicht mehr so taub. Für eine Sekunde huscht mir sogar ein Lächeln über die Lippen, doch gleich darauf hat es sich wieder verflüchtigt.
In der Tiefe schlängelt sich eine Hauptstraße zwischen den Hochhäusern hindurch. Zähes Hupen und Geschrei wehen zu mir herauf. Tausende Fenster blicken mir entgegen. Überall sind Brücken und Treppen. Straßen verlaufen in der Höhe und quetschen sich an den Hausfassaden vorbei. Die Stadt ist ein Wirrwarr aus unzähligen Ebenen. An einigen Hochhäusern sind Plattformen montiert, die halsbrecherisch in die Luft ragen. Über sie verlaufen noch mehr Schienen und Fußwege.
Ich weiß, dass ich hier oben nichts zu suchen habe. Dass ich eigentlich das Treppenhaus direkt neben der Schule hätte nehmen sollen und nicht diesen Abstecher über die Überführung. Aber wie jeden Tag konnte ich auch heute nicht widerstehen. Kein anderer Platz der Stadt erlaubt mir so einen Ausblick. Ich starre auf das unendliche Dickicht aus Betonklötzen und Brücken. In weiter Entfernung liegen die Fabrikhallen und Müllverbrennungsanlagen mit großen Schornsteinen, die ununterbrochen dunklen Rauch in die Luft pumpen. Rechts von ihnen verläuft der große Fluss am Grunde der Innenstadt. Angelaufener Plastikmüll treibt auf seiner Oberfläche, sodass nur noch wenig Wasser zu sehen ist. Die Suppe arbeitet sich langsam voran, auf ihrem weiten Weg zum Meer.
Menschen krabbeln ameisengleich über Gehwege, die sich auf unzähligen Zwischenebenen kreuzen. Es ist wie ein Spinnennetz aus Betonpfeilern und Straßen, ein dichtes Geflecht aus kilometerlangen Stahlbahnen. Der Horizont vermischt Himmel und Stadt, das Ende ist ein verschwommener, grauer Fleck.
Wie jeden Tag, wenn ich auf dieses unendliche Durcheinander schaue, frage ich mich, was wohl dahinter kommt. Ist es überall so wie in meiner Stadt? Oder gibt es einen Ort, an dem noch Luft zum Atmen ist?
»Kann man dir irgendwie helfen, Mädchen?«
Erschrocken zucke ich zusammen.
Wie aus dem Nichts ist eine Frau hinter mir aufgetaucht. Sie trägt ein schillerndes Perlenkostüm, dazu eine farblich passende Filtermaske über Mund und Nase. Angewidert mustert sie meine zerschlissene Kleidung.
»Also?« Die Frau zieht die Augenbrauen in die Höhe.
»Ich bin nur auf dem Weg zu meinem Block«, brumme ich. Meine Stimme ist ganz rau, ich habe den ganzen Tag noch kein Wort gesprochen.
»Für euch gibt es auch unten einen Weg«, zischt die Fremde.
»Aber der dauert viel länger.«
»Mag sein. Aber das ist ja nicht unser Problem.«
»Ich bin ja gleich wieder weg.« Langsam werde ich wütend. »Was ist denn so schlimm daran, wenn ich kurz hier oben entlang gehe?«
Die Frau lacht hysterisch.
»Was daran schlimm ist? Wenn einer damit anfängt, haben wir irgendwann das ganze Gesindel hier oben!« Aufgebracht fächert sie sich Luft zu.
Ich kneife die Augen zusammen.
»Schön. Ich mach’s nicht noch mal.«
»Fein.« Sie wirft mir einen letzten giftigen Blick zu und stelzt auf ihren ungesund hohen Absätzen über die Brücke. Ihr folgt der Duft eines künstlichen Parfums.
Mit gesenktem Kopf raffe auch ich mich auf und mache mich auf den Nachhauseweg. Ich sollte sowieso langsam gehen. Nicht, dass ich es besonders eilig hätte. Nein, genau genommen will ich gar nicht da sein, bevor Alice zurück ist.
Ich trotte über die gepflegte Fußgängerpassage. Unten gibt es keine einzige Straße, die nur annähernd so sauber ist. Mein Weg macht einen Knick. Links wird das Geländer von der Außenwand eines Hochhauses ersetzt. Ich komme an vielen abgeklebten Fenstern vorbei. Als diese Häuser noch jung waren, hätten sie sicher nicht erwartet, dass einmal ein Gehweg in solch einer Höhe an ihnen vorbei laufen würde.
Alle paar Meter ist ein großer Monitor an der Wand befestigt, der den Menschen hier oben verschiedene Produkte präsentiert, die das Leben bereichern sollen. Von teuren technischen Geräten über Frisur-Bauteile bis hin zu Dosenmenüs ist alles dabei. Ich erhasche eine besonders schrille Anzeige, die ein vitaminreiches Getränk präsentiert, gepresst aus einer eigentümlichen, gelben Frucht, die auf dem neuen Planeten Utopia-I entdeckt wurde. Der Preis für ein kleines Fläschchen ist mehr, als Alice in einer Woche verdient.
Mein Weg mündet an einem schmalen Gebäude mit zwei schmiedeeisernen Toren. Das rechte ist aufwendig gesichert, damit nur Anwohner Zutritt erhalten. Es bildet einen der Eingänge in den obersten, wohlhabenden Teil der Welt. Durch die Gitterstäbe kann ich einen Blick von diesem märchenhaften Ort erhaschen. Eine Straße läuft zwischen zwei Haustürmen hindurch. Sie ist mit glänzenden, schwarzen Laternen und eindrucksvollen Türen gesäumt, dazwischen bieten Schaufenster wunderschöne Dinge an. Kleider und Fächer oder seltene Lebensmittel, Kaffee und Süßigkeiten aus fernen Ländern. Die darüber thronenden Wohnhäuser recken sich unbekümmert in den Himmel. Hier beginnt das Quartier derer, die mit viel Glück gesegnet sind.
Ich wähle das linke Tor, einen Fahrstuhl, der mich bis zum Boden hinab fährt. Als ich in der großen Halle aussteige, schlägt mir sofort ein beißender Geruch entgegen. Ich schaudere. Hier unten gehöre ich hin.
Ich ziehe meine Baumwollmaske über Mund und Nase, doch der Geruch von Urin und Schimmel schiebt sich erbarmungslos darunter. Rechts neben dem Fahrstuhl liegen zwei verwahrloste Gestalten mit schmieriger Haut und fleckigen Hosen. Sie nehmen mich nicht wahr und vegetieren weiter vor sich hin. Um sie herum picken ein paar Tauben in den Ritzen des Bodens. Die bleichen LED-Röhren an der Decke rücken die Szene in viel zu scharfes Licht.
Schnell steuere ich den Ausgang der Fahrstuhlhalle an. Ich ziehe meinen Pullover über die Handfläche und drücke die Tür auf. Auch hier draußen ist die Luft verbraucht und steht zwischen den Betonklötzen.
Geistesabwesend schlendere ich das letzte Stück durch die dunklen Gassen. Die vielen Brücken und Plattformen in der Höhe nehmen dem Viertel hier unten fast jedes Tageslicht. Es ist kalt und trist und wird wahrscheinlich nie wieder die Sonne sehen.
Irgendwann finde mich vor unserem Hauseingang wieder. Demütig starre ich auf die morsche, rote Tür, die mich zu unserer Wohnung hinauf bringt. Mir wird übel. Ich wünschte, ich hätte mir noch mehr Zeit für den Rückweg gelassen.
***
Die Wohnungstür fällt ins Schloss. Mich begrüßt wie immer die Stille. Alice ist noch nicht da. Ich ziehe meine Atemmaske vom Gesicht und werfe sie auf die Kommode. Der Gummizug hat Striemen in meine Haut geschnürt. Geistesabwesend reibe ich über die wunden Stellen hinter meinen Ohren. In der Küche nehme ich mir ein Glas Wasser, um den sauren Smoggeschmack aus meinem Mund zu spülen. Doch auch das Leitungswasser stinkt abgestanden und schwefelig und so ist es keine wirkliche Verbesserung. Flüchtig denke ich an die Oberstadt, die immer sauberes Wasser hat.
Eine Weile tigere ich durch die Räume, fühle mich verloren. In unserem Zuhause fehlt alles, was es mal zu einem solchen gemacht hat.
Da ich nicht weiß, wohin mit mir, entscheide ich mich etwas zu kochen. Ich habe keinen besonders großen Hunger, tatsächlich fehlt mir schon seit Wochen der Appetit, aber ich muss meine Hände beschäftigen. Ich werfe unsere tägliche Kohlration in einen Topf mit Wasser und schalte den Herd an. Stumm betrachte ich die schäumende Oberfläche des Wassers und die in der Hitze tanzenden Bläschen.
Das metallische Ratschen eines Schlüssels im Schloss lässt mich auffahren. Sofort durchströmt mich Befreiung.
»Hallo!« Alice streckt ihren braunen Lockenkopf durch die Küchentür. Beim Klang ihrer melodischen Stimme scheint die ganze Wohnung aufzuatmen.
»Hey«, sage ich erleichtert.
Alice zieht ihren roten Mantel aus und legt ihn sorgfältig auf den Küchenstuhl.
»Das riecht ja köstlich«, sagt sie und gibt mir einen Kuss auf den Haarschopf. »Gibt es Kohlsuppe? Gerade eben habe ich noch gedacht, wie viel Appetit ich auf Kohl habe.«
Ich fange ihr Lächeln auf und gebe mein bestes zurück. Ich weiß, dass sie lügt und dass meine Kochkünste wirklich dürftig sind, aber die Worte meiner Schwester tun gut. Sie sagt immer genau das Richtige. Ich verkneife mir den Kommentar, dass wir beinahe jeden Tag Kohl essen.
Während ich uns auffülle, erzählt Alice von ihrem Tag. Sie strengt sich an munter und zufrieden zu klingen.
»Heute hat ein Kunde acht Cheeseburger verdrück! Kannst du dir das vorstellen? Acht Stück! Ich dachte, ich muss gleich den Notarzt rufen, weil er platzt.«
»Dass das geht«, sage ich.
Wir nehmen uns die Teller und schleichen hinüber zum Küchentisch. Auf dem roten Tischläufer liegen noch ein paar Krümel vom Frühstück.
»Und dein Tag?«, fragt Alice. »Waren die anderen nett?«
Sofort fühle ich ein Stechen in meiner Brust.
»Ja, alles okay«, brumme ich.
»Flora?« Alice sieht mich durchdringend an.
»Vielleicht haben sie ja recht«, murmle ich.
»Was meinst du?«
»Na, wahrscheinlich sollte ich meinen Platz auf der Oberschule wirklich aufgeben. Es ist doch eh viel zu teuer.«
»Jetzt fang nicht wieder damit an«, stöhnt Alice. »Ich hab’s dir schon hundert Mal gesagt: Papa wollte immer, dass wir beide einen Abschluss an einer guten Schule machen. Er meinte, nichts auf der Welt sei Geld mehr wert als Bildung.«
»Ich weiß«, sage ich. »Aber jetzt, wo er nicht mehr …« Ich bringe es nicht über mich weiterzusprechen.
»Flora.« Alices hellen Augen durchbohren mich. »Mach dir um das Geld keine Sorgen, okay? Natürlich werden wir nie ganz oben wohnen, nie richtig reich sein, aber Papa hat uns genug Geld hinterlassen, um noch ein paar Jahre gut damit hinzukommen.«
»Und dann?«, sage ich.
»Mit einem guten Abschluss kriegen wir eine gute Arbeit und dann können wir uns selbst finanzieren. Er hatte immer recht und Bildung ist das Wichtigste. Lass dir von niemandem einreden, dass du es nicht verdient hast, eine gute Schule zu besuchen, nur weil wir in der Unterstadt wohnen. Du bezahlst doch rechtmäßig, wie alle anderen auch. Wo ist das Problem!« Vor lauter Rage sind Alices Wangen ganz rosa. Kein Thema verärgert sie mehr als dieses.
»Okay«, gebe ich nach, auch wenn ich nicht überzeugt bin.
Früher bin ich gern zur Schule gegangen. Aber die täglichen bissigen Kommentare meiner Mitschüler und teilweise sogar Lehrer haben in den letzten Monaten so sehr zugenommen, dass ich selber nicht mehr weiß, wo ich hingehöre.
»Du machst bestimmt mal einen super Abschluss und dann irgendetwas Besonderes mit deinem Leben, das sage ich ja schon immer –«
Ein Klingeln unterbricht Alice. Es wiederholt sich ein zweites Mal und verstummt. Erschrocken richten wir beide uns auf. Es dauert einen Augenblick, das Geräusch zuzuordnen. Es kommt von Alices Tablet.
»Eine Nachricht«, sagt sie und ihre Stimme ist auf einmal ganz kehlig.
Sie zieht das Gerät zu sich heran, um das Postfach zu öffnen. Ihr Gesicht zeigt keine Regung.
»Eine Absage.«
»Das tut mir leid.« Ich flüstere, als würde es das irgendwie besser machen. »Irgendeine Universität nimmt dich sicher noch!«
»Nein«, sagt Alice. »Das war meine letzte Bewerbung. Die Unis sind einfach alle sehr … voll.«
Sie zieht ihre Mundwinkel nach oben. Sie will mir zeigen, dass sie schon klarkommt. Aber ich weiß, dass es nicht so ist. In ihren Augen beben Tränen.
Ich schlucke die Bemerkung herunter, dass ein guter Abschluss in unserer Welt anscheinend doch nichts nutzt.
Alice war immer eine der besten ihres Jahrgangs, hat die Schule mit Auszeichnung beendet und trotzdem will keine Universität sie haben. Die wenigen Plätze werden fast ausschließlich an Menschen aus der Oberstadt vergeben.
»Nächstes Jahr probierst du es wieder.« Was für ein blöder Satz; doch mir fällt nichts anderes ein. Es war schon immer ihr Traum, in die Medizin zu gehen, die unzähligen Ablehnungen zerreißen sie.
»Ja, genau. Kein Problem.« Alice nickt etwas zu heftig. »Nächstes Jahr.«
***
Einige Stunden später liege ich im Bett. Mir ist heiß und eng ums Herz. Ich wühle mich von einer auf die andere Seite. Hoffentlich nimmt mich der Schlaf bald in seinen Wattearm.
Plötzlich trägt sich in der Dunkelheit ein zartes Schluchzen zu mir herüber. Es dringt durch die Wand an meiner Kopfseite. Es ist ein Weinen, das nicht gehört werden will. Mein Herzschlag beschleunigt sich, einen Moment lang lausche ich angestrengt, hoffe mich verhört zu haben. Doch es ist unverkennbar und unter allen Schluchzern dieser Welt wüsste ich, wem es gehört. Ich krabble aus dem Bett und schleiche barfuß über meinen Teppichboden. Die Sommerhitze hat ihn aufgeheizt. In der Dunkelheit taste ich nach der Tür, ziehe sie, von einem leisen Quietschen begleitet, auf und husche ins Nebenzimmer.
Stumm schlüpfe ich zu Alice unter die Bettdecke. Ihr Gesicht ist warm und tränennass, genau wie ihr Pyjamaoberteil. Alles in mir zieht sich schmerzlich zusammen. Ich ertrage es kaum, meine Schwester so zu sehen. Ich schlinge meinen Arm um sie und lasse ihre Tränen in mein Nachthemd rinnen. Still liegen wir da, bis ihr Schluchzen in Gähnen verklingt und unsere Augen zufallen.
2
Als ich mich am nächsten Morgen auf den Weg zur Schule mache, bin ich noch niedergeschlagener als sonst. Alices Traurigkeit pocht in meinem Hinterkopf, die Verzweiflung scheint mich zum Asphalt zu ziehen. Ich hasse es, wenn meine Schwester unglücklich ist. Ich fühle mich so hilflos, wünschte, ich könnte irgendetwas für sie tun. Aber da ist nichts. Mir bleibt nichts anderes übrig, als die Schultern zu straffen und erhobenen Hauptes zum Unterricht zu marschieren.
Obwohl es noch früh am Morgen ist, herrscht hier draußen ein geschäftiges Treiben. Männer und Frauen strömen durch die Straßen, die meisten in dürftiger Kleidung. In Hauseingängen lungern bewegungslose Gestalten über ihren Schnapsflaschen. Sie schauen mit trübem Blick auf den klebrigen Gehweg. Ich schiebe mich an ihnen vorbei, versuche nicht so genau hinzuschauen.
Die Häuser stehen dicht an dicht, die Menschen leben gestapelt. Besonders seit der letzten großen Einwanderungswelle scheint die Stadt aus allen Nähten zu platzen. Überall, wo noch ein letztes Fleckchen Grün oder ein Hof war, steht nun ein schäbiger Kunststoff-Container, in dem Zuwanderer untergebracht sind. Auch auf den Gehwegen sind Zelte aufgebaut, in denen ganze Familien unterkommen. Sie betteln und singen jammernde Lieder, doch fast jeder, der noch Geld hat, läuft mit gesenktem Kopf und aufgestelltem Kragen vorbei. In einer Welt, in der es zu viele Menschen gibt, ist ein einzelnes Leben nichts mehr wert.
Ich husche an den traurigen Szenen vorbei. Mit jedem Schritt bekomme ich mehr Bauchschmerzen. Am liebsten würde ich nicht zur Schule gehen.
In meiner Kindheit war es noch völlig normal, dass Schüler aus Ober- und Unterstadt zusammen lernten. Doch in den letzten Jahren war diese Einstellung zunehmend in sich zusammengefallen. Es wurde sich darüber empört, dass Kinder aus der unteren, schmutzigen Stadt auf eine gehobene Schule gehen durften. Es war das plötzliche Aufkeimen einer nie dagewesenen Frage, die, je mehr Menschen sie stellten, scheinbar immer berechtigter wurde.
Ich hasse die teils bissigen, teils unbeteiligten Gesichter meiner Schulkameraden. Wie soll man mit dem Mädchen umgehen, das alles verloren hat? Soll man sie bemitleiden oder noch weiter in der Wunde bohren? So lange, bis man sie endlich los ist? Damit die Schule endlich unbefleckt ist? Sogar die Mädchen, die ich früher als Freundinnen bezeichnet hätte, scheinen hin und her gerissen und beginnen zu tuscheln, wenn sie mich sehen.
Wahrscheinlich wären alle erleichtert, wenn ich einfach wegbliebe. Die Schulleitung würde es sicher kommentarlos hinnehmen. Aber auch beim Gedanken an Zuhause zieht sich mein Magen zusammen. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, die unangenehme Menschenflut oder die gähnende Leere unter unserem Dach.
Heute erübrigt sich die Frage sowieso, da ich Alice nicht noch mehr belasten möchte. Also erlaube ich meinem Tagesablauf, sich unbestritten fortzusetzen.
Ich lege meinen Kopf in den Nacken und betrachte die sich kreuzenden Überführungen über mir und die riesigen Monitore, die banale Celebrity-Neuigkeiten oder Quizfragen in die Welt streuen: »Wie viele Einkerbungen hat ein Golfball? A: 336 B: 454 C: 688.«
Diese Welt ist ein eigentümlicher Ort.
Ich erreiche den Hauptbahnhof, einen Knotenpunkt zwischen zahlreichen Brücken und Ebenen. Ich kann diese Gegend nicht leiden. Züge ächzen in ohrenbetäubender Lautstärke über die Schienen. Die einen verschwinden in Schächten unter der Erde, die anderen über klobige Brücken in einen höheren Teil der Stadt. Bei jeder Kurve, die die Waggons nehmen, stoßen sie ein schrilles Quietschen aus. Ich ziehe angestrengt die Augenbrauen zusammen und drücke mich an einer Menschentraube vorbei.
Auf einmal weht mir eine liebliche und doch dominante Stimme hinterher:
»Du siehst aus, als würdest du einen Neuanfang brauchen.«
Völlig perplex bleibe ich stehen.
»Was?«, stoße ich hervor. Ganz langsam drehe ich mich um.
Vor mir steht eine junge Frau in einem feinen Nadelstreifenkostüm. Sie ist viel zu sauber und zurechtgemacht für diesen Bezirk. In einer Hand hält sie eine große Aktentasche, in der anderen ein modernes Tablet. Auf ihren Lippen liegt ein überschwängliches Lächeln.
»Dachte ich’s mir doch.«
»Was dachten Sie sich?«, frage ich.
»Ich habe in deinen Augen diese tiefe Sehnsucht gesehen … Kann es sein, dass du dir ein besseres Leben wünschst?«
»In meinen Augen?« Ich betrachte sie misstrauisch.
»Sagt dir die EAGOS etwas?«, fährt die Dame fort.
»Nein.«
»European-American Government and Organization of Space«, sagt sie langgezogen. »Die Regierung, die sich um den neuen Planeten Utopia-I kümmert. Von dem hast du aber schon mal gehört?«
»Klar«, sage ich knapp. »Ist ja ständig in den Nachrichten. Aber was hat das mit mir zu tun?«
»Wie schön, du schaust Nachrichten.« Irgendwas in ihrer Stimme klingt, als sei das ungewöhnlich. »Dann hast du bestimmt auch von der ›Solidarischen Bürgerinitiative für Menschenförderung‹ gehört? Die zwei erfolgreichen Passagierüberführungen nach Utopia-I vor fünf und zehn Jahren?«
»Keine Ahnung.« Allmählich werde ich unruhig. »Kann sein.«
Die Frau kommt mir auf einmal so nah, dass sich unsere Schultern berühren. Ich wanke ein paar Schritte zurück.
»Heute Morgen wurde die dritte Welle dieses Sozialprojektes veröffentlicht«, fährt sie fort. »Die EAGOS nimmt noch mal 100 mittellose Menschen mit auf die lange Reise zu dem erstaunlichen, erdähnlichen Planeten. Das ist eine der größten Chancen der Menschheitsgeschichte. Ein kompletter Neuanfang: alles auf Null. Diese 100 Menschen erhalten einen sichereren Arbeitsplatz und eine gute Bezahlung von der EAGOS und können sich eine ganz neue Existenz aufbauen. Das sind 100 Chancen.« Sie strahlt und hält mir dabei ihr Tablet vors Gesicht. Auf der hauchdünnen Oberfläche leuchten die Fotos eines fremden Ortes. Ich sehe ein blaues Meer und eine rote Gesteinswelt, dahinter violetten Himmel, der von Sternen übersät ist. Es sieht wunderschön aus und für einen Moment bin ich in dem Anblick gefangen.
Das Rattern eines Zuges lässt mich auffahren und holt mich zurück in die Realität.
»Schön.« Ich blinzle. »Ich sollte dann mal weiter.«
»Vielleicht möchtest du ja mit auf die Reise kommen. Ich geb dir mal eine Broschüre mit.« Die Frau langt in ihre Tasche und reicht mir einen gefalteten Zettel. »Ich würde mich beeilen, denn 100 Plätze sind nicht viel unter allen Einwohnern von Europa und Nordamerika.«
»Nein danke.« Ich winke ab. »Ich wüsste nicht, was ich damit soll.«
»Also bist du hier etwa glücklich? Wünschst du dir nicht, all dem hier zu entfliehen?« Die Frau deutet mit ihrem Kopf auf die schmutzige Gasse, aus der ich gekommen bin.
»Nein«, brumme ich und fühle mich ertappt. »Schönen Tag noch.«
Ich wende mich zum Gehen und starre auf den tristen Weg, der vor mir liegt.
»Wie schade«, ruft die Frau mir nach. »Dabei haben einige der Passagiere sogar die Möglichkeit, unterwegs zu studieren. Etwa Medizin …«
Wie vom Donner gerührt bleibe ich stehen.
»Was?«, krächze ich und drehe mich erneut zu der Dame um.
»Vielleicht die letzte Chance auf einen Studienplatz für Leute von hier unten«, sagt sie.
Ich schlucke schwer.
»Du kannst dich auch einfach mal einschreiben und schauen, was passiert. Die endgültige Entscheidung kannst du später immer noch treffen.« Wieder streckt sie mir ihr Tablet entgegen.
»Könnte ich auch, hypothetisch, zwei Leute eintragen?«, frage ich mit zittriger Stimme.
»Aber natürlich, alle Bedingungen findest du in der Broschüre. Aber du kannst auch gleich hier die Bewerbungen ausfüllen. Nur einen kurzen Text über jede Person. Und zwei Klicks.«
Mit zwei Klicks zu einem völlig neuen Leben? Ich stehe wie angewurzelt da. Was wenn Alice ihren Traum doch verwirklich kann? Wenn das unsere Chance ist? Was wenn wir zusammen all das hier hinter uns lassen könnten? Eine gute Arbeit finden, ein neues Leben aufbauen, weit weg von diesen Menschenmassen? Mein Puls beschleunigt sich.
Entschlossen greife ich nach dem Tablet. Rastlos überfliege ich die aufgelisteten Informationen. Sichere Arbeitsplätze, fremde Landschaften, Reise ohne Rückkehr.
Dabei fällt mein Blick auf einen Absatz. »Das Programm richtet sich auch an aufstrebende Schüler, die eine Karriere in der Biologie oder Medizin anstreben. Es gibt zwanzig Plätze unter den Mitreisenden für diesen Berufszweig. Die Ausbildung ermöglicht einen praxisnahen Einstieg in das jeweilige Fachgebiet. Voraussetzung ist ein Schulabschluss mit der Note ›Gut‹.« Ich hole tief Luft und klicke auf den großen, gelben Button in der oberen Ecke des Bildschirms. Bewerben. Wie in Trance gebe ich zunächst alle Informationen über Alice ein.
Welche besonderen Qualifikationen bringen Sie nach Utopia-I mit?
Ich überlege. Ich kann nicht behaupten, mich besonders gut mit den Anforderungen an Medizinstudenten auszukennen. »Mein Vater hat als Ingenieur in Entwicklungsländern gearbeitet und Wasser in die Sahara gebracht. Auch ich, Alice Faymonville, hatte schon immer ein großes Interesse an der Wissenschaft und habe einen sehr guten Schulabschluss gemacht«, schreibe ich also. »Hiermit bewerbe ich mich für das Ausbildungsprogramm im Bereich Medizin.«
Dann mache ich mich an meinen eigenen Text. Kurz komme ich ins Stocken. Was soll ich überhaupt über mich sagen? Alice wusste schon immer, was sie einmal mit ihrem Leben anfangen wollte. Aber ich? Die Frage hatte ich mir noch kein einziges Mal beantworten können.
»Mein Name ist Flora Faymonville und ich will einfach nur weit weg«, schreibe ich. Einen Moment betrachte ich das wartende Leerzeichen hinter meinem Text. Es wäre die Wahrheit. Ich lösche den Satz wieder und schreibe: »Mein Name ist Flora Faymonville, ich bin fasziniert von der Vorstellung einer unberührten Welt. Ich würde gerne helfen diese aufzubauen. Ich bin für jeden ausgeschriebenen Beruf offen.«
Ich betrachte noch einmal meinen Text und tippe dann auf den großen Knopf. Senden. Mit dem Geräusch eines startenden Flugzeuges verschwinden unsere Bewerbungen.
»Wie aufregend.« Die Dame strahlt mich an. »Ich drücke dir fest die Daumen, dass es klappt. Du hörst dann von uns.«
Stocksteif stehe ich da, weiß nicht wohin mit mir und meinen Gedanken. Irgendwann beginnen meine Füße loszulaufen, tragen mich durch die Gassen der Stadt. Ohne Ziel und ohne Sinn renne ich durch die verwinkelten Straßen, über Brücken und Überführungen, vorbei an Schienen und Autos.
Was hab ich getan? Immer wieder rauscht mir der Satz durch den Kopf. Was, wenn es tatsächlich klappen sollte? Und was, wenn es nicht klappen sollte?
3
Die Tage ziehen an mir vorbei. Ich trage mein Tablet überall mit mir herum und klicke alle paar Minuten auf den Knopf in meinem Postfach: Aktualisieren. Es wird beinahe zu einer Art Spiel, das alle meine Sinne anspannt. Voller Erwartung reiße ich jedes Mal die Augen auf, wenn mein Finger auf die aufgeheizte Oberfläche des Tablets tippt. In meinem Kopf beginne ich schon mir alles auszumalen. Wie es wohl wäre, mein altes Leben hinter mir zu lassen: meine Schule und Klassenkameraden mit all ihren Demütigungen. Auch unserer Wohnung, die mich in jedem Winkel an jene albtraumhafte Nacht erinnert, würde ich nicht nachtrauern. Ich würde weder die übervollen Kaufhäuser, die blinkenden Werbetafeln und die Unzufriedenheit der Menschen noch die schillernde Oberstadt vermissen, deren gehobenes Leben auf den Dächern der Stadt vor sich geht, während unten Menschen in der Kloake verhungern.
Mich beflügelt die Frage, wie eine neue Welt aussehen könnte. Eine Landschaft, die noch von keinen schmierigen Menschenhänden abgegrabbelt wurde, oder Freiheit und Luft, wie es sie auf der Erde nicht mehr gibt.
Ich kaufe mir alle Artikel und Bücher über Utopia-I, die ich finden kann. Natürlich wusste ich das ein oder andere über diesen Planeten bereits vorher. Banale Dinge, die man eben so in den Nachrichten aufschnappt oder in einer Quizshow erfährt. Doch das alles hatte nie Relevanz für mich. Dieser Zwillingsplanet, wie man ihn nennt, war einfach zu weit weg, eine andere Welt, die nur den genialsten Forschern und Astronauten vorbehalten war. Dass die EAGOS schon angefangen hatte ihn mit ganz normalen Menschen zu besiedeln, hatte ich gar nicht so richtig mitbekommen.
Aber jetzt scheint dieser Ort plötzlich so greifbar und zugänglich, trotz der lächerlich kleinen Wahrscheinlichkeit, dass wir überhaupt genommen werden. Aus unzähligen Artikeln weiß ich nun, was für einen Ansturm es bei den vorherigen Beförderungen gab. Darunter waren auch viele Geschichten über die ersten Siedler auf Utopia-I. Ich verschlinge alle Texte, jede kleinste Information, die mir Onlinebibliotheken oder zwielichtige Astronomie-Fanseiten offenbaren. Ich verleibe mir die neue Welt ein, als sei ich bereits da. Ich überlege, was ich für Kleidung mitnehmen würde, da die Temperaturen auf Utopia-I sehr unbeständig sind, tagsüber kochend heiß, nachts unter dem Gefrierpunkt. Ich mache mir Gedanken, was ich Alice empfehlen würde einzupacken.
Die Aufregung trägt mich durch die Stunden und schenkt mir einen Funken Hoffnung, einen Ort, an den ich fliehen kann, wenn die Panik mich überkommt.
Ständig warte ich auf den perfekten Moment, um Alice von allem zu berichten. Aber es stellt sich schwieriger als gedacht heraus, die Worte über mich zu bringen. Ob es daran liegt, wie absurd alles klingt, oder daran, dass Alice denken könnte, ich hätte mir etwas auf der Straße andrehen lassen, weiß ich nicht. Doch jedes Mal, wenn ich mir fest vornehme sie endlich anzusprechen, schaffe ich es nicht.
***
Es verstreichen Tage, dann Wochen und keine Nachricht kommt. Allmählich gehen mir Euphorie und Nervosität wieder verloren, so wie einem Baum seine Blätter am Ende des Sommers.
Es war doch sowieso klar! Wieso sollten gerade wir ausgewählt werden? In Europa leben so viele Menschen. Und in Amerika noch mal so viele. Schon hier im Bezirk leben so viele Menschen. Langsam schlägt meine Aufregung in Wut um. Ich beginne mich über meine eigene Dummheit zu ärgern. Wie hatte ich denn überhaupt je glauben können, dass wir eine Chance hatten, dass sie unter allen Bewerbungen gerade über meine stolpern? Ich fühle mich blauäugig und mit einem Mal bin ich froh Alice nichts erzählt zu haben. So muss ich mich nur vor mir selbst schämen und vor niemandem sonst. Kein anderer weiß von meiner kindlichen Idee und kann nun, wo es nicht geklappt hat, mitleidig zu mir hinab blicken und sagen: »Was hast du denn gedacht?«
Missmutig versuche ich mich wieder mit meinem Leben hier anzufreunden. Ich versuche mir die schlechten Dinge von Utopia-I vor Augen zu führen. Die Reise dauert trotz modernster Technik zwei Jahre und ist nicht ungefährlich. Die Distanz ist so weit, dass die Funkverbindung zwischen den Planeten ebenfalls Monate dauert. Doch je mehr ich mir das sage, desto interessanter wird dieser mystische Ort nur.
***
Die Dinge ändern sich erst, als eines Tages in der Schule Yezica auf mich zukommt. Wir kennen uns, seit wir klein sind, und früher hätte ich sie als eine Freundin bezeichnet.
»Flora«, sagt sie und tippt mir auf die Schulter. »Hey, wie geht’s dir? Du siehst besser aus, die letzte Zeit, irgendwie lebendiger.«
»Danke, ja«, sage ich und weiß nicht, was ich hinzufügen soll. »Und wie geht’s dir?«
»Gut, ja, alles wie immer.« Sie richtet ihr Haarband. »Du, ich feiere morgen Abend meinen Geburtstag, Sweet Sixteen, das ist ja ein wichtiger Schritt im Leben eines Mädchens!«
Ich pflichte ihr bei, finde das aber absolut nicht wichtig.
»Komm doch auch! Es geht um sechs los, meine Adresse weißt du ja noch, oder?«
»Oh, danke.« Ich nicke mechanisch. »Ja, ich schau mal, ob ich Zeit hab.«
»Gut«, sagt sie und dreht sich schwunghaft um, sodass ihre schwarzen Locken mit den goldenen Haarspitzen in der Luft wippen.
Ich stutze. Lange war niemand mehr so nett zu mir.
***
Am folgenden Tag mache ich mich für die Feier fertig, ohne überhaupt sicher zu sein, dass ich hingehen will. Ich habe es mir mehr aufgetragen, als mich darauf zu freuen, denn irgendwann muss ich ja weitermachen. Oder zumindest einen Versuch unternehmen. Konfrontiert mit einem solchen Ereignis merke ich, wie gesellschaftlich eingerostet ich bin. Die Frage, was ich anziehen soll, kommt mir vor wie eine mathematische Gleichung, die ich nicht lösen kann. In der letzten Zeit habe ich nur übergroße Pullover und weite Hosen getragen. Am liebsten verstecke ich mich unter so viel Stoff, dass ich das Gefühl habe, praktisch nicht mehr da zu sein. Und nun, bei einer richtigen Party? Die anderen Mädchen werden sicher schrille, glitzernde Kleider tragen. Solche Gewänder besitze ich gar nicht. Ich frage mich, wie ich früher mit ihnen mitgehalten habe und ob ich das überhaupt je getan habe.
Draußen tröpfelt Nieselregen gegen die Fensterscheibe. Der Sommer ist langsam in den Herbst gekippt und die frühe Dunkelheit lässt mich noch energieloser werden. Je mehr Zeit ich dafür aufwende, mir Gedanken über den Abend zu machen, umso weniger möchte ich eigentlich hingehen.
Mit der Zahnbürste im Mund krame ich genervt in der Kommode im Wohnzimmer und suche nach irgendwelchen nicht völlig ausgelatschten Schuhen. Während ich hin und her geistere, kommt Alice die Treppe herunter. Ihre hellbraunen Locken sind zottelig, unter den Augen hat sie dunkle Ringe. Ich schnappe überrascht nach Luft.
»Du bist ja gar nicht bei der Arbeit?«
»Nein, ich konnte das heute nicht«, murmelt sie und geht an mir vorbei in die Küche.
Mit einem Mal wird mein Hals ganz trocken. Soweit ich mich erinnere, hat Alice ihre Arbeit noch nie abgesagt. Sie nimmt ihren Job so ernst – auch, wenn er ihr nur einen Hungerlohn einbringt und sich darauf beschränkt, Burger an übergewichtige Kunden zu servieren – dass sie sich immer hingeschleppt hat, selbst wenn sie mal fiebrig und verschnupft war.
Es trifft mich eiskalt, dass ihre Stärke mit einem Mal so in sich zusammenfällt. In den letzten Monaten ist sie das einzig Beständige in meinem Leben gewesen, die Einzige, auf die ich mich noch verlassen konnte. Ich brauche ihre Energie, um selbst auf den Beinen zu bleiben. Wenn Alice nicht mehr funktioniert, geht hier alles kaputt.
In dem Moment klingelt es. Mechanisch schleiche ich zum Eingang. Versunken in meine düsteren Gedanken, frage ich mich nicht einmal, wer uns denn besuchen sollte. Behäbig bewege ich die Zahnbürste in meinem Mund, während ich die Tür aufziehe. Vor mir steht ein schmächtiger Mann in einem zu großen Anzug. Seine wenigen Haare hat er sich zur Seite geföhnt. Er trägt eine runde Brille und einen medizinischen Mundschutz, den er sich gerade herunterzieht.
»Ah – hallo!«, sagt er überschwänglich. »Alice oder Flora Faymonville?«
»Ähm, Flora«, sage ich langsam.
»Wunderbar! Darf ich hereinkommen?«
»Warum … Worum geht es denn?«, nuschle ich skeptisch.
»Ach, wie unhöflich von mir! Natürlich!« Er reckt gestelzt seine Brust. »Ich bin Herr Hinterkamm vom EAGOS Standort Deutschland. Ich komme mit Nachrichten über Utopia-I!«
Mir tropft die Zahnpasta aus dem Mund. Ich starre ihn entgeistert an.
»Ich sehe, du bist noch nicht ganz im Bilde. Darf ich alles Weitere mit Alice Faymonville besprechen?«
»Nein!«, sage ich eilig, erschrecke mich selber über den energischen Ton in meiner Stimme. »Nein, ich meine, warten Sie kurz. Sie ist gerade … auf dem Klo.« Mit diesen Worten knalle ich ihm die Tür vor der Nase zu. Mein Herz beginnt zu rasen. Ich renne ins Bad und entledige mich dem Schaum in meinem Mund.
»Alice!«, schreie ich und renne in die Küche. »Alice, du musst mir helfen! Ich hab ganz schön was angerichtet.«
Alices Blick wandert müde und teilnahmslos zu mir herüber.
»Was?«, fragt sie.
»Ähm, okay … es klingt dumm, wie auch immer ich es verpacke, also sage ich es einfach.« Ich atme tief ein. »Es wäre möglich, dass ich uns für ein Programm zum Umziehen auf den Erdzwilling Utopia-I angemeldet habe und jetzt steht ein Mann vor der Tür, der alles mit dir besprechen will.«
In Alices Gesicht regt sich nichts. Hat sie mich nicht verstanden?
»Ich weiß, das klingt jetzt etwas merkwürdig. Aber ich dachte, ich melde uns einfach an, mal sehen, was passiert … Ich dachte, wir könnten ganz von vorn anfangen. Es ist schon so lange her! Ich bin davon ausgegangen, dass es sich sowieso schon längst erledigt hat. Aber jetzt ist dieser Mann hier, ich wusste ja nicht, dass er herkommen würde …«
»Was?« Alice kommt langsam zu sich. Sie starrt mich an. »Was hast du gemacht?«
»Ich dachte, es ist eine gute Idee! Ich wusste ja nicht … Was mach ich denn jetzt mit ihm da draußen?«
»Was für ein Programm?« Alice ignoriert alles, was ich sage. »Wie kommst du denn darauf, dass wir einfach von hier wegziehen?«
»O Gott, nicht, dass er gleich wieder geht!«, sage ich. »Ich war so unhöflich zu ihm!«
»Was denn überhaupt für ein Planet!«
»Alice, bitte, wir reden nachher. Ich hole ihn jetzt herein und wir hören uns kurz an, was er zu sagen hat!«
Und ohne ein weiteres Wort abzuwarten, sprinte ich wieder zum Eingang, reiße die Tür auf und bitte den Fremden herein.
»Ah, und du musst Alice Faymonville sein, es ist mir eine Freude.« Hinterkamm rennt im Stechschritt in den Flur, reckt Alice ungelenk seine Hand entgegen. Diese starrt ihn völlig versteinert an.
Ich geleite die beiden unbeholfen ins Wohnzimmer. Hinterkamm nickt mir beiläufig zu.
»Darf ich sagen, ich bewundere das Lebenswerk eures Vaters zutiefst«, fährt Hinterkamm fort und lässt sich gegenüber von uns aufs Sofa plumpsen. »Wie lange ist er schon tot?«
Ein großer Kloß bildet sich in meinem Hals.
»Ein halbes Jahr«, sage ich leise und senke den Blick.
»Oh, ja, mein Beileid. Aber ein genialer Mensch, wirklich genial.«
Alice starrt mich an, als sei Hinterkamms Distanzlosigkeit meine Schuld. Ich traue mich nicht, ihren Blick zu erwidern.
»Also, äh, kannten Sie unseren Vater?«, frage ich.
»Aber natürlich. Euer Vater war ein Star der europäischen Ingenieurskunst! Viele bahnbrechende Projekte in der Entwicklungshilfe konnten nur aufgrund seiner Ideen realisiert werden.«
Ich bin überrascht. Ich wusste natürlich, dass mein Vater an großen Konzepten mitgearbeitet hat, aber dass sein Name anderen ein Begriff ist, das ist mir neu.
»Jaah. Also, wir haben uns sehr über eure Bewerbungen gefreut. Genau darum geht es ja beim Projekt, frischen Wind! Und die Verbindung mit dem Vater, wir sind uns sicher, dass diese Gene weitergegeben wurden!« Er lacht auf und es klingt irgendwie einstudiert.
Alice schaut mich noch immer vorwurfsvoll an.
»Wie ihr wisst, gibt es nur wenige Plätze. Und es haben sich unglaublich viele Menschen beworben. Versteht sich ja von selbst bei so einem tollen Projekt. Nun, ich will euch nicht länger auf die Folter spannen, Alice Faymonville, herzlichen Glückwunsch, du hast den Trainee-Platz zur Medizinerin ergattert! Absolut zu Recht, wenn ich das sagen darf. Das war eine tolle Bewerbung und tolle Noten. Die Ausbildung verläuft natürlich etwas anders als hier in Europa, aber auf Utopia-I hast du die Freiheit, damit in verschiedene Fachrichtungen zu gehen. Im ersten Teil der Ausbildung lernen die Biologie- und Medizinstudenten zusammen. Das wird während der Reise sein. Anschließend können sie sich im Rahmen der Möglichkeiten spezialisieren.«
Mein Herz beginnt zu rasen. Es hat tatsächlich geklappt? Alice kann endlich ihrem Traum nachgehen? Ein gelöstes Lächeln breitet sich auf meinem Gesicht aus.
»Wow«, sage ich. »Das ist ja großartig!«
Alice starrt Hinterkamm völlig verwirrt an.
»Wie bitte? Medizin?«
»Natürlich, dafür hast du dich doch beworben?« Hinterkamm sieht Alice mit hochgezogen Augenbrauen an.
»Ich … wann soll das Ganze denn losgehen?«, stammelt Alice.
»Aha, hier denkt jemand mit! Ich merke schon, wir haben die richtige ausgewählt. Der Start ist am 20.03.2087, also im kommenden Frühjahr. Allerdings startet die Vorbereitungsphase im Trainingslager Paris einen Monat vorher. Dort wird der Körper auf die kommende Reise vorbereitet und alles Wichtige mitgeteilt. Hier habe ich alle weiteren Informationen noch einmal zusammengefasst.« Er schiebt Alice eine dicke Stoffmappe zu.
»Danke«, murmelt Alice und rührt die Unterlagen nicht an.
»So, das war es dann auch schon von meiner Seite.« Hinterkamm klopft sich auf die Oberschenkel, dann scheint ihm ein Licht aufzugehen. »Ach ja, fast vergessen, Flora Faymonville?«
Aufgeregt richte ich mich auf. In welchen Bereich ich wohl eingeteilt werde?
»Nun, du verstehst sicherlich, dass nicht jeder mitkommen kann. So ist leider das Leben. Doch ich sehe, wie du dich für deine Schwester freust, das finde ich total super.«
Mein Herz rutscht mir in den Schoß.
»Wie bitte?«, fragt Alice energisch.
»Ich … ich bin nicht dabei?« Ich merke, wie alle Kraft meinen Körper verlässt.
»Leider nein, das große Los hat dich nicht erwählt.«
»Ist es, weil ich noch nicht siebzehn bin?«, krächze ich. »Aber es hieß doch, Schüler dürfen sich auch bewerben!«
»Oh, ja, absolut! Es reisen diesmal sogar einige Minderjährige mit«, sagt Hinterkamm beschwingt. »Sofern sie während der Reise siebzehn und damit volljährig werden, ist es kein Problem, minderjährig zu sein. Nein, du hast einzig das Pech, dass aus deiner Familie schon jemand mitkommt.«
»Was?« Ich starre ihn entgeistert an.
»Es stand ja in den Bedingungen. Aus jeder Familie kann immer nur eine Person mitgenommen werden. Sonst kommen sie alle – gerade die Unterstädter, man kennt es ja! – und wollen noch den und den mitnehmen. Am liebsten noch den Hund und die Cousine!« Er lacht laut auf.
»Nein!«, keuche ich.
Ich weiß nicht, ob ich wütender über seine rassistischen Aussagen bin oder darüber, dass ich den wichtigsten Satz übersehen habe.
»So ist nun mal die Entscheidung. Wir müssen ja sehen, dass wir viel unterschiedliche DNA da drüben haben, sonst wird es kompliziert. Außer zwei Ausnahmen kommt aus jeder Familie nur eine Person mit. Ich weiß, es ist immer schlimm, wenn man nicht gewinnt, doch der Schmerz vergeht.«
Ich höre ihm nicht mehr zu. Es fühlt sich an, als würde etwas in mir zu Bruch gehen.
»Was sind das für Ausnahmen?«, fragt Alice erregt. »Wenn es bei zweien geht, warum dann nicht auch bei uns?«
»Nun, nein, die Ausnahmen sind nur Kinder von wichtigen Persönlichkeiten auf Utopia-I. Diesen ist es gestattet, aufgrund besonderer Umstände ihre Familien hinzuholen. Es ist alles ein tolles System.«
Hinterkamm scheint es hier sichtlich zu gefallen. Er breitet seine Arme über der Sofalehne aus.
»Tatsächlich ist es doch erstaunlich. Das Programm für die sozial Benachteiligten kam wahnsinnig gut an, was natürlich kein Wunder ist, so eine wunderbare Möglichkeit, dem hier zu entkommen.« Er weist auf unser Wohnzimmer. Grimmig verschränke ich die Arme. »Aber in der ersten Klasse dagegen sind noch unzählige Plätze frei. Die sind für externe Wissenschaftler und den Geldadel reserviert, ihr versteht sicher. Ein Jammer, dass diese Leute nur so zaghaft zuschlagen. Sie warten wohl noch darauf, dass mehr Gleichgesinnte mitziehen. Sie wollen erst von ihresgleichen einen Erfahrungsbericht hören. Ein Fehler, wenn ihr mich fragt! Da machen es Leute wie ihr gescheiter. Wie man so schön sagt, oftmals wissen die Stumpfen besser, was gut ist.«
»Stumpf?« Alice starrt ihn an.
»Nun ja, es ist ja auch egal. Fräulein Alice, herzlichen Glückwunsch noch einmal und eine gute Reise. Einen schönen Abend!« Hinterkamm schiebt seine rutschende Brille den Nasenrücken empor und erhebt sich. Ich weiß nicht, was ich noch zu dieser Unterhaltung beitragen soll.
***
Die Tür fällt ins Schloss und eine unangenehme Stille wabert durch die Wohnung. Mir ist zum Weinen zumute. Wieso hatte ich nicht eine einzige Sekunde an die Möglichkeit gedacht, dass nur eine von uns beiden genommen werden könnte? Ich fühle mich völlig bloßgestellt.
»Wann hattest du denn vor mir etwas zu sagen?«, bricht Alice irgendwann das Schweigen. »Wenn sie mich abholen würden, um mich irgendwo hinzufliegen?!«
Ich habe keine Antwort. Ich beginne am ganzen Körper zu schwitzen.
»Ich verstehe gar nicht, wie du darauf kommst auf einen anderen Planeten umzuziehen. Ich wusste nicht mal, dass das geht? Das klingt schon total absurd!«
»Es sollte ein Neuanfang sein«, sage ich kleinlaut.
»Na, aber was für einer! Du weißt doch, dass dort drüben erst eine Handvoll Menschen leben. Man weiß noch gar nicht, wie gefährlich es dort eventuell ist!«
»Die EAGOS schreibt, dass die Voraussetzungen ähnlich wie hier sind«, flüstere ich.
Alice vergräbt ihr Gesicht in den Händen.
»Es ist ja jetzt eh egal. Es hat sich erledigt.«
Sie schüttelt den Kopf und geht. Ich sitze aufgelöst da, meine Augen sind so voller Tränen, dass ich kaum noch etwas sehe. Ich wünschte, ich hätte nie die Bewerbung geschrieben.
***
Yezicas Party kommt mir auf einmal noch alberner vor als vorher. Ich kann mir nicht mal vorstellen jetzt zwischen all diesen leeren Hüllen in schillernden Kostümen zu sitzen und mir und aller Welt vorzugaukeln, dass ich noch Spaß und eine Perspektive in diesem Leben habe.
Meine Beine haben mich stattdessen zu meinem Bett getragen. Ich bin nicht müde und es ist viel zu früh zum Schlafen, aber ich weiß nicht wohin mit mir. Ich geselle mich zu meiner zusammengekauerten Bettdecke und ziehe die Knie an die Brust. Hellwach liege ich da und starre in mein Zimmer. Es ist voll von Dingen, die eigentlich glücklich machen sollten: Spiele, meine alte Puppe und die Bücher im Regal. Ein paar Kleidungsstücke liegen auf dem Boden und Schreibtischstuhl. Es ist alles bedeutungsloses Zeug; nichts davon ist wirklich wichtig.
Gerne würde ich mit Alice sprechen und gleichzeitig will ich nicht als erstes auf sie zugehen. Es ist so demütigend, dass ich nicht ausgewählt wurde. Ich fühle mich wie eine kümmerliche Nummer zwei. Wieso hatte ich diese Bedingung denn nirgends gesehen? Und wieso hatte diese Frau auf der Straße das nicht als allererstes erwähnt! Für mich war immer klar gewesen, dass Alice und ich alles zusammen machen werden.
Plötzlich trifft mich der Gedanke wie ein Schlag: Was wenn Alice allein auf die Reise geht? Vielleicht sollte sie die Chance nutzen? Womöglich ging es bei der ganzen Sache nie um mich! Sie wird ihren Traum verwirklichen können und ich werde hierbleiben. Mein Leben hatte sich eh binnen einer Nacht aufgelöst, kam es da noch drauf an? Sollte doch Alice wenigstens etwas aus ihrem machen.
Ich wühle mich auf die andere Seite meines Bettes und starre aus dem Fenster. Das Stückchen Himmel, das ich von hier aus erkennen kann, ist von dunklen Wolken bedeckt. Irgendwo da, hinter dem Wolkenschleier und noch Millionen Kilometer entfernt liegt diese merkwürdige, neue Welt.
Als wir klein waren, hatte mein Vater uns in seltenen, sternenklaren Nächten nach draußen geholt und uns den Himmel erklärt. Dabei erzählte er auch von der Entdeckung dieses erdähnlichen Planeten. Was für ein Fund er für die Astronomen war: Der erste bekannte Planet mit flüssigem Wasser und einer Atmosphäre, mit einer eigenen Pflanzen- und Tierwelt. Wie unvorstellbar es lange Zeit war, überhaupt ein anderes Sonnensystem zu erreichen. Nur dank eines revolutionären Raketenantriebes war das Vorankommen auf Überlichtgeschwindigkeit gesteigert worden. Eine lange für unmöglich gehaltene Technik, bei der sich nicht das Raumschiff bewegt, sondern der Raum darum herum.
Ich zwirble gedankenverloren mein T-Shirt zwischen meinen Fingern. Man könnte sich ja einfach mal ansehen, was Herr Hinterkamm Alice mitgebracht hat. Das hätte ja noch nichts zu bedeuten.
Ich lausche einen Moment in die dumpfe Stille um mich zu vergewissern, dass Alice in ihrem Zimmer ist. Als ich ein leises Husten von ihr höre, schwinge mich aus dem Bett, tappe zu meiner Tür und die Treppe nach unten ins Wohnzimmer. Inzwischen ist das letzte Licht des Tages aus der Stadt entwichen und unheilvolle Dunkelheit breitet sich in unserer Wohnung aus. Ich taste mich am großen Schrank entlang zum Couchtisch. Mit zusammengekniffenen Augen kann ich die Stoffmappe darauf ausmachen. Als ich nach ihr greife, fühle ich, dass sie offen ist. Es ist auch nichts mehr darin, kein Prospekt, kein Stückchen Papier. Verwundert taste ich mit meinen Fingern über den kleinen Tisch, suche auf dem Boden. Auch da ist nichts. Aber wie soll etwas aus der Mappe verschwunden sein? Die Unterlagen können sich ja nicht in Luft aufgelöst haben. Nein, es gibt nur eine Möglichkeit. Alice muss sie herausgenommen haben. Mein Herzschlag beschleunigt sich. Hatte sie etwa den gleichen Gedanken wie ich? Wird sie mich verlassen?
4
Als ich am nächsten Morgen aufwache, ist mehr Leben in der Wohnung als sonst. Das Radio läuft und eine poppige Melodie beschallt die Räume. Ich höre Alices elfenhafte Schritte auf der Treppe. Sie verschwinden in der Küche und ich kann sie etwas herumräumen hören. Mein Kopf fühlt sich an wie in Watte eingepackt, ich habe die ganze Nacht kaum geschlafen. Ich hieve mich hoch. Mein Hals ist trocken und kratzt vom Smog. Ich nehme einen Schluck Wasser und versuche den Staub wegzugurgeln, doch es klappt nicht so richtig. Langsam stehe ich auf und schlurfe ins Bad und unter die Dusche. Das Wasser stinkt heute besonders schwefelig. Anscheinend wurde der Wassertank in unserem Block wieder lange nicht gereinigt. Ich nehme also nur eine knappe Dusche und ziehe mir dann einen Pullover und eine verschlissene, graue Hose an. Anschließend kämme ich mir einmal durch die dunkelblonden Haare. Flüchtig betrachte ich mich im noch leicht beschlagenen Spiegel. Ich sehe genauso müde aus, wie ich mich fühle. Meine Augen liegen tief in ihren Höhlen, das Grün wirkt getrübt und hoffnungslos. Ich wende mich von mir selbst ab und streune nach unten. Unwillkürlich hole ich Luft, bevor ich in die Küche trete. Ich habe Angst, dass Alice mir etwas sagen wird, was ich nicht ertragen kann.
Als ich die Tür aufschiebe, sehe ich meine Schwester, wie sie munter, ja fast aufgeregt, über die weißen Fliesen huscht. Ihre Locken tanzen mit ihren Bewegungen. Sie ist dabei, Frühstück zu machen. Aber nicht so wie sonst, denn das wäre vielleicht eine hastige Scheibe Brot im Stehen, an guten Tagen auch mal am Küchentisch. Heute hat Alice alles aufgedeckt, was unsere Küche zu bieten hat, und Pfannkuchen bräunen sich in der Pfanne. Es riecht köstlich. Als sie mich sieht, lächelt sie vorsichtig.
»Möchtest du auch einen Tee?«, fragt sie.
»Gerne«, sage ich misstrauisch.
»Ich dachte, wir könnten gleich zusammen frühstücken?«
»Ja, das wäre schön«, sage ich und nippe an meiner Tasse.
Einen Moment schweigen wir beide.
»Hast du gut geschlafen?«, fragt Alice.
»Nein.«
»Mmh.«
Ich sehe mich ratlos um. Ich hasse es, wenn etwas Unausgesprochenes zwischen uns liegt.
»Die Küche ist immer noch so zerstört.« Vorsichtig macht Alice einen zweiten Versuch. »Der Brandfleck an der Decke sieht echt schlimm aus … Und die Tapete ist auch noch ganz verkohlt.«
»Ja«, sage ich, »wir sollten uns wirklich ans Renovieren machen, damit es hier wieder schön wird.«
»Ich weiß nicht, vielleicht ist es ja auch gar nicht mehr zu retten.«
»Warum sagst du das! Ich bin mir sicher, wir kriegen das wieder hin.« Meine Stimme zittert.
»Aber vielleicht wäre es besser, die Wohnung einfach zu verkaufen. Vielleicht ist es an der Zeit, nach vorne zu sehen.«
Unsere Blicke treffen sich. Lange schauen wir uns an.
»Ich kann verstehen, wenn du das hier zurücklassen willst«, sage ich irgendwann. Ich habe einen Kloß im Hals. »Ich komm schon klar.«
Alice schüttelt leicht den Kopf.
»Was du wieder denkst. Nein, vielleicht gibt es ja noch eine andere Möglichkeit.«
Ich komme nicht mehr mit. Was denn für eine Möglichkeit, sie hat Hinterkamm doch genau so gehört wie ich. Mein Schicksal ist es hierzubleiben. Sie allein hat die Chance, neu anzufangen. Alice mustert mich stumm. Dann nimmt sie eine meiner Haarsträhnen in die Hand und zupft daran herum.
»Du bist so besonders in deiner Erscheinung, weißt du das eigentlich? Du hast so ein feines Gespür, nimmst die Welt viel sensibler wahr, als die meisten es tun.«
»Ja, und das ist mehr als anstrengend.« Ich runzle die Stirn. Worauf will Alice nur hinaus?
»Und gleichzeitig wirkst du immer so unnahbar.«
»Unnahbar?«
»Lass mich doch mal ausreden! Du bist immer so unbeeindruckt von anderen Menschen, das meiste, was sie beschäftigt, interessiert dich nicht. Das schenkt dir eine Distanz, keiner kann dich richtig lesen. Du kommst viel mehr nach Papa als ich, wusstest du das?« Alice lächelt traurig. »Jedenfalls, wenn Leute es nicht besser wüssten, könnten sie glatt denken, du seist aus einer anderen Liga, du seist reich und adelig.«
Ich starre sie an. Macht sie mir jetzt belanglose Komplimente, damit ich mich besser fühle? Damit sie sich guten Gewissens aus dem Staub machen kann?
»Hör zu.« Alices Augen huschen aufgeregt hin und her. »Was ich sagen will: Wenn sie dich nicht nehmen wollen, dann bezahlen wir sie eben dafür, dass du mitkommst.«
Ich blinzle perplex.
»Was?«, stoße ich hervor.
»Hinterkamm hat mich auf die Idee gebracht, ohne dass er es wollte: In der ersten Klasse gibt es noch einige Plätze. Dann bist du eben ein Premium Gast.«
»Wie meinst du das?«
»Wenn keiner weiß, dass wir Schwestern sind? Dann musst du ja nur interessant und reich genug aussehen, dass sie dir ein Ticket verkaufen.«
»Aber das ist verboten!«
»Theoretisch vielleicht. Aber es würde ja keiner mitbekommen.«
»Was? Aber wie?«
»Wenn dich niemand kennt, wissen die Leute nur das über dich, was du ihnen erzählst. Seit der Behördenkrise vor zwei Jahren gibt es doch gar keine richtigen Registrierungen mehr, keine gelisteten Nachnamen und Herkunftsorte. Deshalb reist man bei der EAGOS auch nur unter der zugewiesenen Passagiernummer. Die Behörden sind längst unter der Menge der Menschen zusammengebrochen. Geld ist das Einzige, was noch zählt. Wenn du Geld mitbringst, dann glauben dir die Leute, dass du welches hast. Du kannst einfach sein, wer du sein willst!«
Ich sehe sie erstaunt an. Aus Alices Mund kommen normalerweise nicht solche tollkühnen Ideen.
»Selbst wenn«, sage ich zögerlich. »Wir haben ja überhaupt kein Geld.«
»Wir haben Papas Rücklagen. Und wenn wir zusätzlich alles verkaufen, was wir haben: Die Wohnung, die Möbel, Mamas Schmuck … Ich habe es mal überschlagen.«
»Und?«
»Es reicht gerade für die Überfahrt. Und ein paar Monate würden wir noch auskommen.«
»Aber dann haben wir gar nichts mehr!«
»Sieh uns doch an, Flora, wir haben doch jetzt schon nichts mehr.«
Ihre Worte bohren sich wie ein Spieß durch meine Brust. Voller Erschütterung wird mir klar, dass sie recht hat. Das, was wir haben, ist für uns nichts mehr wert.
***
Mit zitternden Händen öffne ich den Kleiderschrank meiner Mutter. Ein Schwall von Traurigkeit strömt mir entgegen. Der letzte Rest ihres Parfums liegt in der Luft. Egal, wie lange ich gewartet hätte, nie wäre ich auf diesen Moment vorbereitet gewesen. Da hängen, fein säuberlich, ihre Röcke und Blusen. Ganz so, als würde sie gleich kommen, sich etwas herausnehmen und es sich anziehen – vielleicht den gelben Pullover, einen ihrer Lieblinge, oder die zarte, violette Strickjacke. Es ist unvorstellbar, dass sie nicht mehr da ist, aber diese banalen Stoffteile schon. Ich lasse meine Hand über die Bügel gleiten, spüre die Stoffe an meinen Fingern. Ich versuche den Boden nicht unter den Füßen zu verlieren.
»Wir müssen die teuersten Kleider heraussuchen«, sagt Alice. »Nimm das grüne dort, das ist doch gar nicht schlecht.«
Ich gehorche ihr stumm und lege das grüne, mit Perlen besetzte Gewand aufs Bett. Wir finden noch einige weitere Kostüme, die zwar altmodisch aussehen, aber dennoch einer reichen Person gehören könnten. Viel ist es nicht, doch es muss ausreichen.
***





























