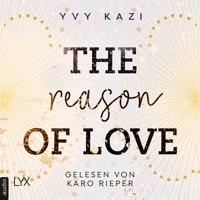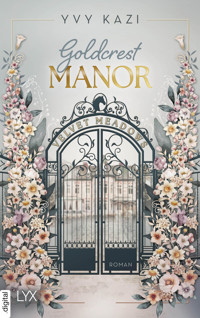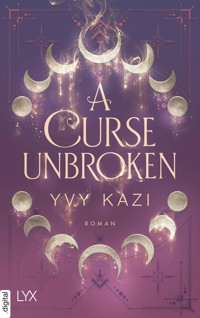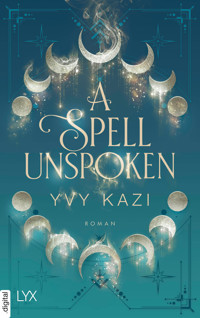
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Magic and Moonlight
- Sprache: Deutsch
Nur gemeinsam können sie den dunklen Zauber aufhalten
Niemals hätte die junge Hexe Gemma Stone geahnt, in welche Gefahr sie geraten würde, als sie Darren Hunter versprach, den Blutfluch zu brechen, mit dem er belegt wurde. Denn die Geheimnisse des schwarzmagischen Zirkels, auf die sie dabei stieß, trafen sie vollkommen unerwartet - genau wie die Gefühle, die Darren in ihr auslöst. Doch als sie der Anziehung nachgeben, merken sie bald, dass ihre Verbindung etwas ganz Besonderes ist. Sie sind bereit, für ihre Zukunft zu kämpfen, und spüren, dass sie nur gemeinsam einen Weg finden werden, das dunkle Unheil, das sie bedroht, noch abzuwenden - auch wenn die Schatten bereits Gemmas Namen flüstern ...
»Moderne Hexerei, ein Kampf zwischen Gut und Böse, Spannung pur und authentische Charaktere treffen auf Romance. I love it!« BOOKCATLADY über A CURSE UNBROKEN
Band 2 der MAGIC & MOONLIGHT-Reihe
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 604
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
INHALT
Titel
Zu diesem Buch
Leser:innenhinweis
Widmung
Motto
Playlist
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
Epilog
Grimoire
Dankesworte
Die Autorin
Die Romane von Yvy Kazi bei LYX
Impressum
Yvy Kazi
A Spell Unspoken
Roman
ZU DIESEM BUCH
Nicht einmal mit einer Tarot-Session hätte die junge Hexe Gemma Stone vorhersehen können, welche Gefahren auf sie lauern würden, als sie versprach, dem mysteriösen Darren Hunter zu helfen. Zwar konnte sie den Blutfluch umgehen, mit dem er belegt wurde, doch die Geheimnisse, auf die sie dabei stieß, trafen sie vollkommen unerwartet – genau wie die Gefühle, die Darren in ihr auslöste. Trotz Darrens gefährlichem Vorhaben, die düsteren Pläne eines schwarzmagischen Zirkels zu vereiteln, der ganz New York unter seine Kontrolle bringen will, entschließt sich Gemma, der Anziehung zu Darren nachzugeben und gemeinsam mit ihm zu kämpfen. Dabei merken die beiden schnell, dass ihre Verbindung etwas ganz Besonderes ist. Etwas, das sie so noch nie gespürt haben und das trotz allem, was passiert ist, so stark ist, wie nie zuvor. Liegt vielleicht in ihren Gefühlen füreinander eine Chance, sich vor dem dunklen Zirkel zu schützen? Gemma und Darren erkennen, dass sie nur gemeinsam einen Weg finden werden, die Bedrohung abzuwenden – auch wenn die Schatten bereits Gemmas Namen flüstern …
Liebe Leser:innen,
wir möchten darauf hinweisen, dass dieses Buch folgende Themen enthält:
Mord, Schilderungen von schweren Erkrankungen und Tod von Familienmitgliedern, Erinnerungen an Mobbing, Pandemie (in der Vergangenheit liegend).
Wir wünschen uns für euch alle das bestmögliche Leseerlebnis.
Eure Yvy und euer LYX-Verlag
Für Shehla und für alle,
die heute ein Licht in der Dunkelheit brauchen
Ein Kuss ist die kürzeste Verbindung zwischen zwei Seelen.
Gemma Stone
PLAYLIST
I Love You (Acoustic) – Woodkid
Someone Else – ClockClock
Unholy – Tomi P
W. I. T. C. H. – Annapantsu
Secret – Louane
WDIA (Would Do It Again) – Rosa Linn
Bad Memories – MEDUZA, James Carter, Elley Duhé, FASTBOY
How Do I Say Goodbye? – Dean Lewis
Rule #27 – Drunk on Pride – Fish in a Birdcage, Philip Bowen
Batshit – Sofi Tukker
Mostly – Vian Izak, Juniper Vale
Once Upon A Dream – Anica Russo
Live Forever – Ely Eira
Keep Me Warm – Juniper Vale, Vian Izak, Ben Laver
Dance with the Fire – Karliene, Roxane Genot
The Good Witch – Maisie Peters
PROLOG
HAZEL
Mittwoch, 23. 11.
Hazel Birds, du bist eine elendige Verräterin, hallt es in meinen Gedanken in Dauerschleife wider. Und obwohl ich mir dieser Tatsache durchaus bewusst bin, schleiche ich mich nachts aus Taros Wohnung und husche im Schutz der Dunkelheit in die nächste Seitengasse.
Dort ziehe ich den Kragen meines Mantels höher und vergrabe die Hände in den Manteltaschen. Der Novemberregen ist unangenehm auf meinen Wangen, und die Kühle der Nacht kriecht selbst durch die Kleidung bis auf meine Haut. Es fühlt sich an, als würden eisige Finger nach mir tasten. Nicht auf dieselbe liebevolle Art, wie Taro in den letzten Stunden meinen Körper erkundet hat, sondern als wollte die Kälte sich bis in meine Knochen graben. Seufzend lasse ich mich gegen eine Backsteinwand sinken und ignoriere den Gestank der nahen Mülltonnen. Vielleicht ist es nicht allzu klug, mich mitten in der Nacht, in einer dunklen Gasse, mit einer Person zu treffen, der ich besser aus dem Weg gehen sollte. Aber wie hätte ich ihre Nachricht ignorieren können?
Es geht um Leben und Tod. – Sechs Worte, die mich bis ins Mark getroffen haben. Eine beängstigende Botschaft – und dasso kurz nachdem mir auch meine beste Freundin Gemma eine kryptische Mitteilung geschickt hat, nun in den Medien als vermeintliche Attentäterin gesucht wird und spurlos verschwunden ist.
Vertraut vorerst niemandem – außer einander. So lauteten ihre letzten Worte, bevor unser Kontakt abbrach.
Ich habe irgendwann damit aufgehört, zu zählen, wie oft ihr Bruder Taro und ich versucht haben, sie in den vergangenen Stunden anzurufen. Es waren unzählige Male. Aber weder Gemma noch Darren reagieren auf Anrufe, Textnachrichten oder E-Mails. Es gefällt mir nicht, Taro in dem Punkt Recht geben zu müssen, doch sie scheinen tatsächlich untergetaucht zu sein – und ich weiß nicht einmal genau weswegen. Auch wenn Taro mir in den letzten Stunden körperlich so nahe war wie noch nie zuvor, ist er nicht dazu bereit, mir zu erzählen, was er über die Hintergründe von Gemmas Verschwinden weiß. Dabei merke ich ihm doch an, dass es irgendetwas gibt, über das er gern mit mir reden würde. Er war es, der mich die vergangenen Monate immer auf Abstand gehalten hat. Und nun? Sucht er meine Nähe. Allein wenn ich daran denke, was wir in den letzten Stunden miteinander getan haben, zieht sich mein Inneres sehnsuchtsvoll zusammen und drängt mich dazu, wieder reinzugehen und zu ihm ins Bett zu steigen.
Ein kalter Windstoß lässt mich erneut frösteln und holt mich auf den nasskalten Boden der Tatsachen zurück. Das hier ist definitiv nicht der richtige Moment für sexy Flashbacks. Ich schließe die Augen, atme tief durch und unterdrücke das leichte Schwindelgefühl, das mich schon den ganzen Tag über begleitet. Vermutlich ist es der dezente Hinweis meines Körpers, dass er neben Taros Nähe auch nach etwas zu essen verlangt.
Erschrocken fahre ich auf, als es neben mir scheppert. Mit viel zu schnell schlagendem Herzen zerre ich mein Handy aus der Manteltasche und schalte die Taschenlampenfunktion ein. Der Lichtkegel tanzt unruhig über die Mülltonnen, spiegelt sich auf der regennassen Straße, aber ich kann nichts Verdächtiges entdecken.
»Hallo?«, rufe ich und klinge selbstbewusster, als ich mich fühle. Da nehme ich aus dem Augenwinkel eine Bewegung wahr, und mir rutscht das Herz in die Hose. Das Licht meines Handys zuckt in die Richtung, aber alles, was ich sehe, sind zwei grüne Punkte, die mir aus der Dunkelheit entgegenleuchten. Sie verschwinden kurz, nur um dann wieder aufzutauchen. War das ein Blinzeln? Erleichtert atme ich auf, als sich eine große, schwarze Katze aus den Schatten löst. Obwohl es der imposanten Erscheinung nach wohl eher ein Kater ist. Mit geschmeidigen Bewegungen schreitet er auf mich zu und maunzt leise. Er ist ein hübsches Tier, viel zu gepflegt für eine Straßenkatze, denn sein seidiges Fell glänzt selbst in der schwachen Beleuchtung meines Telefons.
Es ist eine komische Empfindung, doch irgendwie hilft mir seine Anwesenheit dabei, mich ein wenig zu entspannen.
»Hey, du Schönheit.« Langsam sinke ich in die Hocke, strecke vorsichtig eine Hand in Richtung des Tieres aus und lasse es selbst wählen, ob es gestreichelt werden oder fliehen möchte. Es entscheidet sich für Ersteres und schmiegt sich schnurrend an meine Beine. Behutsam streichle ich über sein weiches Fell und spüre, wie sich mein Herzschlag beruhigt. Seine Wärme und sein behagliches Schnurren erden mich sofort, dennoch irritiert mich etwas an ihm. Erneut kraule ich ihn an einem Ohr, dann seinem Hals. Es dauert einen Moment, bis ich das Gefühl einordnen kann.
»Hast du irgendwo dein Halsband verloren?«, frage ich besorgt und taste erneut danach, aber er trägt keines. Der Kater sieht sauber aus, wohlgenährt und athletisch. Wie ein Freigänger, der zu Hause von seiner Familie erwartet wird. »Sag mir, dass man dich wenigstens kastriert hat, bevor deine Menschen dich rausgelassen haben«, bemerke ich. Die Tierarzttochter in mir kann nicht anders, als das zu überprüfen. Ich spüre, wie sich das Tier unter meinem Griff versteift. Der Blick, den es mir zuwirft, wirkt beinahe vorwurfsvoll. »Entschuldige, Mister, aber deine Familie erscheint mir etwas verantwortungslos zu sein, dich so auf die Straße zu lassen. Lass dich bloß nicht von Tierfängern erwischen.«
Da erklingen schnelle Schritte auf dem Asphalt. Ich hebe den Kopf und blicke die Straße hinunter. Hastig erhebe ich mich, als eine Person in die Gasse einbiegt. Selbst in der spärlichen Beleuchtung erkenne ich ihre Lockenmähne sofort: Beryl.
Ein Fauchen ertönt, als sie sich mir nähert. Mit gesträubtem Fell und erhobenem Schwanz schiebt sich die Katze vor mich. Es wirkt, als würde sie Beryl kennen und könnte sie nicht leiden – oder als hätte sie soeben beschlossen, mich zu beschützen.
Beryl respektiert die Warnung und verharrt in einer Armlänge Entfernung. »Du bist gekommen«, stellt sie in einem Tonfall fest, der für mich nicht zu deuten ist.
»Du hast in deiner WhatsApp-Nachricht behauptet, es ginge um Leben und Tod«, erwidere ich. »Es fällt mir schwer, so etwas zu ignorieren. Du kannst übrigens froh sein, dass Taro gerade im Bad war, als sie eintraf. Er wäre nicht sehr begeistert davon, wenn er wüsste, dass ich deine Nummer noch nicht blockiert habe, obwohl er mich mehrfach darum gebeten hat. Weswegen auch immer. Mir erzählt ja niemand etwas.«
Mit einem letzten warnenden Fauchen in Beryls Richtung wendet sich die Katze von uns ab, springt auf eine der Mülltonnen und bleibt dort sitzen, als wollte sie uns belauschen. Ihr Schwanz zuckt unruhig von einer Seite zur anderen, während sie Beryl nicht aus den Augen lässt. Ein eigenartiges Tier.
»Bist du allein?«, fragt Beryl ohne Umschweife.
»Von der streunenden Katze abgesehen, ja. Ich nehme an, für dich gilt das nicht?« Ich habe nicht vergessen, dass Beryl mit Geistern reden kann und angeblich permanente Begleitung von ihrer verstorbenen Grandma hat. Ich weiß zwar nicht so recht, wie ich mir das vorstellen soll, aber ich glaube Gemma, dass dem so ist. Seitdem ich Gemma getroffen habe, habe ich vieles kennen und akzeptieren gelernt, das ich davor für unvorstellbar hielt. »Taro schläft tief und fest, er wird uns hier also nicht überraschen. Trotzdem wird ihm früher oder später auffallen, dass ich nicht mehr in seinem Bett liege. Also komm zum Punkt«, dränge ich.
»Unter anderen Umständen hättest du dir für die Eroberung des Unnahbaren ein Highfive von mir verdient, aber wie du wünschst: Weißt du, wo Gemma und Darren sich aufhalten?«
»Wenig subtile Frage, aber nein.« Es ist keine Lüge, ich hatte seit Tagen keinen Kontakt zu ihnen. Ich habe allenfalls eine Vermutung darüber, wohin sie verschwunden sein könnten, da jedoch keiner von beiden erreichbar ist, bin ich so ahnungslos wie Beryl. »Ich weiß nicht, wo sie sich versteckt halten. Ich weiß nicht mal, ob sie zurzeit noch in New York oder überhaupt den USA sind. Darrens Dad hat so verdammt viel Geld, dass er bestimmt einen Privatjet besitzt, der sie außer Landes bringen könnte.«
»Den hat er. Und er ist unangetastet.«
»Dann bist du offensichtlich besser informiert als ich. Warum also dieses mysteriöse Treffen? Allein, um ein Uhr nachts.«
Beryl zieht etwas aus ihrer Jackentasche. Wenn mich nicht alles täuscht, ist es ein zusammengefalteter Zettel. »Weil du mit dieser ganzen Sache eigentlich nichts zu tun hast, habe ich dir etwas mitgebracht. Ich mag dich. Ich meine, sieh dich an: Du bist zauberhaft, und die Menschheit hat es nicht verdient, jemanden wie dich zu verlieren, nur weil du mit den falschen Leuten befreundet bist.«
»Wie meinst du das?«, frage ich verwundert. Ich höre ihre Worte, kann aber nicht behaupten, dass ich sie begreife. Was sollte an Gemma und Darren falsch sein?
»Nimm das. Und halte Abstand von Taro.« Sie zögert, bevor sie mir das Blatt Papier hinhält.
Vollkommen durcheinander nehme ich es entgegen. »Ich verstehe gar nichts.«
Noch immer halte ich mein Handy in einer Hand und falte mit der anderen umständlich den Zettel auseinander. Jemand hat eine Zeichnung darauf gekritzelt, die ich nicht deuten kann. Sie wirkt wie eine Kreuzung aus Kleeblatt und Pik-Symbol. Ich sehe außerdem das Logo der Less-Homeless-Foundation und eine Art tabellarische Auflistung.
Am unteren Ende wurde eine Zeile farbig markiert: GenetischeDispositionvorhanden.GenomischeDNA:TypS2.
»Was soll das heißen?«, frage ich irritiert. Wobei soll mir dieser Zettel weiterhelfen?
»Das da ist der Beleg dafür, dass du auf dich aufpassen solltest. Und vor allem auf dein Herz«, lautet ihre schlichte Antwort.
Bevor ich etwas erwidern kann, wendet sie sich bereits zum Gehen.
Blinzelnd sehe ich ihr nach und versuche, diese Begegnung zu rekapitulieren. Was für ein eigenartiges Treffen war das bitte? Statt mich klüger zu fühlen, bin ich einfach nur verwirrt.
Ich stecke den mysteriösen Zettel in meine Manteltasche und drehe mich zu der Katze herum, doch sie ist verschwunden.
Vermutlich ist es so besser für sie. Ich war kurz davor, sie einzupacken und im Rahmen des Streuner-Prävention-Programms meiner Mom kastrieren zu lassen.
Mir ist kalt, und trotz Beryls eigenartiger Warnung kann ich es nicht erwarten, mich wieder in Taros Bett zu kuscheln.
1. KAPITEL
GEMMA
Dienstag, 22.11.
Mein Kopf, er pulsiert im Takt dumpfer Schmerzen.
Die Umgebung kommt mir gedämpft vor, zu fern und gleichzeitig zu laut. Mir ist, als wäre ich in warme Watte gehüllt. In einen Kokon, der mich ebenso schützt wie lähmt. Erst einen Moment später begreife ich, dass ich tatsächlich in eine Wolldecke eingewickelt bin, die mir jemand um die Schultern gelegt hat. Schwerfällig befreie ich meine zitternde, eiskalte Hand daraus und reibe mir über die pochende Schläfe. Ich fühle mich, als hätte ich den schlimmsten Kater meines Lebens. Alles tut mir weh, meine Zunge ist trocken, mein Körper träge und eine unterschwellige Übelkeit breitet sich in meiner Magengrube aus. Es ist nicht die beste Voraussetzung, um in einem fahrenden Auto zu sitzen, aber die Mischung aus Motorengeräuschen, dem Rauschen der Lüftung und dem leichten Geschaukel lässt kaum Interpretationsspielraum, was meinen Aufenthaltsort betrifft.
»Gem?«
Es ist nur ein kurzes Wort, aber ich erkenne seine Stimme sofort: Darren. Mein Herz legt bei diesem Klang einen erleichterten Hüpfer ein. Zu wissen, dass er in der Nähe ist, macht meine Kopfschmerzen zumindest minimal erträglicher.
»Sag mir, dass wir noch leben«, bitte ich. Oder versuche es, doch meine Stimme ist kaum mehr als ein heiseres Krächzen. Ich öffne die Augen und blinzele mehrfach, bevor sich der trübe Schleier von meinen Augen hebt. Mein Kopf lehnt an der Beifahrertür eines Autos, das mir nicht bekannt vorkommt. Wir sitzen definitiv nicht in Darrens Tesla. Dem Stand des Mondes nach scheint es mitten in der Nacht zu sein. War es nicht eben noch Morgen? Hatte nicht gerade erst ein neuer Tag begonnen? Der Tag, an dem ich mit gestohlenen Beweisen in das Büro des Bürgermeisters gegangen bin. Es war der Morgen, an dem alles so entsetzlich schiefgelaufen ist, als man Darrens Eltern ermordet hat. Der Morgen, an dem ich Blutmagie einsetzen musste, um uns zu retten.
Ich erinnere mich.
Schweigend betrachte ich meine Hand, das sorgsam angebrachte Pflaster über dem Schnitt an meinem Zeigefinger und die Spuren der feinen Brandbläschen auf der geröteten Haut meines Unterarms. Zeichen für das eindeutige Überschreiten einer Grenze. Ich kneife leicht die Augen zusammen, betrachte die schillernde Aura, die meine Finger umgibt. Vielleicht hat sie unter meiner Verzweiflungstat gelitten, ist aber noch immer sehr viel kräftiger als Darrens. Der Preis für unsere Flucht war offensichtlich nicht allzu hoch – zumindest, wenn ich von dem Stich meines schlechten Gewissens absehe, das mich daran erinnert, dass ich wissentlich und willentlich einem anderen Menschen geschadet habe. Er war zwar ein Hexer der dunklen Künste, aber ein Mensch bleibt immer noch ein Mensch.
»Wie geht es dir?«, fragt Darren besorgt und schenkt mir einen flüchtigen Seitenblick, während ich sein Profil mustere.
In einer der letzten Erinnerungen vor meiner Bewusstlosigkeit liegt er vor Schmerzen gekrümmt auf dem Fußboden. Mich fröstelt, wenn ich nur daran denke, dass ich ihn hätte verlieren können. So wie er seine Eltern verloren hat. Er hätte tot sein können, denn unsere Feinde schrecken vor nichts zurück.
Ihr beide hättet tot sein können, korrigiert mich das Dröhnen in meinem Kopf.
Wenn ich ehrlich wäre, müsste ich wohl gestehen, dass ich mich so miserabel fühle, dass eine erneute Ohnmacht mir gerade sehr verlockend erscheint, aber damit werde ich Darren sicher nicht belasten. Ich will nicht, dass er sich Sorgen um mich macht. Er hat genug eigene Probleme.
»Alles okay bei dir?«, fragt er erneut, da ich noch immer nicht geantwortet habe. »Du siehst blass aus.«
»Ich bin nur müde, obwohl ich offensichtlich einen ganzen Tag verschlafen habe.« Ich sehe aus dem Fenster zum Mond hinauf. Seine Sichel ist der Beweis dafür, dass es tatsächlich nur ein Tag gewesen sein kann. Schwacher Trost. »Wohin fahren wir?«
»Nach Michigan, zu deinen Moms. Zumindest mehr oder weniger. Ich weiß durch deine alten TikTok-Videos zwar ungefähr, wo ihr gewohnt habt, und dass euer Haus ein ehemaliges Kinderheim in der Nähe von Bay City ist, aber ehrlich gesagt nehmen wir diesen Umweg nicht aus taktischen Gründen, sondern weil ich mich irgendwo verfahren habe. Nachdem ich herausgefunden hatte, wie man die Ortungsdienste in diesem Fahrzeug ausstellen kann, habe ich unsere Handys …«, er zögert, als würde er nach dem richtigen Wort suchen, »entsorgt. Seitdem frage ich mich minütlich, wie die Menschen früher zurechtgekommen sind.«
»Kompass und Landkarte?«, erwidere ich.
»Hab’s versucht. Bin gescheitert.« Darren deutet mit einer fahrigen Geste hinter uns.
Mein Kopf protestiert unter erneuten Schmerzen, als ich mich zu schnell herumdrehe. Mit etwas Fantasie war das zusammengeknüllte Stück Papier auf der Rückbank mal eine Straßenkarte, die sich geweigert hat, sich wieder ordentlich zusammenfalten zu lassen.
»Irgendwie tröstlich zu sehen, dass selbst du nicht perfekt bist«, murmle ich schmunzelnd und lasse mich zurück in meinen Sitz sinken.
»Falls ich diese Illusion bis eben aufrechterhalten konnte, sollte ich vielleicht auch darstellendes Spiel studieren«, schlägt er vor und bringt mich damit zum Lachen.
Ich bereue meinen kurzen Gefühlsausbruch, da sich mein Kopf anfühlt, als würde er zerspringen. Auch wenn ich es hasse, es mir eingestehen zu müssen: Ich bin alles andere als fit.
Darren streicht unruhig mit den Händen über das Lenkrad, als würde ihn etwas beschäftigen. Es dauert einige Sekunden, bis er mit der Sprache herausrückt. »Denkst du denn, es ist okay, wenn wir zu deinen Moms fahren? Oder soll ich umdrehen, um sie keiner Gefahr auszusetzen? Vielleicht wäre es besser, sie nicht in diese Sache hineinzuziehen, aber ich wusste nicht, wohin wir sonst können.«
»Ist okay«, antworte ich matt. »Ich wäre auch zu ihnen gefahren. Meine Moms kennen die besten Schutzzauber der Welt. Für ein paar Tage sollten wir dort sicher sein.«
»Ich dachte nicht unbedingt nur an unsere Sicherheit«, wirft er ein.
Das weiß ich, doch mir ist auch bewusst, dass meine Moms darauf bestehen würden, uns zu helfen.
»Du hast nicht zufällig gesehen, ob Taro mir als Reaktion auf meine Warnung noch irgendwas geantwortet hatte, bevor du mein Handy entsorgt hast?«, wechsle ich das Thema und ziehe mir die Wolldecke bis zu den Ohren hoch, weil ich erbärmlich friere, obwohl die Wagenheizung ihr Bestes gibt.
»Er hat ein Emoji geschickt. Ich vermute, die Botschaft sollte heißen: Ich habe es euch gleich gesagt, es war eine dumme Idee, aber ich habe hier alles im Griff, also bringt euch in Sicherheit.«
»Alle Achtung. Das hast du aus einem einzigen Smiley erkannt?«, ziehe ich ihn auf und drehe meinen Kopf so, dass ich meine Stirn gegen die kühle Fensterscheibe lehnen kann.
»Es war der Smiley von dem Typen, der sich vor den Kopf schlägt. Der bietet nicht allzu viel Interpretationsspielraum. Davon abgesehen kenne ich Taro und Hazel nicht annähernd so gut wie du und bin mir trotzdem sicher, dass sie auch ohne uns zurechtkommen.« Er schenkt mir einen erneuten Seitenblick, der warm auf meiner Haut kribbelt. Ich muss ihn nicht erwidern, um zu wissen, dass Darren besorgt die Stirn runzelt. »Du siehst wirklich nicht gut aus. Wir sollten dir irgendwo etwas zu trinken besorgen. Am besten an einer Tankstelle, denn ich fürchte, der Sprit wird nicht mehr bis zu deinen Moms reichen, und ich würde ungern mitten im Nirgendwo liegenbleiben.«
»Wessen Auto ist das eigentlich?«
»Wieso klingt es schon wieder, als würdest du mir zutrauen, Autos zu stehlen?«, beschwert er sich halbherzig, aber ich bin zu erschöpft, um auf seinen Witz einzusteigen. »Falls es dich beruhigt: Der Wagen gehört mir. Ich hatte ihn in Dads Tiefgarage unter dem Haus gelassen, weil es in New York schon mühsam genug war, für das eine einen Parkplatz zu finden. Glücklicherweise ist es sofort angesprungen, aber der Tank war nur noch halb voll.«
»Wird schwierig, irgendwo anzuhalten, das Auto aufzutanken und einkaufen zu gehen, wenn man in den landesweiten Medien gesucht wird«, werfe ich ein. Obwohl ich meine Haarfarbe sehr liebe, macht sie es auch nicht unbedingt einfacher, unerkannt zu bleiben. Ich taste nach den Kettenanhängern um meinen Hals. Der Turmalin ist durch den Faszinationszauber beim Abendevent in der L. I. F. E. Inc. komplett entladen, aber der Bergkristall verfügt noch über ein wenig Restenergie. Leider ist Neumond erst morgen, sonst hätte ich uns spontan noch etwas Mondwasser herstellen können, um einen improvisierten Tarnzauber zu stärken, aber so habe ich nur ausreichend Mittel für eine sehr kurzfristige Täuschung zur Hand. Wir werden wohl oder übel eine eher abgelegene Tankstelle aufsuchen müssen, bei der mich nur wenige Menschen zu Gesicht bekommen. Denn je stärker die Realität manipuliert werden muss, umso mehr Energie wird dafür verbraucht und desto schneller verfliegt auch die tarnende Wirkung des Zaubers. Wenn mir denn überhaupt ein Spruch mit einer Bitte an die Magie einfällt. Momentan bin ich so erledigt, dass selbst Denken anstrengend ist.
»Hast du vielleicht eine Idee, wie ich die Magie um Hilfe bitten könnte, damit ich unerkannt bleibe? Mein Kopf fühlt sich noch immer wie leer gefegt an«, gestehe ich.
»Was kein Wunder ist, du warst stundenlang bewusstlos.« Darren schenkt mir erneut einen flüchtigen Seitenblick, als wollte er meine Reaktion abchecken, doch ich bin zu erschöpft, um irgendetwas außer Müdigkeit und Schmerz zu empfinden. »Ehrlich, Gem. Ich hätte dich am liebsten gepackt und sofort ins Krankenhaus geschafft. Ich will dir keine Vorwürfe machen, aber mit dieser Art der dunklen Magie ist nicht zu spaßen. Vor allem, wenn man sich damit nicht auskennt. Ich weiß, dass ich Blutmagie schon selbst angewendet habe. Doch die Flüche, die ich mit ihrer Hilfe gewirkt habe, waren sehr viel harmloser als dein Zauber und haben mich trotzdem einiges an Lebensenergie gekostet. Wenn du nicht so ein herausragendes Magiemedium wärst … Du hättest tot sein können, Gem. Diesen Hexer ins Land der ewigen Träume zu schicken war eine gute Idee, aber auch verdammt riskant.«
»Es wäre noch riskanter gewesen, nichts zu unternehmen«, halte ich dagegen. »Oder wäre es dir lieber gewesen, hätte ich einfach nur neben dir gestanden und ihn dich umbringen lassen? Das wäre nämlich die Alternative gewesen. Er hätte erst dich und dann mich getötet. Und uns vorher gequält, einfach nur, weil es ihm Spaß zu machen schien.«
»Das weiß ich. Und ich will wirklich nicht klingen, als wäre ich undankbar. Ich möchte einfach nur, dass du ein wenig auf dich aufpasst. Das ist alles.« Er zögert, bevor er eine Hand in meine Richtung ausstreckt, als wollte er meine Decke richten, stattdessen befreie ich mich daraus und schiebe meine Finger zwischen seine. Seine Haut auf meiner zu spüren schenkt mir ein wärmeres Gefühl als die Heizung. »Ich …« Darren verstummt, atmet tief durch und streicht mit seinem Daumen über meinen Handrücken. Es wirkt, als wollte er noch etwas ergänzen, atmet stattdessen tief durch und festigt seinen Griff. »Ich will dich einfach nicht auch noch verlieren. Das ist alles«, erklärt er so schlicht, als wäre er bemüht, jede Emotionalität zurückzuhalten.
Nickend hebe ich den Kopf von der Scheibe und betrachte Darren erneut. Die Ereignisse sind auch an ihm nicht spurlos vorbeigegangen. Er sieht müde aus, blass, tiefe Schatten liegen unter seinen Augen, und seine Haare sind so zerzaust, als hätte er sie mehrfach aus Verzweiflung gerauft.
Vermutlich sind wir schon seit Stunden unterwegs. Stunden, in denen er weder geschlafen noch sich eine Pause gegönnt hat.
»Wie geht es dir?«, frage ich leise, ziehe die Beine an und lege meinen freien Arm darum. Seine Eltern sind gestorben, auch er wird von den Medien gesucht, man hat ihn gefoltert, und ich habe keine Erinnerungen daran, wie er meine Wunde versorgt oder mich in dieses Auto geschafft hat.
»Ich komme zurecht«, verspricht er. Das mag stimmen, aber vermutlich ist es nicht mehr als das: Er funktioniert, weil er es muss. Weil wir in diesem Moment keine andere Wahl haben, als uns zusammenzureißen, wenn wir nicht gefasst werden wollen.
Denn Fakt ist: Dies ist kein romantischer Pärchenausflug. Wir sind auf der Flucht, weil ich Daten geklaut und ausgehändigt habe, die Darrens Dad überflüssig gemacht haben. Mein Verrat hat dafür gesorgt, dass er leicht zu ersetzen war. Jetzt sind Darrens Eltern tot. Und wir? Wissen zu viel.
»Der Hexer«, beginne ich zögerlich, da sich mit meinen erwachenden Sinnen auch mein moralischer Kompass zurückmeldet. »Hat er überlebt?«
Darren nickt. »Hat er. Er ist in einem magischen Schlaf gefangen – oder er war es. Es gibt in seinem Zirkel sicher ausreichend fähige Hexende, um ihn daraus wieder zu befreien.«
»Das ist gut. Ich wollte ihm nicht wirklich schaden. Ich wollte nur, dass … Keine Ahnung. Dass wir die Möglichkeit haben, zu entkommen.«
»Das weiß ich«, versichert Darren, drückt leicht meine Hand und reibt erneut mit dem Daumen darüber. »Du bist noch immer eiskalt. Wir sollten dir dringend etwas zu essen besorgen, damit du wieder zu Kräften kommst. Kannst du mir dabei helfen, die Augen nach einer Tankstelle offen zu halten?«
Ich nicke und sehe aus dem Fenster, aber in der Dunkelheit fällt es auch mir schwer, mich zu orientieren.
»Wie wäre es mit: Magic of life and destiny, don’t let the people recognize me«, schlägt Darren nach einer Weile vor.
Es dauert ein paar Sekunden, bis ich begreife, dass das sein Vorschlag für die Formulierung des Tarnzaubers ist. Der Spruch klingt gut und könnte funktionieren. Auch wenn es mir etwas ironisch erscheint, einen Bergkristall um eine Art Verschleierungszauber zu bitten, wo er doch ursprünglich für Weitsicht und Klarheit steht. Aber so ist das mit der Magie: Sie funktioniert immer in beide Richtungen.
»Findest du, wir sollten Kristen und dem magischen Zirkel, der sie unterstützt, einen Spitznamen geben?«, fragt Darren unvermittelt. »Gestaltwandelnde und Hexende, die gemeinsam New York unterwandert haben und zur Erreichung ihrer Ziele über Leichen gehen ist in Gesprächen etwas sperrig.«
»Guter Einwand«, murmle ich, aber meine Kopfschmerzen lenken mich zu sehr ab, um mir etwas einfallen zu lassen. »Hast du eine Idee?«
»Wie wäre es einfach mit Crow Coven?«, schlägt Darren vor.
»Weil die Seelen der Mitglieder so nachtschwarz wie Krähenfedern sind?«, vermute ich. Vielleicht steht DarkDuke-Darren aber auch einfach auf Alliterationen. Wenn ich ehrlich sein soll, ist mir vollkommen egal, wie wir Kristens Leute nennen, denn im Grunde ist jeder Name zu schön für deren ekelhafte Machenschaften. Eigentlich habe ich auch gar nichts gegen Krähen, aber ein Schwarm Aasfresser ist dennoch ein passendes Bild für Kristens finstere Gemeinschaft.
Mit Darrens Schulterzucken ist es besiegelt: Von nun an nennen wir Kristen und ihre Verbündeten Crow Coven.
2. KAPITEL
GEMMA
Als Darrens Blick immer häufiger zur Füllstandsanzeige des Tanks zuckt, kann ich nicht anders, als das Universum um ein wenig Beistand zu bitten. Mag sein, dass es nur ein Zufall ist, dass uns kurz darauf die Leuchtreklame einer etwas abseits gelegenen Tankstelle auffällt. Aber wer glaubt noch an Zufälle?
Kaum hat Darren an einer der Zapfsäulen geparkt, mustert er mich mit einem Ausdruck, den ich nicht deuten kann. Als hätte er Angst, dass ich erneut bewusstlos werden könnte, oder als wäre er sich noch immer unsicher, ob der von ihm ausgedachte Zauberspruch wirklich dafür geeignet ist, mich vor den aufmerksamen Blicken unserer Mitmenschen zu schützen. Doch ich bin davon überzeugt, dass es funktionieren wird. Ich vertraue ihm und der Magie.
Er holt tief Luft. »Auf einer Skala von eins bis zehn: Wie nervig ist es, wenn ich dich erneut bitte, auf dich aufzupassen?«
»Dreikommafünf«, antworte ich und schaffe es, ihn anzuzwinkern.
»Und du bist dir ganz sicher, dass du gehen willst?«, hakt er nach. »Ich könnte …«
»Du könntest den Zauber selbst übernehmen und noch mehr deiner Lebensenergie opfern, um dich an meiner Stelle in Gefahr zu bringen«, falle ich ihm ins Wort. »Wolltest du das vorschlagen? Bedaure, DarkDuke. Wenn ich die Wahl zwischen der Intaktheit meines moralischen Kompasses und deiner Gesundheit habe, gewinnt Letztere.«
Vor gar nicht allzu langer Zeit habe ich Darren einmal gesagt, dass das Täuschen von Menschen nicht mit der Lehre der weißen Magie vereinbar ist. Prinzipiell glaube ich das auch immer noch, hier steht allerdings sehr viel mehr als die Reinheit meiner Seele auf dem Spiel. Unzähligen Menschen soll die Lebensenergie entzogen werden, um sie in einer Art Medizin zu konzentrieren, die Darrens Dad mithilfe schwarzer Magie entwickelt hat. Er hat für deren Herstellung die Obdachlosen New York Citys geopfert und behauptet, dass er der Stadt damit einen Gefallen tun würde. Widerlich. Doch wer weiß, was Kristens Leute nun vorhaben? Nachdem ich ihnen aus purer Naivität die Unterlagen mit der Anleitung zur Herstellung der Medizin ausgehändigt habe, war Darrens Dad überflüssig. Sie konnten ihn umbringen und durch einen Gestaltwandler ersetzen, um so die Geschäfte der L. I. F. E. Inc. zu übernehmen. Als wäre das verbotene Allheilmittel an und für sich nicht schon abartig genug, kann man es sogar noch anderweitig missbrauchen. Dank dem hochgradigen Magieanteil der Mixtur ist sie auch für Hexende wertvoll und als Instantmagie nutzbar. Ein Shot verleiht einen kurzen Energieschub für einen spontanen Zauber der dunklen Künste – keine Kristalle benötigt. Ich frage mich noch immer, wer als Erster auf die Idee gekommen sein mag, die Medizin als Energiequelle zu nutzen. Nicht einmal in der Theorie klingt es verlockend, für eine Allmachtsfantasie Menschen zu opfern. Zumindest nicht für mich. Statt die Naturgesetze derart zu pervertieren, bevorzuge ich die klassische Energielehre. Und so umfasse ich den Bergkristall, um den Tarnzauber zu wirken. Ich schließe die Augen und atme tief durch. Die Energie des Kristalls streichelt sacht über meine Handfläche, als wollte sie mich begrüßen. Es ist nur eine zaghafte Berührung, kein kräftiger Händedruck. Eine erneute Bestätigung dafür, dass die Ladung schwach ist und den Zauber nicht lang aufrechterhalten wird. Aber ein Versuch ist besser als keiner, also murmle ich den von Darren erdachten Spruch und spüre, wie meine Finger wärmer werden. Ein untrügliches Zeichen dafür, dass die Magie ihre Wirkung entfaltet. Der Tarnzauber wird allerdings augenblicklich verfliegen, sobald die Energie des Kristalls verbraucht ist – was vermutlich nicht allzu lange dauern wird. Die Realität permanent zu verzerren braucht für gewöhnlich mehr Energie, als sie ein so kleiner Kristall beherbergt.
»Es sollte funktionieren«, sage ich entschieden und sehe Darren an, der mich besorgt mustert.
»Okay, aber wenn du den Eindruck hast, dass der Zauber versagt, komm sofort zurück«, drängt er.
»Ich kriege das schon hin, Mr Der-Zweck-heiligt-die-Mittel«, ziehe ich ihn auf. »Wenn ich in zehn Minuten nicht wieder da bin, fahr ohne mich weiter«, sage ich und öffne die Beifahrertür von Darrens Auto.
»Sehr amüsant.«
»Das war kein Scherz«, versichere ich, versuche, meine Müdigkeit niederzuringen, und schenke ihm ein Lächeln. Kurz überlege ich, ihm einen Abschiedskuss zu geben, aber unterdrücke den Impuls. Das hier soll kein Abschied werden, also ist kein Kuss nötig. »Ehrlich, Hunter. Wenn ich nicht zurückkomme, gönne mir wenigstens einen heroischen Filmmoment. Du weißt schon: Lass mich hier allein zurück. Fahr ohne mich und drehe dich nicht mehr nach mir um.«
Darren rümpft die Nase, als würde ihm meine Antwort missfallen, doch ich meine es ernst. Man hat mehrfach damit gedroht, ihn umzubringen, sollte man ihn erwischen. Daran kann ich nichts Witziges finden. Es ist mir bedeutend lieber, wenn er allein entkommt, als dass sie uns beide festnehmen.
»Du solltest mich gut genug kennen, um zu wissen, dass ich niemals ohne dich fahren würde«, erwidert er trocken und überreicht mir zwei Geldscheine.
»Lass uns wann anders über die Bedeutung des Wortes niemals diskutieren. Drück mir lieber die Daumen, dass alles gut geht und bis gleich«, sage ich so entschieden, als wollte ich ihn, mich und unser Schicksal gleichermaßen davon überzeugen, dass ich wiederkomme.
Kaum bin ich ausgestiegen, werde ich von kaltem Regen und einem nachtschwarzen, sternenlosen Himmel begrüßt, der hervorragend zu unserer bedrückenden Situation passt. Noch immer trage ich das dünne Unterkleid des Kostüms, in dem ich schon die Theateraufführung in der L. I. F. E. Inc. fluchtartig verlassen habe. Darüber habe ich Darrens Lederjacke gezogen, deren Kragen ich mir bis zum Kinn hochschlage, als der Novemberwind über den abgelegenen Parkplatz der Tankstelle bläst. Auf der Suche nach Schutz vergrabe ich meine Hände in den Jackentaschen. Auch wenn ich mich bemühe, der Magie zu vertrauen, bin ich unterschwellig nervös. Theoretisch trennen uns nur noch ein paar Stunden von unserem vorläufigen Ziel, aber was hilft es, wenn man uns hier erwischt? Wie auf ein Kommando hin rebelliert mein Magen lautstark. Fast so, als wollte er mit dem plötzlich einsetzenden Donner konkurrieren und mich daran erinnern, dass wir unsere Energiereserven ebenfalls zwischendurch auffüllen müssen.
»Ganz ruhig, vertrau der Magie. Alles wird gut«, murmle ich mir selbst zu und nähere mich dem Eingang des der Tankstelle angeschlossenen Supermarkts.
Wenn ich nicht den Schein mehrerer schwacher Lampen hinter der großen Fensterfront erahnen würde, käme er mir verlassen vor. Vielleicht hat das miese Wetter also etwas Gutes: Es ist so wenig einladend, dass sich kaum jemand die Mühe gemacht hat, hier rauszufahren. Auf dem Parkplatz stehen neben unserem nur zwei in die Jahre gekommene Autos mit hiesigem Kennzeichen. Normalerweise wäre diese Tankstelle nicht meine erste Wahl, um mir einen Snack zu besorgen, aber gerade die Abgeschiedenheit macht sie perfekt, um die Wirksamkeit des Tarnzaubers zu testen. Weniger Augenzeugen bedeuten auch weniger Energie, die zum Aufrechterhalten des Zaubers aufgewendet werden muss.
Der Takt meines Herzens ist sicher dreimal schneller als der meiner Schritte, während ich durch den Regen in Richtung der Eingangstür husche. Schon nach wenigen Metern bin ich bis auf die Socken durchnässt, aber das ist nicht der Grund für meine eiskalten Finger und Zehen. Ich brauche dringend etwas zu essen und eine Runde Schlaf. Auch wenn ich versuche, es mir vor Darren nicht anmerken zu lassen: Mir geht es noch immer miserabel. Doch es hilft nichts, ich muss die Zähne zusammenbeißen.
Es wird schon werden. Es muss einfach, wiederholen meine Gedanken in Dauerschleife.
Als die Schiebetür vor mir aufgleitet, betrachte ich flüchtig mein verschwommenes Spiegelbild auf der regennassen Glasscheibe. Ob das wohl in etwa dem entspricht, was die übrigen Menschen erblicken, wenn sie mich betrachten? Ich sehe mich, wie ich hier stehe. Unweigerlich real und ziemlich durchnässt. Aber das doppelte Glas, die schummrige Innenbeleuchtung und die feuchte Oberfläche lassen die Details verschwimmen. Meine Haar- oder Augenfarbe? Unmöglich zu bestimmen.
Ich atme ein letztes Mal tief durch und betrete den Supermarkt. Meine Schuhe quietschen unangenehm laut auf dem Linoleumboden in Schachbrettmuster und untermalen jeden meiner Schritte in Richtung einer Kühltheke, als wollten sie sichergehen, dass man mich auch ja zur Kenntnis nimmt. Zum Glück vergeblich. Ein Mann steht vor dem Zeitschriftenregal und beachtet mich gar nicht. Er blättert durch irgendein Magazin, während die Bedienung hinter dem Tresen kaugummikauend zu einem Fernseher an der Wand aufsieht, dann eine Nachricht auf ihrem Smartphone beantwortet.
Ich greife schnell je zwei abgepackte Käsesandwiches und Wasserflaschen aus der Kühlung.
Dann wollen wir mal hoffen, dass der Tarnzauber wirkt. Bitte funktioniere, wiederhole ich mein Mantra, unterdrücke den Impuls, meinen Kettenanhänger schon wieder prüfend anzufassen, und trete an den Tresen heran.
Es dauert einen Moment, bis die Kassiererin mich bemerkt. Gelangweilt blickt sie von ihrem Handy auf – stutzt und blinzelt. Sie mustert mich, hebt eine Augenbraue.
Warum sieht sie mich so aufmerksam an?
Augenblicklich rutscht mir das Herz in die Hose. Wir haben extra einen recht frühen Stopp eingelegt, um auch ohne diese Tankladung noch ein paar Kilometer von hier fliehen zu können, sollte der Tarnzauber versagen und man uns erkennen … Aber was dann? Wie weit sollen wir kommen? Wir befinden uns hier mitten im Nirgendwo. Ohne Handys. Ohne Notproviant. Nur mit einer vollkommen zerknickten Landkarte im Gepäck. Meine Hände werden feucht; alles in mir macht sich dafür bereit, herumzuspringen und aus dem Laden zu stürmen.
Die Bedienung mustert mich noch immer, lässt den Blick zum Fenster hinausschweifen und seufzt. »Bist ganz schön nass geworden, hm? Sie hatten für heute gar keinen Regen angesagt. Was für ein bescheidenes Wetter.«
Das Wetter? Sie spricht ernsthaft mit mir über das Wetter?
Der Magie sei gedankt.
Nur mit Mühe kann ich ein erleichtertes Seufzen unterdrücken, aber das eintretende Schweigen ist auch nicht viel angenehmer, und noch immer schreit ein Teil von mir nach Flucht. Ich sollte an dieser Stelle wohl etwas Unverfängliches erwidern, doch die Anspannung in meinem Inneren hindert mich daran. Was ist, wenn sie mich trotzdem noch erkennt? Oder wenn der Typ hinter meinem Rücken längst die Polizei informiert hat? Auch wenn es unangenehm in meinem Nacken prickelt, unterdrücke ich das Verlangen, mich zu ihm herumzudrehen, um das zu überprüfen.
Räuspernd straffe ich die Schultern, als würde das bei irgendetwas helfen.
»Ich würde gern für vierzig Dollar an Zapfsäule eins tanken, diese Sachen zahlen und dann noch zwei große Cappuccino mitnehmen, bitte«, bestelle ich mit zittriger Stimme, lege meine übrigen Einkäufe ab und gehe im Kopf sämtliche Techniken durch, die wir während des Schauspielstudiums gelernt haben, um unsere Nervosität zu überspielen und selbstbewusst zu wirken. Es fällt mir allerdings schwer, da mein Herz einen erschrockenen Stolperer einlegt. Denn just in dieser Sekunde wird auf dem Fernseher hinter dem Tresen in Großaufnahme der Fahndungsaufruf nach Darren und mir angezeigt.
Was für ein Timing! Das darf doch echt nicht wahr sein!
Ich wünschte, ich hätte einen beruhigenden Handschmeichler dabei, aber in den Taschen von Darrens Lederjacke befindet sich nichts. Nicht einmal ein zerknüllter Kassenbon, den ich zur Ablenkung zwischen den Fingern falten könnte. Es ist zu bizarr, wie mein Gesicht in Überlebensgröße in den Medien gezeigt wird, während zur Hintergrundberieselung die Musik einer quirligen 1990er-Girlband aus den Lautsprechern ertönt. Ich verfluche mich innerlich dafür, zum Fernseher hinaufgestarrt zu haben, als die Kassiererin meinem Blick folgt.
»Ach, die zwei schon wieder.« Sie macht eine wegwerfende Handbewegung und widmet sich der Kaffeemaschine. »Kaum drehen da zwei verwöhnte Rich Kids der New Yorker Upper Class durch und machen einen auf Ökoterrorismus, sind alle aus dem Häuschen. Als hätten wir keine anderen Probleme auf der Welt. Richtige Probleme. Fehlt nur noch, dass sie sich mit Sekundenkleber an ein Bild im MoMA festkleben und Rettet die Wale! rufen. Zwei Cappuccino sagtest du?«
Ich nicke, ohne den Fernseher aus den Augen zu lassen. Hier zu stehen und meinen Fahndungsaufruf auf dem Bildschirm zu verfolgen erzeugt die widersprüchlichsten Gefühle in mir. Bereue ich es, mich auf diese Sache eingelassen zu haben? Vielleicht. Manchmal. Flüchtig. Aber ich bin noch immer der Überzeugung, dass es wichtig ist, die Arbeit der L. I. F. E. Inc. zu stoppen. Sie spielen erneut die rauschigen Aufnahmen von Darren und mir ein, wie wir Seite an Seite an der Demo gegen die Firma seines Dads teilnehmen. Mir läuft es heiß und kalt den Rücken hinab, als sie meinen Bruder Taro zeigen, wie er unser Wohnhaus in Williamsburg verlässt. Es muss eine aktuelle Aufnahme sein, denn sofort bedrängt ihn eine Menschenmenge mit Kameras, Mikrofonen und Fragen. Da der Ton des Fernsehers ausgeschaltet ist, höre ich nicht, was er sagt, aber die zwei Worte, die er sich herauspresst, sehen verdächtig aus wie: »Kein Kommentar.« Er wirkt blass und vollkommen übernächtigt, dabei ist er es als Studierender der Reportagefotografie gewohnt, mit wenig Schlaf und schwierigen Situationen umzugehen. Die tiefen Sorgenfalten auf seiner Stirn sind mir jedenfalls neu. Es bricht mir das Herz, ihn so zu sehen und auch noch der Grund für seinen Kummer zu sein. Taro ist der Einzige, der von unserem Plan wusste. Doch dass diese Sache dermaßen aus dem Ruder laufen würde, hat keiner von uns geahnt.
»Darf es sonst noch etwas sein?«, reißt mich die Bedienung aus meinen finsteren Gedanken, während sie die Becher in einem Papptablett auf den Tresen stellt.
Ich verneine dankend, zahle bar, klemme mir die Wasserflaschen unter einen Arm, greife die Snacks und das Tablett mit Kaffeebechern vom Tresen und wende mich zum Gehen. Erleichtert stoße ich den Atem aus. Der Zauber wirkt. Ich habe es tatsächlich geschafft. Mir wird fast schwindelig vor Glück.
Gerade als ein Teil meiner inneren Anspannung von mir abfällt, ertönt erneut die Stimme der Kassiererin hinter mir.
»Eine Sekunde mal!«
Verdammt!
Zu früh gefreut! Ich sollte einfach weitergehen, doch das Gegenteil passiert. Vor Schreck verkrampfen sich alle Muskeln in meinem Körper, und ich bleibe wie angewurzelt stehen.
Nur aus dem Augenwinkel sehe ich, dass auch der Mann den Kopf gehoben hat und mich so argwöhnisch mustert, als wäre ich soeben beim Klauen erwischt worden. Oder aber aufgeflogen.
Was tust du denn? Du musst hier weg!, ermahne ich mich, doch es hilft nicht. Statt meinen Weg fortzusetzen, drehe ich mich herum und starre die Bedienung an, als wäre ich ein Reh im Scheinwerferlicht. »Ja?« Meine Stimme klingt selbst in meinen Ohren unangenehm hoch und piepsig. Keine Spur von Souveränität.
Mit hochgezogener Augenbraue sieht sie mich an, deutet dann zum Fenster hinaus. »Es schüttet noch immer. Möchtest du vielleicht eine Mülltüte haben? Als Schirmersatz, damit du nicht noch nasser wirst.«
Irritiert blinzle ich sie an. Ist das ihr Ernst? Davon mal ganz abgesehen, dass ich ohnehin schon pitschnass bin, könnten mir meine Haare momentan nicht egaler sein.
»Alles gut. Es ist doch nur Wasser, das trocknet wieder. Aber vielen Dank für das Angebot«, antworte ich rasch und eile aus dem Supermarkt, kaum dass meine Beine sich wieder daran erinnern, wie man läuft.
Auf dem Parkplatz angekommen finde ich die eiskalten Tropfen auf meiner Haut sogar beruhigend, denn in diesem Moment bedeuten sie für mich vor allem eines: Freiheit.
Ich beeile mich, durch den Regen zu kommen, tanke das Auto auf und lasse mich anschließend seufzend auf den Beifahrersitz fallen. Geschafft.
Die gute Nachricht ist: Der Tarnzauber scheint zu wirken, man hat mich nicht erkannt.
Die Schlechte ist: Obwohl mein Ausflug recht kurz war und mich dabei nur zwei Menschen gesehen haben, ist die Ladung des Bergkristalls fast aufgebraucht. Das verheißt nichts Gutes für die nächsten Tage, denn je mehr Menschen ich täuschen will, umso mehr Energie muss ich aufwenden. Auch wenn ich es liebe, verschiedene Schmuckstücke miteinander zu kombinieren: Es muss eine wirkungsvollere Lösung geben. Vermutlich benötigt es ein komplexeres Ritual. Und wo könnte ich so was besser zusammenstellen und abhalten als im Hause meiner Moms?
Ich habe Darren vorhin nicht belogen: Ich weiß einfach, dass meine Moms uns trotz aller Gefahren mit offenen Armen empfangen werden. Mehr noch: Meine Intuition führt mich genau dorthin. Es fühlt sich an, als läge ein unsichtbarer Faden an meiner Seele, der mich sacht, aber bestimmt nach Michigan lotst. Als hätte ich dort eine Aufgabe zu erfüllen.
Ich überreiche Darren einen der Kaffeebecher, doch er stellt ihn lediglich im Getränkehalter der Mittelkonsole ab und betrachtet mich mit Stolz. Aber da liegt noch etwas anderes in seinem Blick. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, dass es Trotz ist.
»Während du weg warst, habe ich über die Bedeutung des Wortes niemals nachgedacht. Vielleicht war es tatsächlich etwas unpräzise«, sagt er mit einer Mischung aus vorwurfsvoll hochgezogener Augenbraue und Schmunzeln, während er sich von mir abwendet und den Motor startet. »Ich meinte damit: Nur über meine Leiche würde ich ohne dich fliehen.«
Ich öffne den Mund, um etwas zu erwidern, und weiß dann doch nicht, was.
3. KAPITEL
DARREN
Mittwoch, 23.11.
Dass Gemma mich seit Stunden anschweigt, ist so untypisch für sie, dass ich mich ständig dabei ertappe, zu ihr hinüberzusehen, um zu prüfen, ob sie noch bei Bewusstsein ist. Vermutlich hat mein Vertrauen in die Welt durch ihre Ohnmacht einen weiteren Knacks erhalten, anders kann ich mir meine Paranoia auch nicht erklären.
Der Stoff ihres Kleides ist nicht viel dicker als ein Nachthemd. Mittlerweile ist der Saum graubraun vom Spritzwasser der Pfützen. Sie hat sich aus der nassen Lederjacke geschält und einen von mir geliehenen Hoodie übergezogen, in dem sie ebenso verloren wie beschützenswert aussieht. Es ist egal, wie oft sie mir sagt, dass sie allein zurechtkommt, und wie sehr ich weiß, dass sie das auch könnte: Da wird immer dieser Teil in mir sein, der sie einfach nur im Arm halten will. Ich bin froh, dass ich trotz meines chaotischen Aufbruchs wenigstens daran gedacht habe, noch ein paar Sachen wie den Pulli und die Wolldecke im Auto zu verstauen, wenn ich es schon versäumt habe, uns Proviant einzupacken.
Erneut werfe ich einen flüchtigen Blick auf Gemma, die ihr Sandwich mittlerweile aufgegessen hat. Mit dem Daumen streicht sie über den Coffee-to-go-Becher in ihrer Hand und öffnet den Mund, als wollte sie etwas loswerden, wendet sich dann jedoch kopfschüttelnd von mir ab und starrt aus dem Autofenster in die Dunkelheit der Nacht.
»Sag es«, fordere ich.
»Kann ich nicht«, gesteht sie nach einem Moment, in dem nur die auf das Autodach prasselnden Regentropfen und das gelegentliche Quietschen der Scheibenwischer zu hören sind. »Es wäre nicht fair, Dinge von dir zu fordern, die ich selbst nicht halten kann.« Sie betrachtet noch immer die Regentropfen, die gegen die Fensterscheibe schlagen, atmet tief durch und führt den Becher zum Mund, doch statt einen Schluck zu trinken, fährt sie auf. »Wenn wir zu meinen Moms wollen, müssen wir dort vorn von der Interstate.«
Meine Gedanken zucken unwillkürlich zu meiner eigenen Mom.
Sie ist tot, schießt es mir durch den Kopf. Es sind nur drei Worte, aber für einen Moment verkrampft sich mein gesamtes Inneres. Sofort treibt mein schlechtes Gewissen seine Klauen in mich und drückt meine Lunge zusammen. Schmerzhaft und unbarmherzig.
Sie ist tot. Und es ist meine Schuld. Ich wollte Dad so unbedingt das Handwerk legen – egal, was es koste. Und sie musste dafür bezahlen.
Ich schnappe erschrocken nach Luft, als Gemma ihre freie Hand auf meine legt und sie sacht drückt. Die kleine Geste hilft mir dabei, dass ich meine Gewissensbisse für einen Moment verdrängen kann.
»Entschuldige«, murmelt sie. »Ich wollte dich nicht … Deine Mom … Es tut mir leid.«
»Schon gut«, versichere ich und habe das Gefühl, dass meine Beteuerung so hohl klingt, wie Gemmas Versicherung darüber, dass es ihr gut geht.
Obwohl Mom quasi mein ganzes Leben lang im Sterben lag – und ich weiß, dass der Preis für ihre Medizin zu hoch war –, kommt es mir falsch vor, dass sie plötzlich nicht mehr da ist. Ich habe keine Ahnung, ob Dad bei ihr war und ihre Hand gehalten hat, während sie starb, oder ob man ihn zum Zeitpunkt ihres Todes bereits ermordet hatte. Bekam sie noch mit, wie man ihn umbrachte, und hat man sie danach vor die Wahl gestellt, ihm zu folgen oder sich von diesen skrupellosen Monstern entführen zu lassen, um Teil ihrer ekelhaften Experimente zu werden? Allein, wenn ich daran denke, wird mir hundeelend. Ich zwinge mich dazu, die Übelkeit erregende Mischung aus Wut und Schuldgefühlen zusammen mit dem Dämon meines schlechten Gewissens zu verdrängen und mich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren. Gemma braucht mich. Für alles andere ist später noch Zeit. Und mit alles andere meine ich vor allem: Rache.
Gemmas Anweisung folgend verlassen wir die Schnellstraße.
»Magst du mir etwas von deinen Moms erzählen?«, frage ich. »Nur damit ich mich seelisch darauf vorbereiten kann, sie kennenzulernen.«
Gemma nickt, zieht ein Bein an und legt den Arm darum. Gedankenverloren spielt sie mit einer Schnalle ihrer Stiefelette, bis sie kurz stutzt. So als würde ihr erst jetzt bewusst, dass sie den Sitz dreckig macht, schlüpft sie aus ihren Schuhen, zieht ihre nassen Socken aus und schlägt die Beine unter. »Ich weiß nicht, ob ich dir das erzählt habe, aber das Haus meiner Moms war schon immer ein Safe Space. In jeglicher Hinsicht. Wenn sie die Nachrichten gesehen haben – und es wäre ein echtes Wunder, wenn nicht –, werden sie alles dafür tun, das Haus so mit Zaubern abzusichern, dass ich jederzeit zu ihnen kommen kann. Ich muss sie nicht anrufen, um das zu wissen. So sind sie eben. Sie würden mich selbst dann noch hereinbitten und in Schutz nehmen, wenn ich tatsächlich mit dem abgetrennten Kopf des Bürgermeisters vor ihrer Tür stehen würde. Ihre Liebe ist bedingungslos.«
»Mhm«, ist alles, was mir dazu einfällt.
»Mach dir keine Sorgen. Wenn ich ein gutes Wort für dich einlege, werden sie dich ebenfalls hereinlassen. Selbst mit blutigen Händen«, zieht sie mich auf und schenkt mir das erste ehrliche Lächeln seit Beginn unserer Flucht. Es ist diese provozierende Art von Lächeln, bei dem mir warm und kalt zugleich wird. Sie zieht eine Augenbraue hoch, als würde sie eine Reaktion erwarten. Dem schelmischen Funkeln ihrer Augen nach erhofft sie sich eine schlagfertige Antwort. Und ich wünschte, ich hätte sie, aber im Moment fühle ich mich auf zu viele Arten müde, um auf meiner internen Festplatte die richtigen Worte zu finden. Der finstere Zauber, der mich zum Schweigen verurteilt hat, ist gebrochen. Aber all die Dinge, die wir auf dem Weg dorthin in Erfahrung gebracht haben, sind fast noch schlimmer, als ich befürchtet habe. Die Abgründe der menschlichen Seelen reichen tiefer, als ich es mir ausmalen konnte. Ich weiß nicht, ob wir dazu in der Lage sind, die Machenschaften rund um die L. I. F. E. Inc. zu beenden. Aber die Augen davor zu verschließen, dass Magie dafür missbraucht wird, dass angeblich nutzlose Menschen getötet werden, nur um Mitgliedern des Crow Covens die Leben zu verlängern oder ihnen eine praktische Energiequelle zur Verfügung zu stellen? Das kann ich nicht.
Gemmas Blick zuckt zu meinen Lippen, als würde sie darüber nachdenken, mich zu küssen, doch sie entscheidet sich dagegen und wendet sich endgültig von mir ab. Seitdem der Fluch gebrochen ist, der es uns unmöglich gemacht hat, uns zu küssen, haben wir es genau ein Mal getan – und dann nicht wieder. Wahrscheinlich, weil dies keine passende Situation für den Austausch von Zärtlichkeiten ist, doch wenn ich in etwas richtig gut bin, dann darin, Sachen kaputtzudenken. Gerade wenn es um Gemma Stone geht, mutiere ich zum verdammten König der Selbstzweifel. Es nervt mich selbst, aber ändern kann ich es nicht. Wie war das mit Achilles und der Ferse? Jeder Mensch hat seine wunden Punkte. Und meiner nippt gerade lustlos an einem Cappuccino, der mittlerweile höchstens noch lauwarm sein kann.
»Soll ich dich vielleicht beim Fahren ablösen?«, bietet sie unvermittelt an.
Wahrscheinlich sollte ich ihr Angebot annehmen und eine Runde schlafen, aber ich kann es nicht. Denn das Fahren lenkt mich zumindest kurzfristig von meinen finsteren Gedanken ab. Sobald ich die Augen schließe, drängen all die unschönen Emotionen der letzten Stunden an die Oberfläche zurück. Da ist mehr als nur die Erinnerung daran, dass man meine Eltern ermordet hat. Immer wieder sehe ich vor meinem geistigen Auge, wie Gemma bewusstlos zu Boden sackt. Wie ich zu ihr hinübergekrochen bin, sie an der Schulter berührt und angefleht habe, aufzuwachen. Nichts geschah. Für einen scheinbar endlosen Moment dachte ich, ich hätte auch sie verloren. Ein Albtraum im Wachzustand. Aber sie hat überlebt.
Ich kann auf jeden Fall getrost darauf verzichten, mich jetzt schlafen zu legen, nur um die Erlebnisse der letzten Stunden auch noch von meinem Unterbewusstsein unter die Nase gerieben zu bekommen. Mein Plan ist es, so lange wach zu bleiben, bis ich in einen traumlosen Schlaf falle. So lange halte ich jetzt durch.
Da ich unsere Handys zerstört und alle GPS-Systeme des Autos deaktiviert habe, navigiert uns Gemma den Rest des Weges. Das Haus ihrer Moms befindet sich ziemlich weit außerhalb von Bay City, Michigan, in einer Gegend, in der es offensichtlich mehr Kühe als Einwohner gibt. Vielleicht liegt es am noch fahlen Licht des gerade beginnenden Tages, am miesen Wetter oder der Tatsache, dass ich dem November generell nichts abgewinnen kann, aber je weiter wir uns von der Zivilisation entfernen, umso deprimierender wirkt die triste Landschaft auf mich. Wir fahren unter einer Allee aus blattlosen Bäumen hindurch, deren knorrige Äste wie gierige Finger wirken, die nach uns greifen. Die Zufahrt, auf die Gemma mich schließlich lotst, verdient nicht einmal den Namen Feldweg, so schmal und verwildert ist der Pfad, dem wir folgen. Braunes Pfützenwasser spritzt gegen die Scheiben, Äste kratzen über den Lack und erinnern mich viel zu sehr an das Geräusch von Kreide, die man quietschend über eine Tafel zieht. Gemma sagte zwar mal, sie wäre eher ländlich aufgewachsen, mir war allerdings nicht bewusst, dass es ein Euphemismus war. Denn das hier sieht wie das sprichwörtliche Ende der Welt aus. Wenn man den klischeehaftesten Ort googelt, um irgendwo unterzutauchen, werden einem sicherlich Bilder dieser Gegend präsentiert.
Der uns umgebende Wald öffnet sich zu einer Lichtung, und vielleicht wäre die Szenerie mit dem taubenblauen Holzhaus am See unter anderen Umständen tatsächlich idyllisch. Heute spüre ich beim Anblick des einsamen Hauses mit regennasser Veranda nur ein latentes Unwohlsein. Nicht allein wegen der Aussicht darauf, mir beim Aussteigen nasse Füße zu holen, sondern auch weil ich zum ersten Mal Gemmas Moms treffe. – Was mir selbst mit trockenen Socken kältere Füße beschert, als ich mir eingestehen will. Denn wenn wir ehrlich sind, ist uns allen bewusst, dass Gemma nur meinetwegen in diesen Schwierigkeiten steckt.
Wir fahren über einen Kiesweg, der offensichtlich schon vor längerer Zeit von der Natur zurückerobert wurde und in einem breiten Parkplatz mündet. Am Rande des Platzes, gleich neben der Treppe zur Veranda, steht ein verwittertes und halb von Efeu verschlungenes Schild. Das einzige Wort, das ich unter den Pflanzenranken erahnen kann, lautet Hatty.
»Ist Hatty ein Name? Er klingt ungewöhnlich.«
»Ja, und damit passte er perfekt zu Tante Hatty«, sagt Gemma lächelnd. »Sie war die Schwester meiner Grandma. Sie hatte keine eigenen Kinder, aber ein großes Herz und hat alle bei sich aufgenommen, die Hilfe brauchten. Egal, weswegen. Egal, woher sie kamen. Mittlerweile ist sie verstorben, und all die Kinder von damals sind längst erwachsen. Meine Moms sorgen dafür, dass sie immer noch jederzeit hierher zurückkehren können, wenn sie es wollen. Sie oder ihre Kinder und auch jeder andere Mensch, der für eine Weile ein sicheres Dach über dem Kopf braucht. Meist sind es Frauen, die sich gerade von ihren gewalttätigen Männern getrennt haben und nicht wissen, wohin sie sich wenden sollen. Meine Familie ist vermutlich etwas schräg, aber …« Gemma zögert, bevor sie leise lacht. »Wahrscheinlich hast du nichts anderes erwartet. Der ganze Dachboden sieht aus wie eine Mischung aus Hexenladen und Bibliothek.«
»Es klingt nicht schräg, sondern nach einer warmherzigen und hilfsbereiten Familie, die zu dir passt«, korrigiere ich. »Außerdem wäre ich wohl kaum in der Position dafür, irgendwen für seine Herkunft zu verurteilen. Im Gegenteil: Deine Familie hilft Menschen in Not; meine bringt sie um. – Hat sie umgebracht, bevor sich jemand anders dazu berufen fühlte, Dads Mission weiterzuführen.«
Wofür Dad vermutlich die gerechte Strafe ereilt hat, wenn man an so etwas wie Karma glauben mag.
Dad. Mein Leben lang hat er mir zu verstehen gegeben, dass er mit meinen Entscheidungen und Ansichten nicht zufrieden ist. Er hat mich beleidigt. Mich verflucht. Und trotzdem habe ich es nie geschafft, ihn zu hassen. Sein Verlust ist nicht annähernd so schmerzhaft wie Moms. Ich kann allerdings nicht behaupten, dass es sich gut anfühlt, ihn auf diese Art gestoppt zu haben.
Ich parke auf dem von Unkraut überwucherten Parkplatz direkt vor dem Haus und werfe einen letzten Blick in den Spiegel der Sonnenblende. Tiefe Schatten liegen unter meinen Augen, und meine Haare bräuchten dringend eine andere Bürste als meine Finger. Aber was soll’s? Nach dem, was sie in den Nachrichten über mich erzählen, würde mir vermutlich nicht einmal einer meiner Maßanzüge bei diesem Kennenlernen weiterhelfen.
Ich habe kaum den Motor abgestellt, da öffnet sich die Haustür und eine Frau betritt die Veranda. Da ich zu wenig über Gemmas Moms weiß, ist es mir unmöglich zu erraten, ob sie wohl Laura oder Viola ist, aber ihr bodenlanges Kleid mit Blumenmuster und das orangefarbene Band in ihren Haaren leuchten so fröhlich, als wollten sie das miese Wetter vertreiben. Sie passt zu Gemma.
Diese rührt sich nicht, starrt lediglich durch die regennasse Scheibe zu ihrer Mom hinüber.
»Ist alles in Ordnung?«, frage ich besorgt.
»Sicher. Es fühlt sich nur komisch an, nach über einem Jahr in New York das erste Mal wieder hier zu sein«, bringt sie stockend hervor. »Wenn wir Glück haben, ist Laura noch bei ihrer Schicht im Krankenhaus.« Mit fahrigen Bewegungen löst sie den Sicherheitsgurt, öffnet die Tür und steigt aus – ohne sich zuvor ihre Stiefeletten wieder anzuziehen. »Komm mit. Ich stelle dir Viola vor.« Nach einem letzten Lächeln wendet sie sich von mir ab, schlägt die Beifahrertür zu und geht über das feuchte Gras in Richtung des Hauses.
Ich komme nicht einmal mehr dazu, meine Bedenken bezüglich des Barfußlaufens im Novemberregen kundzutun. Aber Gemma ist Gemma. Sie tut ohnehin, was sie will.
Ihre Mom zögert keine Sekunde, schreitet die Treppe herunter, läuft auf sie zu und schließt Gemma so energisch in die Arme, dass die kurz ins Straucheln gerät. Eines steht fest: Gemma hat nicht gelogen. Ihre Mom freut sich darüber, sie zu sehen, und wirkt nicht, als wollte sie uns vom Grundstück jagen oder die Polizei rufen.
Ein letztes Mal atme ich tief durch und wage mich in den Nieselregen hinaus, während Gemma und ihre Mom sich noch immer begrüßen. Die beiden so vertraut miteinander zu sehen weckt erneut dieses Ungeheuer in mir, das ich zu unterdrücken versuche. Eine unangebrachte Mischung aus Trauer, Neid und schlechtem Gewissen frisst sich durch meine Eingeweide, während ich Gemma in einer so innigen Umarmung mit ihrer Mom sehe und dabei an meine eigene denke.
Auch wenn nicht alle in der magischen Gemeinde die biochemischen Hintergründe kennen, gibt es etwas, was alle über Sirenen und Tritonen wissen: Sie sind nicht für die Liebe geschaffen. Nicht auf Dauer. Sobald sie ihr Herz verschenken, sterben die meisten von ihnen.
Als Kind war ich oft eifersüchtig auf andere, weil meine Mom selbst in ihren besten Jahren eher zurückhaltend mit ihren Liebesbekundungen war. Da jede wiederkehrende körperliche Nähe ihre Krankheit beschleunigt hätte, habe ich von klein auf gelernt, mich damit abzufinden, nicht umarmt oder geküsst zu werden. Nicht wenn ich Trost brauchte, nicht einmal zum Geburtstag. Bis eben dachte ich, ich hätte diesen Neid irgendwann im Laufe meines Lebens hinter mir zurückgelassen. Aber in Momenten wie diesen, wenn ich Gemma und ihre Mom zusammen sehe, erinnere ich mich daran, dass es eine Zeit gab, in der mir die Zuneigung meiner Eltern lieber gewesen wäre als der Besuch der teuren Privatschulen, maßangefertigte Kleidung oder Luxusautos.
Um mein Unwohlsein zu kaschieren, betrachte ich das Haus: Holzständerbauweise, abblätternder Anstrich, der mal erneuert werden könnte, weiße Veranda mit Blumentöpfen voller Pflanzen, die jetzt, im Herbst, eher tot und traurig als einladend aussehen. Aber je länger ich mich umsehe, desto deutlicher erkenne ich die Handschrift von Gemmas Moms. Denn dieses Haus verkörpert das, was Gemma mir immer wieder zu verstehen gibt: Man soll zu sich und der Magie stehen. – Es sind die Details, die dieses Heim von anderen unterscheiden. Ein Windstoß lässt ein melodiöses Windspiel erklingen, das unter dem Verandadach befestigt wurde. Ein Traumfänger aus Naturgarn, verziert mit braunen Vogelfedern und klaren Kristallen, dreht sich im Luftzug. An der Haustür hängt ein Kranz aus getrockneten Pflanzen, die schon von Weitem wie Lavendel und Salbei aussehen – klassische Bestandteile von Schutz- oder Reinigungszaubern. Unzählige Kerzen verschiedener Farben stehen überall: auf einem Beistelltischchen, der Verandaumrandung, den Fensterbänken.
Ich höre, dass Viola Gemma fragt, ob es ihr gut geht, sehe, wie sie ihr durch die feuchten Haare streicht und forschend ihr Gesicht betrachtet. Der Moment erscheint mir so intim, dass ich mich wie ein Eindringling fühle.
Erschrocken fahre ich auf, als ihre Mom mich unverwandt ansieht und von Gemma zurücktritt.
»Du bist also Darren Hunter?«
Vermutlich sollte ich etwas sagen, doch das Lächeln in Violas Gesicht weicht einer unverhohlenen Skepsis, während sie mich mustert. Ich kann ihr keinen Vorwurf machen, immerhin bin ich es, der Gemma in diesen Schlamassel navigiert hat – und ich bin mir dessen bewusst. Wie lautet wohl die passende Begrüßung in so einem Fall?
»Mom, könntest du damit aufhören, ihn so anzustarren?«, bittet Gemma und verdreht amüsiert die Augen.
»Sicher.« Ihre Mom zuckt mit den Schultern. »Ich bin nur irritiert. Ich meine, er ist … blond. Seit wann stehst du auf blond?«
»Seit wann beurteilen wir Menschen anhand ihres Aussehens?«, gibt Gemma zurück.