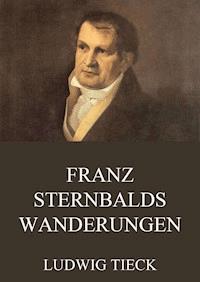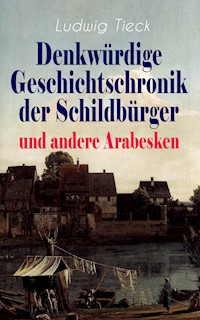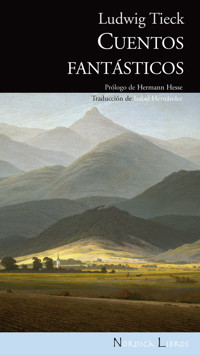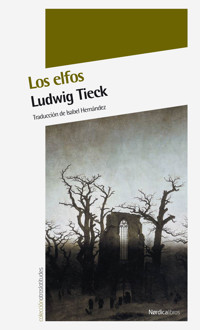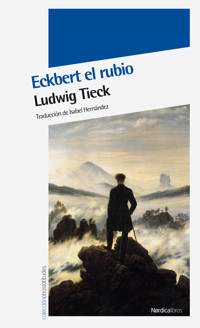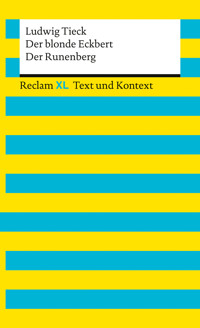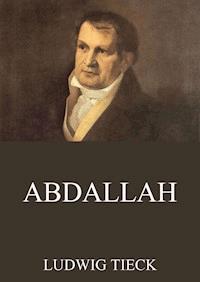
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Erzählung von Abdallah gehört zu den frühen Werken Tiecks. Abdallah ist der Sohn des vom Sultan verstoßenen Selim. Selim sinnt auf Rache und möchte, dass Abdallah mit ihm und Verbündeten den Sultan stürzt. Problematisch wird das Ganze als sich Abdallah in die Tochter des Sultans verliebt ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 298
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Abdallah
Ludwig Tieck
Inhalt:
Ludwig Tieck – Biografie und Bibliografie
Abdallah
Erstes Kapitel.
Zweites Kapitel.
Drittes Kapitel.
Viertes Kapitel.
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel.
Siebentes Kapitel.
Achtes Kapitel.
Neuntes Kapitel.
Zehntes Kapitel.
Zweites Buch.
Erstes Kapitel.
Zweites Kapitel.
Drittes Kapitel.
Viertes Kapitel.
Fünftes Kapitel.
Sechstes Kapitel.
Siebentes Kapitel.
Achtes Kapitel.
Neuntes Kapitel.
Zehntes Kapitel.
Drittes Buch.
Erstes Kapitel.
Zweites Kapitel.
Drittes Kapitel.
Viertes Kapitel.
Fünftes Kapitel.
Sechstes Kapitel.
Siebentes Kapitel.
Achtes Kapitel.
Neuntes Kapitel.
Zehntes Kapitel.
Abdallah, L. Tieck
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783849637767
www.jazzybee-verlag.de
www.facebook.com/jazzybeeverlag
Ludwig Tieck – Biografie und Bibliografie
Dichter der romantischen Schule, geb. 31. Mai 1773 in Berlin, gest. daselbst 28. April 1853, Sohn eines Seilermeisters, besuchte seit 1782 das damals unter Gedikes Leitung stehende Friedrichswerdersche Gymnasium, wo er sich eng an Wackenroder anschloß, und studierte darauf in Halle, Göttingen und kurze Zeit in Erlangen Geschichte, Philologie, alte und neue Literatur. Nach Berlin zurückgekehrt, lebte er von dem Ertrag seiner schriftstellerischen Arbeiten, die er größtenteils im Verlag des Aufklärers Nicolai veröffentlichte. So erschienen in rascher Reihenfolge die Erzählungen und Romane: »Peter Lebrecht, eine Geschichte ohne Abenteuerlichkeiten« (Berl. 1795, 2 Bde.), »William Lovell« (das. 1795–96, 3 Bde.; vgl. Haßler, L. Tiecks Jugendroman »William Lovell« und der »Paysan perverti« des Rétif de la Bretonne, Dissertation, Greifsw. 1903) und »Abdallah« (das. 1796), ferner Novellen meist satirischen Inhalts in der Sammlung »Straußfedern« (1795–98), worauf er, seinen Übergang zur eigentlichen Romantik vollziehend, die bald dramatisch-satirische, bald schlicht erzählende Bearbeitung alter Volkssagen und Märchen unternahm und unter dem Titel: »Volksmärchen von Peter Lebrecht« (das. 1797, 3 Bde.) veröffentlichte. Den größten Erfolg errangen unter diesen Dichtungen die unheimlich düstere Erzählung »Der blonde Eckert« und das phantastisch-satirische Drama »Der gestiefelte Kater«. Die Richtung, die in seinen Schriften immer deutlicher hervortrat, mußte ihn in schroffen Gegensatz zu Nicolai sowie zu Iffland, dem Leiter des Berliner Theaters, bringen, während die Romantiker ihn begeistert anpriesen als ein Genie, das Goethe ebenbürtig sei. Nachdem er sich 1798 in Hamburg mit einer Tochter des Predigers Alberti verheiratet hatte, verweilte er 1799–1800 in Jena, wo er zu den beiden Schlegel, Hardenberg (Novalis), Brentano, Fichte und Schelling in freundschaftliche Beziehungen trat, auch Goethe und Schiller kennen lernte, nahm 1801 mit Fr. v. Schlegel seinen Wohnsitz in Dresden und lebte seit 1802 meist auf dem Gute Ziebingen bei Frankfurt a. O., mit dessen Besitzern (erst v. Burgsdorff, dann Graf Finkenstein) er eng befreundet war. Doch unterbrach er diesen Aufenthalt durch längere Reisen nach Italien, wo er die deutschen Handschriften der vatikanischen Bibliothek studierte (1805), sowie nach Dresden, Wien und München (1808–10). Während dieses Zeitraums waren erschienen: »Franz Sternbalds Wanderungen« (Berl. 1798), ein die altdeutsche Kunst verherrlichender Roman, an dem auch sein Freund Wackenroder Anteil hatte, »Prinz Zerbino, oder die Reise nach dem guten Geschmack« (Jena 1799), und »Romantische Dichtungen« (das. 1799–1800, 2 Bde.) mit dem Trauerspiel »Leben und Tod der heil. Genoveva« (separat, Berl. 1820) sowie das nach einem alten Volksbuch gearbeitete Lustspiel »Kaiser Octavianus« (Jena 1804), weitschweifige Dichtungen, in denen das erzählende und namentlich das lyrische Element überwiegt, aber aus einem Gewirr mannigfaltigster metrischer Ausdrucksformen gelegentlich doch echte Schönheit hervorleuchtet (vgl. Ranftl, L. Tiecks »Genoveva« als romantische Dichtung betrachtet, Graz 1899). Von den zahlreichen Übersetzungen und Bearbeitungen fremder Werke, die T. damals veröffentlichte, seien erwähnt: die fehlerhaften »Minnelieder aus der schwäbischen Vorzeit« (Berl. 1803), die gelungene Verdeutschung des »Don Quichotte« von Cervantes (das. 1799–1804, 4 Bde.), die wertvolle Übersetzung einer Anzahl Shakespeare zugeschriebener, aber zweifelhafter Stücke u. d. T.: »Altenglisches Theater« (das. 1811, 2 Bde.) u. a. Auch gab er u. d. T.: »Phantasus« (Berl. 1812–17, 3 Bde.; 2. Ausg., das. 1844–45, 3 Bde.) eine Sammlung früherer Märchen und Schauspiele, vermehrt mit neuen Erzählungen und dem Märchenschauspiel »Fortunat«, heraus, welche die deutsche Lesewelt lebhaft für T. interessierte. Das Kriegsjahr 1813 sah den Dichter in Prag; nach dem Frieden unternahm er größere Reisen nach London und Paris, hauptsächlich im Interesse eines großen Hauptwerks über Shakespeare, das er leider nie vollendete. 1819 verließ er dauernd seine ländliche Einsamkeit und nahm seinen Wohnsitz in Dresden, wo nun die produktivste und wirkungsreichste Periode seines Dichterlebens begann. Trotz des Gegensatzes, in dem sich Tiecks geistige Vornehmheit zur Trivialität der Dresdener Belletristik befand, gelang es ihm, hauptsächlich durch seine fast allabendlich stattfindenden dramatischen Vorlesungen, in denen er sich als Meister in der Kunst des Vortrags bewährte, einen Kreis um sich zu sammeln, der seine Anschauungen von der Kunst als maßgebend anerkannte. Als Dramaturg des Hoftheaters (seit 1825) gewann er eine bedeutende Wirksamkeit, die ihm freilich durch Angriffe der Gegenpartei mannigfach verleidet wurde. In der Novellendichtung, der sich T. in dieser Dresdener Zeit vor allem widmete, leistete er zum Teil Vortreffliches; aber er bahnte auch jener bedenklichen Gesprächsnovellistik den Weg, in der das epische Element fast ganz hinter dem reflektierenden zurücktritt. Zu den bedeutendsten zählen: »Die Gemälde«, »Die Reisenden«, »Der Alte vom Berge«, »Die Gesellschaft auf dem Lande«, »Die Verlobung«, »Musikalische Leiden und Freuden«, »Des Lebens Überfluß« u. a. Unter den historischen haben »Der griechische Kaiser«, »Dichterleben«, »Der Tod des Dichters« und vor allen der großartig angelegte, leider unvollendete »Aufruhr in den Cevennen« Anspruch auf bleibende Bedeutung. In allen diesen Novellen befriedigt nicht nur meist die einfache Anmut der Darstellungsweise, sondern auch die Mannigfaltigkeit lebendiger und typischer Charaktere und der Tiefsinn der poetischen Idee. Sein letztes größeres Werk: »Vittoria Accorombona« (Bresl. 1840), entstand unter den Einwirkungen der neufranzösischen Romantik und hinterließ trotz der Farbenpracht einen überwiegend peinlichen Eindruck.
T. übernahm in Dresden auch die Herausgabe und Vollendung der von A. W. v. Schlegel begonnenen Shakespeare-Übertragung (Berl. 1825–33, 9 Bde.), doch hat er selber nur die Anmerkungen beigesteuert. Die Übersetzungen A. W. v. Schlegels (s. d.) wurden zum Teil mit eigenmächtigen Änderungen wieder abgedruckt, die übrigen Stücke übersetzten Tiecks Tochter Dorothea (geb. 1799) und Wolf Graf von Baudissin (s. d.). Diese beiden verdeutschten auch noch sechs weitere Stücke des alten englischen Theaters, die T. als »Shakespeares Vorschule« (Leipz. 1823–29, 2 Bde.) mit ausführlicher literarhistorischer Einleitung herausgab. Ebenso stammen aus dieser Zeit mehrere mit Einleitungen versehene Ausgaben von Werken deutscher Dichter, auf die er die Aufmerksamkeit von neuem hinlenken wollte. So hatte er schon 1817 eine Sammlung älterer Bühnenstücke u. d. T.: »Deutsches Theater« veröffentlicht (Berl., 2 Bde.). Dann gab er die hinterlassenen Schriften Heinrichs v. Kleist (Berl. 1821) heraus, denen die »Gesammelten Werke« desselben Dichters (das. 1826, 3 Bde.) folgten, ferner Schnabels Roman »Die Insel Felsenburg« (Bresl. 1827) und die »Gesammelten Schriften« von J. M. R. Lenz (Berl. 1828, 3 Bde.). Aus seiner dramaturgisch-kritischen Tätigkeit erwuchsen die wertvollen »Dramaturgischen Blätter« (Bresl. 1825–26, 2 Bde.; Bd. 3, Leipz. 1852; vollständige Ausg., das. 1852, 2 Tle.). 1837 verlor T. seine Frau, seine Tochter Dorothea starb 21. Febr. 1841. In demselben Jahre wurde er vom König Friedrich Wilhelm IV. nach Berlin berufen, wo er, durch Kränklichkeit zumeist an das Haus gefesselt, ein zwar ehrenvolles und sorgenfreies, aber im ganzen sehr resigniertes Alter verlebte. Sein Bildnis s. Tafel »Deutsche Romantiker« (Bd. 17). Seine »Schriften« erschienen in 20 Bänden (Berl. 1828–46), seine »Kritischen Schriften« in 2 Bänden (Leipz. 1848), »Gesammelte Novellen« in 12 Bänden (Berl. 1852–54), »Nachgelassene Schriften« in 2 Bänden (Leipz. 1855). »Ausgewählte Werke« Tiecks gaben Welti (Stuttg. 1886–1888, 8 Bde.), Klee (mit Biographie, Einleitungen und Anmerkungen, Leipz. 1892, 3 Bde.) und Witkowski (mit Einleitung, das. 1903, 4 Bde.) heraus. Aus Tiecks Nachlaß, der sich in der Berliner Bibliothek befindet, veröffentlichte Bolte mehrere Übersetzungen englischer Dramen, unter andern »Mucedorus« (Berl. 1893). Die Ungleichheit von Tiecks Leistungen ist z. T. auf sein improvisatorisches Arbeiten zurückzuführen, das ihn selten zu reiner Ausgestaltung seiner geist-, phantasie- und lebensvollen Entwürfe gelangen ließ; die Gesamtheit seiner Schriften verrät deutlich die Weite und Größe seines Talents. R. Köpke, der T. in den letzten Berliner Jahren nahe stand, veröffentlichte eine ausführliche Biographie u. d. T.: »Ludwig T., Erinnerungen aus dem Leben etc.« (Leipz. 1855, 2 Bde.). Vgl. außerdem H. v. Friesen, Ludwig T., Erinnerungen (hauptsächlich aus der Dresdener Zeit, Wien 1871, 2 Bde.); »Briefe an Ludwig T.« (hrsg. von K. v. Holtei, Bresl. 1864, 4 Bde.); Ad. Stern, Ludwig T. in Dresden (in dem Werk »Zur Literatur der Gegenwart«, Leipz. 1880); Steiner, Ludwig T. und die Volksbücher (Berl. 1893); Garnier, Zur Entwicklungsgeschichte der Novellendichtung Tiecks (Gieß. 1899); Mießner, L. Tiecks Lyrik (Berl. 1902); Ederheimer, Jak. Böhmes Einfluß auf T. und Novalis (Heidelb. 1904); Koldewey, Wackenroder und sein Einfluß auf T. (Leipz. 1904); Günther, Romantische Kritik und Satire bei Ludwig T. (das. 1907). – Tiecks Schwester Sophie T., geb. 1775 in Berlin, verheiratete sich 1799 mit Aug. Ferd. Bernhardi (s. d.), von dem sie 1805 wieder geschieden wurde, lebte dann in Süddeutschland und mit ihren Brüdern, dem Dichter und dem Bildhauer, längere Zeit in Rom, später in Wien, München und Dresden. 1810 schloß sie eine zweite Ehe mit einem Esthländer, v. Knorring, dem sie in dessen Heimat folgte, und starb dort 1836. Sie hat außer Gedichten, z. B. dem Epos »Flore und Blanchefleur« (hrsg. von A. W. v. Schlegel, Berl. 1822), auch Schauspiele und einige Romane, wie »Evremont« (hrsg. von Ludw. T., das. 1836), geschrieben.
Abdallah
Erstes Kapitel.
Ein Theil der Tartarei ward vom Sultan Ali beherrscht. – Dem Tirannen entgeht der Haß nie, mit dem ihn seine Unterthanen verfolgen und Ali betrachtete sie bald als eben so viele Feinde, über die ihn nur seine Grausamkeit und sein Ansehn erhalten könnten: mit andern Freuden unbekannt, sollte ihm das Gefühl seiner Macht jeden Mangel ersetzen.
Ohne Begriffe, ohne zu denken, ohne nur Seelengenuß zu kennen, war er zum Greise geworden und in einer unerschöpflichen Leere schmachtete er itzt jedem neuen Tage entgegen. Mehrere seiner Gemalinnen starben und er begrub sie mit eben der Gleichmuth, mit der er den Untergang der Sonne sahe, die, wie er wußte, jenseit des Horizonts wieder heraufstieg, – selbst sein einziges Kind Zulma liebte er nicht, nur Stolz war es, was ihn an diese fesselte, da das ganze Land sie für die Krone der Schönheit anerkannte. –
In der Hauptstadt des Landes lebte Selim in einer weisen Eingezogenheit, ohne eine öffentliche Bedienung, ohne daß man viel von ihm sprach ward er von allen geliebt. Er war freigebig ohne Prahlerei, sparsam ohne Kargheit und sein Aufwand unterschied sich sehr von der Pracht des Veziers und der übrigen Großen.
Aus seinen Leiden hatte er stets seine große starke Seele gerettet; seinen Haß konnte nichts aussöhnen, aber eben so unauslöschlich war seine Liebe. – Mit dieser dauernden Liebe umfing er seinen Sohn Abdallah, das Einzige, was ihm seine geliebte Gattin zurückgelassen hatte.
Zweites Kapitel.
Die Sonne war schon untergegangen, als Abdallah und Omar durch ein schönes Gehölz wandelten. Omar war der Lehrer Abdallahs, ein ehrwürdiger Greis, dessen flammende Augen tief in eines jeden Seele schauten, seine Stirn und sein Blick trugen Ehrfurcht vor ihm her, aber ein süßes Lächeln, das fast immer seinen Mund umschwebte, verjüngte sein Gesicht durch eine liebenswürdige Freundlichkeit und lockte zur Mittheilung aller Gefühle und einer kindlichen Aufschließung des Herzens.
Sie traten itzt in einen freien Platz, wo ein stiller See im bleichen Licht des Mondes glänzte. Der letzte Streif der Abendröthe glimmte durch die Fichtenwipfel und durch die zitternden Cypressen bebten ungewiß die Sterne. Verspätete Mücken spielten im Mondstrahle, Käfer summten träge und schläfrig um sie her, und laut erklang durch die ruhige Einsamkeit des Waldes das zirpende Lied des Heimchens.
Siehe Omar, begann Abdallah, wie schön! – Ha! der ruhige See über den sich der Mondschein so lieblich herabsenkt, – der Abend, der noch in den hohen Wipfeln der Bäume säuselt, das Lied der Nachtigall, das mit tausend abwechselnden Melodieen aus dem Walde heraufschallt, – o sieh Omar! wie alle Geschöpfe sich freuen, wie alles lebt und im Leben glücklich ist! Sieh, wie die kleinen Fliegen von der Abendröthe Abschied nehmen, und der Käfer der Nacht seinen dumpfen Willkommen entgegensummt. – O die lebendige Kraft, die aus der Natur so unerschöpflich quillt und unzähligen Wesen Athem und Dasein giebt, – dieser Anblick erfüllt das Herz mit lautem überströmenden Dank gegen den, der so gütig alles aus dem Nichts hervorrief und zum Staube sprach: Lebe und sei glücklich! –
Omar lehnte sich auf den Stamm eines abgehauenen Baums und sahe starr vor sich nieder.
Abdallah. Du bist traurig, mein Omar, kann dich dieser Anblick nicht heiter machen?
Omarblickte auf und faßte seine Hand. – Sieh, sprach er, die Abendfliegen sind verschwunden, sie sangen der Sonne so wehmüthig nach, denn es war das letztemal, daß sie sich in ihrem Strahl erquickten. – Diese Woge wirft das Leben an den Strand, die nächste Welle kömmt, verschlingt es wieder und senkt es in die tiefsten Abgründe. – Eine unendliche Schöpfung spielt itzt lebendig um dich herum, – und in der folgenden Stunde – liegt sie todt und verwest. – Eine Lebenskraft fliegt durch die Natur und Millionen Wesen empfangen wie ein Allmosen auf einen Augenblick einen Funken Leben, sie sind – und geben dann ihr Leben wieder ab und werden todter Staub. Die Welt ist ein Gesang, wo ein Ton den andern verschlingt und vom nächsten verschlungen wird. –
Abdallah. Diese traurige Wahrheit, Omar, wirft meine schöne Begeisterung mächtig nieder. – Ach ja, alles geht durch die Natur hindurch und verläuft sich wie ein Funken in der Asche. Alles wird nur geboren, um zu sterben, alles wandelt wieder dahin zurück, woher es gekommen ist. – O Omar, wenn ich dich nun fragte: Warum glänzt dieser Mond? Warum funkeln diese Sterne und wozu haucht ein lebendiger Geist in meinem Innern?
Omar. Wozu? – O Jüngling, laß die Erde unaufgewühlt, du findest ein scheußliches Todtengerippe! Laß diese Geheimnisse ewig deiner Seele verschlossen bleiben. –
Abdallah. Verschlossen? – O nein, mein drängender Geist steht vor dieser Pforte und klopft ungestüm an. – Was der Mensch fassen kann, will auch ich begreifen.
Omar. Du vertraust dich einem Meere, das dich nie an's Land zurückträgt, Zweifel wälzen dich auf Zweifel, Woge stürmt auf Woge, dein Ruder ist unnütz und die unendliche See dehnt sich dir furchtbar unermeßlich entgegen.
Abdallah. Ich könnte nicht ruhig sein, wenn ich wüßte, daß etwas da sei, was in meinem Gehirne Raum hätte und dem ich den Eingang versagen müßte.
Omar. Aber unsre Weisheit findet eine Felsenmauer vor sich, an die sie vergebens mit allen Kräften anrennt, – wir sind in einem ehernen Gewölbe eingeschlossen, wir sehen nichts, was wirklich ist, die schimmernden Gestalten, die wir wahrzunehmen glauben, sind nichts, als der Widerschein von uns selbst im glatten Erze, – o schon viele Weisen stürzten mit Ohnmacht von diesen Schranken zurück, – und starben. – Der Zweck unsers Daseins? – O wer hindurchschauen könnte durch das Geheimniß der unendlichen Nacht, wenn doch vom Thron der Gottheit nur ein Sonnenstrahl herniederschösse! – Wir tappen ängstlich umher – und finden nur die Wände, die uns eingeschlossen halten. Wir sehen nichts, als daß wir Gefangene sind, – warum wir es sind, müssen wir mit Geduld vom Ausspruch des kommenden Gerichts erwarten.
Abdallah. O warum verlieh uns der Schöpfer nur so viel Kraft, diese Schranken zu sehn und nicht zu durchbrechen? – Warum ward eine Ahndung in unser Herz gelegt, die nie zur Gewißheit reift? Eine Centnerlast liegt auf unsrer Brust, und wir kämpfen vergeblich sie abzuschütteln.
Omar. Vielleicht werden alle diese Räthsel einst gelöst. – Ein großer Schwung wälzt sich durch alle Theile der Natur, durch alle Wesen klingt ein Ton, eine Kraft drängt sie zu einem Mittelpunkt: Genuß! – Alles schöpft aus dem nie versiegenden Quell und legt sich dann zum Schlafe nieder. – Die Welt ist eine reiche Tafel, an der sich alles niedersetzt und gesättigt aufsteht, der Schöpfer schickte die Millionen Wesen in die Wüste hinaus, sie sind Staub und in sich selber eingekerkert, – aber er gab ihnen tausend Mittel auf den Weg, ihr Dasein zu empfinden, und alles freut sich, alle Wesen kommen, genießen und sterben dann, ohne es zu wissen, so wie sie geboren wurden, – nur der verblendete Mensch verfehlt sein vorgestecktes Ziel.
Abdallah. Der Mensch? – Wie? der Preis der Schöpfung? Um dessentwillen die Natur ihre reichen Schätze aufthut? Um den sich die Bestimmung alles Erschaffenen dreht?
Omar. O des Stolzes! – Die Bestimmung alles Erschaffenen? Kein Mensch weiß seine eigne Bestimmung, er taumelt selbst verlassen in der Finsterniß und maßt sich an, den Wesen ihren Rang und ihren Zweck anzuweisen. – Allen Wesen ward ein gleiches Bürgerrecht ertheilt; der ausgeartete Mensch reißt sich aus der Kette des Erschaffnen, statt zu genießen wie alles genießt, ringt er im ewigen Kampfe mit dem Tode und seinem Verhängniß, alle seine Kräfte kämpfen rastlos von der Zeit eine Stunde und eine Minute nach der andern zu erbetteln, – um auch in dieser zu fürchten, um auch in dieser mit Gedanken zu streiten, deren Auflösung weit außer ihm liegt.
Abdallah. Wenn Genuß der höchste letzte Zweck unsers Daseins ist, wodurch ist dann der Mensch vom Thiere unterschieden?
Omar. Und wozu des Unterschiedes? Der Mensch wäre glücklich, hätte er nie höher gestrebt, die Natur umfinge ihn dann noch mit ihren liebevollen Armen, hegte ihn und spielte mit ihm als ihrem Kinde, – aber der Stolze hat sich von seiner Mutter losgeschworen, sieht die Sterne, die über seinem Haupte hängen, erklimmt eine schroffe Klippe und schreit ihnen zu: ich bin euch nahe! Wehmüthig lächelnd blicken die Sterne aus ihn herab und er steht nun verirrt am schwindelnden Abschuß; zur blühenden Wiese, die er erst verschmähte, hat er den Rückweg verloren. –
Abdallah. Und nichts als diesen verächtlichen Uebermuth hätte der Mensch vor den Thieren des Waldes voraus?
Omar. Nichts als ihn. Mit verachtendem Fuß stößt er die Erde zurück und will sich an die Gottheit drängen, aber seine klägliche Natur zieht ihn allmächtig zurück. Seine Weisheit, seine Tugend, mit der er sich brüstet, – Wolkenschatten, die der Wind über die Ebne jagt und denen der Wahnsinnige nachtaumelt.
Abdallah. Tugend, Omar, nur ein Schatten? – Der Lasterhafte und der Edle ständen hier in einer Reihe? Die beiden Enden, Größe und Verächtlichkeit, schlängen sich zusammen? Aus einem Samen sproßte der Schierling und die heilende Pflanze? – Unmöglich! –
Omar. Und warum unmöglich?
Abdallah. Wo ich anbetend in den Staub sinke, wo mein Geist in verehrender Demuth die Flügel zusammenschlägt, wo mein ganzes Wesen sich in Ehrfurcht auflöst, – an diesen Stolz der Menschheit wäre die Schaam der Welt mit unauflöslichen Ketten geschlagen?
Omar. Derselbe Gesang aus einer andern Laute.
Abdallah. Nein, Omar, nein. – Die Gerechtigkeit des Ewigen wird durch diesen Glauben angeklagt. – Wie könnte der Gütige dem Edlen Belohnung und dem Bösewicht Strafen aus jener schwarzen Thür am Ende ihrer Bahn entgegenschicken?
Omar. Abdallah, wir wissen nicht, woher wir kommen, wir wissen nicht, wohin wir gehen. Ob uns ein Gedanke folgt, wenn wir hier Abschied nehmen, ob wir mit allen unsern Träumen in das kalte Grab eingeriegelt werden – o das ist ein Räthsel, vor dem die Weisen ewig forschend stehen werden. – Strafe, – Belohnung, – Tugend, – Laster. – Wenn ich dich fragte, wo du die Scheidewand zwischen Tugend und Laster gründetest, du würdest um eine Antwort verlegen sein. – Die Gewohnheit lehrt uns Worte sprechen, bei denen wir uns oft nur wenig denken.
Abdallah. Omar, du machst, daß ich mir selber mißtraue. –
Omar. Wir sind mit unsrem Lob und unsrer Verdammung so freigebig und kurzsichtig genug, um nicht wahrzunehmen, wie ungerecht wir oft beides vertheilen. – Wir ahnden nicht, daß es nur eine Kraft ist, die in der Tugend und im Laster lebt, beides eine Gestalt, aus demselben Spiegel zurückgeworfen. – Nur ein kalter eigensinniger Thor trat hinzu, schied und sagte: dies sei gut, dies nicht!
Abdallah. Ein Thor?
Omar. Dieses Leben, das uns geliehen ward, ist zu kurz uns selbst zu kennen, – in unsrem eignen Innern herrscht ein wüstes Dunkel und mit vorwitzigem Blick treten wir zu unserm Nachbar und wollen in seiner Seele lesen.
Abdallah schwieg und sahe starr vor sich nieder. Omar fuhr fort:
Alle meine Handlungen sind Gestalten, die aus meinem Innern aufsteigen, von tausend innern Kräften gereift, von hundert Neigungen gepflegt, schießt die Pflanze empor, – nur ich, der Schöpfer, bin mit ihrer Entstehung bekannt, ich verstehe mich selbst nur, ich handle nur für mich, der ich mich selbst kenne, – alle übrigen Menschen sind für mich in einer mindern Abstufung fremde Wesen, wie mir der Wurm und der Krokodil Fremdlinge sind.
Abdallah. Omar, du wirfst mich in eine fürchterliche Einsamkeit, ich verliere mich selbst in der schrecklichen Wüstniß. –
Omar. Ich handle, wie mein innrer Sinn es mir befiehlt, und ein Fremdling, der nicht in das Gebäude meiner Seele hineinschauen kann, der die Leiter nicht entdeckt, von der die Ahndung zum Gefühl, das Gefühl zum Gedanken, zum Vorsatz und dieser endlich zur Wirklichkeit aus dem unergründeten Brunnen heraufstieg, – dieser tritt mit kaltem und verschloßnem Sinn herbei und sagt: deine That ist ein Laster!
Abdallah. O ich verstehe dich! weiter! weiter!
Omar. Aus derselben Quelle wird eine andre Schaale heraufgezogen und man nennt sie Tugend. Beide steigen aus der Tiefe einer Seele hervor, aus einem Stoff gewebt – und man hält sie für Feinde.
Abdallah. Fürchterlich sonderbar!
Omar. Wo ist der Bösewicht, der nicht zum Engel würde, wenn er den Richter in die geheime Werkstätte seiner Seele führen könnte? – Abdallah, wir sind Brüder aller Mörder, die je die Geschichte mit Abscheu genannt hat und schwesterlich schließt sich unsre Seele an alle, die einst bewundert und angebetet wurden. – O ihr Thoren, laßt den nichtigen Rangstreit, ein Hauch weht in allem Leben, – freut euch dieses Hauches, er kehrt nicht zurück, wenn er entflohen ist.
Abdallah. Du führst mich durch Labirinthe, Omar. –
Omar. Als die erste Gesellschaft zusammentrat, als man das erste Gesetz niederschrieb, da veräußerte der Mensch selbst sein hohes, heiliges Recht. Dem Ganzen opferte jeder Einzelne seine Freiheit, allmächtig ward eine Schnur zwischen Gut und Böse gezogen und unglückliche Vorurtheile keimten auf. Vorurtheile, die Menschen gegen Menschen hetzten, das Blut von Tausenden vergossen. – An den Gedanken Verbrecher knüpfte man Haß und Unversöhnlichkeit und eine ewige Verfolgung wühlt durch das ganze Menschengeschlecht. – Seit der Zeit ist der große Spruch gesprochen; in einem nichtigen Taumel greift der eine zur Belohnung seiner Tugend nach der Sonne und tritt gewaltsam seinen Bruder unter sich, der nach dem Uebereinkommen ein Verbrecher ist. –
Abdallah. Ha! die ewigen Schranken stürzen ein!
Omar. Strafe und Belohnung? – Hier unten sind sie entschieden, – aber wen soll der Richter dort belohnen oder strafen? – Sandte er nicht alles was ist, aus seiner Hand in die Sterblichkeit? Ist es nicht sein Athem, der den Staub belebt? – Alle Handlungen kommen zu ihm zurück und melden sich als ihm angehörig: sein Schatten wandelt in tausend Gestalten umher; wo er hinsieht, erblickt er sich nur selbst in dem Spiegel der unendlichen Naturen, soll er, kann er sich selber strafen? –
Abdallah. Omar, halt ein! immer neue Wundergestalten stehn aus einem Abgrund auf, mich zu schrecken. –
Omar. Von einer unbekannten Macht der Welt übergeben, tritt der Mensch seine Bahn an, nicht aus sich selbst hervorgebracht, ohne seinen Willen in das Leben geworfen. – Er lebt und vereinigt tausend Pflanzen und Thiere mit seinem Selbst, sein erstes Wesen geht durchaus verloren, – alle Lagen, von Kindheit an bis in sein Greisenalter, prägen sich in treuen Abdrücken in seinen Geist; alles um ihn her modelt und formt ihn anders, er selbst geht unter, und aus seiner Nahrung, seinem Vergnügen, aus den todten Gegenständen, die ihn umgeben, tritt ein andres fremdes Wesen an seine Stelle, – das nach und nach von einem neuen wieder verdrängt wird.
Abdallah. So sind wir nur eine Hütte, in die ein Fremdling nach dem andern einkehrt und sie dem folgenden überläßt.
Omar. Wer handelt nun? – Wer ist gut, wer böse? – Soll des Mörders Dolch bestraft werden, oder sein Arm, sein Herz, sein Blut? Oder der Gedanke, den er vielleicht vor zwanzig Jahren dachte? – Sein Blut, das er sich nicht selber gab? Der Gedanke, der durch tausend Formen wandelnd, von einem Sonnenstaub seinen Weg antrat und beim gräßlichsten Morde aufhörte?
Abdallah. Undurchdringlich ist das Gewebe, das sich seit Ewigkeiten her verschlang.
Omar. Eigne Kraft ist uns versagt; was wir unsern Willen, unsern Vorsatz nennen, ist nur der Einfluß fremder Dinge, wir sind nur ein Stoff, an welchem fremde Kräfte sichtbar werden; ein großes Spiel von einer fremden Macht regiert, der eine steht als König, der andre als Sklave da, – und alle sind sich gleich, nichts als hölzerne Zeichen, obgleich der König und der Ritter stolz auf das Fußvolk vor sich hinabsehn, – das Spiel ist zu Ende – und Laster und Tugend hört auf verschieden zu sein. – Ein Wirbel dreht sich durch die Welt, alles bis zum kleinsten wirkt in den großen Plan; der eine Augenblick gebiert den folgenden, eine Handlung stößt die andre vor sich her, eine unendliche Kette, die sich rund um alle Welten zieht. Kein Glied kannst du herausreissen, ohne das vorhergehende und folgende zu zerstören und eine allgemeine Vernichtung zu bewirken.
Abdallah. O entsetzlich! – Omar, – ich schaudre, – wenn ich gerade diesen Schritt itzt nicht thäte, – nicht gerade diesen Gedanken dächte – so könnte die Welt nicht erschaffen sein! –
Omar. Nothwendig. – Eine große Schwungkraft belebt die Unendlichkeit, alle Kräfte weben und wirken durch einander von Ewigkeit berechnet, die treibende Gewalt ermattet nie, das Leben fliegt durch alle Pulse der Natur und so geht das große Werk den allmächtigen Gang. – Wie will dies kleine Wesen, der Mensch, sich gegen ewige Gesetze stemmen? Wie in seinem engen Geist den Schöpfer mit all seinen Planen fassen? Eigenmächtig gegen das Weltall wirken und durch sein jämmerliches Dasein noch Verdienst erringen? Ohnmächtig kämpfend wird er fortgerissen, der eine Ton verklingt in der allgemeinen Harmonie.
Beide schwiegen düster vor sich hinbrütend. Ein hohes Roth flog über Omar's Wangen, ein neues Feuer fuhr in seinen Augen auf, er faßte heftig Abdallah's Hand.
Jüngling! rief er aus, was wir gut, was wir böse nennen, verschwimmt in ein Wesen, alles ist nur ein Hauch, ein Geist wandelt durch die ganze Natur und ein Element wogt in der Unermeßlichkeit – und dieses ist Gott!
Abdallah fuhr zurück.
Omar. Wo sollte der Unendliche jenseit der Schöpfung Raum für sich finden? – Er umarmt und durchdringt die Welt, die Welt ist Gott, in einem Urstoff steht er in Millionen Formen vor uns, wir selbst sind Theile seines Wesens! – Dies ist der tiefe Sinn von der Lehre seiner Allgegenwart. – Wirft er einst die Kleidung wieder von sich, dann gehn im Ruin die Welten und seine Himmel unter, dann steht er wieder da, er vor sich selbst, in der ewigen Wüste. –
Eine tiefe Stille. Um Abdallah war alles rund umher versunken – er stand mit gesenktem Haupte und betrachtete in seinem Innern die gestaltlosen Bilder, die auf- und niederschwebten. – Omar, sagte er nach langer Zeit, – nun ist die Kraft meiner Seele versiegt, alle meine schönen Entwürfe, meine wonnevollen Schwärmereien liegen wie Leichen um mich her, alle Freuden sind verwelkt, alle Hoffnungen in meiner Brust verwest. – Ein Kampf rastloser Zweifel wüthet da, wo ehedem meine Himmel standen.
Omar. Du hast es so gewollt, du hast das fürchterliche Todtengerippe ausgegraben, wo du einen Schatz zu finden hofftest. – O, wohl dem, der mit verbundnen Augen durch das Leben taumelt! der nie sich selbst anrührt und furchtsam fragt: Wer bin ich?
Abdallah warf sich unter eine Cipresse nieder. Sein Geist war von hundert neuen Vorstellungen verwirrt, ohne sich festhalten zu lassen flohen tausend Gestalten seiner Seele mit Blitzesschnelle vorüber.
Der Mond stand itzt hinter den dunkeln Zweigen der Tannen und von zitternden Schatten getheilt, gossen sich goldene Streifen über die Wiese aus. Ein leiser Abendwind wiegte sich in den Wipfeln der Bäume und spielte mit einem Blatte, das auf dem glatten See schwankend tanzte; ruhig betrachtete sich die Gegend selbstgefällig in dem Wasserspiegel und der Duft der Nacht stieg ernst und langsam aus dem Schooß der Erde.
Die schöne Landschaft, mit all den lieblichen Träumen, die über ihr hingen, vermischte sich nach und nach mit den Gedanken Abdallah's; er hatte sich schon den Spielen seiner Einbildungskraft überlassen, als er noch zu denken glaubte.
Die Wipfel säuselten immer leiser und leiser, vom Winde angehaucht lief ein stilles Flüstern durch das Rohr des Sees, – immer wunderbarer spielte das Mondlicht um die buschichten Tannenzweige, – noch einigemal blickte er mit mattem Auge empor und sahe wie vom nahen Berge ein Greis in die Arme seines Omar eilte, – beide hielten sich umarmt – als die Gegend allgemach wie hinter einem schwarzen Vorhang hinabsank. –
Aus den Cypressen stiegen Träume auf ihn herab, durch seine Augenlieder dämmerte schwach in seine Traumgestalten die monderhellte Gegend. –
Plötzlich rollt es dumpf wie ferne Donner, ein wildes Rauschen, wie wenn die erboßte Fluth gegen Felsen hinanheult, fuhr immer lauter und lauter über ihn dahin, – Abdallah erwachte.
Da stand er einsam in schwarzer Nacht, Stürme hatten den Mond hinter ferne Gebirge hinabgeschleudert, große Wolken wälzten sich krauß durch einander, die hohen Wipfel der Cedern schlugen krachend zusammen. – Ein Schaudern springt aus dem Walde hervor und packt ihn an mit eiskaltem Arm. Omar! ruft er mit bebender Stimme, aber höhnend stürmt der Orkan durch seine Töne und wirft sie zerrissen in die Lüfte.
Ein leuchtender Glanz flammte plötzlich in den Wolkengebirgen auf, eine Feuerkugel flog durch den Himmel, von einer andern verfolgt, die tausend blendende Funken von sich sprühte. – Jeder Funken sprang mit einem Donner los, der sich furchtbar auf des Sturmwinds Schwingen über alle Wälder hinabwälzte. – Mit lautem Gebrüll sank die Kugel nieder und die stille Nacht stand wieder um Abdallah. –
Eine bleiche zitternde Gestalt fährt aus dem nahen Busche und ergreift kalt Abdallahs Hand, – es war Omar. – Krampfhaft preßte er die Hand des Jünglings in die seinige und riß ihn mit sich fort. –
Abdallah folgte schaudernd.
Sie kamen in die Stadt und eilten auf ihr Gemach, Omar's Gesicht war lang und verzerrt, sein Auge rollte wild. Abdallah wagte kaum, ihn anzusehen. – An Geist und Körper müde, legte er sich schlafen, Omar ging noch lange gedankenvoll umher.
Drittes Kapitel.
Abdallah erwachte, als Omar sich schon entfernt hatte. Der Tag sah trübe durch die Fenster und eine schwermüthige Erinnerung des gestrigen Abends kam ihm sogleich entgegen. Sein Leben trat itzt eine neue Bahn an; alles, was er vorher gedacht hatte, war von einem Strudel kämpfender Zweifel verschlungen. Alle seine früheren Gedanken schienen ihm unreif und kindisch; er hatte mit Leidenschaft die Lehre Omars ergriffen und doch that es ihm weh, seine ganze Pflanzung, die er so sorgfältig aufgezogen hatte, zerstört zu sehn. – Wie eine schwarze Nacht stieg es in ihm auf, wenn sein Geist noch einmal über alle die Gedanken hinwegsahe, die er seit gestern dachte; er hätte es so gern nicht geglaubt, er hätte so gern den vorigen Sonnenschein zurückgerufen, die vorige Unschuld seiner Seele zurückgezaubert, aber sein Verstand wies mit verachtendem Ernst alle seine früheren Gedanken zurück, die wieder in ihm aufdämmern wollten.
O heilige Tugend! rief er aus, – vor derem Bilde ich einst niederkniete, – dein Altar ist umgestürzt! Du Sonne bist erloschen, zu der ich mit kühnem Fittig emporfliegen wollte und der Pfeil des Zweifels hat meine Schwingkraft gelähmt. – Wer bin ich, wenn diese Gottheit todt ist, die mich sonst mit mütterlichem Lächeln zu sich lockte? – Ich muß mich selbst verachten, wenn ich nicht mein eigen bin, wenn nur eine finstre Nothwendigkeit mich durch das Leben jagt, wenn ich dem Druck einer fremden Macht nachgeben muß, die mich wider meinen Willen zu Gräueln oder edeln Thaten drängt. – Doch, was schwatz' ich? – Mein Wille sinkt im Triebwerk des Ganzen unter und mit der Tugend ist das Laster zugleich gestorben, ich bin ein abgerißnes Blatt, das der Wirbelwind nach seinem Gefallen in die Lüfte wirft. – Der Unendliche, den ich sonst schwindelnd dachte, auf dessen Vatersorge und Allmacht ich so fest vertraute – er und das Schicksal ist mir entrissen. Im Felsen und im Gesträuch steht der Unfaßliche vor mir, mir näher gebracht und dadurch um so entfernter. Omars Lehre hat mich zu einer Waise, mich mir selbst verächtlich gemacht, – und doch bin ich ein Strahl jener Gottheit! –
Er schwieg und verlor sich immer tiefer in seinen Träumen; Gefühle wollten sich itzt in seine Seele zurückdrängen, die ihn einst so bezaubert und die Aussichten des Lebens so verschönt hatten, aber kein Klang aus der Vorzeit schlug wie ehedem an seine verstimmte Seele. O! rief er aus, gieb mir meine glückliche Unwissenheit zurück, Omar, laß mich wieder zum Kinde werden, wie ich war, mein Geist ist zu schwach für diese Last, er seufzt gekrümmt unter der drückenden Bürde.
Raschidtrat itzt zu ihm herein. Er war kein Freund Abdallah's, aber einer von den angenehmen Gesellschaftern, an die der Jüngling sich so leicht schließt und sie eben so leicht wieder verliert. Er war Aufseher über die Gärten des Sultans und kam itzt zu Abdallah um Trost zu suchen, denn er war gewöhnlich finster und verdrüßlich. Abdallah ging ihm freundschaftlich entgegen. »Willkommen, sprach er, indem er ihm froh die Hand drückte, ich habe dich lange nicht gesehn.« – Er freute sich, daß ihn jemand aus seinen Träumereien riß, die er gern von sich abwarf und sich dem Wohlwollen überließ. – Willkommen! rief er noch einmal.
Raschid war traurig, sein Gesicht war bleich und sein Auge eingefallen. Ein schweres Leiden schien seine Seele zu drücken, eine tiefe unbestechliche Schwermuth sahe aus seinem schwarzen tiefliegenden Auge, nichts vermochte eine Heiterkeit über sein Gesicht zu werfen, seine Stimme war langsam und ohne Feuer. –
Dein Anblick wird immer kränker, fuhr Abdallah fort.
Raschid. Kränker? – Wirklich? – Vielleicht geh' ich dem Tode entgegen.
Abdallah. Dem Tode? –
Raschid. Ich hoff' es.
Abdallah. Du hoffst es?
Raschid. Mein Geist erträgt die Leiden nicht mehr, die sich immer höher thürmen.
Abdallah. Deine Liebe, Raschid, wird dich in dein Grab hinuntertragen. – Sei heitrer, verabschiede deinen Gram und werde wieder der blühende Jüngling, der du warst. – Die Liebe soll ja, wie man sagt, in Felsen Paradiese auferstehen lassen und dir –
Raschid. O glücklich, daß du davon wie von einem unbekannten Lande sprichst. – Doch nein, du bist unglücklich. – Ein Wesen ohne Liebe, – eine Laute ohne Saiten. – Für die göttlichsten Empfindungen todt kriecht der Gefühllose im Staube, wenn der Liebende den glänzenden Fittig im Morgenrothe wiegt. –
Abdallah. Und dennoch nennst du dich elend. –
Raschid. Ja und doch möcht' ich meine Liebe nicht zurückgeben, – Freund, nur ein Blick aus ihrem Auge – ach! er würde den Frühling in meiner Seele wieder auferwecken! – Eiserne, unzerbrechliche Ketten halten mich zurück, – ich liebe und darf nicht hoffen, – ich wünsche und meine Wünsche überschreien meinen Verstand; wenn er zuweilen die Stimme erhebt, – o dann treten sie alle bleich zurück. – Mein Unglück hat alle Blumen um mich her ausgerissen und in den Wind verstreut, die Freude hat mich in eine düstre Nacht geworfen und mir ewig ihre Thür verschlossen, – ach Abdallah, ich sterbe gern: denn welcher Wunsch, welche Hoffnung soll mich in's Leben zurückhalten? –
Abdallah. Wer würde nicht wenigstens hoffen? –
Raschid. Ach! wenn ich nur hoffen dürfte! wenn ich nur eine Spalte in der hohen Felsenmauer entdeckte, durch die ich mich hindurchwinden könnte!
Abdallah. Du hast mir aber noch nie den Gegenstand deiner Liebe genannt – wen liebst du?
Raschid. Laß dies noch itzt ein Geheimniß bleiben. – Ach! ich möcht' es mir selber nicht gestehn, daß der Mensch sich seinem Glücke Mauern in den Weg baute, die seiner Ohnmacht spotten, daß – ich kam hierher mich zu trösten und ich gehe trauriger von dir als ich kam.
Abdallah. Wodurch kann ich dich trösten?
Raschid. Nein, ich mag auch nicht getröstet sein. – Lebe wohl – dieser Schmerz ist mir lieb, denn ich leide ihn für sie, – ich will in der Einsamkeit meine Thränen weinen, ich finde keinen Menschen, der mich versteht.
Er ging und Abdallah sah ihn traurig nach, dann versank er wieder allmählig in sein voriges Nachdenken. Omar kam. – Du bist so tiefsinnig, Abdallah?
Abdallah fuhr auf und sahe ihn bedeutend an.
Worüber dachtest du? fragte Omar.
Abdallah. Ueber deine gestrigen Lehren.
Omar. Sie haben dich traurig gemacht.
Abdallah. Ich irre in einer ausgestorbenen Wüste, alles ist hin, was einst mein