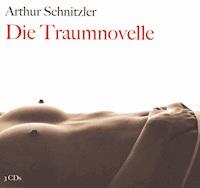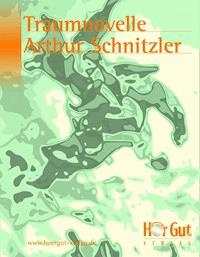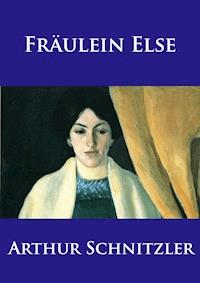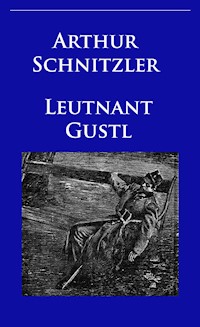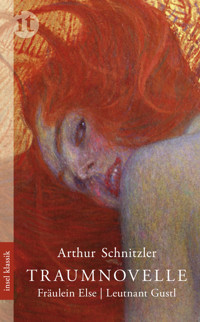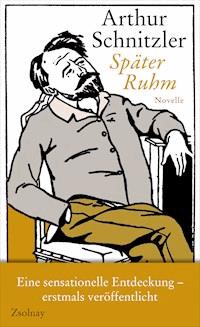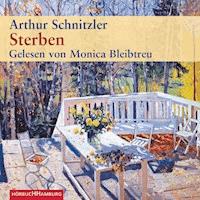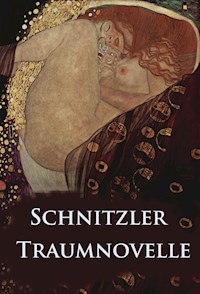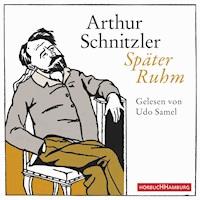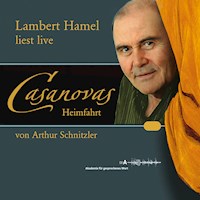1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Fischer Klassik Plus
- Sprache: Deutsch
Mit dem Autorenporträt aus dem Metzler Lexikon Weltliteratur. Mit Daten zu Leben und Werk, exklusiv verfasst von der Redaktion der Zeitschrift für Literatur TEXT + KRITIK. Im Jahr 1520 wütet die Pest in Bergamo und auch die Eltern des 18-jährigen Anselmo Rigardi sterben. Anselmo überwindet seine Trauer schnell und fühlt sich nun vor allem frei – muss er doch niemandem mehr Rechenschaft ablegen. Überzeugt davon, dass ihm ein besonderes Schicksal vorbestimmt ist, verlässt er seine Heimatstadt und begibt sich auf eine siebentägige Wanderung durch Italien.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 99
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Arthur Schnitzler
Abenteurernovelle
FISCHER E-Books
Mit dem Autorenporträt aus dem Metzler Lexikon Weltliteratur.
Mit Daten zu Leben und Werk, exklusiv verfasst von der Redaktion der Zeitschrift für Literatur TEXT + KRITIK.
Daß Anselmo am gleichen Tage Vater und Mutter verlor, bedeutete ein Schicksal, das zu diesen Zeiten manchem Jüngling beschieden war, dem jungen Rigardi wohl nicht einmal als dem einzigen in Bergamo, wo in den ersten Tagen des Jahres 1520 plötzlich die Pest ausgebrochen war, die wunderbarerweise bis dahin gerade diese kleine Stadt verschont hatte, und nun mehr als drei Viertel der Bevölkerung vernichtete. Ganze Familien waren ausgestorben, die meisten Häuser standen leer, Ärzte und Apotheker waren, wie es so oft geschah, gleich im Beginn dahingerafft worden. Die Familie Rigardi war zuerst verschont geblieben, obwohl das alte, ziemlich verfallene Haus mitten in der Stadt und nicht im gesündesten Teile stand, und schon hatten der Baron, seine Frau und Anselmo sich gefeit geglaubt, als das Übel ganz unvermutet, während sich die Überlebenden schon zu neuer Arbeit und neuer Freude rüsteten, das Ehepaar Rigardi überfiel und Anselmo, der abends vorher noch mit ihnen an der Tafel gesessen, am nächsten Morgen allein an der leeren Lagerstatt seiner Eltern stand. Die Magd und der Diener waren in Angst entflohen. Die Toten selbst waren nach der strengen Verordnung von den dazu Beamteten unverzüglich fortgeschafft worden, feierliche Leichenbegräbnisse, ja geordnete Begräbnisse gab es längst nicht mehr, und wer in diesen Pestzeiten verschieden war, dessen Ruhestatt suchte man später vergebens.
Zugleich mit seiner Einsamkeit und seinem Grauen aber fühlte Anselmo, als das Tor hinter den Särgen zugefallen war, noch ein Drittes, ihm gerade so ungewohnt wie die Einsamkeit und das Grauen und auch wie der Schmerz, der ihm übrigens noch kaum zum Bewußtsein gekommen war. Dieses Dritte war ein Gefühl von Freiheit, das er bisher nicht gekannt hatte. Mit einem Male war er plötzlich keinem Menschen, weder Vater noch Mutter, Rechenschaft schuldig. Er hätte den Abend, die Nacht hinbringen dürfen, wo und wie es ihm beliebte, und des Morgens hätte ihn niemand gefragt, woher er käme. Doch war diesem Bewußtsein einer plötzlich gewonnenen Freiheit kaum noch das aufatmende Gefühl der Befreiung beigemischt, denn er war seiner Unselbständigkeit, seiner Gebundenheit noch nicht recht bewußt. Er war streng, aber eigentlich ohne Härte gehalten worden.
Die Rigardi waren ein uraltes Geschlecht von Baronen, aber der einstige Reichtum – fast ein Viertteil der Stadt war in ihrem Besitz gewesen, Häuser und Grund, auch Ländereien außerhalb der Gemarken – war allmählich zunichte geworden. Die Ahnen hatten an Kriegsunternehmungen teilgenommen, von denen sie im Siegesfalle wenig Nutzen gezogen, doch wenn sie der unterliegenden Partei angehörten, hatten sie immer aus eigener Kasse zusetzen müssen. Dazu kam, daß seit zwei Jahrhunderten kein Rigardi vermocht hatte, durch eine günstige Heirat, wie es vielen ihrer Standesgenossen geglückt war, seine Verhältnisse zu verbessern; und der Großvater hatte im Würfelspiel so viel verloren, daß Anselmos Vater, ein ernster und redlicher Mann, sein ganzes Leben lang an den Schulden der Familie abzuzahlen hatte. Und so war ihm außer einer verpachteten Landwirtschaft, die allerlei Nahrhaftes für den Hausstand lieferte, nichts verblieben als das Stammhaus, der Palazzo Rigardi, das freilich nicht mehr viel von einem Palast an sich hatte, nichts als den düsteren Bau der gewaltigen Quadern, die auch der Ewigkeit widerstanden hätten, das eiserne Tor, an dem vor hundertfünfzig Jahren der Ansturm der Veroneser Lanzenreiter zerschellt war und die hochgewölbte Halle mit den Reliefs des Bildhauers Giuliani, in der freilich längst keine Feste mehr stattfanden und in der es keinen anderen Lärm mehr gab als das Klingen und Klirren der Degen, wenn Anselmo mit seinem Fechtmeister übte, dem altberühmten Raboldi aus Neapel, nach dem ein gewisser unwiderstehlicher Primhieb jahrzehntelang den Namen beibehielt. Aber auch der hatte in den letzten Jahren für Anselmo keinen Schrecken mehr. Denn er selber war in der Fechtkunst sehr geschickt, ja im letzten Jahr beinahe ein Meister geworden, und es wunderte die paar jungen Herren von Bergamo, mit denen er, zum fast einzigen geselligen Vergnügen, unter Raboldis Leitung ein- oder zweimal im Monat kleine Turniere ausfocht, daß er bei alledem keine eigentlich kriegerischen Neigungen zeigte, sondern seine Fertigkeit nur um der Kunst willen auszuüben schien. Manche meinten, Raboldi auch, daß er schon um dieser in jenen Zeiten besonders gerühmten Gabe willen sicher seinen Weg machen müßte, wenn er sich auf Reisen begäbe und, was ihm mit seinem Namen nicht schwerfallen sollte, Zutritt an den Hof eines Fürsten oder Kardinals fände, deren es in diesem zerrissenen Land viele gab. Aber um Anselmo auszustatten, wie es für eine solche Unternehmung wenigstens nach des alten Rigardi Meinung, nötig gewesen wäre, waren nicht genügend Mittel vorhanden, und gerade in diesem letzten Jahr vor Ausbruch der Pest war vielmehr die Rede davon gewesen, daß Anselmo, der überdies, wenn nicht eben mit Begeisterung, doch mit leidlichem Fleiß unter der Führung seines Vaters sich im Lateinischen und in der Mathematik einigermaßen ausgebildet hatte, die Universität Padua beziehen sollte, um sich dort entweder dem Studium der Rechtsgelehrsamkeit oder der Heilkunde zu widmen. Mit dem rechten Ernste war dies alles freilich noch von keiner Seite erwogen worden. Keineswegs hätte Anselmo einer entschiedenen Mahnung sich widersetzt, denn er hatte noch nie Gelegenheit gehabt, auf einer eigenen Meinung zu bestehen. Auch schien es ihm und den wenigen Freunden des Hauses, daß weder Vater noch Mutter ihn leichten Herzens hätten fortziehen lassen, um so weniger, als seine einzige Schwester, ein blühendes Mädchen von fünfzehn, gerade im letzten Sommer, vor Ausbruch der Pest, als hätte sie sich vor der furchtbaren Seuche in einen schöneren Tod geflüchtet, bei einer Kahnfahrt im See von Iseo ertrunken war, zusammen mit den Geschwistern Decarli, Florio und Maria. Anselmo wußte nicht, um wen von den dreien er am meisten trauerte, um seine Schwester, um Florio, seinen besten Freund, oder um Maria, das einzige junge Mädchen bisher, das zärtliche Gefühle in ihm erregt hatte. Die Liebe zu ihr hatte ihn bis dahin vor jeder Verführung bewahrt, die dem Achtzehnjährigen in mancherlei anmutiger oder bedenklicher Gestalt genaht war. Und als bald nach dem Tod der drei blühenden jungen Menschen das Grauen über die Stadt hereingebrochen war, ergaben nur die sich dem Genuß, denen er schon früher vertraut gewesen und nun Rettung vor Angst und Grauen bedeutete. Oft geschah es dann, daß ein Mann in den Armen seiner Geliebten, eine Frau in den Armen ihres Geliebten erkrankte, und es dauerte selten eine Nacht und einen Tag, daß eines dem andern in den Tod folgte.
So jagten Bilder, Gedanken, Erinnerungen ungeordnet durch Anselmos Hirn, während er in der dunkelnden Halle ruhelos auf und ab ging. Keiner von den Freunden – es lebten nicht viele mehr – hatte sich, seit gegen Mittag die Leichen der Eltern fortgeschafft worden waren, in dem verpesteten Haus gezeigt, kein Diener hatte die Fackeln entzündet, die gestern um die gleiche Zeit noch den Raum erleuchtet, unbestimmt schimmerten von den Wänden her die Figuren des Giuliani – schäumende Pferde, trunkene Greise, bekränzte Weiber – bewegten sich, schienen selbst auf der Flucht, und die breite Treppe, die zu dem oberen Stockwerk führte und über die vor kurzem die schwarzen Bahren mit den verhüllten Leichen, von vermummten Trägern gestützt, geschwankt hatten, verlor sich nach oben, gleichsam in Nacht. Niemand auch hatte ihm ein Mahl zugerichtet, niemand die Schlafstatt bereitet, sinnlos unaufhörlich irrte er, den Wänden entlang, in der Halle umher, die, sich bald verengend, bald verbreiternd, bald ein Gefängnis, bald die Unendlichkeit selber schien.
Und plötzlich wußte Anselmo, daß er hier nichts anderes mehr zu erwarten hatte als den Tod. Was sollte er tun? Sollte er aus der Speisekammer sich Brot und Früchte holen, denen wohl das Pestgift anhaftete? Die Lippen letzen mit einem verpesteten Trunk an dem Brunnen? Sollte er hinauf in sein Gemach, das er seit den ersten Morgenstunden nicht mehr betreten, da die Todesschreie der Eltern ihn an ihr Lager gerufen? Sollte er sich auf sein Bett strecken, auf den Ausbruch der Krankheit warten bis zum eigenen Todesschrei, den niemand hören würde? Oder sollte er sich ans Fenster stellen und nach Menschen rufen? Was konnten sie ihm helfen? Dieses Haus, in dem er jetzt weilte, war das einzige noch verseuchte in Bergamo, es würde keiner wagen einen Fuß hineinzusetzen. Sonst wäre doch wenigstens einer schon gekommen. Nein, sie dachten wohl zu warten, bis auch ihn das Schicksal ereilt hatte, bis ihn die vermummten Träger hinausgeschleppt hätten, dann würde man kommen, um den Palazzo Rigardi auszuräuchern oder gar zu plündern.
So blieb ihm nur eines: zu fliehen. Und kaum hatte er diesen Entschluß gefaßt, schien auch schon die Gefahr geringer, die hier aus allen Ecken entgegendrohte. Mit einem Male erschien er sich gefeit.
Er entzündete ein Licht, begab sich in die Speisekammer, holte allerlei zum Essen, Backwerk, Früchte, auch ein gebratenes Huhn, das von dem gestrigen Nachtmahl noch übrig geblieben war, holte aus dem Keller eine Flasche roten Weins, entzündete die Fackeln in der Halle, ängstigte sich auch vor den irrenden Schatten nicht mehr, die über den Boden flatterten, rückte den Tisch aus der Ecke, an dem er noch gestern abend mit den Eltern gespeist, und ließ es sich vortrefflich schmecken. Und wunderbarerweise ward ihm so behaglich zu Mut, als hätte er seit gestern, seit heute nacht nicht all das Furchtbare erlebt, ja, er ward seiner Einsamkeit, seiner Ungestörtheit unbegreiflich froh. Daß er gänzlich allein war, völlig auf sich angewiesen, niemandem Gehorsam schuldig, gab ihm allmählich ein Gefühl des Stolzes, das er bisher nicht gekannt. Er war nicht mehr Anselmo Rigardi, der Sohn seiner Eltern, nicht ein junger Herr aus heruntergekommenem Hause, nicht einer, der sich, was immer er wollte oder tat, vor allem zu beraten, Rede und Antwort zu stehen hatte, nichts zwang ihn auf die Universität nach Padua zu gehen und dort zu studieren, er war der Jüngling Anselmo, durfte die Schritte lenken, wohin er wollte, und die Welt gehörte ihm.
Wie nun der Wein, von dem er mehr getrunken als je, durch seine Adern rollte, schwand auch die Angst vor Schlafzimmer und Bett. Er begab sich in das kleine Turmgemach, wo er von Kind auf hauste, entkleidete sich, streckte sich aufs Lager hin. In seinen ersten Schlummer drang von der Straße her Lachen und Singen junger Menschen, ja, ihm war, als erkennte er manche Stimme, als hörte er das Lachen einer ganz bestimmten Frau, die in den letzten Tagen versucht hatte, ihn Maria vergessen zu machen. Auch sie hatte sich heute nicht in das Haus gewagt, und wäre er schon tot gewesen, sie hätte sich kaum darum gekümmert. Er hatte mit ihr, mit all den anderen Freunden und Freundinnen nichts zu schaffen, er dachte an die vielen, die die Pest vernichtet hatte, an die wenigen, die noch lebten, und bei manchen erinnerte er sich kaum, ob sie zu den Lebenden oder Toten gehörten.
Als er die Augen aufschlug, graute die erste Frühe durch das hohe schmale Turmfenster. Traumlos war sein Schlaf gewesen, niemals war er zu einem so klaren Tage erwacht. Er mußte sich nicht, wie es in solchen Morgenstunden nach ungeheuren Erlebnissen des vergangenen Tags der Fall zu sein pflegt, erst allmählich besinnen, er wußte gleich: Vater und Mutter waren tot, und es war, als hätte er auch schon den Schmerz um sie hinter sich gelassen, als hätte diese Nacht gewaltig in der Tiefe strömend auch die Eltern gleich zu den andern früher Verstorbenen hingerissen. Er erhob sich, über die hallende Treppe durch die noch immer dämmernde Halle lief er auf den Hof und wusch sich unter dem grauenden Himmel am Brunnen. Er zog sein bestes Linnen und sein bestes Gewand an, packte nur wenige Kleidungsstücke in sein Ränzel, aus einem Schrank, wo der Vater sein Geld verwahrte, nahm er, was sich an Goldstücken und Nickelmünzen noch vorfand, gürtete seinen Degen um und als einer, der sich anschickt eine Stätte des Grauens und des Fluchs auf immer zu verlassen, trat er auf die Straße. Beide Flügel des Tors ließ er offen stehen. Mochten sie mit dem Palazzo Rigardi machen, was sie wollten.