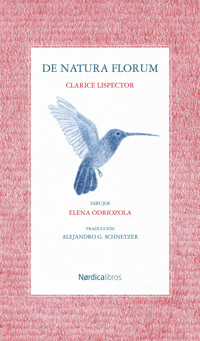14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Endlich wiederentdeckt: die Virginia Woolf Südamerikas
Platz 1 der SWR Bestenliste, eine beeindruckende Anzahl hymnischer Rezensionen und eine Nominierung der Übersetzung für den Preis der Leipziger Buchmesse 2020: der erste Band von Clarice Lispectors Erzählungen (»Tagtraum und Trunkenheit einer jungen Frau«) begeisterte die Presse ebenso wie Leserinnen und Leser. Zum 100. Geburtstag der Autorin liegt nun der zweite und letzte Band vor. Auch er zeigt die brasilianische Ausnahmeautorin wieder als einzigartige Chronistin des weiblichen Lebens und seiner Abgründe: Eine junge Frau entdeckt nach vielen Demütigungen das ekstatische Glück des Lesens. Ein Hausmädchen versinkt in traurigen Gedanken, um gestärkt in den Alltag zurückzukehren. Eine Beobachterin taucht in fremde Menschen ein und wird zu deren Fleisch. In 44 Geschichten, entstanden auf dem Höhepunkt ihrer literarischen Karriere und für diese Ausgabe von Luis Ruby neu übersetzt, paaren sich widersprüchlichste Gefühle und kühne Bilder mit philosophischer Erkenntnis. Lispector macht uns staunen – nicht zuletzt über die Kompliziertheit des Lebens.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 403
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Endlich wiederentdeckt: Die Virginia Woolf Südamerikas
Carla tanzt im Nachtclub und ist doch keine richtige Frau. Carmem und Beatriz reisen nach Montevideo und entledigen sich ihres gemeinsamen Liebhabers. Maria das Dores erlebt eine jungfräuliche Geburt und nennt ihr Kind: Emmanuel… Entstanden auf dem Höhepunkt von Lispectors literarischer Karriere, sprengen diese 44 Geschichten alle Grenzen der Konvention, des Denkens und der Sprache. So humorvoll wie tiefgründig erzählen sie von weiblicher Lust, dem Begehren im Alter, von der Kompliziertheit des Lebens und der unendlichen Freiheit des Schreibens. Weit zugänglicher als ihre Romane, überraschen Lispectors Geschichten immer wieder mit kühnen Bildern, mit philosophischen Rätseln und tiefer Erkenntnis.
Zusammen mit dem Band Tagtraum und Trunkenheit einer jungen Frau liegen zum 100. Geburtstag Clarice Lispectors, dieser brasilianischen Ausnahmeautorin, all ihre Erzählungen in neuer, teilweise erstmaliger deutscher Übersetzung vor.
Clarice Lispector wurde 1920 als Tochter jüdischer Eltern in der Ukraine geboren und wuchs im ärmlichen Nordosten Brasiliens auf. Sie studierte Jura, arbeitete als Lehrerin und Journalistin und führte als Diplomatengattin ein ebenso glamouröses wie rebellisches Leben. Bereits ihr erster, viel beachteter Roman Nahe dem wilden Herzen brach 1944 klar mit allen Regeln konventionellen Schreibens. Von Krankheit und Tablettenkonsum zerstört, starb Lispector 1977 mit nur 56 Jahren in Rio de Janeiro.
»Die ideale Gelegenheit, die zutiefst weiblichen Obsessionen dieser Diva der modernen brasilianischen Literatur kennenzulernen. Geheimnisvolle Geschichten von wildem und sprunghaftem Eigensinn.« Der Tagesspiegel, Gregor Dotzauer
»Große Kunst.« taz – die tageszeitung, Fokke Joel
»Eine gefährliche Literatur – verstörend, rätselhaft und gerade darin faszinierend.« ORF, Susanne Schaber
Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook
CLARICE LISPECTOR
ABER ES WIRD REGNEN
SÄMTLICHE ERZÄHLUNGEN II
Herausgegeben von Benjamin Moser
Aus dem brasilianischen Portugiesisch von Luis Ruby
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel Todos os contos bei Editora Rocco Ltda.
In deutscher Sprache erscheint das Buch in 2 Bänden, Band I erschien im Herbst 2019.
Die Übersetzung dieses Werkes wurde gefördert vom brasilianischen
Ministerium für Kultur in Zusammenarbeit mit der Stiftung Nationalbibliothek und dem Tourismusministerium.
Obra publicada com o apoio do Ministério das Relações Exteriores do Brasil em cooperação com a Fundação Biblioteca Nacional | Ministério do Turismo.
Der Übersetzer dankt dem Deutschen Übersetzerfonds e. V.
für die großzügige Förderung seiner Arbeit durch ein Exzellenzstipendium.
Copyright © 1940, 1941, 1944, 1960, 1964 by the Heirs of Clarice Lispector
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2020
Penguin Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Übersetzung von »Heimliches Glück«, »Reste vom Karneval« und Teilen der Erzählung »Brasília« © Schöffling & Co. Verlagsbuchhandlung GmbH, Frankfurt am Main. Alle Übersetzungen wurden für diese Ausgabe überarbeitet.
Dieses Buch wurde vermittelt durch: Agencia Literaria Carmen Balcells, Barcelona
Redaktion: Maria Hummitzsch, Corinna Santa Cruz
Umschlaggestaltung: Sabine Kwauka
Umschlagmotiv: © Teresa Pintó /Agencia Balcells und shutterstock / Cartone Animato
Autorinnenfoto: © Paulo Gurgel Valente
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-641-26287-7V002
www.penguin-verlag.de
INHALT
HEIMLICHES GLÜCK
Heimliches Glück
Reste vom Karneval
Iss, mein Sohn
Gott vergeben
Hundert Jahre Ablass
Eine Hoffnung
Das Hausmädchen
Federzeichnung eines Jungen
Eine Geschichte von so viel Liebe
Die Wasser der Welt
Unfreiwillige Fleischwerdung
Zwei Geschichten auf meine Art
Der erste Kuss
WO WART IHR IN DER NACHT
Auf der Suche nach einer Würde
Die Abfahrt des Zuges
Knappe Studie zum Thema Pferde
Wo wart ihr in der Nacht
Bericht vom Ding
Bekanntmachung der Stadt
Dona Frozinas Finessen
Da will ich hin
Der Tote im Meer von Urca
Stille
Ein erfüllter Nachmittag
So viel Sanftmut
Seelensturm
Ungeschminktes Leben
DER KREUZWEG DES LEIBES
Erklärung
Miss Algrave
Der Körper
Kreuzweg
Der Mann, der plötzlich auftauchte
Er hat mich getrunken
Vorübergehend
Tag um Tag
Der Klang von Schritten
Bevor es die Brücke zwischen Rio und Niterói gab
Praça Mauá
Die B-Sprache
Besser als Feuersqualen
Aber es wird regnen
VISION VOM GLANZ – LEICHTE EINDRÜCKE
Brasília
LETZTE GESCHICHTEN
Die Schöne und das Biest oder Die Wunde, die allzu groß war
Ein Tag weniger
ANHANG
Bibliografische Notiz
HEIMLICHES GLÜCK
HEIMLICHES GLÜCK
Sie war dick, klein, sommersprossig und hatte viel zu krauses Haar, mit einem Stich ins Rotblonde. Sie hatte einen riesigen Busen, während wir anderen Mädchen noch flachbrüstig waren. Und als wäre das nicht genug, stopfte sie sich die Brusttaschen ihrer Bluse mit Bonbons aus. Aber sie hatte etwas, das jedes auf Geschichten versessene Kind gerne gehabt hätte: einen Vater mit einer Buchhandlung.
Viel Nutzen schlug sie daraus nicht. Und wir noch weniger: Selbst zu Geburtstagen bekamen wir von ihr kein Büchlein aus dem Laden des Vaters – und wäre es noch so billig –, sondern nur eine schlichte Postkarte, und zwar ausgerechnet eine Ansicht unserer eigenen Stadt Recife mit ihren Brücken, die wir in- und auswendig kannten. Auf die Rückseite schrieb sie in verschnörkelten Lettern Floskeln wie »Ehrentag« und »liebe Grüße«.
Aber welch ein Talent für Grausamkeit! Das Mädchen war reine Rachsucht, geräuschvoll Bonbons lutschend. Wie musste sie uns hassen, die wir so unverzeihlich hübsch waren, so schlank und groß gewachsen, mit frei fallenden Haaren. Mir gegenüber betrieb sie ihre sadistische Neigung mit ruhiger Unmenschlichkeit. In meiner Gier nach Lektüre bemerkte ich kaum, welchen Demütigungen sie mich unterwarf: Immer weiter bettelte ich, sie möge mir die Bücher borgen, die sie nicht las.
Bis der große Tag kam, an dem sie mich endlich einer Folter unterziehen konnte, die geradezu von chinesischer Raffinesse war. Scheinbar beiläufig sagte sie, sie besitze Monteiro Lobatos Reinações de Narizinho.
»Näsleins Vergnügungen« war ein dickes Buch, mein Gott, in diesem Buch konnte man leben, davon essen, darin schlafen. Und ich konnte es mir nicht annähernd leisten. Sie lud mich ein, am nächsten Tag zu ihr zu kommen, dann werde sie es mir borgen.
Bis zum nächsten Tag verwandelte ich mich in die reinste Hoffnung auf Freude: Ich lebte nicht, ich schwamm gemächlich in einer sanften See, die Wellen schaukelten mich hin und her.
Am nächsten Tag ging ich, rannte ich buchstäblich zu ihr. Sie wohnte nicht in einem Mietshaus wie ich, sondern in einem Einfamilienhaus. Sie bat mich nicht herein. Stattdessen sah sie mir tief in die Augen und sagte, sie habe das Buch einem anderen Mädchen geliehen, ich möge am nächsten Tag wiederkommen. Mit offenem Mund trottete ich davon, doch schon bald ergriff die Hoffnung wieder von mir Besitz, und ich begann erneut, die Straße entlangzuhüpfen, in der mir eigenen seltsamen Art, mich durch die Straßen von Recife zu bewegen. Diesmal sogar ohne hinzufallen: Mich leitete die Aussicht auf das Buch, der nächste Tag würde kommen, die nächsten Tage würden später mein ganzes Leben sein, die Liebe zur Welt erwartete mich, ich lief hüpfend durch die Straßen wie immer und fiel kein einziges Mal hin.
Doch dabei blieb es nicht. Der geheime Plan der Buchhändlerstochter war gelassen und teuflisch. Am nächsten Tag stand ich also wieder vor ihrer Tür, lächelnd und mit pochendem Herzen. Um die ruhige Antwort zu hören: Sie habe das Buch noch nicht zurück, ich möge am nächsten Tag wiederkommen. Ich hatte ja keine Ahnung, dass sich später, im Laufe des Lebens, das Drama mit dem »nächsten Tag« immer wieder neu abspielen sollte. Und ich mit pochendem Herzen.
Und so ging es weiter. Wie lange? Ich weiß es nicht. Sie wusste, dass es endlos weitergehen konnte, solange nicht sämtliche Galle aus ihrem plumpen Körper abgeflossen war. Ich begann inzwischen zu ahnen, dass sie mich ausgesucht hatte, um mich leiden zu lassen, manchmal ahne ich so etwas. Doch selbst wenn ich es ahne, nehme ich es manchmal hin: als wäre derjenige, der mich leiden lassen will, verzweifelt darauf angewiesen.
Wie lange? Ich ging täglich zu ihr, ließ nicht einen Tag aus. Manchmal sagte sie: »Tja, gestern Abend war das Buch noch hier, aber du bist ja erst jetzt gekommen, da habe ich’s einem anderen Mädchen geliehen.« Und ich, die ich nicht so leicht Augenringe bekam, spürte, wie sich unter meinen verstörten Augen nach und nach dunkle Ringe bildeten.
Bis eines Tages, während ich vor ihrer Haustür stand und ihre Absage still über mich ergehen ließ, die Mutter erschien. Sie wunderte sich wohl über die stumme, täglich wiederkehrende Erscheinung dieses Mädchens vor ihrer Tür. Also fragte sie, was da los sei. Verwirrte Stille trat ein, durchbrochen von einigen wenig aufschlussreichen Erklärungen. Die Mutter merkte mit wachsendem Erstaunen, dass ihr die Sache unverständlich blieb. Bis diese gute Seele von Mutter schließlich doch verstand. Da drehte sie sich zur Tochter um und rief ganz erstaunt: »Das Buch hat das Haus doch nie verlassen, und du wolltest es auch nicht lesen!«
Das Schlimmste war für sie nicht etwa, feststellen zu müssen, was sich da abspielte. Das Schlimmste war wohl, zu ihrem Entsetzen festzustellen, was für eine Tochter sie hatte. Schweigend sah sie uns an: die Begabung zur Bosheit bei dieser Tochter, die sie nicht kannte, und das blonde Mädchen, das erschöpft vor ihrer Tür stand, im Wind der Straßen von Recife. Da straffte sie sich endlich und sagte fest und ruhig zur Tochter: »Du leihst ihr jetzt auf der Stelle das Buch.« Und dann zu mir: »Und du behältst das Buch, solange du möchtest.« Man stelle sich das vor! Das war mehr wert, als mir das Buch einfach zu überlassen: »Solange du möchtest« ist der kühnste Wunsch, den ein Mensch, ob groß oder klein, überhaupt wagen kann.
Wie soll ich erzählen, was dann geschah? Ich war völlig fassungslos, und so nahm ich das Buch entgegen. Ich glaube, ich habe kein Wort gesagt. Ich nahm einfach das Buch. Und nein, ich lief nicht hüpfend davon wie sonst. Ich ging mit langsamen Schritten. Ich weiß noch, dass ich das dicke Buch mit beiden Händen festhielt und die ganze Zeit an meine Brust drückte. Wie lange ich für den Heimweg gebraucht habe, ist unwichtig. Meine Brust war heiß, mein Herz in Gedanken.
Zu Hause angekommen, fing ich nicht mit der Lektüre an. Ich tat so, als hätte ich das Buch gar nicht, nur um dann zu erschrecken, dass ich es doch hatte. Stunden später schlug ich es auf, las einige wundervolle Zeilen, klappte es wieder zu, lief in der Wohnung herum, schob den Moment noch weiter hinaus, indem ich ein Stück Brot mit Butter aß, tat so, als hätte ich das Buch verlegt, fand es wieder, schlug es für einige Augenblicke auf. Ich dachte mir die unsinnigsten Hindernisse für dieses heimliche Etwas aus, das das Glück war. Glück sollte für mich immer etwas Heimliches bleiben. Scheint, dass ich das schon vorausahnte. Wie lange ich mir Zeit ließ! Ich lebte in der Luft … In mir waren Stolz und Verschämtheit. Ich war eine zarte Königin.
Manchmal setzte ich mich in die Hängematte, schaukelte darin, das Buch offen auf dem Schoß, ohne es anzufassen, in reinster Ekstase.
Ich war nicht mehr ein Mädchen mit einem Buch: Ich war eine Frau mit ihrem Geliebten.
RESTE VOM KARNEVAL
Nein, nicht vom letzten Karneval. Aber aus irgendeinem Grund hat gerade der mich in meine Kindheit zurückversetzt, zum Aschermittwoch auf ausgestorbenen Straßen, in denen noch Luftschlangen und Konfetti durch die Luft wirbelten. Die eine oder andere Betschwester ging auf dem Weg zur Kirche verschleiert über die Straße, wo es so außerordentlich leer ist, wenn der Karneval endet. Bis zum nächsten Jahr. Wie nun die Aufregung erklären, die im Innersten von mir Besitz ergriff, wenn das Fest näher rückte? Als öffnete sich die Welt aus der Knospe, die sie war, endlich zur großen scharlachroten Rose. Als ließen die Straßen und Plätze von Recife endlich erkennen, wozu sie gemacht waren. Als besängen menschliche Stimmen endlich die Fähigkeit zu genießen, die heimlich in mir war. Der Karneval fand für mich statt, für mich.
In Wirklichkeit hatte ich daran nur wenig Anteil. Noch nie war ich zu einem Kinderball gegangen, noch nie hatte ich ein Kostüm getragen. Dafür durfte ich bis elf Uhr abends am Hauseingang stehen und begierig zusehen, wie die anderen sich vergnügten. Zwei kostbare Dinge bekam ich und verwendete sie sparsam, beinahe geizig, damit sie für volle drei Tage reichten: einen Parfümzerstäuber und eine Tüte Konfetti. Ach, das Schreiben wird mir schwer. Denn ich spüre, dass sich mir gleich das Herz verdüstert, da ich erkenne, wie wenig ich zur allgemeinen Freude beitrug und wie sehr mich doch nach ihr dürstete – schon so gut wie nichts machte mich zu einem glücklichen Kind.
Und die Masken? Sie jagten mir Angst ein, aber diese Angst war lebensnotwendig, denn sie traf mit meinem tiefen Bedenken zusammen, dass auch das menschliche Gesicht eine Art Maske sei. Sprach mich unten an der Haustür ein Maskierter an, so spürte ich auf einmal die unentbehrliche Verbindung zu meiner inneren Welt, in der nicht nur Kobolde und verzauberte Prinzen lebten, sondern auch Menschen mit ihrem Rätsel. Sogar mein Erschrecken über die Maskierten war für mich also von grundlegender Bedeutung.
Verkleidet wurde ich nicht: Über all den Sorgen um meine kranke Mutter hatte bei uns niemand den Kopf frei für kindliche Karnevalsfeiern. Aber ich bat eine meiner Schwestern, mir Lockenwickler in die glatten Haare zu drehen, mit denen ich ständig haderte. So durfte ich mir wenigstens für drei Tage im Jahr etwas auf meine Locken einbilden. Außerdem ließ mir meine Schwester an diesen drei Tagen meinen brennenden Traum, eine junge Frau zu sein – ich konnte es kaum erwarten, eine Kindheit hinter mich zu bringen, die ich als verletzlich empfand –, und schminkte mir den Mund mit einem kräftigen Lippenstift, sie verteilte sogar Rouge auf meinen Wangen. So fühlte ich mich schön und weiblich, entfloh dem Kindesalter.
Ein Karneval aber verlief anders als die anderen. So wunderbar, dass ich nicht glauben konnte, was mir alles geschenkt wurde, mir, die ich doch schon gelernt hatte, nur wenig zu verlangen. Und zwar hatte die Mutter einer Freundin beschlossen, ihrer Tochter ein Kostüm aus einer Modezeitschrift zu basteln, das Kostüm Rose. Zu diesem Zweck hatte die Mutter stapelweise rosa Krepppapier gekauft, aus dem wohl die Blütenblätter nachgebildet werden sollten. Mit offenem Mund wohnte ich dem Schaffensprozess bei, in dem das Kostüm immer weiter Form annahm. Zwar erinnerte das Krepppapier nur entfernt an Blütenblätter, doch ich hielt es ernsthaft für eines der schönsten Kostüme, die ich jemals gesehen hatte.
Da geschah durch Zufall das Unverhoffte: Es blieb Krepppapier übrig, reichlich davon. Und die Mutter meiner Freundin beschloss – vielleicht, weil sie meinem stummen Flehen Gehör schenkte, meiner stummen, neidvollen Verzweiflung, vielleicht auch aus reiner Gutherzigkeit und weil nun einmal Papier übrig war –, aus dem restlichen Material auch für mich ein Rosenkostüm zu basteln. In diesem Karneval sollte ich also zum ersten Mal im Leben bekommen, was ich mir immer gewünscht hatte: Ich sollte eine andere sein als ich selbst.
Schon die Vorbereitungen machten mich ganz benommen vor Glück. Nie hatte ich mich so beschäftigt erlebt: Meine Freundin und ich überlegten uns alles ganz genau. Unter der Verkleidung würden wir einen Unterrock tragen, denn falls es regnete und die Verkleidung sich auflöste, wären wir wenigstens annähernd bekleidet – schon bei dem Gedanken daran, ein plötzlicher Regen könnte uns mit unserer weiblichen Verschämtheit von Achtjährigen im Unterrock auf der Straße stehen lassen, genierten wir uns zu Tode. Aber ach! Gott würde uns beistehen! Es würde nicht regnen! Was den Umstand betraf, dass sich mein Kostüm nur den Überresten eines anderen verdankte, so schluckte ich mit einem gewissen Unbehagen meinen Stolz herunter, der seit jeher kein Pardon kannte, und nahm demütig entgegen, was mir das Schicksal als Almosen bot.
Aber warum musste ausgerechnet dieser Karneval, der einzige mit Kostüm, ein so kummervoller werden? Schon früh am Sonntagmorgen hatte ich die Lockenwickler im Haar, damit die Locken am Nachmittag auch richtig hielten. Die Minuten vergingen kaum vor lauter Ungeduld. Doch endlich, endlich! Drei Uhr nachmittags: Vorsichtig, damit das Papier nicht riss, kleidete ich mich als Rose.
Vieles, was mir später widerfahren ist, um so viel Schlimmeres, ist längst vergeben und vergessen. Das allerdings begreife ich noch nicht einmal jetzt: Kennt das Würfelspiel des Schicksals keine Vernunft? Es ist gnadenlos. Ich war schon ganz in Krepppapier gehüllt, noch mit den Lockenwicklern im Haar und ohne Lippenstift und Rouge – da verschlechterte sich der Gesundheitszustand meiner Mutter auf einmal drastisch, zu Hause ging es drunter und drüber, und ich wurde eilends zur Apotheke geschickt, um ein Medikament zu holen. Als Rose verkleidet rannte ich – aber das noch nackte Gesicht trug nicht die Maske der jungen Frau, die mein so schutzloses kindliches Leben verdecken sollte –, ich rannte, rannte verstört, fassungslos, zwischen Luftschlangen, Konfetti und Karnevalsgeschrei. Die Ausgelassenheit der anderen erschreckte mich.
Als Stunden später im Haus wieder Ruhe einkehrte, frisierte mich meine Schwester und schminkte mich. Aber in mir war etwas gestorben. Und wie in den Geschichten, die ich gelesen hatte, in denen Feen Menschen ver- und wieder entzauberten, so war auch ich entzaubert worden; ich war keine Rose mehr, ich war wieder ein Kind. Ich ging hinunter auf die Straße, und wie ich da stand, war ich keine Blume, ich war ein gedankenverlorener Clown mit roten Lippen. In meinem Hunger nach Ekstase fing ich immer wieder an, mich zu freuen, doch dann dachte ich reuig an den schlimmen Zustand meiner Mutter und starb ein weiteres Mal.
Erst Stunden später kam die Rettung. Und wenn ich mich eilends an sie klammerte, dann deshalb, weil ich so sehr der Rettung bedurfte. Ein etwa zwölfjähriger Junge, für mich also schon ein Großer, dieser sehr hübsche Junge blieb vor mir stehen und übergoss in einer Mischung aus Zärtlichkeit, Grobheit, Spielerei und Sinnlichkeit mein Haar, das sich schon wieder geglättet hatte, mit Konfetti: Einen Moment lang standen wir uns gegenüber, lächelnd, ohne zu sprechen. Und da fand ich kleine Frau von acht Jahren für den Rest des Abends, dass mich endlich jemand erkannt hatte: Ich war sehr wohl eine Rose.
ISS, MEIN SOHN
»Die Welt sieht platt aus, aber ich weiß, dass das nicht stimmt. Weißt du, warum sie platt aussieht? Weil, wenn man schaut, ist der Himmel immer oben, nie unten, nie seitlich. Ich weiß, dass die Welt rund ist, das habe ich gehört, aber rund aussehen würde sie bloß, wenn man schaut und der Himmel auch mal unten ist. Ich weiß, dass sie rund ist, aber für mich ist sie platt, und Ronaldo weiß einfach bloß, dass die Welt rund ist, für ihn sieht sie nicht platt aus.«
»…«
»Ich war schon in vielen Ländern und ich habe gesehen, dass der Himmel in den Vereinigten Staaten auch oben ist, deshalb hat die Welt für mich ganz grade ausgesehen. Aber Ronaldo war noch nie woanders als in Brasilien, also kann er denken, dass der Himmel bloß hier oben ist, und anderswo ist es nicht platt, bloß in Brasilien, und an anderen Orten, die er nicht gesehen hat, wird die Welt rund. Wenn er was hört, glaubt er’s halt, für ihn muss nichts irgendwie aussehen. Mama, was findest du besser, tiefe Teller oder platte?«
»Platt… du meinst wohl flache.«
»Ich auch. Bei tiefen sieht’s so aus, als ob mehr draufpasst, aber das ist ja bloß am Boden, auf platte passt was auf die Seite, und man sieht gleich alles, was drauf ist. Gurken sehen unreal aus, stimmt’s?«
»Irreal.«
»Warum meinst du?«
»So heißt das eben.«
»Nein, warum meinst du, dass Gurken unreal aussehen? Ich glaube das auch. Wenn man die anschaut, sieht man ein bisschen was von der anderen Seite, die haben lauter Striche, alle in dieselbe Richtung, sie sind kalt im Mund und sie knirschen beim Kauen wie ein Stück Glas. Gurken sehen erfunden aus, meinst du nicht auch?«
»Doch, ja.«
»Wo wurde eigentlich Reis mit Bohnen erfunden?«
»Hier.«
»Oder in Arabien, hat Pedrinho neulich bei noch was gesagt.«
»Nein, hier.«
»Bei Gatão gibt’s leckeres Eis, das schmeckt nämlich so wie die Farbe. Schmeckt für dich Fleisch wie Fleisch?«
»Manchmal.«
»Ach, komm! Jetzt sag mal ernst: so wie das Fleisch, das beim Metzger hängt?!«
»Nein.«
»Und auch nicht wie das, was wir meinen. Das schmeckt überhaupt nicht so, wie wenn du sagst, dass Fleisch Vitamine hat.«
»Red nicht so viel, iss.«
»Na, wenn du mich so anschaust, aber das machst du gar nicht, damit ich esse, das machst du bloß, weil du mich grade so lieb hast, stimmt’s?«
»Stimmt. Iss, Paulinho.«
»Du denkst immer bloß daran. Ich habe so viel geredet, damit du nicht bloß ans Essen denkst, aber dann vergisst du’s doch nicht.«
GOTT VERGEBEN
Ich ging über die Avenida Copacabana und blickte zerstreut auf Gebäude, ein Stück Meer, auf Leute, ohne an etwas zu denken. Ich hatte noch nicht bemerkt, dass ich gar nicht zerstreut war, sondern in einem Zustand müheloser Aufmerksamkeit, ich war etwas sehr Seltenes, nämlich frei. Ich sah alles, wie es eben kam. Erst nach und nach bemerkte ich, dass ich Dinge bemerkte. Da wurde meine Freiheit noch etwas intensiver und blieb dabei doch Freiheit. Das war keine tour de propriétaire, nichts von alledem gehörte mir, ich wollte es auch nicht besitzen. Doch war ich wohl zufrieden mit dem, was ich sah.
Da überkam mich ein Gefühl, von dem ich noch nie gehört hatte. Aus reiner Zärtlichkeit fühlte ich mich auf einmal als Mutter Gottes, und die war der Planet Erde, die Welt. Wirklich aus reiner Zärtlichkeit, ganz ohne Anmaßung oder Selbstherrlichkeit, ohne mir im Mindesten überlegen vorzukommen oder mich vergleichen zu wollen, einfach aus Zärtlichkeit war ich die Mutter dessen, was existiert. Ich begriff auch: Wenn all das »wirklich wäre«, was ich fühlte – und nicht womöglich eine Gefühlsirrung –, so würde sich auch Gott ohne jeden Stolz und jede Kleinlichkeit liebkosen lassen, und das ohne jede Verpflichtung mir gegenüber. Dann wäre die Vertraulichkeit meiner Liebkosung für Ihn annehmbar. Das Gefühl war mir neu, aber es war sehr deutlich und nur deshalb nicht früher vorgekommen, weil es nicht hatte sein können. Ich weiß, dass man liebt, was Gott ist. Mit ernsthafter Liebe, feierlicher Liebe, mit Respekt, Furcht und Ehrerbietung. Von einer mütterlichen Zärtlichkeit für Ihn hatte ich noch nie reden hören. Und so wie meine zärtlichen Gefühle für einen Sohn diesen nicht kleiner machen, sondern eher größer, so war, Mutter der Welt zu sein, meine Liebe in Freiheit.
Ausgerechnet in diesem Moment wäre ich beinahe auf eine riesige tote Ratte getreten. Nicht einmal eine Sekunde, und mir stellten sich die Haare auf, so erschreckend ist es, lebendig zu sein, nicht einmal eine Sekunde, und ich zersplitterte völlig in Panik und unterdrückte, so gut ich konnte, meinen tiefsten Schrei. Fast rennend vor Angst, blind inmitten der Leute, erreichte ich schließlich den nächsten Häuserblock, stützte mich an einen Laternenpfahl und schloss heftig die Augen, die nichts mehr sehen wollten. Aber das Bild schob sich zwischen den Lidern hindurch: eine große Ratte mit rotem Fell, einem riesigen Schwanz, zerquetschten Pfoten und tot, reglos, mit rotem Fell. Meine maßlose Angst vor Ratten.
Völlig zitterig schaffte ich es, weiterzuleben. Völlig verunsichert ging ich weiter, den Mund kindlich weit vor Überraschung. Ich versuchte, die Verbindung zwischen den zwei Tatsachen zu kappen: meiner Empfindung vor wenigen Minuten und der Ratte. Aber vergeblich. Zumindest die räumliche Nähe verband sie. Zwischen den beiden Tatsachen spannte sich ohne jede Logik ein Band. Mich erschütterte, dass eine Ratte mein Kontrapunkt gewesen sein sollte. Und eine plötzliche Auflehnung wallte in mir auf: Konnte ich mich denn nicht vorbehaltlos der Liebe hingeben? Woran wollte mich Gott erinnern? Ich bin nicht so eine, die man daran erinnern muss, dass im Inneren von allem Blut ist. Nicht nur vergesse ich das Blut dort drinnen nicht, ich begrüße es sogar und will es, bin ich doch selbst zu sehr Blut, um das Blut zu vergessen, und geistliche Worte ergeben für mich keinen Sinn, noch nicht einmal irdische Worte ergeben Sinn. Das wäre nicht nötig gewesen, mir eine Ratte vor mein so nacktes Gesicht zu halten. Nicht in diesem Augenblick. Man hätte sehr wohl berücksichtigen können, welche Angst mich von klein auf umtreibt und verfolgt. Ratten haben mich schon ausgelacht, in alter Zeit haben mich Ratten sogar schon verschlungen, hastig und voller Wut. So war das also? Ich auf meinem Weg durch die Welt, ohne um etwas zu bitten, ohne etwas zu brauchen, liebend aus reiner, unschuldiger Liebe, und da zeigte mir Gott Seine Ratte? Gottes Ruppigkeit verletzte und kränkte mich. Gott war ein grober Klotz. Als ich weiterging, mit verschlossenem Herzen, war meine Enttäuschung so untröstlich, wie ich nur als Kind enttäuscht worden bin. Ich ging weiter und versuchte zu vergessen. Aber mir fiel nichts anderes ein als Rache. Doch welche Rache sollte ich gegen einen Gott vermögen, der Allmächtig ist, einen Gott, der mich noch mit einer zerquetschten Ratte zerquetschen könnte? Nur meine Verletzlichkeit als einsame Kreatur. In meinem Rachewunsch vermochte ich Ihm noch nicht einmal ins Gesicht zu blicken, ich wusste ja nicht, wo Er jetzt war, welches Ding das sein konnte, in dem Er jetzt war, und ob ich Ihn, wenn ich dieses Ding wütend betrachtete, überhaupt sehen würde? In der Ratte? In diesem Fenster? In den Steinen auf dem Boden? In mir war Er bestimmt nicht mehr. Ja, in mir sah ich Ihn bestimmt nicht mehr.
Da kam mir die Rache der Schwachen in den Sinn: Ach, so ist das? Na, dann behalte ich das Geheimnis nicht für mich, dann erzähle ich es weiter. Ich weiß, es ist unedel, jemandem sehr nahe zu kommen und dann seine Geheimnisse zu verraten, aber ich tue es doch – nein, erzähl es nicht, nur um meinetwillen, erzähl es nicht, behalt für dich, was Ihm Schande macht –, o doch, ich erzähle es, ich verbreite, was mir da widerfahren ist, diesmal bleibt das nicht ohne Folgen, ich erzähle jetzt, was Er getan hat, Seinen Ruf kann er vergessen.
Aber womöglich war es passiert, weil auch die Welt eine Ratte ist und ich gedacht hatte, ich sei auch für die Ratte schon bereit. Weil ich mich stärker wähnte. Weil ich aus der Liebe eine mathematische Gleichung machte, die nicht aufging: Ich dachte, ich bräuchte nur alles zusammenzuzählen, was es zu verstehen gibt, und dann würde ich lieben. Ich wusste nicht, dass man erst wahrhaft liebt, wenn man zusammenzählt, was man nicht versteht. Weil ich mir nur wegen der Zärtlichkeit, die in mir gewesen war, eingebildet hatte, zu lieben sei leicht. Weil ich feierliche Liebe abgelehnt hatte, ohne zu begreifen, dass Feierlichkeit das, was man nicht versteht, ritualisiert und in eine Opfergabe verwandelt. Und auch, weil ich schon immer zum Kämpfen geneigt habe, das Kämpfen ist mein Weg. Weil ich immer versuche, auf meinem eigenen Weg zum Ziel zu kommen. Weil ich noch nicht weiß, wie man nachgibt. Weil ich im Grunde das lieben will, was ich lieben würde – und nicht das, was ist. Weil ich noch nicht ich selbst bin, und darauf steht die Strafe, eine Welt lieben zu müssen, die nicht sie selbst ist. Und auch, weil ich so schnell beleidigt bin. Weil man mir die Dinge vielleicht brutal ins Gesicht sagen muss, ich bin ja so stur. Weil ich so besitzergreifend bin, weshalb mir mit einer gewissen Ironie die Frage gestellt wurde, ob ich vielleicht auch die Ratte für mich haben will. Weil ich erst Mutter der Dinge sein kann, wenn ich in der Lage bin, eine Ratte in die Hand zu nehmen. Ich weiß, dass ich niemals in der Lage sein werde, eine Ratte in die Hand zu nehmen, ohne meines schlimmsten Todes zu sterben. Dann soll ich also zum Magnificat greifen, das blindlings von dem singt, was man weder weiß noch sieht. Und soll zu der Förmlichkeit greifen, die mich auf Distanz bringt. Weil die Förmlichkeit meine Schlichtheit nicht verletzt hat, sehr wohl jedoch meinen Stolz, denn gerade im Stolz, geboren zu sein, fühle ich mich der Welt so innig nahe, dieser Welt allerdings, die ich aus mir herausgelöst habe mit einem stummen Schrei. Weil die Ratte ebenso sehr existiert wie ich, und vielleicht sind weder ich noch die Ratte dazu da, von uns selbst gesehen zu werden, die Distanz macht uns gleich. Vielleicht muss ich zuallererst diese meine Natur akzeptieren, die den Tod einer Ratte will. Vielleicht halte ich mich für allzu feinfühlig, bloß weil ich meine Verbrechen nicht begangen habe. Nur weil ich meine Verbrechen in mir eingeschlossen habe, halte ich mich für unschuldig liebend. Vielleicht kann ich die Ratte so lange nicht ansehen, wie ich nicht meine Seele ansehen kann, ohne zu erbleichen, die gerade so eingeschlossen ist. Vielleicht muss ich als »Welt« diese meine Art bezeichnen, ein wenig von allem zu sein. Wie kann ich die Größe der Welt lieben, wenn ich nicht lieben kann, was meine Natur umfasst? Solange ich mir vorstelle, dass »Gott« gut ist, nur weil ich schlecht bin, werde ich überhaupt nichts lieben: Das wird bloß meine Art sein, mich anzuklagen. Ich, die ich nicht einmal mich selbst ganz durchlaufen hatte, als ich schon den Entschluss fasste, mein Gegenteil zu lieben, und mein Gegenteil will ich Gott nennen. Ich, die ich mich nie an mich selbst gewöhnen werde, habe mir die ganze Zeit über gewünscht, dass mich die Welt nicht schockiert. Denn ich, die ich bei mir nur eines erreicht hatte, nämlich mich mir selbst unterzuordnen, da ich ja so viel unerbittlicher bin als ich, ich wollte mich für mich selbst entschädigen, und zwar mit einem Land, das weniger heftig wäre als ich. Denn solange ich einen Gott nur liebe, weil ich mich nicht will, bin ich ein gezinkter Würfel, und das Spiel meines größeren Lebens wird nicht gespielt. Solange ich Gott erfinde, kann es Ihn nicht geben.
HUNDERT JAHRE ABLASS
Wer noch nie gestohlen hat, wird mich nicht verstehen. Und wer noch nie Rosen gestohlen hat, der wird mich niemals verstehen können. Ich stahl als Kind Rosen.
Es gab in Recife unzählige Straßen, die Straßen der Reichen, gesäumt von Villen, die inmitten großer Gärten standen. Mit einer Freundin zusammen spielte ich oft, wir würden entscheiden, wem die Villen gehörten.
»Die weiße da gehört mir.«
»Nein, habe ich doch längst gesagt, die weißen gehören mir.«
»Aber die ist nicht ganz weiß, die Fenster sind grün.«
Manchmal blieben wir lange stehen, das Gesicht an die Gitterstäbe gepresst, und schauten.
Angefangen hat es so. Wir waren bei einem solchen »Das Haus da ist meins«-Spiel vor etwas stehen geblieben, das wie ein kleines Schloss wirkte. Im Hintergrund sah man einen riesigen Obstgarten. Und vorne, in sehr gepflegten Beeten, wuchsen die Blumen.
So weit, so gut, aber abseits im Beet stand eine Rose, die erst ein kleines Stück weit aufgegangen war, tiefrosa. Mit offenem Mund und voller Bewunderung betrachtete ich diese hochmütige Rose, noch nicht einmal ganz Frau. Und da geschah es: Tief im Herzen wollte ich diese Rose für mich. Ich wollte sie, ah, wie ich sie wollte. Doch sie zu bekommen war völlig unmöglich. Wäre der Gärtner da gewesen, dann hätte ich ihn um die Rose gebeten, obwohl ich wusste, dass er uns fortgejagt hätte wie Straßenkinder. Aber es war kein Gärtner in Sicht, niemand. Und wegen der Sonne waren die Läden an den Fenstern geschlossen. Es war eine Straße, durch die keine Trambahnen fuhren, nur selten kam ein Auto vorbei. Inmitten meiner Stille und der Stille der Rose war da mein Wunsch, sie als etwas zu besitzen, das nur mir gehörte. Ich wollte sie anfassen können. Ich wollte daran riechen, bis ich spürte, wie mein Blick sich trübte vor lauter Benommenheit vom Duft.
Da hielt ich es nicht mehr aus. Der Plan reifte in mir unmittelbar, voller Leidenschaft. Trotzdem besprach ich ihn, gute Realisatorin, die ich war, kühl mit meiner Freundin und erklärte ihr die Aufgabe, die ich ihr zugedacht hatte: auf die Fenster zu achten oder das immer noch denkbare Auftauchen des Gärtners, auf die seltenen Passanten draußen auf der Straße. Während sie das tat, öffnete ich langsam das Tor mit den angerosteten Gitterstäben, das leise Knarren schon mit einberechnend. Ich öffnete das Tor nur einen Spalt, gerade weit genug, dass mein schmaler Mädchenkörper hindurchpasste. Und auf Zehenspitzen, aber schnell lief ich über die Kieselsteine, die den Rand der Blumenbeete bildeten. Bis ich die Rose erreichte, verging ein Jahrhundert Herzklopfen.
Da, endlich, stehe ich vor ihr. Ich warte einen Moment lang, einen gefährlichen Moment, denn aus der Nähe ist sie noch schöner. Schließlich mache ich mich daran, den Stiel abzubrechen, steche mich an den Dornen, lecke mir das Blut von den Fingern.
Und plötzlich liegt sie ganz in meiner Hand. Auch das Rennen zurück zum Tor musste lautlos gelingen. Durch das Tor, das ich angelehnt gelassen hatte, schob ich mich und hielt die Rose in Händen. Und dann rannten wir, beide blass, ich und die Rose, rannten buchstäblich weg von dem Haus.
Was tat ich nun mit der Rose? Ich tat Folgendes: Sie war mein.
Ich trug sie nach Hause, stellte sie in ein Glas Wasser, und da stand sie majestätisch, mit ihren dicken, samtigen Blütenblättern in verschiedenen Zwischentönen von Rosa. In der Mitte ballte sich die Farbe, und ihr Herz schien fast rot.
War das schön.
So schön, dass ich einfach weiter Rosen stahl. Es lief immer gleich ab: das Mädchen, das Wache schob, und ich, die ich hineinging, den Stiel abbrach und davonrannte, die Rose in der Hand. Immer mit klopfendem Herzen und immer mit dieser Seligkeit, die mir niemand nehmen konnte.
Pitangabeeren habe ich auch gestohlen. Nicht weit von zu Hause stand eine presbyterianische Kirche, umgeben von einer grünen Hecke, die hoch war und so dicht, dass sie den Blick auf die Kirche verstellte. Ich habe den Bau nie zu sehen bekommen, bis auf ein Stück Dach. Die Hecke bestand aus Pitangasträuchern. Aber deren Früchte verstecken sich gern: Ich konnte keine finden. Da schaute ich schnell nach links und nach rechts, ob auch niemand kam, schob die Hand zwischen den Gitterstäben hindurch, tauchte sie in die Hecke und tastete mich voran, bis meine Finger das Feuchte der kleinen Frucht erspürten. Oft zerquetschte ich in meiner Eile eine allzu reife Beere zwischen den Fingern, die danach aussahen wie in Blut gebadet. Ich pflückte mehrere, die ich an Ort und Stelle verzehrte, manche waren allzu grün, die warf ich weg.
Niemand hat je davon erfahren. Ich spüre keine Reue: Wer Rosen und Pitangabeeren stiehlt, erlangt für hundert Jahre Ablass. Pitangabeeren zum Beispiel bitten selbst darum, gepflückt zu werden, anstatt zu reifen und am Zweig zu sterben, jungfräulich.
EINE HOFFNUNG
Bei uns zu Hause hat sich eine Hoffnung niedergelassen. Nicht die klassische Hoffnung, die sich so häufig als Hirngespinst erweist, auch wenn sie uns selbst dann noch trägt. Sondern die andere, hübsch konkrete und grüne: eine der Heuschrecken, die wir esperanças nennen und als Glücksbringer betrachten.
Von einem meiner Söhne kam ein erstickter Schrei: »Eine Hoffnung! Da drüben an der Wand, genau über deinem Stuhl!« Aufgeregt auch er, bei dem sich die beiden Hoffnungen zu einer einzigen verbanden, er ist dafür schon alt genug. Eher überrascht ich: Hoffnungen sind sehr diskret, normalerweise lassen sie sich direkt auf mir nieder, ohne dass es jemand merkt, und nicht erst an einer Wand über meinem Kopf. Ein kleines Gewirr: Aber kein Zweifel, da war sie und hätte dünner und grüner nicht sein können.
»Die hat ja fast keinen Körper«, beklagte ich mich.
»Sie hat nur eine Seele«, erklärte mein Sohn, und da Kinder für uns eine Überraschung sind, entdeckte ich überrascht, dass er von beiden Arten von Hoffnung sprach.
Die Hoffnung stakte auf ihren dürren langen Beinen zwischen den Bildern an der Wand herum. Dreimal suchte sie hartnäckig einen Ausgang zwischen zwei Bildern, dreimal musste sie wieder umdrehen. Das Lernen fiel ihr schwer.
»Die ist ein bisschen dumm«, bemerkte der Junge.
»Ich weiß«, erwiderte ich fast ein wenig dramatisch.
»Schau, jetzt versucht sie’s auf einem anderen Weg, die Arme, die ist ja ganz unsicher.«
»Ich weiß, genau so ist das.«
»Mama, ich glaube, Hoffnungen haben keine Augen, die folgt ihren Antennen.«
»Ich weiß«, fuhr ich noch unglücklicher fort.
So saßen wir da und sahen zu, ich weiß nicht, wie lange. Wachten über die Hoffnung, wie man in Griechenland oder in Rom über ein gerade entzündetes Herdfeuer wachte, damit es nicht erlosch.
»Die hat vergessen, dass sie fliegen kann, Mama, die denkt, sie kann nur so langsam laufen.«
Sie lief wirklich langsam – war sie womöglich verletzt? Aber nein, sonst hätte sie auf die eine oder andere Weise bluten müssen, bei mir jedenfalls ist das immer so.
Eben da kam auf einem Streifzug durch die essbare Welt hinter einem Bild eine Spinne hervor. Nein, nicht eine Spinne, mir kam sie vor wie die Spinne. Wie sie da über ihr unsichtbares Netz lief, schien sie weich durch die Luft zu gleiten. Sie wollte die Hoffnung. Aber wir wollten sie auch und, oh Gott!, wir legten es nicht darauf an, sie zu verschlingen. Mein Sohn holte den Besen. Schwach, verwirrt, im Zweifel, ob die unglückliche Zeit gekommen wäre, die Hoffnung aufzugeben, sagte ich: »Spinnen soll man nicht töten, weißt du, das bringt …«
»Aber die frisst sonst die Hoffnung!«, antwortete der Junge aufgebracht.
»Ich muss dem Hausmädchen mal sagen, dass es hinter den Bildern sauber machen soll«, sagte ich und empfand den Satz sogleich als deplatziert, hörte darin eine gewisse Müdigkeit. Dann hing ich kurz dem Gedanken nach, wie ich dem Hausmädchen eine knappe, ja rätselhafte Anweisung geben würde. Ich würde nur sagen: Sei so gut und mach den Weg frei für die Hoffnung.
Als die Spinne tot war, dachte sich der Junge ein Wortspiel aus, es ging um das Insekt und unsere Hoffnung. Mein anderer Sohn, der vor dem Fernseher saß, hörte es und lachte vor Freude. Es gab keinen Zweifel: Die Hoffnung hatte sich bei uns niedergelassen, in Wohnung, Seele und Körper. Ach, ist das ein schönes Insekt: lässt sich mehr nieder, als es lebt, ein kleines grünes Skelett, und seine Form ist so zart. Das erklärt auch, warum ich, die ich so gern Dinge anfasse, nie versucht habe, eine Hoffnung anzufassen.
Einmal übrigens, jetzt fällt es mir wieder ein, ließ sich eine deutlich kleinere Hoffnung auf meinem Arm nieder. Ich spürte nichts, so leicht war sie, ihre Anwesenheit kam mir nur durch die Augen zu Bewusstsein. Die Zartheit machte mich ganz verlegen. Ich hielt den Arm still und dachte: ›Na so was! Was soll ich denn jetzt tun?‹ Tatsächlich tat ich nichts. Ich verharrte völlig reglos, als wäre in mir eine Blume geboren. Was danach geschah, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, es geschah nichts.
DAS HAUSMÄDCHEN
Ihr Name war Eremita. Sie war neunzehn Jahre alt. Vertrauen im Gesicht, einige Mitesser. Wo lag ihre Schönheit? Es war Schönheit in diesem Körper, der weder hässlich noch hübsch anzusehen war, in diesem Gesicht, wo eine Sanftheit, die noch größere Sanftheiten herbeisehnte, das Leben offenbarte.
Schönheit, ich bin mir nicht sicher. Möglicherweise war da auch keine, wobei die unbestimmten Züge wohl anziehend wirkten, so wie Wasser anziehend wirkt. Da war durchaus lebendige Substanz, Nägel, Fleisch, Zähne, ein Gemisch aus Widerständen und Schwächen, zusammengenommen eine vage Präsenz, die sich jedoch zu einem Kopf voller Fragen und Beflissenheit verdichtete, sobald jemand einen Namen aussprach: Eremita. Die braunen Augen waren unübersetzbar, ohne Bezug zum Gesicht rundherum. So unabhängig, als wären sie ins Fleisch eines Armes gepflanzt worden und blickten uns von dort aus an – offen, feucht. Ihr ganzes Wesen war von einer Sanftheit, die leicht in Tränen umschlug.
Manchmal antwortete sie so ungehörig, wie es nur eine tut, die zum Haus gehört. So sei sie schon von klein auf gewesen, erklärte sie. Mit ihrem Charakter hatte das allerdings nichts zu tun. Denn in ihrem Geist war keine Verhärtung, kein wahrnehmbares Gesetz. »Da hatte ich Angst«, sagte sie geradeheraus. »Ich hatte so einen Hunger«, sagte sie, und was sie sagte, ließ sich aus unerfindlichen Gründen nie in Abrede stellen. »Er behandelt mich sehr respektvoll«, sagte sie von ihrem Verlobten, und trotz des geliehenen, klischeehaften Ausdrucks fand sich, wer das hörte, in eine zarte Welt von Tieren und Vögeln versetzt, in der alle einander respektvoll behandeln. »Das ist mir peinlich«, sagte sie und lächelte, verwickelt in ihre eigenen Schatten. Hunger hatte sie nach Brot – das sie herunterschlang, als könnte es ihr jemand wegnehmen –, Angst vor Donner, peinliche Scheu vor dem Reden. Sie war freundlich, ehrlich. »Gott bewahre, oder?«, sagte sie manchmal abwesend.
Sie hatte nämlich ihre Abwesenheiten. Das Gesicht verlor sich dann in einer unpersönlichen, faltenlosen Traurigkeit. Einer Traurigkeit, älter als ihr Geist. Die Augen verharrten leer; ich würde sogar sagen, ein wenig rau. Wer immer sich an ihrer Seite befand, litt und konnte nichts dagegen tun. Außer warten.
Denn sie war in irgendetwas vertieft, rätselhaftes Kind. Niemand hätte gewagt, sie in diesem Moment anzurühren. Man wartete mit einer gewissen Schwere, Kummer im Herzen, und wachte über sie. Man konnte nichts für sie tun, als zu wünschen, dass die Gefahr vorüberzog. Bis sie mit einer trägen Bewegung, kaum mehr als einem Seufzen, zu sich kam, wie ein neugeborenes Zicklein auf die Beine kommt. Sie war von ihrer Einkehr in der Traurigkeit zurück.
Wenn sie wiederkam, war sie nicht gerade reicher, aber doch selbstsicherer, genährt aus einer unbekannten Quelle. Die Quelle musste alt sein und rein, so viel konnte man sehen. Ja, in Eremita war Tiefe. Aber niemand, der in ihre Tiefen hinabgestiegen wäre, hätte etwas gefunden – bis auf die eigene Tiefe, so wie man im Dunkel aufs Dunkel trifft. Mag sein, dass jemand, der noch weiter gegangen wäre, nach meilenweitem Marsch durch die Finsternis den Hinweis auf einen Weg entdeckt hätte, vielleicht geleitet durch einen Flügelschlag, die Spur eines Tiers. Und – plötzlich – Wald.
Ah, dann war wohl dies ihr Rätsel: Sie hatte einen Pfad in den Wald entdeckt. Gewiss ging sie während ihrer Abwesenheiten dorthin. Die Augen bei der Rückkehr ganz weich und ahnungslos, Augen, denen nichts fehlte. Die Ahnungslosigkeit so grenzenlos, dass alle Weisheit der Welt hineingepasst und sich darin verloren hätte.
So war Eremita. Wäre sie mit allem, was sie im Wald gefunden hatte, wieder aufgetaucht, man hätte sie auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Aber was sie gesehen hatte – in welche Wurzeln sie gebissen, an welchen Dornen sie sich blutig gestochen, in welche Wasser sie die Füße getaucht hatte, welch goldene Dunkelheit das Licht gewesen war, das sie umhüllte –, das alles erzählte sie nicht, weil sie es nicht wusste: alles wahrgenommen mit einem einzigen Blick, allzu schnell, um etwas anderes zu sein als ein Rätsel.
Also war sie, wenn sie wieder auftauchte, ein Hausmädchen. Das ständig aus dem Dunkel ihres Pfads gerufen wurde, um niedere Aufgaben zu verrichten, Kleider zu waschen, den Boden trocken zu wischen, mal diesen, mal jenen zu bedienen.
Aber war das wirklich ein Dienen? Hätte nämlich jemand darauf geachtet, so hätte er sehen können, dass sie die Kleider wusch – in der Sonne; den Boden wischte – der regennass war; die Bettwäsche lüftete – im Wind. Sie wusste es so anzustellen, dass sie nur im weitesten Sinne diente und anderen Göttern. Immer mit der geistigen Kraft, die sie aus dem Wald mitbrachte. Ohne einen einzigen Gedanken: nur ein Körper, der sich gemessen bewegte, ein Gesicht voll sanfter Hoffnung, die niemand gibt und niemand nimmt.
Die Gefahr, die sie durchgestanden hatte, zeigte sich nur in ihrer verstohlenen Art, Brot zu essen. Ansonsten blieb sie gelassen. Selbst wenn sie etwas Geld an sich nahm, das die Dame des Hauses auf dem Tisch vergessen hatte, selbst wenn sie dem Verlobten ein paar unauffällig verpackte Vorräte aus der Speisekammer mitbrachte. Mit leichter Hand zu stehlen, auch das kannte sie aus ihren Wäldern.
FEDERZEICHNUNG EINES JUNGEN
Wie den Jungen jemals kennenlernen? Um ihn kennenzulernen, muss ich auf seinen Niedergang warten, erst dann wird er für mich erreichbar. Da ist er, ein Punkt im Unendlichen. Niemand wird kennenlernen, was sein Heute ist. Nicht einmal er selbst. Was mich betrifft, so sehe ich hin, aber vergeblich: Was nur gegenwärtig ist, vollkommen gegenwärtig, das kann ich nicht begreifen. Seine Lage kenne ich sehr wohl: Er ist der Junge, der gerade die ersten Zähne bekommen hat, derselbe, der einmal Arzt werden wird oder Schreiner. Bis es so weit ist – sitzt er auf dem Boden, auf eine Weise real, die ich vegetativ nennen muss, um sie verstehen zu können. Hätten dreißigtausend solche auf dem Boden sitzende Jungen die Chance, eine andere Welt zu errichten, eine Welt, gespeist aus der Erinnerung an die absolute Gegenwärtigkeit, an der wir einst Anteil hatten? Gemeinsam wären sie stark. Da sitzt er, beginnt alles aufs Neue, aber zu seinem eigenen künftigen Schutz ohne eine echte Chance auf einen Neubeginn.
Ich weiß nicht, wie ich den Jungen zeichnen soll. Ich weiß, dass es unmöglich ist, ihn mit Kohle zu zeichnen, denn schon die Feder befleckt das Papier über die hauchfeine Linie des äußerst Gegenwärtigen hinaus, worin er lebt. Eines Tages werden wir ihn zu einem Menschen zähmen, und dann werden wir ihn zeichnen können. So haben wir es auch mit uns selbst gemacht und mit Gott. Der Junge selbst wird bei seiner Zähmung helfen: Er ist tüchtig und wirkt mit. Er wirkt mit, ohne zu wissen, dass die Hilfe, um die wir ihn bitten, in seiner Selbstaufopferung besteht. In letzter Zeit hat er sogar fleißig geübt. Und so wird er weitermachen und Fortschritte erzielen, bis er nach und nach – durch die notwendige Gnade, kraft der wir uns retten – aus der Zeit des Gegenwärtigen in die Zeit des Alltäglichen eintreten wird, aus der Meditation in den Ausdruck, aus der Existenz ins Leben. Indem er das große Opfer bringt, nicht wahnsinnig zu sein. Ich bin kein Wahnsinniger, aus Solidarität mit den Tausenden von uns, die, um das Mögliche zu schaffen, ebenfalls die Wahrheit geopfert haben, denn die wäre Wahnsinn.
Doch einstweilen, man sehe und staune, sitzt er auf dem Boden, versunken in eine tiefe Leere.
Aus der Küche vergewissert sich die Mutter: »Bist du da drüben auch schön brav?« Bei dieser Aufforderung, etwas zu unternehmen, erhebt sich der Junge mühevoll. Er stolpert über die eigenen Beine, die Aufmerksamkeit ganz nach innen gerichtet: Sein gesamtes Gleichgewicht liegt innen. Als das geschafft ist, richtet er seine gesamte Aufmerksamkeit nach außen: Er betrachtet, was dieses Sich-Erheben ausgelöst hat. Denn aufzustehen hatte Folgen über Folgen: Der Boden schwankt, ein Stuhl ragt über ihm auf, die Wand wird zur Grenze. Und an der Wand hängt das Porträt Der Junge. Es ist schwierig, zu dem Porträt dort hochzuschauen, ohne sich auf ein Möbelstück zu stützen, das hat er noch nicht geübt. Doch siehe da, seine eigenen Schwierigkeiten dienen ihm als Stütze: Dass er sich auf den Beinen hält, verdankt sich just der Aufmerksamkeit für das Porträt dort oben, der Blick nach oben dient ihm als Kran. Aber da begeht er einen Fehler: Er blinzelt. Das Blinzeln löst für einen Sekundenbruchteil die Verbindung zu dem Porträt, das ihm Halt gegeben hat. Das Gleichgewicht löst sich auf – in einer einzigen, umfassenden Bewegung fällt er auf den Hintern. Aus dem Mund, der vor lauter Lebensanstrengung leicht offen steht, läuft heller Speichel und tropft auf den Boden. Er beäugt den Tropfen von ganz nahe, wie eine Ameise. Der Arm hebt sich und streckt sich, ein mühseliger, mechanischer Ablauf, der mehrere Phasen umfasst. Und plötzlich, wie um etwas Unsagbares zu ergreifen, patscht er unerwartet heftig mit der flachen Hand auf den Speichel. Er blinzelt, er wartet. Als endlich die Zeit vergangen ist, die man eben warten muss, hebt er behutsam die Hand vom Boden und betrachtet auf dem Parkett das Ergebnis seines Experiments. Doch auf dem Boden ist nichts. In einer neuen, brüsken Phase beäugt er seine Hand: Der Speicheltropfen klebt also an der Handfläche. Jetzt weiß er auch das. Da leckt er mit weit geöffneten Augen den Speichel auf, der dem Jungen gehört. Und denkt recht laut: »Junge.«
»Wen rufst du da?«, fragt die Mutter aus der Küche.
Angestrengt und artig lässt er seinen Blick durchs Wohnzimmer schweifen, hält Ausschau nach demjenigen, von dem die Mutter sagt, dass er ihn ruft, dreht sich dabei um die eigene Achse und kippt um. Während er weint, sieht er das mit einem Mal schiefe und durch die Tränen mehrfach gebrochene Wohnzimmer, die weiße Gestalt wächst auf ihn zu – Mama! Sie nimmt ihn mit starken Armen auf, und siehe da, der Junge ist schön weit oben in der Luft, schön im Warmen und Weichen. Die Zimmerdecke ist jetzt näher; der Tisch unter ihm. Und da er vor Müdigkeit nicht mehr kann, verdreht er die Pupillen, bis sie in den Horizont der Augen eintauchen. Er schließt die Lider über dem letzten Bild, den Stäben seines Bettchens. Erschöpft und seelenruhig schläft er ein.