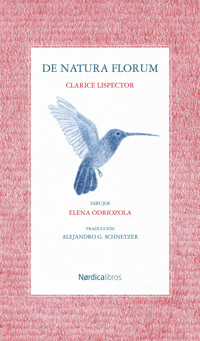9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Eine der geheimnisvollsten Autorinnen des 20. Jahrhunderts.« Orhan Pamuk
»Es ist eigenartig, dass ich nicht sagen kann, wer ich bin.« In der Ehe mit Rechtsanwalt Otávio findet Joana keine Antwort auf ihre Fragen. Auch ihr drängender Wunsch, nahe dem »wilden Herzen« des Lebens zu sein, sich durch die Liebe zu befreien, bleibt unerfüllt. Joana sucht im Rückblick auf die eigene Kindheit und Jugend nach Träumen und frühen Zielen, stößt auf inneren Reichtum und die Gewissheit zu leben. Lispectors autobiografisch gefärbter Roman gleicht einer Reise ins Innere des Verstehens einer Frau. Im Alter von nur 19 Jahren verfasst, machte er die Autorin in Brasilien mit einem Schlag berühmt. Noch heute staunt man über die kühnen Bilder, die radikale Ehrlichkeit und philosophische Tiefe, mit denen Lispector das junge, hungrige Leben einer Frau auslotet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 275
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Clarice Lispector wurde 1920 als Tochter jüdischer Eltern in der Ukraine geboren und wuchs in Brasilien auf. Sie studierte Jura, arbeitete als Lehrerin und Journalistin und führte als Diplomatengattin ein ebenso glamouröses wie rebellisches Leben. Lispector schrieb Romane, Erzählungen, Kinderbücher und Kolumnen. In Brasilien ein Star, starb sie 1977 mit nur 56 Jahren in Rio de Janeiro. Ihr Werk erscheint in Deutschland im Penguin Verlag.
Clarice Lispector in der Presse:
»Clarice Lispector gehört aufs Regal neben Kafka und Joyce.« Los Angeles Times
»Eine gefährliche Literatur – verstörend, rätselhaft und gerade darin faszinierend.« ORF
»Eine wirklich außergewöhnliche Schriftstellerin.« Jonathan Franzen
»Eine der geheimnisvollsten Autorinnen des 20. Jahrhunderts.« Orhan Pamuk
Außerdem von Clarice Lispector lieferbar:
Tagtraum und Trunkenheit einer jungen Frau
Aber es wird regnen
Wofür ich mein Leben gebe: Kolumnen 1946 –1977
www.penguin-verlag.de
Clarice Lispector
Nahedem wildenHerzen
Roman
Aus dem brasilianischen Portugiesischvon Ray-Güde Mertin
Überarbeitet von Corinna Santa Cruz
Der Übersetzung, ursprünglich erschienen 1981 und 1987 im Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, liegt die 7. Auflage der Ausgabe von Editora Nova Fronteira 1980, Rio de Janeiro, zugrunde. Bei der Überarbeitung wurde die Erstausgabe, erschienen bei Editora A. Noite, Rio de Janeiro 1943, berücksichtigt. Der Originaltitel lautet Perto do coração selvagem.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright der Originalausgabe © Paulo Gurgel Valente, 2024 © PERTODOCORAÇÂOSELVAGEM, 1944.
Copyright © 2024 der deutschsprachigen Ausgabe by Penguin Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Sabine Kwauka
Umschlagabbildung: © Tina Berning/2 Agenten
E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-31846-8V001
www.penguin-verlag.de
NAHE DEM WILDEN HERZEN
»Er war allein. Er war verlassen, glücklich, nahe dem wilden Herzen des Lebens.«
James Joyce
Erster Teil
DER VATER
Die Maschine des Vaters hämmerte klack-klack … klack-klack-klack … Die Uhr erwachte ohne großes Aufheben mit tin-tan. Die Stille schleppte sich schschschschschsch dahin. Was sagte der Kleiderschrank? Kleider-Kleider-Kleider. Nein, nein. Zwischen der Uhr, der Schreibmaschine und der Stille hörte ein Ohr zu, groß, rosafarben und tot. Die drei Geräusche waren durch das Tageslicht miteinander verbunden und durch das Rascheln der kleinen Blätter am Baum, die sich leuchtend eins am anderen rieben.
Den Kopf an die glänzende, kalte Scheibe gelehnt, sah sie auf den Hof des Nachbarn hinaus, in die große Welt der Hühner-die-nicht-wussten-dass-sie-sterben-würden. Sie konnte die heiße, festgestampfte, so wohlriechende und trockene Erde wahrnehmen, als läge sie unmittelbar vor ihrer Nase, und sie wusste, wusste ganz genau, dass sich dort irgendwo der eine oder andere Regenwurm räkelte, bevor er von dem Huhn aufgegessen würde, das die Leute aufessen würden.
Dann ein großer, stillstehender Moment, mit nichts darin. Sie öffnete die Augen weit, wartete. Nichts kam. Weiß. Plötzlich lief ein Zittern durch den Tag, und wie aufgezogen begann alles wieder anzulaufen, die Schreibmaschine holpernd, die Zigarette des Vaters qualmend, die Stille, die kleinen Blätter, die gerupften Hühner, die Helligkeit, die Dinge lebten wieder auf, hatten es eilig wie ein dampfender Wasserkessel. Es fehlte nur das Tin-tan der Uhr, das alles noch viel schöner machte. Sie schloss die Augen, tat so, als hörte sie es, und stellte sich zum Rhythmus der lautlosen Musik auf die Zehenspitzen. Sie machte drei leichte, beflügelte Tanzschritte.
Dann plötzlich betrachtete sie alles angewidert, als hätte sie zu viel von dieser Mischung verzehrt. »Oh, weh …«, seufzte sie leise und erschöpft und dachte danach: was wird jetzt geschehen, jetzt jetzt jetzt? Und immer weiter tropfte die Zeit und tropfte, und nichts geschah, wenn sie weiter darauf wartete, was geschehen würde, verstehst du? Sie schob diesen schwierigen Gedanken beiseite, lenkte sich ab mit einer Bewegung ihres bloßen Fußes auf dem staubigen Holzboden. Sie rieb sich den Fuß und sah dabei aus dem Augenwinkel zum Vater hinüber, wartete auf seinen ungeduldigen, gereizten Blick. Aber da kam nichts. Nichts. Schwer, Menschen so anzusaugen wie ein Staubsauger.
»Papa, ich habe mir ein Gedicht ausgedacht.«
»Wie heißt es?«
»›Ich und die Sonne.‹« Nach einer kurzen Pause begann sie:
»›Die Hühner im Hof haben schon zwei Regenwürmer gegessen, aber ich hab es nicht gesehen.‹«
»Und? Was haben du und die Sonne mit dem Gedicht zu tun?«
Sie sah ihn eine Sekunde lang an. Er hatte es nicht verstanden …
»Die Sonne liegt auf den Regenwürmern, Papa, und ich habe das Gedicht gemacht und die Regenwürmer nicht gesehen …« Pause. »Ich kann gleich noch eins machen:
›O Sonne, komm mit mir spielen.‹ Und noch ein längeres:
›Ich habe eine kleine Wolke gesehen
der arme Regenwurm
ich glaube, sie hat ihn nicht gesehen.‹«
»Schön, mein Kleines, wirklich schön. Wie macht man eigentlich so hübsche Gedichte?«
»Das ist nicht schwer, man braucht nur loszureden, dann kommt es von alleine.«
Sie hatte die Puppe schon angezogen und wieder ausgezogen, hatte sie sich auf einem Fest vorgestellt, wo sie glänzte zwischen all den Töchtern. Ein blaues Auto fuhr durch Arletes Körper, tötete sie. Dann kam die Fee, und die Tochter war wieder lebendig. Die Tochter, die Fee, das blaue Auto war Joana selbst, sonst wäre das Spiel ja langweilig. Sie fand immer einen Weg, genau dann selbst die Hauptrolle zu übernehmen, wenn die eine oder andere Figur ins Rampenlicht trat. Sie arbeitete ernsthaft, schweigsam, die Arme an den Körper gelegt. Sie brauchte sich Arlete nicht zu nähern, um mit ihr zu spielen. Sogar aus der Ferne besaß sie die Dinge.
Sie vergnügte sich mit den Bögen aus Pappe. Sie sah sie eine Weile an, und jeder Bogen war ein Schüler. Joana war die Lehrerin. Einer war gut, der andere böse. Ja, schon, und weiter? Und jetzt jetzt jetzt? Und dann immer nichts, wenn sie … Schluss.
Sie erfand einen kleinen Mann, so groß wie der Zeigefinger, mit langen Hosen und einem Krawattenknoten. Sie trug ihn bei sich in der Tasche ihrer Schuluniform. Der kleine Mann war eine echte Perle, eine Perle mit Krawatte, hatte eine tiefe Stimme und sagte aus der Tasche heraus: »Majestät Joana, könntet Ihr mir eine Minute zuhören, könntet Ihr für eine Minute Eure stete Beschäftigung unterbrechen?« Und dann erklärte er: »Zu Euren Diensten, Prinzessin. Euer Wunsch ist mir Befehl.«
»Papa, was kann ich mal machen?«
»Geh lernen.«
»Ich hab schon gelernt.«
»Geh spielen.«
»Ich hab schon gespielt.«
»Dann stör mich nicht weiter.«
Sie drehte sich schnell wie ein Kreisel, hielt an und betrachtete ohne Neugier die Wände und die Decke, die sich weiterdrehten und sich auflösten. Sie lief auf Zehenspitzen und trat immer nur auf die dunklen Dielenbretter. Sie schloss die Augen und ging mit ausgestreckten Händen umher, bis sie an ein Möbel stieß. Zwischen ihr und den Gegenständen war ein Ding, aber wenn sie dieses Ding mit der Hand einfing wie eine Fliege und dann nachsah – auch wenn sie aufpasste, dass ihr nichts entwich –, stieß sie nur auf ihre eigene, rosige, enttäuschte Hand. Ja, ich weiß schon, die Luft, die Luft! Aber das half nicht, erklärte nichts. Das war eins ihrer Geheimnisse. Sie würde nie zugeben, auch ihrem Vater gegenüber nicht, dass sie »das Ding« nie fangen konnte. Über alles, was besonders wichtig war, konnte sie nicht sprechen. Sie redete nur dummes Zeug mit den anderen. Wenn sie Ruth zum Beispiel ein paar Geheimnisse anvertraute, ärgerte sie sich danach über Ruth. Es war wirklich das Beste, nichts zu sagen. Noch etwas: wenn ihr irgendwas wehtat und sie auf die Uhrzeiger sah, während es wehtat, bemerkte sie, dass die Minuten, die sie an den Zeigern abzählte, vergingen und die Schmerzen immer noch wehtaten. Sogar wenn ihr gar nichts wehtat, wenn sie vor der Uhr stand und sie aufmerksam betrachtete, war auch das, was sie nicht fühlte, größer als die an der Uhr abgezählten Minuten. Geschah also etwas, worüber man sich freuen oder ärgern konnte, lief sie zur Uhr und betrachtete vergeblich die Sekunden.
Sie ging zum Fenster, zeichnete ein Kreuz auf die Fensterbank und spuckte geradeaus nach draußen. Wenn sie noch einmal spucken würde – jetzt könnte sie es erst wieder abends –, würde das Unglück nicht kommen und Gott würde ihr größter Freund sein, so ein großer Freund, dass … ja, dass was?
»Papa, was kann ich mal machen?«
»Ich habe dir schon gesagt, du sollst spielen und mich in Ruhe lassen!«
»Aber ich hab schon gespielt, ganz ehrlich.«
Ihr Vater lachte:
»Aber Spielen hat doch nie ein Ende …«
»Hat es doch.«
»Dann denk dir was anderes aus.«
»Ich will nicht mehr spielen und auch nicht lernen.«
»Was willst du denn dann machen?«
Joana überlegte:
»Mir fällt nichts ein …«
»Willst du fliegen?«, fragte ihr Vater zerstreut.
»Nein«, antwortete Joana. – Pause. – »Was kann ich machen?«
Diesmal polterte ihr Vater los:
»Stoß mit dem Kopf gegen die Wand!«
Sie zog sich zurück und flocht sich dabei einen kleinen Zopf in die glatten Haare. Niemals niemals niemals ja ja sang sie leise. Sie hatte gerade Zöpfe flechten gelernt. Sie ging zum Tischchen mit den Büchern, spielte mit ihnen, indem sie sie aus einiger Entfernung anschaute. Hausfrau Ehemann Kinder, grün ist der Mann, weiß die Frau, rot kann Sohn oder Tochter sein. Ist »niemals« ein Mann oder eine Frau? Warum ist »niemals« nicht Sohn oder Tochter? Und »ja«? Ach, es gab so viele Dinge, die einfach nicht zu erklären waren. Man konnte ganze Nachmittage darüber nachdenken. Zum Beispiel: Wer hatte wohl zum ersten Mal gesagt: niemals?
Ihr Vater war mit seiner Arbeit fertig und sah sie dasitzen und weinen.
»Aber was ist denn, meine Kleine?« Er nahm sie in die Arme, betrachtete unbeeindruckt das brennende, traurige Gesichtchen. »Na, was denn?«
»Ich weiß nicht, was ich tun soll.«
Niemals niemals ja ja. Alles war wie der Lärm von der Straßenbahn vor dem Einschlafen, bis du ein bisschen Angst hast und einschläfst. Der Mund der Schreibmaschine war zugeklappt wie der Mund einer alten Frau, aber da kam etwas und drückte auf ihr Herz wie der Lärm von der Straßenbahn, nur dass sie nicht einschlafen würde. Die Umarmung des Vaters. Der Vater dachte einen Augenblick lang nach. Aber keiner kann etwas für den anderen tun, beruhigte er sich. Das Kind läuft so verloren herum, so zart und so frühreif … Er atmete heftiger, schüttelte den Kopf. Ein kleines Ei, genau das, ein kleines, lebendiges Ei. Was wird nur aus Joana werden?
JOANAS TAG
Die Gewissheit, dass ich einen Hang zum Bösen habe, dachte Joana.
Was sonst war dieses Gefühl geballter Kraft, das nur darauf wartete, sich in Gewalt zu entladen, dieses Verlangen, sie mit geschlossenen Augen einzusetzen, ganz und gar, mit der unbesonnenen Sicherheit eines Raubtier? Konnte man denn nicht nur im Bösen furchtlos atmen, indes man die Luft und die Lungen akzeptierte? Nicht einmal das Vergnügen würde mir so viel Vergnügen bereiten wie das Böse, dachte sie überrascht. In sich spürte sie ein vollkommenes Tier, durchdrungen von Ungereimtheiten, Egoismus und Vitalität.
Sie dachte an ihren Mann, der sie in diesem Gedanken wahrscheinlich gar nicht erkennen würde. Sie versuchte sich ins Gedächtnis zu rufen, wie Otávio aussah. Doch jedes Mal, kaum nahm sie wahr, dass er das Haus verlassen hatte, verwandelte sie sich, konzentrierte sich auf sich selbst; und als hätte er sie nur unterbrochen, spann sie langsam den Faden ihrer Kindheit weiter, vergaß ihn und ging in tiefster Einsamkeit durch die Zimmer. Kein Geräusch drang aus der ruhigen Wohngegend mit den weit auseinanderliegenden Häusern zu ihr.
Und nun, da sie frei war, kannte nicht einmal sie ihre eigenen Gedanken.
Ja, in sich spürte sie ein vollkommenes Tier. Die Vorstellung, dieses Tier eines Tages loszulassen, stieß sie ab. Vielleicht aus Angst vor einem Mangel an Ästhetik. Oder fürchtete sie eine Offenbarung … Nein, nein, sagte sie sich, du darfst keine Angst davor haben, etwas zu erschaffen. Tief innen stieß das Tier sie vielleicht ab, weil sie immer noch den Wunsch verspürte, zu gefallen und von jemandem geliebt zu werden, der so mächtig war wie die verstorbene Tante. Nur um sie dann zu treten, rücksichtslos zu verachten. Denn der beste Satz, und immer noch der jüngste war: Güte verursacht mir Brechreiz. Die Güte war lauwarm und leicht, sie roch nach rohem, lange gelagertem Fleisch. Das aber nicht ganz verdorben war. Ab und zu frischte man es auf, würzte es ein bisschen, gerade so viel, dass es als ein Stück lauwarmes und stilles Fleisch erhalten blieb.
Eines Tages, noch vor ihrer Heirat, als ihre Tante noch lebte, hatte sie einen gierigen Menschen essen sehen. Sie hatte seine weit aufgerissenen, glänzenden, blöden Augen betrachtet, die versuchten sich nicht die geringste Geschmacksempfindung entgehen zu lassen. Und die Hände, die Hände. Eine Hand hielt eine Gabel mit einem blutigen Fleischstück darauf gespießt – kein lauwarmes, stilles, sondern sehr lebendiges, ironisches, unmoralisches Fleisch –, die andere klammerte sich um das Tischtuch und packte es ungeduldig, voller Gier nach dem nächsten Bissen. Die Beine unter dem Tisch schlugen den Takt einer unhörbaren Musik, einer Teufelsmusik von reiner, ungehemmter Gewalt. Die Wucht, die Fülle seiner Farbe … Rötlich auf den Lippen und um die Nase, blass und bläulich unter den kleinen Augen. Joana war vor ihrem armseligen Kaffee erschauert. Aber später hätte sie nicht zu sagen gewusst, ob aus Widerwillen oder aus Faszination und Wollust. Sicher beides. Sie wusste, dass der Mann eine Kraft war. Sie fühlte sich unfähig, so wie er zu essen, sie war von Natur aus genügsam, aber die Vorführung verwirrte sie. Auch traf es sie, wenn sie diese schrecklichen Geschichten las, in denen die Gemeinheit kalt und durchdringend war wie ein Eisbad. Als sähe sie jemanden Wasser trinken und würde entdecken, dass sie Durst hatte, einen tiefen, alten Durst. Vielleicht war es nur ein Mangel an Leben: sie lebte weniger, als sie konnte, und glaubte, dass ihr Durst nach Überschwemmungen verlangte. Vielleicht nur ein paar Schluck … Oh, das sei dir eine Lehre, das sei dir eine Lehre, würde die Tante sagen: Nie losgehen, nie stehlen, bevor du nicht weißt, ob das, was du stehlen willst, nicht irgendwo ganz ordnungsgemäß für dich bereitsteht. Oder etwa nicht? Stehlen lässt alles wertvoller werden. Der Geschmack des Bösen – Rot kauen, süßliches Feuer verschlucken.
Mich nicht anklagen. Die Grundlage des Egoismus suchen: alles, was ich nicht bin, kann mich nicht interessieren, es ist unmöglich, viel mehr als das zu sein, was man ist – ich aber gehe auch ohne Delirium über mich hinaus, ich bin eigentlich normalerweise schon mehr als ich –, ich habe einen Körper, und alles, was ich tue, ist die Fortsetzung meines Anfangs; wenn die Kultur der Maya mich nicht interessiert, dann liegt es daran, dass nichts in mir sich ihren Bas-Reliefs verbunden fühlt; ich nehme alles an, was von mir kommt, weil ich die Ursachen nicht kenne, und möglicherweise trete ich auf Lebenswichtiges, ohne es zu wissen; das ist das Demütigste an mir, ahnte sie.
Das Schlimmste war, dass sie alles, was sie gedacht hatte, auslöschen konnte. Einmal gedacht, waren ihre Gedanken wie Statuen im Garten, sie sah sie an, während sie durch den Garten schritt, und folgte weiter ihrem Weg.
An diesem Tag war sie fröhlich, und auch schön. Ein bisschen Fieber hatte sie auch. Warum diese Romantisierung: ein bisschen Fieber? Aber ich habe wirklich Fieber: die Augen glänzen, diese Kraft und diese Schwäche, unregelmäßige Herzschläge. Wenn die leichte Brise, die Sommerbrise, sie umstrich, erzitterte sie am ganzen Körper vor Kälte und Hitze. Und dann überstürzten sich ihre Gedanken, sie konnte das Phantasieren nicht mehr aufhalten. Das ist weil ich noch so jung bin, überlegte sie, und immer, wenn ich berührt oder nicht berührt werde, spüre ich, dachte sie. Jetzt zum Beispiel an blonde Bäche denken. Eben gerade weil es keine blonden Bäche gibt, verstehst du? so flieht man. Ja, aber die Goldstreifen der Sonne, die sind in gewisser Weise blond … Also habe ich mir das in Wirklichkeit gar nicht ausgedacht. Immer der gleiche Sturz: weder das Böse noch die Phantasie. Im ersten, im endgültigen Mittelpunkt ein einfaches Gefühl ohne Eigenschaften, so blind wie ein rollender Stein. In der Phantasie – und nur sie hat die Kraft des Bösen – bloß die vergrößerte, verwandelte Vision: darunter die gleichmütige Wahrheit. Man lügt und stürzt in die Wahrheit. Selbst wenn sie sich in ihrer Freiheit fröhlich für neue Wege entschied, erkannte sie sie später wieder. Frei sein hieß am Ende doch, sich selbst zu folgen, und da kam man wieder auf den vorgezeichneten Weg. Sie würde nur das sehen, was sie schon in sich trug. Verloren also war die Lust am Phantasieren. Und der Tag, an dem ich weinte? – auch da gab es ein gewisses Bedürfnis zu lügen –, ich machte Mathematikaufgaben und plötzlich spürte ich die erschreckende, kalte Unmöglichkeit des Wunders. Ich sehe durch dieses Fenster, und die einzige Wahrheit, die Wahrheit, die ich diesem Mann, wenn ich ihn anspreche, nicht sagen könnte, ohne dass er vor mir die Flucht ergriffe, die einzige Wahrheit ist, dass ich lebe. Ich lebe einfach. Wirklich, ich lebe. Wer bin ich? Nun, das ist schon zu viel. Ich erinnere mich an die chromatische Studie von Bach und verliere den Verstand. Sie ist kalt und klar wie Eis, und dennoch kann man auf ihr schlafen. Ich verliere das Bewusstsein, aber das macht nichts, denn die größte Gelassenheit finde ich in der Täuschung der Sinne. Es ist eigenartig, dass ich nicht sagen kann, wer ich bin. Besser gesagt, ich weiß es nur zu gut, aber ich kann es nicht sagen. Vor allem habe ich Angst, es zu sagen, weil in dem Augenblick, in dem ich es auszusprechen versuche, ich nicht nur nicht ausdrücke, was ich empfinde, sondern, was ich empfinde, langsam zu dem wird, was ich sage. Oder wenigstens ist das, was mich zum Handeln treibt, nicht das, was ich empfinde, sondern das, was ich sage. Ich spüre, wer ich bin, und dieses Gefühl sitzt oben im Gehirn und auf den Lippen – vor allem auf der Zunge –, auf der Oberfläche der Arme und auch in meinem Körper, tief innen durchströmt es mich, aber wo, wo genau, kann ich nicht sagen. Es schmeckt grau, ein bisschen rötlich, in den alten Teilen ein bisschen bläulich und bewegt sich zähflüssig wie Gelatine. Manchmal wird es scharf und verletzt mich, wenn es mit mir zusammenstößt. Also gut, jetzt zum Beispiel an den blauen Himmel denken. Aber vor allem, woher kommt diese Gewissheit zu leben? Nein, es geht mir nicht gut. Niemand stellt sich doch diese Fragen und ich … Aber man muss nur schweigen, um, unter allen Wirklichkeiten liegend, die einzige, unbeugsame zu erkennen, die der Existenz. Und unter allen Ungewissheiten – die chromatische Studie – weiß ich, dass alles vollkommen ist, denn von Tonleiter zu Tonleiter ist sie dem vorbestimmten Weg in Bezug auf sich selbst gefolgt. Nichts entgeht der Vollkommenheit der Dinge, das ist mit allem so. Aber das erklärt doch nicht, warum es mich so bewegt, wenn Otávio hustet und die Hand so auf die Brust legt. Oder wenn er raucht und die Asche auf seinen Schnurrbart fällt, ohne dass er es merkt. Ach, Mitleid empfinde ich dann. Mitleid ist meine Form der Liebe. Des Hasses und der Verständigung. Es hält mich aufrecht gegen die Welt, so wie einer getrieben vom Begehren lebt, ein anderer von der Angst. Mitleid mit den Dingen, die ohne mein Wissen geschehen. Aber ich bin müde, trotz meiner Freude heute, einer Freude, deren Grund ich nicht kenne, so wie die Freude an einem Sommermorgen. Ich bin müde, jetzt ganz unvermittelt! Lass uns leise miteinander weinen. Weil wir gelitten haben und ganz sachte weitermachen. Der ermüdete Schmerz in einer vereinfachten Träne. Aber jetzt ist es schon das Verlangen nach Dichtung, das gestehe ich, Gott. Lass uns Hände halten im Schlaf. Die Welt dreht sich, und irgendwo gibt es Dinge, die ich nicht kenne. Lass uns auf Gott und dem Geheimnis schlafen, ein ruhiges, zerbrechliches Schiff, das auf dem Meer schwimmt, hier kommt der Schlaf.
Warum glühte sie, war so schwerelos wie Luft, die von einem Ofen ausströmt, wenn man ihn öffnet?
Der Tag war wie jeder andere gewesen – vielleicht kam daher die Zunahme von Leben? Sie war aufgewacht voller Tageslicht, ganz durchdrungen. Noch im Bett hatte sie an Sand gedacht, an Meer, ans Trinken von Meerwasser im Haus der verstorbenen Tante, an Fühlen, vor allem Fühlen. Sie wartete einige Sekunden auf dem Bett; da nichts geschah, verbrachte sie einen gewöhnlichen Tag. Sie hatte sich noch immer nicht vom Wunsch-Macht-Wunder befreit, seit sie klein war. So oft war diese Formel wiedergekehrt: das Ding spüren, ohne es zu besitzen. Dabei musste ihr nur alles zu Hilfe kommen, sie schwerelos und unberührt werden lassen, der Magen nüchtern, damit sie die Phantasie empfangen konnte. Schwierig wie das Fliegen und ohne festen Halt für die Füße etwas äußerst Kostbares in den Armen empfangen, ein Kind zum Beispiel. Doch selbst wenn sie allein war, hatte sie erst an einem gewissen Punkt in diesem Spiel nicht mehr den Eindruck, dass sie log – und hatte Angst, nicht in all ihren Gedanken anwesend zu sein. Sie wollte das Meer und fühlte die Bettlaken. Der Tag schritt voran und ließ sie allein zurück.
Sie hatte noch im Bett gelegen und war ganz still gewesen, hatte fast nichts gedacht, wie es manchmal geschah. Sie betrachtete flüchtig das Haus, das um diese Zeit erfüllt war von Sonne, die hoch aufragenden Scheiben, die glänzten, als wären sie selbst das Licht. Otávio war weggegangen. Niemand zu Hause. Und deshalb niemand in ihrem Inneren, der die wirklichkeitsfernsten Gedanken haben konnte, wenn er wollte. Wenn ich mich dort auf der Erde von den Sternen aus erblickte, wäre ich ganz allein von mir. Es war nicht Nacht, es gab keine Sterne, und es war unmöglich, sich auf diese Entfernung zu erkennen. Während sie sich so ihren Gedanken überließ, fiel ihr jemand ein – große, auseinanderstehende Zähne, wimpernlose Augen –, der sich der Originalität seiner Äußerung sicher war, aber dennoch aufrichtig sagte: Mein Leben ist furchtbar nächtlich. Nachdem er das gesagt hatte, blieb dieser Jemand unbeweglich stehen wie ein Stier in der Nacht; ab und zu drehte er in einer unlogischen, sinnlosen Geste den Kopf, um sich daraufhin wieder auf seine Stumpfheit zu konzentrieren. Er erfüllte alle Welt mit Entsetzen. Ach ja, der Mann gehörte in ihre Kindheit, und neben der Erinnerung an ihn war da ein feuchter Strauß großer Veilchen, die vor Lasterhaftigkeit zitterten … In diesem Augenblick könnte Joana, wenn sie wollte, wacher wäre, sich ein bisschen mehr gehen ließe, ihre ganze Kindheit nacherleben … Die kurze Zeit mit dem Vater, der Umzug in das Haus der Tante, der Lehrer, der sie leben lehrte, die sich geheimnisvoll ankündigende Pubertät, das Internat … die Ehe mit Otávio … aber all dies war viel kürzer, ein einfacher, überraschter Blick würde all diese Tatsachen aufzehren.
Es war ein bisschen Fieber, ja. Wenn es die Sünde gab, dann hatte sie gesündigt. Ihr ganzes Leben war ein Irrtum gewesen, sie war unbedeutend. Wo war die Frau mit der Stimme? Wo waren die Frauen, die nur Weibchen waren? Und wo die Fortsetzung all dessen, was sie als Kind begonnen hatte? Es war ein bisschen Fieber. Das Ergebnis jener Tage, als sie umherstreifte, tausendmal dieselben Dinge zurückweisend oder liebend. Jener dunklen und schweigsam lebenden Nächte, die kleinen dort oben flimmernden Sterne. Das aus gestreckt auf dem Bett liegende Mädchen, den Blick wachsam ins Halbdunkel gerichtet. Das weißliche Bett in der Finsternis schwimmend. Schleppende Müdigkeit im Körper, die Helligkeit auf der Flucht vor der Krake. Traum fetzen, erste Bilder. Otávio im anderen Zimmer. Und plötzlich bündelt sich die vom Warten herrührende Mattigkeit in einer nervösen, schnellen Bewegung des Körpers, ein stummer Schrei. Dann Kälte, und Schlaf.
… DIE MUTTER …
Eines Tages kam der Freund des Vaters von weit her und umarmte ihn. Beim Abendessen sah Joana verblüfft und bedrückt ein nacktes, gelbes Huhn auf dem Tisch. Der Vater und der Mann tranken Wein, und der Mann sagte ab und zu:
»Ich kann gar nicht glauben, dass du eine Tochter zustande gebracht hast …«
Der Vater drehte sich lachend zu Joana und sagte:
»Die habe ich an der Ecke erstanden …«
Der Vater war fröhlich und dann auch wieder ernst, während er aus dem weichen Innenteil des Brots Kügelchen knetete. Ab und zu trank er einen großen Schluck Wein. Der Mann wandte sich an Joana und sagte:
»Weißt du, dass das Schweinchen ro-ro-ro macht?«
Der Vater antwortete:
»Du hast kein Talent für so was, Alfredo.«
Der Mann hieß Alfredo.
»Siehst du denn nicht, dass die Kleine nicht mehr in dem Alter ist, wo man Schweine nachmacht?«
Da lachten sie, auch Joana. Der Vater gab ihr noch einen Hühnerflügel, und sie aß ihn ohne Brot.
»Was für ein Gefühl ist es eigentlich, so eine Kleine zu haben?«, fragte der Mann kauend.
Der Vater wischte sich mit der Serviette den Mund ab, neigte den Kopf zur Seite und sagte lächelnd:
»Manchmal ist es wie ein warmes Ei, das du in der Hand hältst. Manchmal gar nichts: vollkommener Gedächtnisschwund … Hin und wieder das Gefühl, ein kleines Mädchen zu haben, das wirklich mir gehört.«
»Mädchen, Mädchen, Rädchen, Städtchen, Lädchen …«, trällerte der Mann zu Joana gewandt. »Was willst du sein, wenn du eine junge Dame bist und so?«
»Was das und so betrifft, hat sie selbst noch nicht die geringste Vorstellung, mein Lieber«, erklärte der Vater. »Aber wenn sie nichts dagegen hat, erzähle ich dir gern von ihren Plänen. Sie hat zu mir gesagt, dass sie ein Held sein wird, wenn sie groß ist …«
Der Mann lachte und lachte. Plötzlich hörte er auf, griff nach Joanas Kinn, und während er es festhielt, konnte sie nicht weiterkauen:
»Du wirst doch nicht weinen, weil das Geheimnis nun gelüftet ist, was, Kleine?«
Dann unterhielt man sich über Dinge, die sicher geschehen waren, bevor sie auf die Welt gekommen war.
Manchmal ging es nicht einmal um solche Dinge, die geschehen, nur Worte – aber auch die waren aus der Zeit vor ihrer Geburt. Sie hätte es tausendmal lieber gehabt, wenn es geregnet hätte, weil es dann viel einfacher gewesen wäre, ohne Angst vor der Dunkelheit einzuschlafen. Die beiden Männer holten ihre Hüte, um wegzugehen; da stand sie auf und zog ihren Vater am Jackett:
»Bleib doch noch …«
Die beiden Männer warfen sich einen Blick zu, und einen Moment lang wusste sie nicht, ob sie bleiben würden oder gehen. Aber als der Vater und sein Freund ein bisschen ernst dreinblickten und nach einer Weile beide zu lachen anfingen, wusste sie, dass sie bleiben würden. Wenigstens so lange, bis sie müde genug wäre, um sich schlafen zu legen, ohne den Regen zu hören, ohne Menschen zu hören, in Gedanken bei dem restlichen dunklen, leeren, stillen Haus. Sie setzten sich hin und rauchten. Das Licht begann vor ihren Augen zu flimmern, und am nächsten Tag würde sie, sobald sie wach wäre, nach den Hühnern auf dem Nachbarhof sehen, weil sie heute gebratenes Huhn gegessen hatte.
»Ich konnte sie einfach nicht vergessen«, sagte der Vater. »Nicht, dass ich immerzu an sie gedacht hätte. Hin und wieder ein Gedanke, wie ein Merkzettel für später. Später kam, und ich dachte doch nicht weiter darüber nach. Da war nur dieser leichte schmerzlose Stachel, ein gerade mal angedeutetes Ach ja!, flüchtiges Nachdenken und dann das Vergessen. Sie hieß …«, er sah zu Joana hinüber, »sie hieß Elza. Ich erinnere mich, dass ich ihr sogar gesagt habe: Elza klingt wie ein leerer Sack. Sie war schmal, etwas gebeugt – du weißt, was ich meine, oder? –, voller Macht. Sie war so schnell und hart in ihren Schlussfolgerungen, so unabhängig und bitter, dass ich sie, als wir zum ersten Mal miteinander sprachen, derb nannte! Stell dir vor … Sie lachte, dann wurde sie ernst. Damals versuchte ich mir vorzustellen, was sie wohl nachts machte. Denn es erschien mir unvorstellbar, dass sie schlief. Nein, sie gab sich nie hin. Und sogar diese welke Farbe – zum Glück hat die Kleine sie nicht –, diese Farbe passte zu keinem Nachthemd … Sie verbrachte die Nacht sicher mit Beten, betrachtete vielleicht den Himmel, wachte für jemanden. Ich hatte ein schlechtes Gedächtnis, konnte mich nicht einmal erinnern, warum ich sie derb genannt hatte. Aber so schlecht, dass ich sie etwa ganz vergessen hätte, war es dann auch wieder nicht. Ich sah sie noch vor mir, wie sie mit festen Schritten über den Sand lief, ihr Gesicht war verschlossen, abwesend. Alfredo, das Merkwürdige dabei war, dass es gar keinen Sand gegeben haben konnte. Und dennoch blieb dieses Bild hartnäckig, ließ keine Erklärung zu.«
Der Mann rauchte und lag dabei fast im Stuhl. Joana fuhr mit dem Fingernagel über den roten Lederbezug des alten Sessels.
»Einmal bin ich frühmorgens mit Fieber aufgewacht. Fast fühle ich jetzt noch die heiße Zunge wie einen trockenen, rauen Lappen im Mund. Du weißt, wie sehr ich mich davor fürchte, Schmerzen ertragen zu müssen, lieber verkaufe ich meine Seele. Nun, ich musste an sie denken. Unglaublich. Wenn ich mich nicht irre, war ich da schon zweiunddreißig Jahre alt. Mit zwanzig hatte ich sie kennengelernt, flüchtig. Und in einem solchen Augenblick der Angst musste ich – bei all den Freunden, die ich habe, und sogar dich hatte ich doch, wusste aber nicht, wo du warst –, in diesem Augenblick musste ich an sie denken. Es war schrecklich …«
Der Freund lachte:
»So was ist schrecklich, ja …«
»Du kannst dir das gar nicht vorstellen: Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so wütend auf andere ist, wirklich wütend, und die Menschen auch so verachtet. Und gleichzeitig war sie auch wieder so gut, auf eine spröde Art. Oder mache ich mir das nur vor? Ich mochte einfach ihre Art von Güte nicht: als ob sie sich über einen lustig machte. Aber ich gewöhnte mich daran. Sie brauchte mich gar nicht. Ich sie allerdings auch nicht. Aber wir lebten zusammen. Ich würde alles darum geben, wenn ich jetzt noch erfahren könnte, worüber sie eigentlich so viel nachdachte. So wie du mich hier siehst und mich kennst, würde ich dir an ihrer Seite wie ein Einfaltspinsel vorkommen. Und dann stell dir nur die Wirkung auf meine armselige, spärliche Familie vor: Es war, als hätte ich ihrem rosigen, üppigen Schoß – erinnerst du dich, Alfredo?« – die beiden lachten – »ja, als hätte ich den Pockenvirus gebracht, einen Ketzer, was weiß ich … Na ja, ich möchte ja selbst nicht, dass dieser Sprössling da nach ihr gerät. Und auch nicht nach mir, da sei Gott vor … Zum Glück habe ich den Eindruck, dass Joana ihren eigenen Weg gehen wird …«
»Und dann?«, fragte der Mann darauf.
»Dann … nichts. Sie starb, sobald sie konnte.«
Danach sagte der Mann:
»Sieh mal, deine Tochter ist schon fast eingeschlafen … Tu was Gutes und steck sie ins Bett.«
Aber sie schlief nicht. Wenn man nämlich die Augen nicht ganz zumachte und den Kopf zur Seite fallen ließ, dann war es ein bisschen so, als würde es regnen, alles verschwamm leicht. Genauso wenn sie sich hinlegte und das Laken hochzog, dann könnte sie eher einschlafen und würde das Dunkel nicht so schwer auf ihrer Brust spüren. Besonders heute, wo sie Angst vor Elza hatte. Aber vor der Mutter darf man keine Angst haben. Die Mutter war wie ein Vater. Während der Vater sie durch den Flur ins Zimmer trug, lehnte sie ihren Kopf gegen ihn und spürte den starken Geruch, der von seinen Armen kam. Sie sagte, ohne zu sprechen: nein, nein, nein … Um sich Mut zu machen, dachte sie: morgen, morgen zuallererst die lebendigen Hühner sehen.
Die letzte Sonne zitterte draußen in den grünen Zweigen. Die Tauben pickten auf der lockeren Erde herum. Ab und zu drangen die Brise und die Stille vom Schulhof her ins Klassenzimmer vor. Dann wurde alles schwereloser, die Stimme der Lehrerin wehte wie eine weiße Fahne.
»Und von da an lebten er und seine ganze Familie glücklich bis an ihr Lebensende.« Pause – die Bäume raschelten im Hof, es war ein Sommertag. »Schreibt eine Inhaltsangabe dieser Geschichte bis zur nächsten Stunde.«
Die Kinder hingen noch in Gedanken der Geschichte nach, sie regten sich langsam, mit unbeschwertem Blick und zufriedenen Mündern.
»Und was erreicht man, wenn man glücklich ist?« Ihre Stimme war ein scharfer, schlanker Pfeil.
Die Lehrerin sah zu Joana hinüber.
»Wiederhol die Frage …?«
Schweigen.
Die Lehrerin lächelte, während sie ihre Bücher zusammenräumte.
»Stell doch die Frage noch einmal, Joana, ich habe sie nur nicht richtig verstanden.«
»Ich möchte gern wissen: Nachdem man glücklich ist, was ist dann? Was kommt danach?«, wiederholte das Mädchen hartnäckig.
Die Frau sah sie überrascht an.
»Was für ein Gedanke! Ich glaube, ich verstehe nicht, was du meinst, was für ein Gedanke! Formulier die Frage anders …«
»Glücklich ist man, um was zu erreichen?«
Die Lehrerin errötete – man wusste nie genau, warum sie rot wurde. Sie sah die Klasse an und schickte alle in die Pause hinaus.
Der Schuldiener kam und rief das Mädchen ins Lehrerzimmer. Dort saß die Lehrerin.
»Setz dich … hast du schön gespielt?«
»Ein bisschen …«
»Was willst du werden, wenn du groß bist?«
»Ich weiß nicht.«