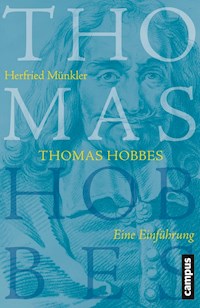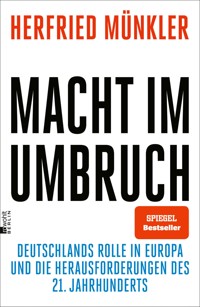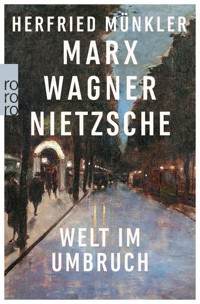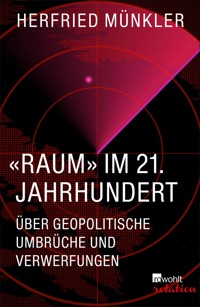12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein Gespenst geht um in Deutschland, das Gespenst des Abstiegs. Immer mehr Untergangsszenarien sind im Umlauf oder werden sogar bewusst geschürt. Wenn es um die Zukunft geht, gilt es als ausgemacht, dass es unseren Kindern einmal schlechter gehen wird als uns. Doch diese Aussage ist ebenso grundlos wie gefährlich. Herfried und Marina Münkler zeigen eindrucksvoll, warum solche diffusen Ängste den Zusammenhalt einer Gesellschaft gefährden und allen Populisten, aus welcher Richtung sie auch kommen, Angriffspunkte bieten. Mehr noch: Das Abstiegsgerede hindert die Politik daran, über die wirklichen Schwachstellen der Gesellschaft zu sprechen und sie anzugehen. Bildung, Demokratie, europäische Integration: Das sind die Felder, auf denen jahrzehntelang nichts geschah und auf denen jetzt die Probleme heranwachsen, die auf mittlere Sicht unseren Wohlstand und, schlimmer, die Architektur unserer Gesellschaft gefährden können. «Dieses Buch leistet, was eigentlich Aufgabe der Bundesregierung gewesen wäre», schrieb der «Spiegel» über das Vorgängerbuch «Die neuen Deutschen» – und das gilt genauso für dieses: Es bekämpft falsche, gefährliche Ängste und zeigt, was Deutschland jetzt braucht und wie wir die Zukunft zurückgewinnen können. x
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 650
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Herfried Münkler • Marina Münkler
Abschied vom Abstieg
Eine Agenda für Deutschland
Über dieses Buch
Ein Gespenst geht um in Deutschland, das Gespenst des Abstiegs. Immer mehr Untergangsszenarien sind im Umlauf oder werden sogar bewusst geschürt. Wenn es um die Zukunft geht, gilt es als ausgemacht, dass es unseren Kindern einmal schlechter gehen wird als uns. Doch diese Aussage ist ebenso grundlos wie gefährlich. Herfried und Marina Münkler zeigen eindrucksvoll, warum solche diffusen Ängste den Zusammenhalt einer Gesellschaft gefährden und allen Populisten, aus welcher Richtung sie auch kommen, Angriffspunkte bieten. Mehr noch: Das Abstiegsgerede hindert die Politik daran, über die wirklichen Schwachstellen der Gesellschaft zu sprechen und sie anzugehen. Bildung, Demokratie, europäische Integration: Das sind die Felder, auf denen jahrzehntelang nichts geschah und auf denen jetzt die Probleme heranwachsen, die auf mittlere Sicht unseren Wohlstand und, schlimmer, die Architektur unserer Gesellschaft gefährden können.
«Dieses Buch leistet, was eigentlich Aufgabe der Bundesregierung gewesen wäre», schrieb der «Spiegel» über das Vorgängerbuch «Die neuen Deutschen» – und das gilt genauso für dieses: Es bekämpft falsche, gefährliche Ängste und zeigt, was Deutschland jetzt braucht und wie wir die Zukunft zurückgewinnen können.
Vita
Herfried Münkler, geboren 1951, lehrte bis zu seiner Emeritierung 2018 an der Berliner Humboldt-Universität. Zuletzt erschienen von ihm «Die Deutschen und ihre Mythen» (2009), «Der Große Krieg» (2013) und «Der Dreißigjährige Krieg» (2017), die jeweils monatelang auf der «Spiegel»-Bestsellerliste standen.
Marina Münkler, geboren 1960, ist Professorin für Literaturwissenschaft an der Technischen Universität Dresden. Sie veröffentlichte u. a. «Marco Polo» (1998), «Erfahrung des Fremden» (2000) und «Narrative Ambiguität. Die Faustbücher des 16.–18. Jahrhunderts» (2011).
Gemeinsam veröffentlichten Herfried und Marina Münkler das «Lexikon der Renaissance» (2000) und «Die neuen Deutschen» (2016).
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Oktober 2019
Copyright © 2019 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin
Covergestaltung Frank Ortmann
ISBN 978-3-644-10084-8
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Einleitung: Zeitenwende oder Zwischenspiel?
Weithin ratlos reagiert das Gros der Beobachter darauf, dass sich inzwischen auch in Ländern mit beachtlichem Wohlstand eine Unzufriedenheit ausgebreitet hat, die jederzeit in Zorn und Wut umschlagen kann. Bis vor kurzem noch herrschte die Auffassung vor, die Ordnung der Demokratie sei dann sicher, wenn es einem Land wirtschaftlich gut gehe. Umgekehrt galten langwährende ökonomische Krisen als Gefährdung der demokratischen Ordnung. Das Paradebeispiel dafür ist die Zeit zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg, als die gerade erst gegründeten Demokratien Mitteleuropas sich der Reihe nach in autoritäre oder diktatorische Ordnungen verwandelten. Wenn nach historischen Analogien zur aktuellen Krise gesucht wird, fällt der Blick deshalb regelmäßig auf die 1920er und 1930er Jahre. Zumal in Deutschland wird das Ende der Weimarer Republik als Menetekel für die jüngsten Entwicklungen beschworen. Nach einer kurzen Prosperitätsphase geriet das Land in eine schwere Wirtschaftskrise, mit deren Dauer das Vertrauen in die Demokratie dahinschmolz. Im Unterschied dazu hat die Bundesrepublik die letzte Finanz- und Wirtschaftskrise glimpflich überstanden und danach ein Jahrzehnt ungebrochenen wirtschaftlichen Wachstums durchlaufen. Das ist der grundlegende Unterschied zur Endphase der Weimarer Republik. Dennoch wird der Vergleich mit den 1920er und 1930er Jahren, in denen die Demokratie allenthalben in die Defensive geriet und in Süd- und Mitteleuropa durch den Aufstieg von Diktatoren zerstört wurde, immer wieder herangezogen.[1] Sobald die Vorstellung aufkommt, die aktuelle Krise stehe für einen «Wendepunkt der Geschichte», hat das krisenverschärfende Folgen, denn diese Deutung dramatisiert die Krise und damit die weitere Entwicklung.
Unstreitig sind in den letzten Jahren in Europa und andernorts Politiker an die Macht gekommen, die den demokratischen Rechtsstaat und die Anhänger einer liberal-pluralistischen Gesellschaft verachten. Sie sind jedoch keineswegs gewählt worden, weil sie ihre Aversion gegen die Grundsätze der demokratischen Ordnung geheim gehalten hätten; vielmehr haben sie damit offen für sich geworben. Sie haben auf demokratischem Weg Mehrheiten gewonnen, auf die gestützt sie die Demokratie einschränken, wenn nicht abschaffen wollen. Das zeigt, dass eine große Anzahl von Menschen kein Vertrauen mehr in die Funktionsmechanismen der Demokratie hat – jedenfalls dann, wenn Demokratie nicht nur für die Herrschaft nach dem Willen der Mehrheit steht, sondern auch für die Bindung der Mehrheit an das Recht und die Möglichkeit individueller Präferenzentscheidungen gegen die Auffassung der Mehrheit. Auf diesen drei Grundsätzen – demokratische Machtkontrolle, Rechtsstaatlichkeit und gesellschaftliche Liberalität – beruht, was wir als «westliche Demokratie» bezeichnen. Genau das aber bestreiten die Anhänger von Erdoğan, Kaczyński und Orbán, Trump, Putin, Duterte und Bolsonaro. Für sie heißt Demokratie, dass die Mehrheit ohne Rücksicht auf Minderheiten entscheidet, was sie will, und dass diese Mehrheit mit populistischen Parolen und Maßnahmen gelenkt wird.
Die Faktoren, die zum Aufstieg der autoritär-autokratischen Politiker geführt haben, sind unterschiedlich, mischen sich teilweise aber auch: In Polen etwa verband sich gekränkter Nationalstolz mit den in ländlichen Räumen vorherrschenden Werten; in anderen Fällen trat die Vorstellung in den Vordergrund, Zuwanderung gefährde die nationale Identität; in den USA, aber auch in Teilen Frankreichs spielt die Erfahrung wirtschaftlichen Abgehängtwerdens eine zentrale Rolle; in Brasilien oder auf den Philippinen kommt physischer Angst infolge dramatischer Drogenkriminalität eine ausschlaggebende Bedeutung zu. Überall geht der Aufstieg autoritär-autokratischer Politiker mit Korruptionsvorwürfen gegen die politische Elite einher – in einigen Fällen treffen die Vorwürfe zu, in anderen sind sie nur ein Bestandteil von Denunziationskampagnen. Der Gestus des Auskehrens und Saubermachens trifft dabei nicht nur den politischen Gegner, sondern auch die demokratische Ordnung selbst: Sie sei, so der Subtext, nicht in der Lage, der sich ausbreitenden Korruption erfolgreich Widerstand zu leisten. Deshalb müssten «starke Männer» kommen, um das Land zu säubern[2] – von moralischer Verkommenheit, politischen Intrigen und gegen den «Willen des Volkes» gerichteten Einflusskoalitionen.
Die Delegitimation der politischen Parteien und der parlamentarischen Ordnung ist das eine; das andere ist ein in der Gesellschaft weit verbreitetes Gefühl der Einflusslosigkeit, der Wehrlosigkeit gegenüber Entwicklungen, die als bedrohlich wahrgenommen werden, und des Ausgeliefertseins an Mächte, denen man hilflos gegenübersteht. Als Sammelbegriff für diese Empfindungen hat sich die Formel vom Kontrollverlust durchgesetzt. Das Gefühl der Wehrlosigkeit und des Ausgeliefertseins ist inzwischen zur durchgehenden Grundierung der ansonsten wechselnden Stimmungslagen in der Politik geworden. Es findet seinen Niederschlag in der Ausbreitung obsessiver Verschwörungstheorien,[3] die auf der politischen Linken wie der Rechten anzutreffen sind, und in einer diffusen Identifikation mit «starken Männern», die bei den an ihrer Hilflosigkeit Leidenden ein Gefühl wiedergewonnener Stärke hervorbringt.
Das unvermittelte Nebeneinander von gefühlter Hilfslosigkeit und imaginierter Allmacht ist weniger ein politisches als ein religiöses Phänomen, jedenfalls dann, wenn man als «politisch» eine Beziehung begreift, die unter dem Vorbehalt ihrer Revidierbarkeit eingegangen wird, während religiöse Bindungen unbedingt und uneingeschränkt sind. Der europäische Weg zur demokratischen Ordnung war dementsprechend mit der politischen Neutralisierung des Religiösen durch Zurückdrängung in die Sphäre des Privaten verbunden. Aber das war keine einsinnige Entwicklung, denn der gesellschaftliche Zusammenhalt, auf den Demokratien angewiesen sind, wird nicht zuletzt von im weiteren Sinn religiösen Antrieben getragen. Beides muss aber sorgsam auseinandergehalten werden.
Die Säkularisierung des Politischen in Europa ging immer wieder mit Gegenbewegungen einher, die, wie etwa der Nationalismus oder der Glauben an einen unfehlbaren Führer, religiöse Elemente in die politischen Beziehungen mischten und dabei das Politische ins Herrschaftliche oder Totalitäre zurückverwandelten.[4] Die Erinnerung an die daraus erwachsenen Katastrophen genügen aber offenbar nicht mehr, um die Sehnsucht nach der Sakralisierung des Politischen zu blockieren. In der Sehnsucht nach «starken Männern» zeichnet sich nicht nur eine Rückkehr religiöser Sehnsüchte in eine «entzauberte Welt» (Max Weber) ab, die das Projekt der liberalen Demokratie gefährden, sondern auch das Paradox, dass das, was besonders entschieden abgelehnt wird, nämlich der Islamismus, sich genau durch eine solche Vermischung von Politik und Religion auszeichnet.[5] Nun betrifft der Verweis auf den Islam sicherlich nicht das Selbstverständnis der westlichen Demokratie, die sich als Sachwalter einer irreversiblen Entwicklung angesehen hat und nach wie vor ansieht. Aber die entscheidende Frage lautet, ob es sich bei der Rückkehr religiöser Elemente in die Politik um eine zeitweilige Regression, ein politisches Zwischenspiel oder eine Zeitenwende handelt, wobei der Islamismus dann ein Vorreiter dessen wäre, was uns in Europa noch bevorsteht.
Dabei genügt es freilich nicht, nur die jüngere Vergangenheit, etwa die 1920er und 1930er Jahre, oder die Demokratisierungsschübe nach dem Ersten Weltkrieg und dem Zusammenbruch des Sowjetsystems zu betrachten.[6] Es müssen vielmehr größere Zeiträume ins Auge gefasst werden, in denen bürgerpartizipative Ordnungen für Jahrhunderte verschwunden sind. Dafür steht das Ende der athenischen Demokratie im 4. vorchristlichen Jahrhundert, die Agonie der römischen Republik nach jahrzehntelangen Bürgerkriegen drei Jahrhunderte später und auch der Untergang republikanisch-stadtstaatlicher Ordnungen im 15. und 16. Jahrhundert. In allen drei Fällen handelt es sich nicht um eine zeitweilige Unterbrechung in der Geschichte bürgerpartizipativer Ordnungen, sondern um das definitive Ende eines spezifischen Typs von Bürgerpartizipation. Als Jahrhunderte später wieder Ordnungen errichtet wurden, die auf der politischen Teilhabe von Bürgern beruhten, war dies ein Neuanfang und keine Wiederaufnahme dessen, was es zuvor schon einmal gegeben hatte. Das ist mit Wendepunkt oder Zeitenwende gemeint: eine für lange Zeit irreversible Veränderung.
Wie kommt es zu solchen Abbrüchen in der Geschichte bürgerpartizipativer Ordnungen? Der Verweis auf eine tiefe, unüberbrückbare Spaltung der Gesellschaft ist die eine Erklärung dafür: Demnach sind die sozialen und politischen Gegensätze so groß geworden, dass sie in bürgerpartizipativer Form nicht mehr zu befrieden sind und der Ruf nach einem mit uneingeschränkter Macht ausgestatteten Herrscher entsteht. Ein weiterer Grund kann sein, dass die bürgerpartizipative Ordnung von äußeren oder inneren Feinden gewaltsam zerschlagen wird. Eine dritte Erklärung spricht vom freiwilligen Rückzug der Bürger aus der Politik, sei es, weil ihnen der damit verbundene Aufwand zu lästig geworden ist, sei es, weil sie das sichere Leben im Privaten den Risiken eines politischen Lebens vorziehen.
Diese drei Erklärungen schließen sich gegenseitig nicht aus. So ist politisches Engagement in einer gespaltenen Gesellschaft sehr viel riskanter als in einer sozial und politisch geeinten. Und Feinde der bürgerpartizipativen Ordnung haben in gespaltenen Gesellschaften bessere Chancen, an die Macht zu kommen, als in gefestigten. Ob daraus nun eine Unterbrechung oder ein Abbruch politischer Teilhabe wird, hängt wesentlich davon ab, ob eine starke Gruppe der Bürger am Partizipationsprojekt festhält und es zu erneuern versucht oder ob die Bürgerschaft resigniert und eigene Macht- und Geltungsansprüche aufgibt. Étienne de La Boétie, ein französischer Jurist und Essayist des 16. Jahrhunderts, hat mit Blick auf Letzteres von der servitude volontaire gesprochen, der freiwilligen Knechtschaft, in die sich Bürger begeben, um der Last politischer Teilhabe ledig zu sein.[7] La Boétie glaubte, eine solche Entwicklung in seiner Gegenwart, die er mit dem Ende der römischen Republik verglich, beobachten zu können. Er gelangte zu dem Ergebnis, die Ära bürgerschaftlicher Politikpartizipation sei definitiv zu Ende gegangen.
Anders als La Boétie war Karl Marx bei seiner Auseinandersetzung mit dem Scheitern der 1848er-Revolution in Frankreich und dem Staatsstreich von Napoleons Neffen im 18. Brumaire des Louis Bonaparte der Auffassung, das Ende der Epoche der Bourgeoisie und den Aufstieg des Proletariats vor Augen zu haben, wenngleich Letzteres durch die Unterwerfung der Bourgeoisie unter die Herrschaft Bonapartes aufgehalten wurde. In einem anderen Sinne als La Boétie ging aber auch er von einer freiwilligen Unterwerfung aus, nämlich vom Eingeständnis der Bourgeoisie, «dass ihr eigenes Interesse gebiete, sie der Gefahr des Selbstregierens zu überheben, dass um (…) ihre gesellschaftliche Macht unversehrt zu erhalten, ihre politische Macht gebrochen werden müsse, dass (…) um ihren Beutel zu retten, die Krone ihr abgeschlagen und das Schwert, das sie beschützen solle, zugleich als Damoklesschwert über ihr eigenes Haupt gehängt werden müsse».[8] Das klingt – ganz ähnlich wie bei La Boétie – nach freiwilliger Knechtschaft, beschreibt aber kein prinzipielles Ende, sondern nur den politischen Abstieg einer Klasse, die einer aufsteigenden Platz machen muss, den Machtwechsel aber durch ein Übergangsregime verzögert: «Die französische Bourgeoisie bäumte sich gegen die Herrschaft des arbeitenden Proletariats, sie hat das Lumpenproletariat zur Herrschaft gebracht, an der Spitze den Chef der Gesellschaft vom 10. Dezember [Louis Bonaparte].»[9]
La Boétie erzählt die Geschichte der republikanisch-bürgerpartizipativen Ordnung als eine von Niedergang und Untergang. Für ihn ist das die Summe dessen, was er einerseits an historischem Wissen zusammengetragen und andererseits selbst beobachtet hat. Marx hingegen beschreibt einen Abstieg, in dessen Hintergrund sich, wie er meint, der Anfang eines neuen Zeitalters abzeichnet. Dieser Unterschied in der Beobachtung wird aber nicht in erster Linie durch faktische Differenzen begründet, sondern durch Erzählmuster, durch Narrative, die es ermöglichen, das Beobachtete einzuordnen und zu bewerten. Abstieg und Niedergang bilden hier frames, Rahmungen, die letzten Endes darüber entscheiden, ob wahrgenommene Ereignisse auf den Aufstieg der einen Klasse oder den Abstieg der anderen hindeuten, ob sie den Niedergang von Herrschaftsformen oder die Heraufkunft einer neuen Gesellschaft ankündigen.[10] Narrative sind in gesellschaftliche Konstellationen eingebettet, deren Wahrnehmung und Beschreibung ihrerseits durch ebendiese Narrative geprägt ist. Dabei verschaffen sie sich die empirischen Belege für ihre Richtigkeit selbst. Narrative können deshalb auch nicht empirisch widerlegt werden. Aber sie können ihre Deutungsmacht einbüßen.[11]
Um den Zirkel zu durchbrechen, in dem polarisierende Narrative alle anderen Formen der Weltwahrnehmung verdrängen, müssen zunächst die Narrative selbst kritisch betrachtet werden. In der Bundesrepublik wie in der DDR waren die Nachkriegszeit, die späten 1950er und die frühen 1960er Jahre von der Vorstellung eines kollektiven Aufstiegs geprägt: der Rückkehr Deutschlands in die Gemeinschaft der europäischen Völker und der allgemeinen Verbesserung der Lebensverhältnisse. Im Unterschied dazu dominieren gegenwärtig die Narrative von Abstieg und Niedergang: des Abstiegs ganzer Schichten in den Zustand dauerhafter Prekarität, aber auch des ökonomischen Abstiegs Deutschlands und Europas, ebenso wie des Niedergangs vorgeblich christlich-abendländischer Werte. Der «Westen», von dem vor nicht allzu langer Zeit noch angenommen wurde, er sei der politische und ökonomische Prägestempel der Zukunft,[12] wird als globaler Abstiegskandidat angesehen, und der ängstliche Blick richtet sich auf Ost- und Südostasien als das neue Kraftzentrum des 21. Jahrhunderts.[13] Zweifellos ins Wanken geraten ist «der Westen» als politisches Projekt; der Optimismus der frühen 1990er Jahre ist verflogen. Das Frappierende daran ist, dass man nicht recht erklären kann, warum es gerade jetzt zu diesem Stimmungsumschlag gekommen ist. Nicht die Empirie hat sich verändert, sondern das Leitnarrativ.
Nachfolgend soll es jedoch nicht nur um Erklärungen für den Stimmungswechsel gehen. Es wird auch nach Auswegen aus der Krise und nach Perspektiven für eine Gesellschaft gesucht, in der nicht mehr, wie zwischen den 1950er und den 1970er Jahren, mit einem sozialen «Fahrstuhleffekt» gerechnet werden kann.[14] Zudem werden Überlegungen zur politischen Ordnung einer Welt angestellt, in der Europa und die USA nicht länger wie selbstverständlich die wirtschaftliche Führungsposition einnehmen werden. Letztlich geht es um die Struktur einer Welt, die nicht mehr in Niall Fergusons Formel The West and the Rest beschrieben werden kann.[15] Und es geht um eine Gesellschaft, in der sozialer Aufstieg wie Abstieg zu einer wesentlich individuellen Angelegenheit geworden sind, wobei soziale Veränderungen zwar ganze Berufsgruppen erfassen können, aber nicht mehr zum Aufstieg ganzer Schichten und Klassen führen werden.[16] Dass dies weitreichende Folgen gerade für das Selbstverständnis der deutschen Gesellschaft hat, steht außer Frage. Sie war in der Nachkriegszeit wie in der Phase der Wiedervereinigung durch die Erwartung kollektiver Aufstiege geprägt, und der «Abschied vom Aufstieg» hat ihr Selbstverständnis wie ihren Erwartungshorizont tiefgreifend verändert.[17]
Seit den 1960er Jahren gab es in der Bundesrepublik einen starken Trend der Parteien zur politischen Mitte, weil nach Auffassung der Demoskopen die Wahlen dort und nicht auf den politischen Flügeln entschieden wurden.[18] Die Polarisierung der politischen Landschaft nahm ab, was auch damit zu tun hatte, dass sich die Erwartungen im unteren Segment der Gesellschaft nicht länger auf grundlegende Veränderungen der Verhältnisse richteten, als deren Beförderer sich bis dahin die Parteien des linken Spektrums profiliert hatten. An ihre Stelle traten Vorstellungen eines schrittweisen, aber kontinuierlichen Aufstiegs. Parallel dazu schwand in bürgerlichen Kreisen die Angst, durch die unteren Schichten wirtschaftlich enteignet zu werden, und liberalere Auffassungen wurden auch in konservativen Kreisen akzeptabel. Die beiden Volksparteien CDU und SPD rückten weiter in die Mitte des politischen Spektrums, wo sie auf die dort seit längerem angesiedelte FDP trafen, und nach einer Phase parteiinterner Flügelkämpfe folgten ihnen auf diesem Weg auch die am Ende der 1970er Jahre neu entstandenen Grünen.[19]
Seit einiger Zeit herrscht nun in der Mitte parteipolitisches Gedränge, und es ist eher an den Nuancen in Sach- als in Grundsatzfragen erkennbar, wofür die Parteien jeweils stehen. Das ist durchaus bemerkenswert, denn der Drang zur politischen Mitte verstärkte sich in dem Maße, wie die Warnungen vor einer Erosion der sozialen Mitte häufiger wurden. Die Folge dieses allgemeinen Drangs in die Mitte war jedenfalls, dass die festen Wählerbindungen schwanden, die Zahl der Wechselwähler zunahm und die Wahlbeteiligung konstant zurückging. Die Wahlentscheidung wurde dadurch, was politische Informiertheit und Orientierung an den eigenen Interessen anbetraf, erheblich anspruchsvoller, und das kam der Mittelschicht zugute, die politisch stärker interessiert und engagiert ist. Sie ging zur Wahl, während die sozial Depravierten ihr immer häufiger fernblieben.[20]
Dann aber wurden im Gefolge der letzten Finanz- und Wirtschaftskrise und der zunehmenden Probleme, die der EU zu schaffen machten, die politischen Ränder in Europa wieder attraktiv. Es waren indes weniger die alten Rechts- und Linksparteien, die Zulauf erhielten, als neue populistische Parteien, die mit einfachen Antworten auf komplexe Fragen beachtliche Wahlerfolge erzielten.[21] Auf welcher Seite des politischen Spektrums die populistischen Bewegungen entstanden, scheint im Wesentlichen von der wirtschaftlichen Lage und der politischen Kultur des Landes abhängig zu sein: In den südlichen EU-Ländern war der Populismus (mit dem Sonderfall Italien)eher links angesiedelt, im restlichen Europa dagegen eindeutig rechts,[22] und auch im globalen Rahmen ist er überwiegend politisch rechts zu finden – wobei freilich anzumerken ist, dass die Rechtspopulisten auch einige genuin linke Themen aufgegriffen haben, mit denen sie nicht nur die Parteien «rechts der Mitte», sondern auch traditionell linke Parteien in Bedrängnis bringen konnten. In der Folge hat sich das klassische Parteienspektrum verschoben – so weit, dass sich die Frage stellt, ob die Rechts-links-Unterscheidung noch angemessen und zutreffend ist. Die Diagnose von Abstieg und Niedergang ist jedenfalls auf beiden Seiten anzutreffen, und die entsprechenden Narrative gehören zum Mobilisierungspotenzial der Parteien und Bewegungen beider politischer Flügel.
Verlierer dieser Entwicklung sind die Volksparteien, die in einer Zwickmühle stecken: Stärken sie in Reaktion auf die neuen sozioökonomischen Herausforderungen und die Verschiebungen im Parteiensystem ihre rechten oder linken Flügel, so verlieren sie Wähler in der Mitte. Bleiben sie hingegen Parteien der Mitte und grenzen sich gegen die rechts- wie linkspopulistischen Bewegungen ab, so verlieren sie Wähler auf den jeweiligen Flügeln, was sie unter Umständen die Stimmen kostet, die sie brauchen, um ihren Anspruch auf das Prädikat einer Volkspartei aufrechtzuerhalten oder zumindest eine Position zu besetzen, die eine Regierungsbildung ohne sie unmöglich macht. Wie die Entscheidung auch ausfällt: Sie ist mit erheblichen Wählerverlusten verbunden, weswegen die Parteiführungen vor klaren Entscheidungen zurückschrecken und die Richtungskonflikte innerhalb der alten Volksparteien zunehmen.[23] Das wiederum senkt deren Attraktivität für Wähler der Mitte. Die CDU ist mit diesem Dilemma bisher geschickter umgegangen als die SPD, die die Hauptleidtragende der veränderten Parteienlandschaft ist: Sie hat in der Mitte, nach links, aber auch nach rechts verloren, und Teile ihrer alten Klientel gehen überhaupt nicht mehr zur Wahl.[24]
Gewinner dieser Entwicklung sind in Deutschland – neben den Rechtspopulisten der AfD – die Grünen, die sich leicht links von der Mitte angesiedelt und als die Partei einer modernen bürgerlichen Mittelschicht etabliert haben. Man kann darin eine Bestätigung von Ronald Ingleharts These sehen, wonach Menschen, die in materiell gesicherten Verhältnissen leben, «postmaterialistische» Werthaltungen ausbilden.[25] Dabei spielen materielle Interessen zwar weiterhin eine Rolle, aber sie stehen nicht, wie bei Personen mit «materialistischer» Grundhaltung, im Mittelpunkt der politischen Präferenzen; Werte wie Menschenrechte und Minderheitenschutz gewinnen dagegen an Bedeutung und können durchaus höher gewichtet werden als das unmittelbare Eigeninteresse. Auch das Eintreten für die Interessen der gesamten Menschheit, zu denen die Begrenzung des Klimawandels und der Schutz der Artenvielfalt gehören, kann der postmaterialistischen Werthaltung zugerechnet werden.
Die populistischen Bewegungen, gleichgültig, ob politisch rechts oder links, sind dagegen zu Sammlungsbewegungen für Personen mit «materialistischer» Grundeinstellung geworden, die sich zunächst um ihre eigene Subsistenz sorgen, aber ebenso um ihre Lebensstile, Traditionen und Werte. Das erklärt auch, warum jene Teile der Industriearbeiterschaft, die sich durch Globalisierung, Wertewandel und Umweltschutz bedroht fühlen, eher den Rechtspopulisten als der klassischen Linken zuneigen. Rechtspopulistische Bewegungen vermitteln ihnen den Eindruck, ihre Angst vor dem sozialen Abstieg werde ernst genommen und abgewertete Traditionen würden verteidigt. Dementsprechend können die Rechtspopulisten nicht nur das konservative bis rechte Narrativ des politischen Niedergangs, sondern auch das links angesiedelte des sozialen Abstiegs bespielen.[26]
Das ist das zweite Dilemma der Volksparteien: dass sie zwischen Interessenvertretung und Wertorientierung hin- und herschwanken und dabei auf Kompromisse setzen, die von einem Teil ihrer Wähler als faule Kompromisse abgelehnt werden. Sie können weder die eine noch die andere Seite hinreichend bedienen. Eine Reihe von Beobachtern hat daraus geschlussfolgert, dass die große Zeit der Volksparteien vorbei sei und diese sich in den kommenden Jahren in kleinere Parteien in einer aufgesplitterten Parteienlandschaft verwandeln würden. Was das bedeuten könnte, soll nachfolgend erörtert werden.
Die Veränderung der politischen Grundstimmung von Vertrauen zu Misstrauen, von Zuversicht zu Pessimismus und Zukunftsangst, die in den Abstiegs- und Niedergangsnarrativen ihren Ausdruck findet, dazu das Auseinanderdriften der Gesellschaft, in dessen Folge «Materialisten» und «Postmaterialisten» einander unversöhnlich gegenüberstehen, das Auseinanderfallen von Lebensstilen und schließlich die Neuordnung der Parteienlandschaft mit dem angesichts wachsender Polarisierung paradoxen Effekt eines erhöhten Zwangs zum Kompromiss – all dies hat zu einem fundamentalen Wandel der politischen Perspektiven geführt, der durchaus als Wendepunkt begriffen werden kann. Stand global seit Mitte der 1950er Jahre die Schaffung wirtschaftlicher, später auch politischer Großräume im Mittelpunkt der Agenda, so hat sich inzwischen eine Präferenz für politische Kleinräumigkeit durchgesetzt, wie sie im Brexit-Votum der Engländer, im Erfolg der «America first»-Parole Trumps in den USA und im Anwachsen zentrifugaler Kräfte in der EU zum Ausdruck kommt. Es hat sich damit auch ein Politikstil durchgesetzt, der nicht mehr auf nüchterne und argumentativ unterfütterte Rationalität, sondern auf Herabsetzung des politischen Gegners und des «Anderen» setzt. Langfristige Planung und die dafür erforderlichen Kompromisse werden derzeit durch eine hektische, kurzfristig orientierte Politik konterkariert und durch negative Emotionalisierung, die nicht zuletzt durch die digitalen Kommunikationsplattformen des Internetzeitalters befördert wird, erschwert bis unmöglich gemacht.
Die Folge ist, dass der lange dominante Multilateralismus durch Bilateralität verdrängt wird. Die großen Mächte sind vor allem um ihre eigenen Vorteile besorgt und kümmern sich kaum noch um die common goods einer globalen Ordnung. Politiker, die sachbezogene Politik betreiben, haben gegen all jene, die Stimmungen aufheizen und Ängste bewirtschaften, einen schweren Stand. Das hat sich inzwischen zu einer ernst zu nehmenden Bedrohung der liberal-rechtsstaatlichen Demokratie ausgewachsen. Die Probleme sind groß und die Herausforderungen gewaltig. Dennoch sind die folgenden Kapitel im Grundton der Zuversicht gehalten. «Abschied vom Abstieg» heißt nicht, dass wir uns in eine neuerliche Aufstiegseuphorie hineinerzählen; zunächst steht für uns fest, dass der Abstieg nicht das Leitnarrativ bleiben darf. Es gibt durchaus gute Gründe, zuversichtlich in die Zukunft zu blicken. Dazu müssen freilich einige der entscheidenden Probleme bearbeitet werden.
Wir werden deshalb Vorschläge machen, die drei zentrale gesellschaftliche und politische Felder betreffen: Bildung, Demokratie und Europa. Auf allen drei Feldern lassen sich die skizzierten Probleme und die Wirkung von Abstiegs- und Niedergangsnarrativen gut erkennen. Für alle drei Felder lässt sich aber auch eine Agenda entwickeln, um die Probleme lösungsorientiert und vorwärtsgewandt anzugehen. Gewiss werden diese Vorschläge nicht unumstritten sein, aber eine positiv ausgerichtete und auf rationalen Begründungen fußende Diskussion könnte in einer Situation, in der von medialer Empörung getriebene Kompromisslosigkeit und negative Emotionalisierung die Debatten bestimmen, schon viel helfen.
1. Der Verlust der Zukunft: eine Bestandsaufnahme
Wie der Glaube an den Fortschritt der Angst vor dem Abstieg wich
Die Linke redet vom Abstieg, die Rechte vom Niedergang, und die politische Mitte, nach wie vor die größte politische Gruppe, traut sich kaum, dagegenzuhalten und geltend zu machen, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt auch in Zukunft gewährleistet sei und die deutsche Kultur der Prägestempel für die in diesem Land Lebenden bleiben werde. Abstiegs- und Niedergangsdiagnosen geben das Muster vor, nach dem zurzeit die Ereignisse und Entwicklungen in Deutschland und Europa sortiert und bewertet werden. Dabei ist letzten Endes gleichgültig, ob das Wahrnehmungsmuster nun auf Abstieg oder Niedergang geeicht ist: In beiden Fällen geht es bergab, und bis weit in die gesellschaftliche Mitte hinein haben viele das Gefühl, alles, was ihnen vor kurzem noch als fraglos und sicher erschien, sei ins Rutschen gekommen und der Boden unter ihren Füßen gerate mehr und mehr in Schräglage.
So wächst die alltägliche Besorgtheit der Menschen, sie verdichtet sich zur Sorge um die Zukunft, und aus der Sorge wird schließlich Angst: Angst vor der Zukunft, vor dem Neuen, vor dem Fremden. Diese Angst spielt Populisten in die Hände – vor allem aber verhindert sie, dass jene Probleme angegangen werden, die auf mittlere Sicht unseren Wohlstand und unsere Freiheit gefährden. Was Deutschland jetzt braucht, ist ein politischer und mentaler Neuanfang.
Die Zeiten der Sorglosigkeit sind ebenso vorbei wie jene Konstellationen, in denen die Politik den Menschen ein sorgenfreies Leben versprochen hat. Das ist es, was man während der letzten Jahre beobachten konnte – nicht nur in der deutschen Gesellschaft, wenngleich die Redewendung von der German angst vor allem die Deutschen in den Blick nimmt,[1] sondern in allen europäischen Ländern. Die Vorstellung von Abstieg und Niedergang hat inzwischen sogar die Amerikaner erreicht, die in der europäischen Wahrnehmung über lange Zeit für unerschütterlichen Optimismus standen. Das Vertrauen, die Zukunft werde in der Summe besser sein als die Vergangenheit, und die Zuversicht, Politik und Gesellschaft würden die auf sie zukommenden Herausforderungen schon meistern, sind dahin; stattdessen haben sich bei den einen Ängstlichkeit und Resignation, bei den anderen Missmut und Zorn breitgemacht. Besorgnis und Angst sind obendrein ungleich verteilt, und die Diagnose einer gespaltenen Gesellschaft lässt sich nicht zuletzt anhand ihrer Präsenz in unterschiedlichen sozialen Gruppen veranschaulichen.
Nun bezeichnen «Abstieg» und «Niedergang» als politische Diagnosebegriffe keineswegs dasselbe: «Abstieg» steht eher für soziale Entwicklungen und bezieht sich auf bestimmte Gruppen der Gesellschaft, für die sich inzwischen der Begriff des Prekariats eingebürgert hat.[2] Es handelt sich um einen Diagnosebegriff der politischen Linken. Mit «Niedergang» und «Verfall» dagegen sind soziokulturelle, aber auch machtpolitische Entwicklungen gemeint, und wo sie diagnostiziert werden, betreffen sie tendenziell alle Bürger eines Landes oder richten sich auf Europa in seiner Gesamtheit. Wo von Niedergang die Rede ist, wird Europa auch mit einem sonst kaum noch gebräuchlichen Begriff als «Abendland» bezeichnet.[3] Oswald Spenglers aus dem frühen 20. Jahrhundert stammende Formel vom «Untergang des Abendlandes» hat wieder einen prominenten Platz in der politischen Sprache erlangt.[4] Mit Niedergang, Verfall und Untergang argumentiert vor allem die politische Rechte, der es weniger um soziale Schichten als vielmehr um ethnische Kollektive geht.
Beiden Diagnosen ist gemeinsam, dass sie keinerlei Aussicht auf einen wie auch immer gearteten Fortschritt bieten, kein Zutrauen zur Zukunft und keine Zuversicht in die Leistungsfähigkeit der bestehenden politischen Ordnung vermitteln. Mehr noch: Beide Begriffe mitsamt den ihnen zugehörigen Wahrnehmungsmustern rufen zur Umkehr auf und stellen dabei die Vergangenheit als Vorbild und Orientierungsmarke heraus. Das «Damals» wird zum Wegweiser für das «Demnächst»: Damals, als es noch eine starke und selbstbewusste Arbeiterbewegung gab, die für ihre Ziele kämpfte und erreichte, dass der Sozialstaat weiter ausgebaut wurde – damals gab es noch Solidarität, und es wurde dafür gesorgt, dass die Gesellschaft nicht auseinanderbrach. Damals, als die Deutschen noch unter sich und nicht «Fremde im eigenen Land» waren – damals hatten sie noch Einfluss auf die ethnische Zusammensetzung des Volkes und waren die «Herren» über ihre eigene Kultur. Oder, auf beiden Seiten des politischen Spektrums zu hören: Damals, als dem Nationalstaat noch eine Nationalökonomie korrespondierte, auf die man, wenn man wollte, politisch Einfluss nehmen konnte – damals ließen sich Entwicklungen noch steuern, wohingegen die Wirtschaft sich seit der Globalisierung weitgehend der politischen Kontrolle entzogen hat, so dass ein buchstäblich entfesselter Kapitalismus entstanden ist.[5] Diese Art von Kapitalismuskritik wurde etwa laut, als sich Linke wie Rechte vehement gegen das transatlantische Handelsabkommen TTIP ausgesprochen haben.
Der Blick zurück, um sich der Zukunft zu vergewissern, ist für Konservative nicht neu; er gehört zur DNA des politischen Konservatismus. Seit seinen Anfängen, als sich in Reaktion auf die Französische Revolution ein bis dahin diffuser Traditionalismus zu einer politisch-programmatischen Bewegung formierte,[6] hat sich der Konservatismus als ein politisches Projekt zur Entschleunigung von Veränderungen begriffen. Dieses Projekt war keineswegs durchweg pessimistisch grundiert; immerhin beurteilte man die jeweilige Gegenwart ja so positiv, dass man sie für bewahrens- und verteidigenswert hielt. Ein Fortschrittsglaube, wie er sich seit der Aufklärung entwickelt hatte und bei den Liberalen sowie insbesondere in der politischen Linken beheimatet war, blieb dem Konservatismus zunächst weitgehend fremd. In der Orientierung am Bestehenden gerieten die Konservativen jedoch schon bald unter den Druck reaktionärer Gruppierungen, die nicht mehr die Gegenwart, sondern vergangene politische und soziale Ordnungen als das propagierten, was es wiederherzustellen galt.
Gegen diese Vorstellungswelt war die sozialdemokratische Formel gerichtet, die Reaktionäre würden «das Rad der Geschichte zurückdrehen» wollen.[7] Die Sozialdemokratie gebrauchte die Redewendung in dem Vertrauen, dass alle, die das versuchten, unweigerlich unter dem «Rad der Geschichte» zermalmt würden. Die Konservativen wiederum, so eine Variation dieser Formel, würden bloß ins «Rad der Geschichte» greifen, um es anzuhalten – aber das werde ihnen auf Dauer nicht gelingen. Solange sich die Fortschrittlichen mit dem Gang der Geschichte verbündet wussten, vermochten weder Konservative noch Reaktionäre ihr politisches Selbstvertrauen zu erschüttern. Sie waren sich sicher, «die Geschichte» in Gestalt des sich in ihr vollziehenden Fortschritts auf ihrer Seite zu haben. Der Fortschrittsglaube war die entscheidende ideologiepolitische Ressource einer Linken, die sich selbst in der Tradition der Aufklärung sah.[8]
Dem reaktionären Flügel der Konservativen standen die Liberal-Konservativen gegenüber, die nicht grundsätzlich gegen den Fortschritt waren, für das Verhältnis von Bestehendem und Veränderung aber eine Beweislastumkehrung forderten: Gegen den Glauben, das Zukünftige sei grundsätzlich besser als Gegenwart und Vergangenheit, setzten sie die Regel, wonach die politisch geforderte Veränderung zu beweisen habe, in der Summe besser zu sein als das Bestehende. Die Beweislast sollte nicht, wie es der Fortschrittsglaube wollte, beim Bestehenden liegen, sondern bei der Veränderung. Das war eine pragmatische Reaktion auf den Ansturm der Progressisten. Spätestens seit Mitte der 1960er Jahre hatte sich der politische Konservatismus in Deutschland auf diese pragmatische Position zurückgezogen und sich damit auf eine im Prinzip reformoffene Politik verständigt.[9] Der orthodoxe Konservatismus ist seitdem weitgehend aus dem politischen Raum verschwunden, um sich in gesellschaftlichen Nischen einzurichten.
Der langjährige CSU-Vorsitzende Franz Josef Strauß hat die neue Liaison von Konservatismus und Fortschritt damals auf die paradoxe Formel gebracht, die Konservativen marschierten an der Spitze des Fortschritts. Dabei dürfte er vor allem den technologischen und ökonomischen Fortschritt im Auge gehabt haben, dem er in Bayern alle Türen geöffnet hat. Strauß dürfte jedoch bewusst gewesen sein, dass der ökonomische Fortschritt gesellschaftliche Veränderungen nach sich zog, die schwerlich mit einem strikt konservativen Weltbild zusammenpassten. Diese Form des Konservatismus vertraute indes darauf, dass die lebensweltlichen Gepflogenheiten der Menschen hinreichend Selbstbehauptungskraft gegen den Sog der Veränderung haben würden. Dabei sollten ihnen die Parteien der «bürgerlichen Mitte» beistehen. «Laptop und Lederhose» wurde in Bayern zur dafür einschlägigen Formel.
Die schwindende Bindekraft von Volksparteien
Konservative, so lässt sich festhalten, blicken in Gegenwart und Vergangenheit, wenn sie nach Orientierung suchen – aber auf der politischen Bühne Deutschlands hat es seit Jahrzehnten nur noch wenige Konservative in diesem Sinn gegeben. In ihrer überwiegenden Mehrheit hingen die sich als konservativ bezeichnenden Politiker einer modifizierten Vorstellung vom Fortschritt an. Dass die Menschen es in Zukunft besser haben würden als in der Vergangenheit, wurde zu einem Wahlversprechen auch der konservativen Parteien. Die Orientierung am Bestehenden beziehungsweise an der Vergangenheit ist dabei durch den Verweis auf Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft als Markenkern des politischen Konservatismus abgelöst worden. Leistung wurde als Triebkraft des Fortschritts verstanden, und Fortschritt wurde weithin mit wachsendem Wohlstand identifiziert. Dieser Sichtweise hat sich auch die Sozialdemokratie schrittweise angenähert, am weitesten mit der Agenda 2010 in der zweiten Amtszeit Gerhard Schröders als Kanzler. So haben sich die politischen Koordinaten verändert: Die Konservativen haben sich auf den Glauben an den Fortschritt eingelassen, die Sozialdemokraten auf dessen restriktive Bindung an wirtschaftliche Leistung. Da war es nur konsequent, wenn beide, die zuvor politische Alternativen dargestellt hatten, miteinander über längere Zeit koalieren mussten.[1]
Von nun an war der Fortschritt in der politischen Vorstellungswelt der Deutschen keine Gewissheit mehr, auf die man sich unbesehen verlassen konnte, sondern er musste Jahr für Jahr in Gestalt der Wirtschaftsbilanz erarbeitet werden. Der Fortschritt geriet damit unter Stress. Wohlgemerkt: Das Wahrnehmungsmuster hatte sich verändert, nicht die Realität, denn natürlich hatten Wohlstandszuwächse schon immer erarbeitet werden müssen. Doch was vorher als selbstverständlich angesehen wurde, fand nun unter erheblichem Druck statt. Dieser Stress war im Wesentlichen die Folge eines wachsenden Wissens um die internationale Konkurrenz, der gegenüber man stets aufs Neue «die Nase vorn haben» musste, um im internationalen Vergleich die Spitzenposition zu halten. Auch das war im Prinzip nicht neu, aber indem man es jetzt ständig betonte, wurde aus einer Selbstverständlichkeit eine permanente Belastung. Es kam zu einer nachhaltigen Erosion des Zukunftsvertrauens und einem allmählichen Schwinden des Glaubens an den Fortschritt – jedenfalls erfuhr man den Fortschritt nicht mehr als eine unterstützende Kraft, sondern zunehmend als etwas, dem man sich stellen musste und dem man zu genügen hatte. Damit haben die Parteien der politischen Mitte ihre wichtigste Leiterzählung verloren; seitdem irren sie weithin ziellos durch die politische Landschaft. Die Christdemokaten haben das insgesamt besser verkraftet als die Sozialdemokraten, weil sie immer noch den Glauben aktivieren können, das Bestehende sei ohnehin besser als eine ungewisse Zukunft, die nur vom Fortschrittsglauben rosarot beleuchtet werde. Für die Sozialdemokratie hingegen wuchs sich der Verlust des Fortschrittsglaubens zur folgenreichen Verstümmelung aus.
Der Verlust ihres Zentralnarrativs ließ die Bindekraft der Volksparteien schwinden. Der Verweis auf den beständigen Fortschritt als Wohlstandszuwachs hatte die Stammwählerschaft bei der Stange gehalten. Das zeigt sich bei der Sozialdemokratie um einiges deutlicher als bei den Christdemokraten. Letztere sind, wie erwähnt, mit dem Fortschrittsglauben eine eher pragmatische Liaison eingegangen, während für die Sozialdemokratie das Vertrauen in einen kontinuierlichen Fortschritt, dem man politisch nur assistieren musste, geradezu ein Lebenselixier war. Die Unwiderstehlichkeit des Fortschritts und der soziale Aufstieg der Arbeiterklasse waren dabei aufs engste miteinander verbunden. Konkret hieß das: materielle Besserstellung, höhere Beteiligung am Volksvermögen und politische Gleichberechtigung der Arbeiterschaft. Diese Fortschrittsvorstellung war zuvor die Leitidee des aufsteigenden Bürgertums, und von diesem hat die Arbeiterbewegung sie übernommen. Solange das Vertrauen in den Fortschritt plausibel war, weil man ihn «am eigenen Leib» erfahren konnte, befand sich auch die Sozialdemokratie im Aufstieg. Als das Wachstum der Arbeiterbewegung dann seinen Zenit erreicht hatte, dehnte die SPD ihr Aufstiegsversprechen auf das Kleinbürgertum in seiner Gesamtheit aus. Danach war sie keine Klassenpartei mehr, sondern wurde zur zweiten großen Volkspartei der Bundesrepublik. Die Sozialdemokratie war damit zum Sachwalter und Interessenvertreter der unteren Mitte geworden.
Doch dann begann die Gewissheit eines sich kontinuierlich fortsetzenden Aufstiegs in der unteren Mitte zu schwinden. Die Hochzeit der Industrialisierung ging zu Ende, und mit dem Wachstum des Dienstleistungssektors kam es sehr viel häufiger zu individuellen Aufstiegen, aber auch Abstiegen. Überdies setzte mit der teilweisen Ablösung der Industrie- durch die Dienstleistungsgesellschaft eine Spreizung der Einkommen ein, die sich nur schwerlich mit dem Vertrauen in einen kontinuierlichen Fortschritt vereinbaren ließ. Als in Reaktion auf den Prozess der Deindustrialisierung insbesondere in Ostdeutschland, wo sie nach der Wiedervereinigung tatsächlich dramatische Züge annahm, Teile der Arbeiterschaft politisch rechts wählten, weil sie hofften, so den drohenden sozialen Abstieg aufhalten zu können, begann auch der Abstieg der SPD.[2] Das hatte es in der Schlussphase der Weimarer Republik schon einmal gegeben, und die Erinnerung an die Folgen dessen sorgte dafür, dass sich die Hinwendung der Arbeiterschaft sowie kleinbürgerlicher Kreise zur politischen Rechten beziehungsweise zum Rechtspopulismus in Deutschland sehr viel langsamer vollzog als in anderen europäischen Ländern oder den USA.[3]
Zeitweilig gab es in Deutschland so etwas wie eine Imprägnierung der unteren Mitte und vor allem der Arbeiterschaft gegen die Versuchung, sich unter dem Eindruck drohenden Abstiegs politisch nach rechts zu bewegen,[4] und diese Imprägnierung resultierte aus dem Blick zurück auf das Ende der Weimarer Republik. Das war jedoch ein Sonderfall. Im Prinzip war in den westeuropäischen Demokratien (und auch in den USA) das Vertrauen in einen kontinuierlichen Fortschritt als Garant kleiner, aber zuverlässiger Wohlstandszuwächse die zentrale Barriere gegen die einfachen Antworten und suggestiven Versprechungen des Populismus, ob der nun eher links oder rechts eingefärbt war. Solange man sich auf diesen Fortschritt verlassen beziehungsweise an ihn glauben konnte, war die überwiegende Mehrheit der Wahlbevölkerung gegen jede Art von Populismus immun. Die Erosion des Fortschrittsglaubens hat den Populismus erstarken lassen.
Dass der Verlust des Fortschrittsnarrativs für die Sozialdemokratie – nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa – folgenreicher war als für die sogenannten bürgerlichen Parteien, lässt sich an den Wahlergebnissen des zurückliegenden Jahrzehnts ablesen. Die SPD ist notorisch unsicher, in welche Richtung sie sich bewegen und wie sie ihre Reformpolitik ausrichten soll: im Hinblick auf gesellschaftliche Fehlentwicklungen infolge veränderter ökonomischer Konstellationen und die daraus erwachsenen neuen sozialen Herausforderungen, also durchaus auf weiteren Fortschritt, dessen Motor man sein will, der aber hart erarbeitet werden muss, wie das konzeptuell der Agenda 2010 zugrunde lag; oder an einer Rückkehr zum früheren Sozialstaat und dessen Versorgungsgarantien orientiert, wie sie die anschließende Abkehr von der Agenda-Politik und die Präferenz für weitergehende Umverteilungen zum Ziel hatten. Dementsprechend streiten in der deutschen Sozialdemokratie zwei Flügel miteinander, und einmal ist der eine, dann wieder der andere obenauf. Das Problem ist, dass man unter diesen Umständen nicht weiß, woran man bei den Sozialdemokraten ist.
Man kann diesen programmatischen Streit beschreiben als einen zwischen denen, die auf weiteren Fortschritt vertrauen und Politik als ein Mittel verstehen, um ihn zu moderieren und zu lenken, und jenen, die zu früheren Konstellationen zurückstreben, als die Sozialleistungen des Staates noch nicht an bestimmte Voraussetzungen geknüpft waren. Letztere stellen den sozialen Abstieg von Teilen der klassischen Arbeiterschaft, den Anstieg prekärer Beschäftigungsverhältnisse und die Ausweitung des Niedriglohnsektors in den Mittelpunkt ihrer Lagebeschreibung, während Erstere auf die Chancen setzen, die mit dem ökonomischen Wandel auch für die untere Hälfte der Gesellschaft verbunden sind. Man muss diese Chancen freilich nutzen oder nutzen können, und die Wahrnehmung von Chancen erfolgt inzwischen überwiegend individuell und nicht mehr im Kollektiv einer Schicht oder Klasse. So schwankt die Sozialdemokratie zwischen eingeschränktem Fortschrittsvertrauen und politischer Rückwärtsorientierung.[5]
Hinter diesen Widersprüchen steht nicht nur eine programmatische Konfusion, sondern auch ein für die Sozialdemokratie existenzielles Dilemma: Die tatsächlichen Veränderungen und die Interessen der klassischen Arbeiterschaft lassen sich nicht mehr auf denselben Nenner bringen, und infolgedessen kann die Sozialdemokratie das Fortschrittsnarrativ, das sie früher stark gemacht hat, kaum noch ins Spiel bringen, ohne dass dies in einem performativen Selbstwiderspruch endet. Das Versprechen, den sozialen Abstieg von Teilen der Gesellschaft aufzuhalten, ist kein Ersatz für die Vorstellung vom kollektiven Aufstieg ganzer sozialer Schichten. Das ist der Hauptgrund für den kontinuierlichen Niedergang der Sozialdemokratie während des letzten Jahrzehnts, in Deutschland wie in Europa.
Vor drei Jahrzehnten bereits hat Ralf Dahrendorf das «Ende des sozialdemokratischen Jahrhunderts» vorausgesagt, wobei er sich freilich auf eine andere Begründung als den Verlust des Fortschrittsnarrativs gestützt hat. Dahrendorf war der Überzeugung, dass die Sozialdemokratie sich durch den Erfolg ihrer eigenen Politik überflüssig gemacht habe.[6] Viele nämlich, die auf Grundlage der von Sozialdemokraten durchgesetzten Reformen einen sozialen Aufstieg geschafft hätten, seien in Positionen aufgestiegen, in denen es für sie nicht mehr opportun erschien, sozialdemokratisch zu wählen oder sich gar zu engagieren. Die meisten von denen, die den sozialen Aufstieg nicht geschafft hätten, sondern in den untersten Bereich der Gesellschaft abgerutscht seien, verfielen dagegen in politische Apathie und würden nicht mehr wählen, so dass auch von ihnen keine politische Unterstützung zu erwarten sei. Dahrendorfs Diagnose erwies sich jedoch als verfrüht, denn im Übergang vom 20. zum 21. Jahrhundert, in der Ära von Tony Blair und Gerhard Schröder, erlebte die Sozialdemokratie – teilweise im Bündnis mit ökologischen Parteien – noch einmal einen Aufschwung, in dessen Folge sie für ein Jahrzehnt die politische Agenda in Europa bestimmte. Obendrein ist zu fragen, ob das Erfordernis, den sozialen Aufstieg politisch zu begleiten und zu unterstützen, tatsächlich hinfällig geworden ist oder ob sich nur die Art des Aufstiegs – eher individuell als im Kollektiv – gewandelt hat. Die entscheidende Veränderung wäre dann nicht, dass sich die Sozialdemokratie durch ihren Erfolg überflüssig gemacht hat, sondern dass ihr die enge Bindung an kollektive Aufstiege zum Verhängnis geworden ist. Die nämlich finden seit längerem nicht mehr statt. Die politische Herausforderung besteht somit in der Neukonturierung von Zukunftsvertrauen unter den veränderten Konstellationen postindustrieller Gesellschaften. Davon wird in den nachfolgenden Kapiteln ausführlicher die Rede sein.
Was für die Sozialdemokratie der Verlust des Vertrauens in den Aufstieg ganzer Gesellschaftsschichten ist, ist für die Christdemokraten das Schwinden der Erwartung, der technologische und ökonomische Fortschritt werde gegenüber gesellschaftlichen Lebensmustern und kulturellen Leitbildern neutral bleiben. Das ist schon lange nicht mehr der Fall. Das Zusammenleben in Familien, die aus einem Mann und einer vorzugsweise nicht berufstätigen Frau sowie ihren gemeinsamen Kindern bestehen, ist nicht länger die vorherrschende Lebensform unserer Gesellschaft und kann kaum noch als sozial prägende Norm angesehen werden. Ehen haben nicht mehr die Stabilität, die ihnen frühere Sozialverhältnisse garantierten, als Frauen schon aus ökonomischen Gründen keine Scheidung anstreben konnten. Patchworkfamilien und Lebensabschnittspartnerschaften sind zumindest teilweise an ihre Stelle getreten. Homosexuelle Paare haben weitgehend die gleiche soziale Anerkennung wie heterosexuelle Paare erlangt, auch wenn sie nach wie vor oft auf homophobe Ablehnung stoßen. Die kirchlich-religiösen Bindungen der Menschen sind kontinuierlich im Schwinden begriffen, und das hat zu einer Diversifizierung der gesellschaftlichen Wertvorstellungen geführt. Grundsätzlich ist die Orientierung an Autoritäten geschwunden.
Währenddessen hat sich die Mitgliederzahl der beiden großen Volksparteien halbiert, was ihre politische Bindekraft weiter geschwächt hat. Die Christdemokraten haben im Verlauf der letzten zwei Jahrzehnte darauf mit einer Veränderung ihrer Leitvorstellungen reagiert; sie haben dadurch neue Wähler in der politischen Mitte gewonnen, aber bei einem Teil ihrer Stammwählerschaft an Attraktivität verloren. Wer weiterhin einem konservativen Gesellschaftsbild verhaftet ist, hat Mühe, diese Veränderungen mitzutragen. Erst recht gilt dies für das Auftreten der CDU als Sachwalterin der nationalen Identität, die mit ihrem traditionellen Gesellschaftsbild verbunden war. Indem die Partei die politische Mitte fest besetzt hat und dabei weit in die untere Mittelschichtklientel der SPD eingedrungen ist, hat sie am rechten Rand und im konservativen Milieu Wähler verloren. Aber der Ratschlag, doch wieder in die alten Positionen zurückzukehren, ist wenig hilfreich, da die CDU dann die in der Mitte Dazugewonnenen wieder verlieren würde – und wahrscheinlich wären das mehr, als sie durch die Rechtsverschiebung zurückgewinnen kann. Das Hauptproblem beider Volksparteien, der Christdemokraten wie der Sozialdemokraten, besteht darin, dass sich die Interessenlage, die Wertpräferenzen und die Zukunftsvorstellungen der ihnen traditionell verbundenen Wählerklientele so stark diversifiziert haben, dass sie nicht länger unter einen programmatischen Hut gebracht werden können. Die programmatisch-organisatorische Ausdifferenzierung des klassisch sozialdemokratischen Lagers durch die Etablierung der Grünen und später der Linkspartei hat sich inzwischen mit der Konsolidierung der AfD als Vertreterin nationalistischer bis rechtsradikaler Gesinnungen auf der politischen Rechten wiederholt. Allenthalben ist deswegen vom Niedergang der Volksparteien die Rede.[7]
Diffuse Zukunftsskepsis und ihre Folgen
Der sich ausbreitende Zweifel, ob die jüngsten Veränderungen noch als Fortschritt zu beschreiben sind – und zwar als Fortschritt in materieller wie in wertebezogener Hinsicht –, hat dazu geführt, dass die von Abstieg und Niedergang Sprechenden inzwischen das Debattenklima bestimmen. Sie haben die diskursive Hegemonie über das vorherrschende soziopolitische Wahrnehmungsmuster erlangt. Eine verunsicherte Mitte ist den Diagnosen des Abstiegs und Niedergangs nicht entschieden entgegengetreten, sondern hat darauf abwartend und zögerlich reagiert. Sie zeigt darin, dass sie sich ihrer Zukunft nicht mehr sicher ist.[1]
Bemerkenswert ist, dass die meisten verfügbaren Daten die Krisenszenarien des Abstiegs oder Niedergangs keineswegs bestätigen[2] – jedenfalls solange sie nicht auf bestimmte Gruppen, sondern auf das Land in seiner Gesamtheit bezogen sind. Der Widerspruch zwischen vorherrschender Stimmung und tatsächlicher Lage zeigt sich auch darin, dass die meisten der Befragten ihre persönliche Situation und die entsprechenden Zukunftsaussichten eher positiv beurteilen, während sie gleichzeitig die allgemeine Lage des Landes in düsteren Farben malen.[3] Diese Diskrepanz ist die politische Einbruchstelle für rechtspopulistische Bewegungen, deren Parolen inzwischen bis weit in die bürgerliche Mitte hinein Resonanz finden. Gleichzeitig tragen die in der politischen Linken verbreiteten Diagnosen des Abstiegs breiter sozialer Schichten und die Suche nach Möglichkeiten des Gegenhandelns zur weiteren Zersplitterung der Linken bei. So haben die rechtspopulistischen Akteure in der Öffentlichkeit eine kommunikative Dominanz erlangt, die deutlich größer ist als ihre tatsächliche Unterstützung durch die Bevölkerung. Davon unbenommen sind indes Status- und Abstiegsängste, die – vor allem in den ostdeutschen Bundesländern – auf zurückliegende biographische Erfahrungen zurückgehen, und die in bestimmten Branchen keineswegs unbegründete Befürchtung, dass Arbeitsplätze in großem Stil ins Ausland verlagert werden oder aber in den nächsten Jahren der Digitalisierung zum Opfer fallen.[4] Damit lässt sich zwar eine gespaltene Stimmungslage erklären, nicht jedoch der vorherrschende Grundton von Abstieg und Niedergang.
Wenn nun Vorstellungen von Abstieg und Niedergang die gesellschaftliche Selbstwahrnehmung prägen – welche Folgen hat das für die Möglichkeiten des Regierens oder, präziser: für die Fähigkeit der Politik, die für Abstieg und Niedergang als ursächlich ausgemachten Probleme zu bearbeiten? Auf längere Sicht angelegte Reformen beruhen auf Zuversicht und Zukunftsvertrauen. Wer sich auf den mühseligen Weg von Reformen begibt, tut dies in der Überzeugung, damit Voraussetzungen zu schaffen, um gegenwärtigen und künftigen Herausforderungen gewachsen zu sein. Obendrein benötigen Reformen eine größere Zeitspanne, bis die von ihnen eingeleiteten Maßnahmen Wirkung zeigen. In Abstiegs- und Niedergangsdiagnosen wird indes in Zweifel gezogen, dass genügend Zeit vorhanden ist, um die Probleme schrittweise bearbeiten zu können. Wo diese Überzeugung schwindet, verkümmern auch die Reformanstrengungen. An ihre Stelle treten Visionen des Untergangs, der nur noch durch eine politisch radikale Kehrtwendung verhinderbar sein soll. Wenn das Gestell der Reformpolitik in seiner Gesamtheit verworfen wird, ist es sinnlos, an seinen Stellschrauben zu drehen.
Wo sich Abstiegsängste und Niedergangsvorstellungen verbreiten, gerät die Politik unter Zeitdruck, der umso dramatischer ist, je bedrohlicher die Zukunft ausgemalt wird. Die Politik soll schnell und umfassend reagieren, für langwierige und kleinteilige Reformen sei keine Zeit, lautet die Forderung, und erst recht sei keine Zeit für die Suche nach Kompromissen zwischen unterschiedlichen Interessen und Wertungen. Kompromisse werden unter dem Druck solcher Szenarien als «faule» Kompromisse begriffen. Mit der Forderung nach schnellem und entschlossenem Handeln ist fast immer der Ruf nach einem «starken Mann» verbunden, der die radikale Kehrtwendung durchsetzen soll. Aus der Dominanz von Niedergangs- und Untergangsvorstellungen erwächst eine Politik der Panik. Schnelles Handeln und einsame Akteure lässt das politische System der parlamentarischen Demokratie aber nicht oder kaum zu. Die parlamentarische Demokratie ist eine Ordnung der Entschleunigung, die sich am Imperativ der Fehlervermeidung orientiert.[5]
Demgemäß überschütten die Abstiegs- und Niedergangsdiagnostiker inzwischen fast jeden Reformvorschlag der etablierten Parteien mit Hohn und Spott. Reformen werden als Täuschungsmanöver denunziert: Sie täuschten Handeln vor, ohne wirkliches Handeln zu sein. Die Zurückweisung von Reformen mit dem Vorwurf, dass sie keine angemessene Antwort auf die von den Populisten ausgemachten Herausforderungen seien, ist bei der Vorstellung vom Niedergang häufiger anzutreffen als bei der vom Abstieg, wie überhaupt dort, wo am Ende der Untergang steht, sich alles dramatischer und radikaler darstellt, als wenn es «nur» um den Abstieg geht. Im Dramatisierungswettlauf wird der Linkspopulismus vom Rechtspopulismus deswegen regelmäßig überboten.[6] Beiden Strömungen des Populismus ist jedoch dasselbe Eskalationsschema eigen: Was als Kritik am politischen Personal und an dessen Arbeit beginnt, steigert sich zum Vorwurf der moralischen Verkommenheit und Korruption und wird unter dem Einfluss von Abstiegs- und Niedergangsängsten nach einiger Zeit zur grundsätzlichen Systemkritik. Das entspricht der Logik populistischer Narrative: Die Dämonisierung der Probleme führt dazu, dass Reformen nicht mehr als adäquate Reaktion erscheinen.
Das Wahrnehmungsmuster von Abstieg oder Niedergang läuft freilich nicht zwangsläufig auf eine Radikalisierung der politischen Positionen und die damit verbundene Konfliktverschärfung hinaus. Eine alternative Reaktionsform ist die melancholische Resignation, wie Theodor Fontane sie in der Gestalt des Dubslav von Stechlin dargestellt hat. Dubslav, ein älterer märkischer Junker und Gutsherr im fiktiven Dorf Stechlin, ist vielerlei: Anhänger einer autokratischen Ordnung, von der er weiß, dass ihre Zeit vorüber ist; nonkonformistischer Konservativer, der sich auf keine zum Machtkampf entschlossene Parteipolitik einlassen will, und schließlich liberaler Pragmatiker und fürsorglicher Patriarch, dem jede Prinzipienreiterei zuwider ist.[7] Vom Grundsatz her hält Dubslav Reformen im Deutschen Reich für dringend erforderlich, nur bezweifelt er, dass sie von Erfolg gekrönt sein werden. Mit dem alten Barby diskutiert er, welche Folgen ein längeres Leben Friedrichs III. – er war im Jahre 1888 für nur neunundneunzig Tage Kaiser – für Deutschland gehabt hätte. Barby meint, Friedrich hätte Deutschland verändert, ohne dass er in die hektische Betriebsamkeit seines Sohnes und Nachfolgers Wilhelm II. verfallen wäre. Dubslav wendet dagegen ein, Friedrich wäre dabei gescheitert, und zwar keineswegs bloß an seinen Feinden, sondern auch an seinen Freunden. Der alte Stechlin hat innerlich in den Abstieg von seinesgleichen eingewilligt; er ahnt, dass eine neue Zeit heraufkommt, in der alles anders sein wird als früher, aber er bezweifelt, dass diese Zeit besser sein wird als die alte. Das alles veranlasst ihn nicht zu aufgeregter Betriebsamkeit; er verarbeitet Abstieg und Niedergang in kontemplativer Gelassenheit. Das von Dubslav gepflegte unterhaltsame Geplauder über die kleine wie die große Politik wird zum Modus der Angstbewältigung.[8] Es gibt auch heute solche Konservative, aber sie sind selten, und in der Politik findet man sie so gut wie nie.
Den Gegentypus zu resignativer Melancholie bilden jene, die sich selbst im Anschluss an Armin Mohler als «konservative Revolutionäre» verstehen; als solche also, die erst nach einer radikalen Veränderung der bestehenden Verhältnisse oder einer entschlossenen Umkehrung dessen, was sie als politischen Niedergang wahrnehmen, einigermaßen beruhigt konservativ sein können.[9] Ein Ankommen im Modus des Bewahrens ist für sie freilich kaum möglich, weil immer, wenn dieser Zustand erreicht ist, sich sogleich die Furcht vor einer neuen Abwärtsbewegung einstellt. Deswegen unternehmen sie in einer Mischung aus Untergangsalarmismus und Umsturzphantasien alles, um den von ihnen behaupteten Niedergang aufzuhalten. Die «konservativen Revolutionäre» sind deswegen hauptsächlich revolutionär, während sie kaum dazu kommen, konservativ zu werden.[10] Revolutionär sind sie freilich nicht in dem landläufigen Sinn, dass ihnen der Fortschritt zu langsam ist und sie ihn deswegen revolutionär beschleunigen wollen, sondern es geht ihnen darum, die vorherrschende Entwicklung umzukehren und in eine reaktionäre Richtung zu lenken. Während die Abstiegsdiagnostiker – im Prinzip zumindest – durchaus zur Ruhe kommen können (sei es infolge einer zeitweise günstigen ökonomischen Lage, sei es nach Durchsetzung größerer Umverteilungsmaßnahmen), ist das bei den Niedergangs- und Verfallsdiagnostikern nicht der Fall. Sie sind in einen endlosen Kampf gegen die aus ihrer Sicht verhängnisvollen Zeitläufte verstrickt.
Das Ende einer Epoche kollektiver Aufstiege und die Entstehung des Populismus
Die Diagnosen von Abstieg und Niedergang stellen in jedem Fall eine Vereinfachung und Vereinheitlichung der jüngeren Entwicklungen in Deutschland dar. Soziologische und politikwissenschaftliche Untersuchungen liefern ein zu differenziertes Bild, als dass es in der Vorstellung von einer generellen Abwärtsbewegung der Gesellschaft zusammengefasst werden könnte. Die Soziologie konstatiert durchaus Abstiege sozialer Schichten, nur handelt es sich dabei weniger um Abstiege absoluter Art, die in Armut und Not enden, sondern fast immer um relative Abstiege, die sich erst im Vergleich zur allgemeinen Einkommens- und Wohlstandsentwicklung oder in einer notorischen Sorge und Angst um die eigene Zukunft und die der Kinder zeigen. Dem steht im Gesamtbild der Gesellschaft der Aufstieg anderer gesellschaftlicher Gruppen gegenüber. Was es seit längerem jedoch nicht mehr gibt, ist die Erwartung, dass es jedem, gleich, welcher sozialen Schicht er angehört, in einigen Jahren besser gehen wird als derzeit. Die frühere allgemeine Aufstiegserwartung war durch die Ausnahmesituation einer Nachkriegsgesellschaft geprägt, die in dieser Form nicht wiederkehren wird.[1]
Die Zeit des kollektiven Aufstiegs endete in Westdeutschland in den 1970er Jahren, als der Boom des Wirtschaftswunders auslief und sich eine allgemeine Abschwächung der Wirtschaftsentwicklung mit strukturellen Veränderungen der Industrieproduktion bemerkbar machte. Aber das gemeinsame Gedächtnis der Deutschen blieb auch danach durch die Erinnerung des kollektiven Aufstiegs geprägt, zumal das Wirtschaftswunder in Ermangelung genuin politischer Narrative zum zentralen Gründungsmythos der alten Bundesrepublik wurde.[2]Die DDR war ebenfalls durch ein kollektives Fortschritts- und Aufstiegsnarrativ geprägt, nur dass dieser Fortschritt im Sinne allgemeiner Wohlfahrt in eine noch zu erreichende Zukunft verlegt wurde. Auch in der DDR ging man aber davon aus, dass man schon vieles erreicht habe und es zukünftig allen besser gehen werde. Ein zeitlich begrenzter Erfahrungsraum hat insofern für lange Zeit den Erwartungshorizont der Deutschen bestimmt.[3] An seine Stelle ist mittlerweile die Normalsituation einer postindustriellen Gesellschaft getreten, in der es gleichzeitig soziale Aufstiege und soziale Abstiege gibt, so dass überwiegend individuelle Auf- und Abstiege zu beobachten sind, während kollektive Aufstiege ganzer Schichten kaum noch vorkommen. Per saldo ist eine materiell positive Entwicklung zu konstatieren, deren Effekte jedoch nicht bei allen Gesellschaftsmitgliedern gleichermaßen ankommen. Obendrein ist die Erfahrung materiellen Fortschritts nicht länger durch die eines normativen Fortschritts gedeckt; gesollter und tatsächlicher Fortschritt sind seit der ökologischen Wende nicht mehr kongruent. Die Folge ist, dass materielle Verbesserungen seltener als solche wahrgenommen werden.
Der jüngste Streit in der deutschen Gesellschaft dreht sich im Wesentlichen um die Frage, ob die neuen Herausforderungen mit systemimmanenten Mitteln zu bewältigen sind, also im Rahmen einer parlamentarischen Demokratie und ihrer Institutionen sowie von dem politischen Personal, wie es in einer Parteiendemokratie ausgewählt wird – oder ob es dazu einer grundlegenden Veränderung bedarf, die bei der politischen Klasse[4] beginnt und vor den Institutionen der repräsentativen Demokratie nicht haltmacht. Dabei wird gegen die Leitvorstellung einer politischen Mitte, wie sie für die repräsentativ-parlamentarische Demokratie typisch ist, der Begriff des Volkes als konträre Legitimationsinstanz der direkten Demokratie gesetzt, und zwar von links wie von rechts.[5] Die auf die politische Mitte ausgerichtete Ordnung dreht sich um die Vorstellung eines kompetenten Bürgers,[6] also einer Person, die politisch langfristig denkt, Optionen rational gegeneinander abwägt und an Kompromissen zwischen widerstreitenden Interessen und Präferenzen orientiert ist; die entgegengesetzte Begrifflichkeit des Volkes hebt dagegen auf die voluntative Dimension von Politik ab, den sogenannten Volkswillen, der mit der Erwartung von schnellen sowie eindeutigen und endgültigen Entscheidungen verbunden ist. Populistische Bewegungen erheben für sich den Anspruch, den Volkswillen zu verkörpern: Sowohl bei der Occupy-Bewegung als auch bei Pegida war zu hören, man stehe für 99 Prozent der Bevölkerung, also für das Volk.[7]
Der Aufstieg populistischer Bewegungen in Europa und den USA[8] begann mit einer Kritik an der politischen Klasse, zunächst an deren materiellen Privilegien, dann an ihrer moralischen Integrität, schließlich an ihrer Problembearbeitungsfähigkeit. Diese Kritik wuchs sich relativ schnell zu einer Kritik an der gesamten politischen Ordnung aus – anfänglich, weil diese Ordnung eine bestimmte politische Klasse hervorgebracht habe, dann aber auch, weil sie Politikergebnisse produzierte, die seitens der Populisten und ihrer Anhänger grundsätzlich abgelehnt wurden, und schließlich wurde auch die Entschleunigung von Entscheidungen zwecks intensiverer Reflexion ihrer Voraussetzungen und Folgen kritisiert. Inzwischen hat ein Radikalisierungsprozess stattgefunden, bei dem ganz offen die Systemfrage gestellt wird – auch aufseiten der politischen Linken, dort freilich auf den äußersten Rand und im Wesentlichen auf die Szene der sogenannten Autonomen beschränkt, vor allem aber von rechts, und von hier mit ständig wachsender Wucht. Auch das spricht dafür, dass die Dynamik eines sich radikalisierenden Populismus eher die politische Rechte als die Linke begünstigt.[9]
In beiden Fällen bilden Abstiegs- und Niedergangsvorstellungen den Legitimationshintergrund der Kritik, und sie generieren zugleich den Zeitdruck, auf den populistische Bewegungen verweisen, wenn es darum geht, die von ihnen dramatisierte Abwärtsbewegung aufzuhalten. Erhebliche Teile dieser populistischen Bewegungen vertrauen nicht auf die institutionell vorgesehenen Einfluss- und Korrekturmöglichkeiten der Wahlen und wollen auch nicht darauf warten, dass in solchen Wahlen Macht und Einfluss neu verteilt werden. Stattdessen setzen sie unter der Parole, sie verträten den wahren Volkswillen, die gewählten Politiker unter Druck, um sie zu einer augenblicklichen Kursänderung zu zwingen oder aus ihren Ämtern zu vertreiben. Die Abstiegs- und Niedergangsszenarien, die in links- wie in rechtspopulistischen Kreisen zirkulieren, beschleunigen und verstärken die Kritik an einzelnen Maßnahmen zur Systemkritik, die radikale Mittel unverzichtbar mache.
An den populistischen Bewegungen in Europa und den USA lässt sich das Nebeneinander von Abstiegs- und Niedergangsängsten sowie deren wechselseitige Verstärkung gut beobachten. In Europa stand am Anfang dieser Entwicklung die sogenannte Eurokrise, die, befeuert durch die 2008 von den USA ausgegangene globale Finanzkrise, im Wesentlichen eine Überschuldungskrise der südlichen EU-Staaten war (und immer noch ist). Die Überschuldung der Staaten des europäischen Südens wurde verstärkt, weil auf die Finanz- eine Wirtschaftskrise folgte, die vor allem in den überschuldeten Ländern zu einem starken Anstieg der Arbeitslosigkeit führte. Schon bald war klar, dass das lange Zeit im Fokus stehende Griechenland nicht aus eigener Kraft aus dieser Krise herauskommen würde, sondern auf die Hilfe der anderen Mitglieder der Eurozone angewiesen war – wenn es nicht zum Staatsbankrott und zum wirtschaftlichen Zusammenbruch des Landes kommen sollte. Mehr als zwei Jahrzehnte hatte Griechenland weit «über seine Verhältnisse gelebt». Als man sich die Leistungsfähigkeit von Wirtschaft und Staat genauer ansah, stieß man neben einer Reihe von Steuerprivilegien auf einen überdimensionierten und wenig effizienten Staatsapparat. Das Zusammentreffen von jährlich wachsenden Schulden, ineffizienter Verwaltung und einer wenig reformbereiten Politik führte dazu, dass in den Nettozahlerländern des Euroraums ein medial angefeuerter Widerstand gegen Hilfskredite für Griechenland entstand: Einige meinten, es handele sich bei dem Land um ein «Fass ohne Boden»; andere wollten nicht für die angebliche «Leichtlebigkeit» der Griechen aufkommen, während die Nettozahler, wie betont wurde, für ihren Lebensstandard hart arbeiten mussten; wieder andere meinten, man müsse an Griechenland ein politisches Exempel statuieren, um Nachahmungseffekte bei anderen Euroländern zu verhindern. Die Suche nach konkreten Hilfsmaßnahmen für das am Abgrund stehende Land wurde schon bald von einer populistischen Stimmungsmache begleitet, die das Fundament der Europäischen Union und des Euroraums ebenso in Frage stellte, wie das bei einer Dehnung der Verträge der Fall war, ohne die man Griechenland nicht helfen konnte.[10] Die europäische Politik verständigte sich schließlich auf eine konditionierte Hilfe: Kredite für Griechenland unter der Voraussetzung, dass das Land zu harten Reformen und einer restriktiven Finanzpolitik bereit war. Letzten Endes blieb Griechenland nichts anderes übrig, als sich diesen Bedingungen unter fortgesetztem Protest zu fügen.
Den Kritikern der «Griechenlandrettung» war das jedoch nicht genug; sie reagierten auf die europäischen Beschlüsse mit der Feststellung, die EU zerfalle, weil die Verträge, auf denen sie begründet sei, nicht eingehalten würden, und dieser Niedergang werde schon bald in einer fiskalischen Katastrophe enden.[11] Die Kontroversen um die «Griechenlandrettung» wurden in Deutschland zur Geburtsstunde der AfD, die abwechselnd dafür eintrat, dass Griechenland aus dem Euro austreten, Deutschland die Eurozone verlassen oder die Eurozone ganz aufgelöst werden solle.[12] Dass Griechenland aus dem Euro austreten solle, wurde auch von anderen Parteien vorgeschlagen, da man sich durchaus darüber streiten konnte, ob es sinnvoll und auf Dauer möglich war, ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und ihrer währungspolitischen Mentalität nach so unterschiedliche Länder wie die des europäischen Südens mit denen der Mitte und des Nordens in einer Währungszone zusammenzuhalten.[13] Populistisch daran war zunächst in erster Linie die Kommunikation dieses Vorschlags, die auf eine strikte Verweigerung jeder Hilfe hinauslief und dabei den Eindruck erweckte, diese Hilfe gehe ausschließlich zulasten der deutschen Steuerzahler. Dass es bei der «Griechenlandrettung» auch um die Absicherung deutscher und französischer Banken ging, also darum, den Zusammenbruch von Finanzinstituten zu verhindern, der zu einer wirtschaftlichen Depression in Europa hätte führen können, wurde dabei ebenso verschwiegen wie der Umstand, dass der infolge der Verschuldungskrise des europäischen Südens sehr niedrige Wechselkurs des Euros einer Konjunkturspritze für die deutsche Exportindustrie gleichkam, was einen kontinuierlichen Rückgang der Arbeitslosenrate in Deutschland zur Folge hatte. Dass all dies in der öffentlichen Debatte nicht oder nur am Rande erwähnt wurde, kann nicht allein der AfD angelastet werden, auch wenn sie der Hauptprofiteur dieser einseitigen Darstellung war. Aber es wäre die Aufgabe der anderen Parteien gewesen, darauf nachdrücklich hinzuweisen. Unerwähnt blieb auch, welche Folgen ein Zusammenbruch Griechenlands geopolitisch für die ohnehin labile Südostflanke Europas haben würde – ein Aspekt, der letzten Endes für die «Griechenlandrettung» den Ausschlag gegeben haben dürfte.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: