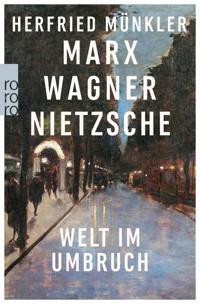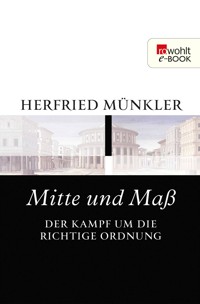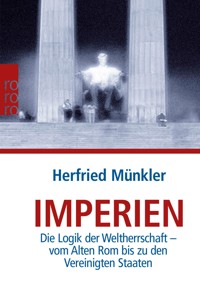Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: edition Körber-Stiftung
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Liegt die Zukunft Europas in deutscher Hand? Angesichts zahlreicher Krisen und schwindender Akzeptanz der Europäer für das gemeinsame Projekt ist die Frage nach der Rolle Deutschlands aktueller denn je. Einige Staaten fürchten dessen erneutes Erstarken; andere erwarten von ihm, seine Zurückhaltung endlich zugunsten einer klaren, furcht losen Haltung aufzugeben. Muss Deutschland mehr Führung wagen, um ein Auseinanderdriften Europas zu verhindern? Der renommierte Politikwissenschaftler Herfried Münkler kreist die neuralgischen Punkte der deutschen Politik ein, legt historische Bezüge offen und entwirft mit politischer Hellsichtigkeit eine Strategie für das größte Land inmitten des Kontinents. Ob es Deutschland gelingt, diese neue Rolle einer Macht in der Mitte nicht erneut zu missbrauchen, wird wesentlich davon abhängen, ob es sich aus seiner Komfortzone wagt und seine ökonomische, politische und kulturelle Macht zum Wohle Europas einsetzt. Nie zuvor standen die Zeichen dafür besser.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 208
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Einleitung
Dieses ist kein Buch über die Eurokrise und die Frage, wie ihr am besten beizukommen sei. Es ist auch kein Buch über die Brüsseler Bürokratie und ihre mitunter kleinkarierten Verordnungen, und ebenso wenig ist es ein Buch über das notorische Demokratiedefizit der Europäischen Union. Über all das ist in den letzten Jahren viel geklagt und geschrieben worden (u.a. Enzensberger 2011), und dem ist schwerlich etwas Neues hinzuzufügen. Hier soll es vielmehr um die inneren Verhältnisse der Europäischen Union gehen, um die Spannungen zwischen den Mitgliedern und die drohenden Spaltungen innerhalb der EU. Dabei ist, im Unterschied zu dem, was im Rückblick auf die europäische Geschichte zu erwarten wäre, nicht das Verhältnis zwischen Osten und Westen, sondern das zwischen Norden und Süden zum Problem geworden. Die Frage des Essays lautet also: Wie kann Europa zusammengehalten werden, und welche Aufgabe kommt dabei Deutschland als der Macht in der Mitte zu?
Aus einem Frontstaat des Kalten Krieges bzw., um genau zu sein: aus zwei Frontstaaten ist Deutschland im zurückliegenden Vierteljahrhundert zu einer Macht in der Mitte des EU-Raums geworden, zu einem Land, das erstmals in seiner Geschichte zu allen seinen Nachbarn freundschaftliche Beziehungen pflegt und in aller Ruhe einkassiert, was wir als »Friedensdividende« zu bezeichnen uns angewöhnt haben. Der Begriff allein zeigt, dass die politische Publizistik nach wie vor von einem Normal- oder Regelzustand ausgeht, in dem aufgrund offener oder latenter Spannungen zu einem der Nachbarn oder eben aufgrund einer allgemeinen und diffusen Wahrnehmung von Bedrohung in erheblichem Umfang Ressourcen für militärische Zwecke aufgewendet werden. Wo das nicht der Fall ist, fällt eine Extradividende an, die unmittelbar in die Wohlstandssteigerung eingeht und in der Regel unmittelbar konsumiert wird. In diesem Zustand befindet sich Deutschland seit mehr als zwei Jahrzehnten, und wir gehen wie selbstverständlich davon aus, dass das auch so bleiben wird. Dass diese Erwartung realisiert wird, hängt, so die nachfolgend entwickelte These, ganz entscheidend von der Macht in der Mitte ab. Ihr obliegt es, Europa zusammenzuhalten, den immer wieder neu auftretenden Zentrifugalkräften entgegenzuwirken, Interessendivergenzen abzubauen und Ausgleichsprozesse zu moderieren. Das ist eine Aufgabe, die von der Politik Weitsicht und Fingerspitzengefühl, mitunter auch Entschlossenheit, in der Regel aber große Geduld und Gelassenheit abverlangt. In der Politik werden immer wieder Fehler gemacht, aber die Macht in der Mitte ist der Akteur, der sich das am wenigsten leisten kann. Das ist eines der definitorischen Merkmale dessen, was hier als Macht in der Mitte bezeichnet wird: eine im Vergleich zu allen anderen Akteuren des politischen Raumes reduzierte Fehlertoleranz.
Macht in der Mitte ist also mehr als eine bloß geographische Bezeichnung; es ist eine politische Position, in der sich erhöhter Einfluss mit gesteigerter Verantwortung verbindet, in der ein Mehr an Macht mit einem Mehr an Verpflichtung zusammenkommt. Entgegen dem, was der Begriff »Friedensdividende« nahelegt, ist es also keine Position, in der man sich dauerhaft aufs Konsumieren der günstigen Lage im Raum und der glücklichen Umstände in der Zeit verlegen kann, sondern in der man unausgesetzt in die Aufrechterhaltung dieser Rahmenbedingungen investieren muss. Genau das ist der politischen Öffentlichkeit in Deutschland nicht hinreichend bewusst: In breiten Kreisen dieser Öffentlichkeit wird Mitte als etwas begriffen, das man in aller Ruhe genießen kann, und das tut man umso mehr, je stärker man sich aus den Problemen der Umgebung heraushält. Tatsächlich ist jedoch das Gegenteil der Fall: Die mit mangelnder Konkurrenzfähigkeit gepaarte Überschuldung der südlichen Länder Europas und das Erfordernis, dies zu ändern, um die Zentrifugalkräfte zu begrenzen und die Position Europas in der globalen Ökonomie zu behalten, haben dies ebenso sichtbar gemacht wie die Russland-Ukraine-Krise oder der Krieg in der Levante, mit denen die Europäer an ihrer Peripherie konfrontiert sind. Die Macht in der Mitte, so ein weiteres definitorisches Merkmal, muss permanente Anstrengungen unternehmen, um den politischen und wirtschaftlichen Raum, dessen Mitte sie ist, in der Balance zu halten und dem Einwandern von Krisen aus der Peripherie entgegenzuwirken. Was das heißt und wie das vonstattengehen kann, soll nachfolgend beschrieben und analysiert werden.
Dass die Bundesrepublik Deutschland die Position einer Macht in der Mitte im politisch verfassten Europa einnimmt, ist das Ergebnis von Veränderungen, die sich in den zwei zurückliegenden Jahrzehnten vollzogen haben, die aber selten einen solchen Ereignischarakter hatten, dass man sie sofort registriert hätte. Dazu gehört als Erstes die in zwei Beitrittsrunden erfolgte Osterweiterung der EU, in deren Folge Deutschland in die geographische Mitte des politisch verfassten Europa gekommen ist. Das hätte an sich keine größere Bedeutung gehabt, wenn nicht parallel dazu ein allmählicher Rückzug der USA aus der sicherheitspolitischen Verantwortung für Europa stattgefunden hätte. Das politische und militärische Disengagement der USA in Europa hat aus der geographischen eine geopolitische Mitte werden lassen. Das aber lässt, sobald es in dieser Form ausgesprochen worden ist, alle Alarmglocken schrillen, denn Deutschland hat sich in der Vergangenheit schon einige Male in der Position einer solchen geopolitischen Mitte befunden – und das ist in der Regel weder ihm selbst noch dem europäischen Raum in seiner Gesamtheit gut bekommen. Über die Macht in der Mitte kann also nicht gesprochen werden, ohne dass längere Ausflüge in die europäische Geschichte sowie in die Theorie und Praxis der Geopolitik unternommen werden. Auch darum wird es in den nachfolgenden Kapiteln gehen.
Als die Blockkonfrontation zu Ende ging, war gelegentlich davon die Rede, Europa werde nun nach einer längeren Phase der Absenz wieder zur Weltmacht aufsteigen und eine dementsprechende Rolle spielen (Sloterdijk 1994). Daraus ist jedoch nichts geworden, und man kann davon ausgehen, dass sich an der europäischen Verweigerung gegenüber der Rolle einer globalen Supermacht nichts ändern wird (Sheehan 2008: 241ff.). Aber die Europäer werden früher und in höherem Maße, als das vor Kurzem noch zu erwarten war, für die politische und soziale Stabilisierung ihrer Peripherie zu sorgen haben, und diese Herausforderung wird sie gänzlich in Anspruch nehmen. Sie betrifft die Mitgliedstaaten der EU jedoch in unterschiedlichem Maße und auf unterschiedliche Weise. Ein gemeinsames europäisches Handeln ist also alles andere als selbstverständlich; allein deshalb ist es eine der großen Aufgaben, die sich für die Macht in der Mitte stellen, die Europäer auf eine gemeinsame Linie zu bringen und für eine gesamteuropäische Solidarität gegenüber den Mitgliedstaaten zu sorgen, die den Bedrohungen aus der Peripherie in besonderer Weise ausgesetzt sind. Nur wenn das gelingt, wird die Europäische Union als regionale Ordnungsmacht auftreten können. Das ist die Aufgabe, der sich das politisch verfasste Europa stellen muss, wenn es in den nächsten Jahren nicht scheitern soll. Die Rolle einer regionalen Ordnungsmacht ist etwas anderes als die einer Weltmacht, doch mit der relativ sinkenden Macht der USA dürfte die Weltordnung des 21. Jahrhunderts darauf hinauslaufen, dass mehrere solcher regionalen Ordnungsmächte in sektoraler Form unterhalb der Vereinten Nationen und der seltener als in der Vergangenheit als Weltpolizist auftretenden USA dafür sorgen, dass Konflikte nicht eskalieren und Kriege, wenn sie denn nicht zu beenden sind, regional begrenzt bleiben. Auch dabei kommt Deutschland als der europäischen Macht in der Mitte eine gewichtige Rolle zu.
In den tastenden Überlegungen, die während der 1990er-Jahre zur Frage der politischen Mitte und ihrer Bedeutung für Europa angestellt wurden (Schmierer 1996: 156ff.), gab es noch keine Vorstellung davon, welches politische Gewicht der Mitte innerhalb Europas zukommen und welche Bedeutung diese Mitte für den Zusammenhalt der Europäischen Union erlangen würde. Die Probleme und Verwerfungen, mit denen die EU in den zurückliegenden Jahren konfrontiert wurde, sind nicht oder nur unzureichend antizipiert worden. In der Regel hat man die Entwicklung des kleinen »Europa« der 1960er- und 1970er-Jahre extrapoliert und allenfalls damit gerechnet, dass es nach Phasen eines beschleunigten Fortschritts auch solche des Stillstands geben werde, wie das auch in der Vergangenheit immer wieder der Fall gewesen ist. Mit der Drohung von Rückschlägen oder gar eines Zerfalls wurde nicht gerechnet, und deswegen hat man sich auch keine Gedanken über die Rolle einer Macht in der Mitte gemacht.
Die Entstehung einer Macht in der Mitte wird nachfolgend als eine Folge dessen begriffen, dass es zu den – zumindest zeitweilig als Ziel der politischen Entwicklung angesehenen – »Vereinten Staaten von Europa« nicht gekommen ist und entgegen den Erwartungen einiger Beobachter (etwa Habermas 2011: 48ff.) wohl auch nicht kommen wird. Die Gründe dafür sind vielfältig: Die unterschiedlichen politischen Traditionen und die damit verbundenen kollektiven Erinnerungen, die auf eine Fortführung des Nationalstaatsprojekts hinauslaufen, sind das eine, die sozialstrukturellen Divergenzen, die – im Unterschied zu den USA – mit starken Regulations- und Steuerungserwartungen an den Staat verbunden sind, sind das andere. Es ist festzuhalten, dass die sozioökonomische Konvergenz, die in Europa zeitweilig zu beobachten war, seit 2008 zum Stillstand gekommen ist (Hüther 2014: 253). Im Zuge der Fiskal- und Wirtschaftskrise in den südeuropäischen EU-Ländern sind vielmehr die Divergenzen wieder größer geworden. Währenddessen wollen die Briten Befugnisse, die bereits an die Gemeinschaft übertragen wurden, wieder zurückhaben, streben also eine Revision des Vergemeinschaftungsprozesses an. Kurzum: Die zentrifugalen Kräfte sind gewachsen, und um sie einigermaßen im Zaum zu halten, bedarf es einer Macht in der Mitte, die balanciert und ausgleicht und die Kraft des Zentripetalen ist.
Die Entstehung einer Macht in der Mitte ist also über deren geographische Position hinaus die Folge dessen, dass der europäische Integrationsprozess zum Stillstand gekommen ist und mit seiner Wiederaufnahme vorerst nicht gerechnet werden kann. Im Gegenteil: Es wird nicht leicht sein, angesichts der von Griechenland und Großbritannien auf unterschiedliche Weise ausgehenden Zentrifugalkräfte das erreichte Niveau der europäischen Integration und deren gegenwärtigen Umfang zu halten. Das Aufkommen rechts- wie linkspopulistischer Parteien in allen EU-Mitgliedsländern, die durch eine polemische Ablehnung des Integrationsprojekts miteinander verbunden sind, ist ein untrügliches Indiz für die Probleme, in die das Europaprojekt gekommen ist. Die Rolle, die der Macht in der Mitte zukommt, wird deswegen zukünftig noch größer und bedeutsamer werden. Das Nachdenken über die Politik Deutschlands als dem (zeitweiligen?) Inhaber der Position einer Macht in der Mitte hat gerade erst begonnen. Dieser Essay will einen Beitrag zur Debatte darüber leisten.
KAPITEL 1: Äußere Ränder, innere Trennlinien und neue Mitte: Die Rolle Deutschlands in Europa
Politische Paradoxien im Europaprojekt
Große Projekte haben häufig paradoxe Effekte. So haben einige der in den letzten Jahrzehnten gemachten Schritte zur Stärkung und inneren Einung Europas das Gegenteil zur Folge gehabt: Anstelle der kohäsiven Kräfte wurden durch sie die zentrifugalen Kräfte gestärkt, und anstatt der erwarteten intensiveren Kooperation der nationalen Regierungen in Europa kam es zu vermehrtem Streit, gegenseitigen Vorwürfen und einem Wiederaufleben von nationalen Vorurteilen, die man für längst verschwunden und vergessen gehalten hatte. Die Einführung der Gemeinschaftswährung und die Direktwahl zum Europaparlament sind dafür Beispiele: Der Euro sollte nicht nur die wirtschaftliche Verflechtung Europas erhöhen und den Zahlungsverkehr erleichtern, darüber hinaus die dominierende Rolle der D-Mark und damit der Deutschen Bundesbank in Europa beenden, sondern auch zu einem Symbol des geeinten Europa werden, das im tagtäglichen Leben der Menschen eine zentrale Rolle spielte und dazu beitrug, dass aus Deutschen, Franzosen, Spaniern, Italienern, Griechen u.a. Europäer wurden. Der Euro sollte einen Beitrag dazu leisten, dass sich neben der nationalen Identität der Bürger eine europäische Identität entwickelte, die um einiges belastbarer war als die verbalen Versicherungen europäischer Spitzenpolitiker bei Festakten und Preisverleihungen, in deren Mittelpunkt zumeist sie selber stehen. Und auch die Direktwahl der Abgeordneten zum Europaparlament, die an die Stelle der Entsendung von Parlamentariern proportional zur Parteienrepräsentanz in den nationalen Parlamenten trat, sollte das Zusammengehörigkeitsgefühl der Europäer, ihre europäische Identität stärken und ein Schritt zur Demokratisierung Europas sein.
Es ist anders gekommen, als man sich das vorgestellt hat: Der Euro hat, spätestens seit Beginn der europäischen Fiskalkrise im Jahre 2010, die allgemein als Eurokrise bezeichnet wird, die zentrifugalen Kräfte gestärkt. Die Unterschiede und Gegensätze in Europa sind heute stärker ausgeprägt, als sie dies vor der Einführung des Euro waren. Es ist zu einem regelrechten Hochkochen nationaler Ressentiments und Aversionen gekommen, wie man es sich nicht mehr hatte vorstellen können (Geppert 2013: 67ff.). Und die Direktwahl der Europaabgeordneten, in deren Folge die Wählerschaft sich unmittelbar zu europapolitischen Fragen und Perspektiven äußern konnte, hat inzwischen zu einem dramatischen Aufwuchs europakritischer bis europafeindlicher Parteien im Europäischen Parlament geführt. Außerdem ist die Beteiligung der Bürger an Wahlen zum Europaparlament immer geringer geworden. Man kann darüber streiten, ob die Repräsentanz der Europagegner in Brüssel und Straßburg auf längere Sicht nicht besser sei als deren Unsichtbarbleiben, weil dadurch die Auseinandersetzung über die Ausgestaltung des Europaprojekts dort geführt werden könne, wo sie hingehöre. Das mag im Grundsatz richtig sein. Die kontinuierlich sinkende Wahlbeteiligung spricht jedoch dagegen, dass das Europaparlament als der entscheidende Ort bei der Austragung politischer Kontroversen wahrgenommen wird. Die Präsenz der Europaskeptiker bis Europagegner in Straßburg und Brüssel und die damit verbundene Alimentierung dieser Parteien mit Finanzmitteln hat schließlich in Form einer Rückstoßwirkung deren nationale Sichtbarkeit verstärkt und die Repräsentanz populistischer Parteien in den nationalen Parlamenten deutlich erhöht (Fieschi/Morris/Caballero 2013). Das Vorhaben, aus dem Elitenprojekt Europa ein Projekt der Bürger zu machen, hat eine solche Fülle nicht intendierter Nebenwirkungen und gegenteiliger Effekte hervorgebracht, dass inzwischen die Frage gestellt wird, ob diese Transformation die bisherigen Erfolge auf dem Weg zur politischen und wirtschaftlichen Integration Europas womöglich in Frage stellt und das gesamte Projekt gefährdet. Jedenfalls ist es um die Wertschätzung Europas durch seine Bürger heute deutlich schlechter bestellt, als das vor den europäischen Direktwahlen und der Einführung des Euro der Fall war.
Die politischen und wirtschaftlichen Eliten, die das europäische Projekt vorangetrieben haben, stellten sich dessen Fortgang als einen linearen Prozess vor, in dem es zwar Phasen der Verlangsamung und womöglich auch des Stillstands geben könne, doch mit Rückschlägen, die eine unmittelbare Folge von Fortschritten bei der Integration Europas waren, hatten sie nicht gerechnet. Die Ablehnung des Vertrags über eine Verfassung für Europa, dessen Umsetzung dem Europaprojekt eine gemeinsame Verfassung verschaffen sollte, bei den Volksabstimmungen in Frankreich und den Niederlanden im Sommer 2005 war mehr als ein bloßer Warnschuss. Sie könnte das Ende des Weges zu einem europäischen Bundesstaat und die Festschreibung eines Zwischenstadiums von Staatenbund und Bundesstaat gewesen sein, was für einige, wie Hermann Lübbe (1994), eher der Abschied von einem Irrweg als ein Scheitern gewesen ist. Die maßgeblichen Politiker in Europa haben die beiden Referenden aber überwiegend als bloßen Warnschuss wahrgenommen und das Scheitern des Verfassungsvertrags in den Volksabstimmungen bei den beiden Gründungsmitgliedern der EWG auf ein bloßes Performanzproblem reduziert: Hätte man den Vertrag besser kommuniziert und engagierter für die Zustimmung der Bevölkerung geworben, dann wäre er bei der Volksabstimmung auch angenommen werden. Man traute sich jedoch nicht, der französischen und niederländischen Bevölkerung einen leicht modifizierten Verfassungsvertrag ein zweites Mal zur Abstimmung vorzulegen – eine sonst durchaus übliche Praxis –, und schaltete wieder auf das Verfahren zurück, bei dem solche Verträge von den politischen Eliten ausgehandelt wurden. Die Idee, aus dem Europaprojekt könne einmal eine europäische Nation hervorgehen, kann als gescheitert gelten. Europa wird, in welcher Verfassung auch immer es sich präsentiert, ein Ensemble von Nationen bleiben (Koslowski/Brague 1997), und diese werden auf die politische Hülle von Staatlichkeit Wert legen. Dementsprechend werden die Nationalstaaten auch zukünftig in Europa eine entscheidende Rolle spielen.
Allein der Ansatz, das politische Scheitern des zentralen Demokratisierungsprojekts mit unzureichender Werbung und schlechter Performanz zu erklären, zeigt allzu deutlich, dass die politische Herausforderung, Europa aus einem Eliten- in ein Bürgerprojekt zu verwandeln, nicht begriffen worden ist: Man stellte sich das Bürgerprojekt als Fortsetzung des Elitenprojekts bei regelmäßig eingeholter, in der Sache aber bereits vorausgesetzter Zustimmung der Bürger vor. Man wollte die demokratischen Legitimationsdefizite des verfassten Europa beseitigen, aber die Steuerung und Kontrolle des Integrationsprozesses nicht aus der Hand geben – schließlich glaubte man ja zu wissen, welcher Schritt als nächster erforderlich und was das Beste für die europäische Bevölkerung sei. Ich nenne dies das Demokratisierungsparadox; es handelt sich dabei um eine Konkretisierung und Spezifikation der eingangs getroffenen Feststellung, wonach große politische Projekte mitunter paradoxe Effekte haben bzw. sich der Festlegung auf eine lineare Weiterentwicklung entziehen. Solche Paradoxien treten verstärkt und vermehrt auf, wenn tief greifende Veränderungen in geordneten Bahnen vollzogen werden sollen. Die politischen Eliten haben eine klare Vorstellung davon, wie die Entwicklung weitergehen soll, und haben dafür, wie es im Polit-Sprech heißt, »alle Weichen gestellt«; zugleich aber möchten sie, da es sich dabei ja um ein demokratisches Verfahren handeln soll, im Nachgang zur Weichenstellung die Zustimmung der Bürger einholen. Die freilich soll nichts anderes zum Ergebnis haben als die Bestätigung der bereits erfolgten Weichenstellung. Um im Bild zu bleiben: Die Fahrgäste sollen applaudieren, wenn der Zug die fraglichen Weichen passiert.
Üblicherweise ist der europäische Integrationsprozess auf diese Weise organisiert worden: Man hat die Bevölkerung nur vermittels ihrer politischen Repräsentanten zu Wort kommen lassen. Im Falle der Verfassungsgebung hat man in einigen Ländern jedoch das Volk direkt befragen wollen und ist damit bereits in zwei als unproblematisch angesehenen Ländern, die deswegen auch als Erste abgestimmt haben, deutlich gescheitert. Politiktheoretisch formuliert: Das Verfahren der Output-Legitimation hat sich nicht auf eine Input-Legitimation umstellen lassen. Oder vereinfacht: Die europäische Integration war und ist ein viel zu komplexer Prozess, als dass man diesen der begleitenden Kontrolle und Einspruchnahme der Bevölkerung aussetzen könnte. Man riskiert dann, dass Teile der europäischen Bevölkerung die Weichen umstellen oder, schlimmer noch, die einen sie nach rechts und die anderen sie nach links stellen wollen, sodass der Zug entgleisen würde, übernähme die europäische Bevölkerung den Fahrdienst. Außerdem müsste der europäische Zug bei permanenter Einflussnahme der Bevölkerung sehr viel langsamer fahren, als er in der Vergangenheit gefahren ist. Also hat man auf Regierungsebene nach dem Scheitern des Verfassungsvertrags den Lissabon-Vertrag ausgehandelt und ihn ohne Volksabstimmungen in Kraft gesetzt (Fuest u.a. 2008). Man hat damit den linearen Fortgang der europäischen Integration über die Risiken seiner Unterbrechung, Umleitung oder gar Rückbewegung infolge demokratischer Einspruchnahme gestellt. Die ausschlaggebende Begründung dafür lief in der Regel darauf hinaus, dass die globalen ökonomischen und die regionalen politischen Herausforderungen dafür gar keine andere Wahl ließen. Die demokratietheoretisch heikle Behauptung der Alternativlosigkeit von Entscheidungen und Entwicklungen hat auf der europäischen Ebene schon lange eine Rolle gespielt, bevor sie von Angela Merkel auch für die deutsche Politik in Anspruch genommen worden ist.
Revolutionäre Umbrüche sind dagegen Vorgänge, in denen solche Paradoxien der nachholenden demokratischen Legitimation von Elitenentscheidungen nicht zum Tragen kommen – zum einen, weil in ihnen mit der Annahme einer linearen Entwicklung gebrochen wird, und zum anderen, weil in ihnen die Eliten, die den Übergang kontrollieren und steuern, von den Schalthebeln der Macht entfernt werden. Paradoxien der beschriebenen Art sind also der Preis einer Revolutionsvermeidung, wobei Revolutionen ganz allgemein als kostspielige und zeitraubende Neuformatierungen der politischen und sozialen Ordnung verstanden werden können. Europa ist ein politisches Projekt, das bislang ohne solche revolutionären Umbrüche ausgekommen ist und, wenn es erfolgreich weitergeführt werden soll, auch in Zukunft ohne solche Umbrüche auskommen muss. Die Europäische Gemeinschaft würde in ihrer jetzigen Form einen solchen Umbruch nicht überstehen. Um ihn zu vermeiden, sucht sie sich demokratische Legitimation zu verschaffen, darf dabei aber nicht so weit gehen, dass die demokratische Einflussnahme einen umwälzenden (= revolutionierenden) Charakter bekommt. Das ist gemeint, wenn vom Demokratisierungsparadox gesprochen wird. Darin besteht zugleich der fundamentale Unterschied zwischen der Entstehungsgeschichte der USA und der des politisch verfassten Europa: Die USA sind in einer zugleich bürgerlichen und antikolonialen Revolution aus dem Verband des Britischen Empire ausgebrochen und haben in einem langwierigen Prozess der Verfassungsgebung für sich eine neue politische Ordnung entwickelt. Außerdem haben sie einen Sezessionskrieg durchgestanden, in dem zwei Modelle der sozioökonomischen Ordnung gegeneinander gekämpft haben und an dessen Ende sich die Ordnung des Nordens gegen die des Südens auf dem Schlachtfeld durchgesetzt hat. Eine analoge Entwicklung ist in und für Europa undenkbar. Deswegen ist es auch abwegig, die weitere Entwicklung des Europaprojekts an der US-amerikanischen Verfassung orientieren zu wollen, wie das von europaaffinen Intellektuellen immer wieder vorgeschlagen wird (zuletzt Habermas 2013).
Die undeutlichen Außengrenzen Europas
Weil das verfasste Europa keine Neugründung in einem politisch jungfräulichen Raum sein konnte und ein revolutionärer Bruch mit der bisherigen Geschichte der Nationalstaatlichkeit bzw. eines pluriversen Staatensystems nicht in Frage kam, weil gerade die Vielgestaltigkeit Europas dessen Dynamik begründet hatte (Jones 1991), bzw. weil eine revolutionäre Neugründung Europas unmöglich war, da sich dafür nicht einmal im Ansatz eine hinreichende politische Unterstützung finden ließ, muss das verfasste Europa mit den immer wieder auftretenden Paradoxien seiner Entwicklung umzugehen lernen. Zu diesen Paradoxien gehört an erster Stelle, dass Europa ein Kontinent mit geographisch unklaren Grenzen ist bzw. sich die Wertigkeit der geographischen Grenzziehungen im Verlauf der Geschichte immer wieder verändert hat. Das politisch verfasste Europa muss sich also selber Grenzen setzen, aber die Kriterien, nach denen diese Grenzen gezogen werden sollen, sind politisch umstritten. Von der Geographie können keine eindeutigen Vorgaben gemacht werden, bzw. geographische Vorgaben werden durch historische Hinweise und kulturelle Einsprachen immer wieder relativiert. Die Grenzfrage ist somit offen: Soll dabei so etwas wie eine europäische Identität ausschlaggebend sein, und, wenn ja, was sind die spezifischen Merkmale dieser europäischen Identität? Sind sie religiöser Art, etwa im Sinne der Vorstellung vom »christlichen Abendland« (dazu Faber 1979)? Oder sind sie kultureller Art mit einem starken Akzent auf klassischer Bildung, sodass das antike Griechenland als Ursprungsort der europäisch-humanistischen Bildung in jedem Fall einzubeziehen ist (Cobett 2010; Jaeckle 1988: 46–79)? Oder sind sie eher geographischer Art, wonach Nordatlantik und Mittelmeer die natürlichen Grenzen Europas sind und die Grenze im Osten gegenüber Asien entweder am Don oder an der Wolga verläuft (Gollwitzer 1964)? Oder sind sie gemäß den Vorgaben der politischen Kultur zu ziehen, wonach eine demokratische Verfassung und eine lebendige Zivilgesellschaft unabdingbare Voraussetzungen der Europazugehörigkeit darstellen (Siedentop 2002)? Und wenn Letzteres der Fall ist: Bei welchen Verstößen können dann Länder, die einmal EU-Mitglied geworden sind, wieder ausgeschlossen werden (Müller 2013)?