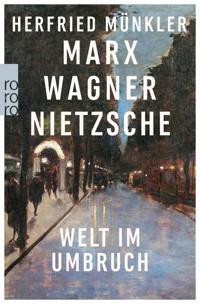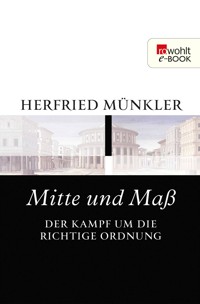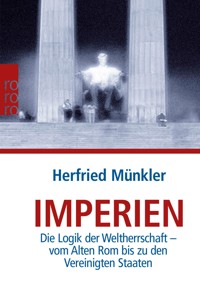
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Imperien, glaubte man in Europa bis vor kurzem, seien Relikte der Vergangenheit. Umso bestürzter waren die Europäer, als die USA ihre Vormachtstellung offen demonstrierten – ratlos nahm man die Wiederkehr des tot geglaubten «Imperialismus» zur Kenntnis. Plötzlich stellen sich drängende Fragen: Wodurch zeichnen sich Imperien aus? Welche Risiken birgt eine imperiale Ordnung? Und welche Chancen bietet sie? Herfried Münkler zeigt, wie Imperien für Stabilität sorgen und welche Gefahren ihnen drohen, wenn sie ihre Kräfte überdehnen. Er beschreibt, was es heißt, im Machtbereich eines Imperiums zu leben, und macht die Logik deutlich, nach der es funktioniert. Im alten China und im Römischen Imperium, im Reich der Mongolen und der russischen Zaren, im portugiesischen, spanischen oder britischen Weltreich – überall herrschten andere Bedingungen. Die grundlegenden Prinzipien der Machtentfaltung und -erhaltung aber gelten heute noch. Herfried Münkler unternimmt nicht nur einen souveränen Gang durch die Geschichte, er liefert auch die brillante Analyse eines hochaktuellen Themas.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 469
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Herfried Münkler
Imperien
Die Logik der Weltherrschaft – vom Alten Rom bis zu den Vereinigten Staaten
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1. Was ist ein Imperium?
Eine knappe Merkmalsbeschreibung der Imperien
Weltreiche und Großreiche
Imperialer Interventionszwang, Neutralitätsoptionen und der Melier-Dialog bei Thukydides
2. Imperium, Imperialismus und Hegemonie: eine notwendige Differenzierung
Die selbstzerstörerische Dynamik des Kapitalismus: die ökonomischen Imperialismustheorien
Das Zentrum-Peripherie-Problem
Prestigestreben und Mächtekonkurrenz: die politischen Imperialismustheorien
Expansionszwänge, Randlagenvorteile und Zeitsouveränität
Die heikle Unterscheidung zwischen Hegemonie und Imperium
3. Steppenimperien, Seereiche und globale Ökonomien: eine kleine Typologie imperialer Herrschaft
Imperienbildung durch militärische und kommerzielle Mehrproduktabschöpfung
Die (mindestens) zwei Seiten von Imperien
Imperiale Zyklen und augusteische Schwellen
4. Zivilisierung und Barbarengrenze: Merkmale und Aufgaben imperialer Ordnung
Der Frieden als Rechtfertigung imperialer Herrschaft
Imperiale Mission und Sakralität des Reiches
Der Barbarendiskurs und die Konstruktion des imperialen Raumes
Prosperität als Rechtfertigung und Programm imperialer Herrschaft
5. Das Scheitern der Imperien an der Macht der Schwachen
Formen imperialer Überdehnung
Politische Mobilisierung und militärische Asymmetrierung: die Strategien antiimperialer Akteure
Kulturelle Identitätskämpfe und Terrorismus als Strategie des Verwüstungskrieges
6. Die überraschende Wiederkehr des Imperiums im postimperialen Zeitalter
Die Diagnose vom Ende des imperialen Zeitalters und das Problem postimperialer Räume
Die USA: das neue Imperium
Ein demokratisches Imperium?
Die imperiale Herausforderung Europas
Karten
Anmerkungen
Literaturverzeichnis
Danksagung
VORWORT
Seit Mitte des 20. Jahrhunderts hat sich in der deutschen Wissenschaft für Theorie und Geschichte der Imperien niemand mehr besonders interessiert. Erst der Zusammenbruch der Sowjetunion hat ein kurzzeitiges Interesse daran aufleben lassen, getragen freilich von der erleichterten Feststellung, dass die Geschichte der Imperien, die bis in die Zeit der frühen Hochkulturen zurückreicht, nunmehr definitiv zu Ende sei. Das hat sich in den letzten Jahren, als die neue weltpolitische Rolle der USA sichtbar wurde, schlagartig geändert. Mit einem Mal war vom amerikanischen Imperium die Rede, und seitdem weist die Kritik am weltpolitischen Agieren der USA starke antiimperiale Züge auf. Zwar ist den USA schon häufig Imperialismus vorgeworfen worden – während des Vietnamkriegs etwa, anlässlich von Militärinterventionen in Lateinamerika oder am Persischen Golf. Doch solche Vorwürfe richteten sich gegen bestimmte Entscheidungen und Handlungen der amerikanischen Regierung; die antiimperiale Grunddisposition richtet sich gegen das Übergewicht und die Dominanzansprüche der USA als solche. Das ist entschieden mehr.
Ist die Weltgemeinschaft zu ihrer eigenen Sicherheit auf eine imperiale Vormacht angewiesen? Oder stellt diese imperiale Vormacht eine gravierende Störung der Weltordnung dar, und es wäre besser, wenn es sie nicht gäbe? Um diese Frage kreist im Prinzip die Debatte, wie sie im Vorfeld des jüngsten Golfkrieges geführt worden ist. Tatsächlich hat die in der UNO versammelte Weltgemeinschaft in den vergangenen Jahren immer wieder auf die Fähigkeiten der imperialen Vormacht zurückgegriffen. Dass diese Inanspruchnahme nicht selbstlos war und die USA dafür Sonderrechte forderten, hat man nicht wahrhaben wollen. Die daraus erwachsenen Irritationen waren auch eine Folge davon, dass man Funktionen und Ansprüche eines Imperiums schon lange nicht mehr durchdacht hatte.
Imperien sind mehr als große Staaten; sie bewegen sich in einer ihnen eigenen Welt. Staaten sind in eine Ordnung eingebunden, die sie gemeinsam mit anderen Staaten geschaffen haben und über die sie daher nicht allein verfügen. Imperien dagegen verstehen sich als Schöpfer und Garanten einer Ordnung, die letztlich von ihnen abhängt und die sie gegen den Einbruch des Chaos, der für sie eine stete Bedrohung darstellt, verteidigen müssen. Der Blick in die Geschichte nicht nur der USA, sondern auch anderer Imperien zeigt, dass sprachliche Wendungen wie die von der «Achse des Bösen» oder den «Vorposten der Tyrannei» nichts Neues und Besonderes sind. Vielmehr durchziehen sie die Geschichte der Imperien wie ein roter Faden.
Das Pendant der Furcht vor dem Einbruch des Chaos und der selbst gewählten Rolle eines Verteidigers der Ordnung gegen die Unordnung, des Guten gegen das Böse, in der sich das Imperium sieht und durch die es sich legitimiert, ist die imperiale Mission, die ebenfalls eine grundlegende Rechtfertigung der Weltreichsbildung darstellt: Entweder soll die Zivilisation verbreitet werden, oder es geht um die weltweite Durchsetzung der sozialistischen Gesellschaftsordnung, den Schutz der Menschenrechte oder die Förderung der Demokratie. Während Staaten an den Grenzen anderer Staaten Halt machen und es ihnen selbst überlassen, ihre inneren Angelegenheiten zu regeln, mischen sich Imperien in die Verhältnisse anderer ein, um ihrer Mission gerecht zu werden. Deshalb können Imperien auch sehr viel stärkere Veränderungsprozesse in Gang setzen, während die Ordnung der Staaten durch einen strukturellen Konservatismus geprägt ist.
Betrachtet man die Dinge unter dieser Perspektive, so steht keineswegs fest, was unter dem Einfluss der Imperialismustheorien zu einer Selbstverständlichkeit geworden ist: dass eine globale Ordnung gleichberechtigter Staaten ohne imperialen Akteur das Wünschens- und Erstrebenswerte ist. Die politische Ordnung des europäischen Raumes hat sich nach dem Untergang des Römischen Reiches so entwickelt, dass es keine dauerhafte und handlungsmächtige imperiale Macht mehr gegeben hat, wohl aber eine Fülle von Prätendenten auf diese Rolle, die jedoch alle frühzeitig gescheitert sind. Das ist – abgesehen davon, dass die Europäer in anderen Kontinenten sehr wohl Großreiche gebildet haben – andernorts nicht so gewesen. Vor allem in Asien setzte sich eine politische Ordnung durch, in der Imperien sich mit einem Kranz von Klientelstaaten umgeben haben. Infolgedessen ist die Ordnung dieser Räume stark zentriert worden, während in Europa ein vielfältiger Polyzentrismus entstand.
Unser Bild von Imperien ist durch die Vorstellung geprägt, dass die Peripherie von ihnen ausgesaugt und ausgebeutet werde: Sie verarme, und das Zentrum werde immer reicher. Tatsächlich hat es solche Imperien stets gegeben, aber sie waren nur von kurzer Dauer. Nach einiger Zeit nahm der Widerstand gegen das Zentrum überhand, und die Beherrschungskosten überstiegen die aus der Peripherie gezogenen Gewinne. Dagegen hatten diejenigen Imperien eine längere Dauer, die in ihre Randbereiche investierten und so dafür sorgten, dass die Peripherie schließlich am Fortbestand des Imperiums ebenso interessiert war wie das Zentrum.
Darum also geht es in diesem Buch: um die Typen imperialer Herrschaft, die Formen von Expansion und Konsolidierung und um die Medien, in denen sich die Imperiumsbildung vollzogen hat. Aber das Erkenntnisinteresse beschränkt sich nicht auf die Unterscheidung von See- und Landimperien, Handels- und Militärimperien, imperialen Ordnungen, die sich über die Kontrolle von Räumen entwickeln, und solchen, die im Wesentlichen in der Kontrolle von Strömen (Menschen, Waren, Kapital) bestehen, sondern zielt darüber hinaus auf die Rationalität der Akteure, eben auf die Logik der Weltherrschaft. Es geht auch darum, Prognosen über die Dauer und Stabilität des amerikanischen Imperiums zu machen und Überlegungen zu der Frage anzustellen, wie ein Europa beschaffen sein muss, das sich einerseits als selbständige politische Kraft neben den USA zu behaupten vermag und andererseits in der Lage ist, seine instabilen und hereinstürzenden Ränder zu befestigen und positiv auf seine Nachbarn einzuwirken. Ein solches Europa wird nicht umhin kommen, selbst imperiale Merkmale zu übernehmen und imperiale Fähigkeiten zu entwickeln – und wenn man genau hinsieht, hat es damit bereits begonnen. Die Voraussetzung dafür ist freilich, dass imperiales Agieren nicht von vornherein als schlecht und verwerflich wahrgenommen, sondern als eine Form von Problembearbeitung neben der des Staates und anderer Organisationsformen des Politischen angesehen wird.
Das ist nicht zu verwechseln mit einer Rehabilitierung der alten Kolonialimperien. Sich aus einem solchen Kolonialimperium in einem Unabhängigkeitskrieg hinausgekämpft zu haben ist der Gründungsmythos der USA; eine solche Form der Beherrschung außereuropäischer Räume einmal ausgeübt und dann hinter sich gelassen zu haben ist das Selbstverständnis der Europäer. Aber dass das auf Gleichheit und Reziprozität angelegte Staatenmodell in den nächsten Jahrzehnten in der Lage sein wird, die erkennbaren Herausforderungen zu bestehen, wird man eher bezweifeln dürfen. Staatsversagen, insbesondere Staatenzerfall, provoziert das Eingreifen oder die Entstehung von Imperien.
Dagegen werden viele einwenden, dass die Gegenüberstellung von Staat und Imperium keine erschöpfende Alternative sei – und ihre Wunschvorstellungen von guter politischer Ordnung aufzählen. Dabei werden sie sich immer weiter von dem entfernen, was der Fall ist. Der Blick auf die Geschichte zeigt, dass sich die Modelle politischer Ordnung letzten Endes doch zwischen Staat und Imperium erschöpft haben – wenn man denn beide Begriffe weit und großzügig versteht und nicht für jeden Spezialfall von Staatlichkeit und Imperialität einen eigenen Oberbegriff erfindet. Was der Imperiumsbegriff leistet, soll hier ausgelotet werden. Auf welchen Bahnen Imperien entstanden und wie sie zerfallen sind, soll dargestellt werden. Wissenschaftlich wird dabei ein Feld betreten, das lange brachgelegen hat.
Berlin, Februar 2005
1. WAS IST EIN IMPERIUM?
Die Debatten über den letzten Irakkrieg, die möglichen Hintergründe und verborgenen Ziele des erneuten militärischen Eingreifens der USA in der ölreichen Golfregion, überhaupt die Rolle der USA am Golf und in Zentralasien, dazu die tiefen Zerwürfnisse in den transatlantischen Beziehungen haben in Europa den Blick für die Entstehung einer neuen Weltordnung nach dem Ende des Ost-West-Konflikts geschärft. Mit der notorischen Weigerung der USA, internationalen Vereinbarungen beizutreten, vom Kyoto-Protokoll bis zum Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, zeichnete sich eine Neudefinition der amerikanischen Position in der politischen Ordnung der Welt ab. Es kommt hinzu, dass die Beziehungen zwischen den USA und der UNO, die in den letzten Jahrzehnten nie ohne Probleme gewesen sind, grundsätzlich zur Disposition stehen, nachdem US-Präsident George W. Bush in einem denkwürdigen Auftritt vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 12. September 2002 damit gedroht hat, die USA würden einige der drängenden sicherheitspolitischen Probleme im Alleingang lösen, wenn die Weltorganisation sich dazu als unfähig erweise.
Dass dies keine leere Drohung war, hat sich im Frühjahr 2003 mit dem Dritten Golfkrieg gezeigt. Zwei Interpretationen des neuen Verhältnisses der USA zum UN-Sicherheitsrat waren möglich: Entweder die USA suchten ihn als amerikahörigen Legitimationsspender zu instrumentalisieren oder sie begannen damit, sich aus der notorischen Inanspruchnahme als militärischer Arm der Weltorganisation zu emanzipieren: Sie stellten ihren ebenso hoch entwickelten wie teuren Militärapparat nicht länger in den Dienst der Weltgemeinschaft, sondern setzten ihn gemäß eigener Interessen und Ziele ein. Die Konflikte im Vorfeld des Irakkriegs waren – auch – eine Kontroverse über die Frage, wer wen als Instrument benutzen konnte: die Vereinigten Staaten die Vereinten Nationen oder die Vereinten Nationen die Vereinigten Staaten.1
Die europäische Sicherheitsarchitektur, auf die man sich in Deutschland bis dahin verlassen hatte, schien ebenfalls brüchig geworden. Weitgehend unbemerkt hatte sich die Nato in den 1990er Jahren aus einem Bündnis auf konsultativer Grundlage in ein Instrument der USA zur Kontrolle Europas verwandelt. Und wo es sich für die amerikanische Politik als zu sperrig erwies, wurde es kurzerhand durch eine coalition of the willing ersetzt. Im Vergleich zu den Zeiten des Kalten Krieges ist die faktische Abhängigkeit der Europäer von den USA eher gewachsen als gesunken: Wer bei der Erfüllung der amerikanischen Vorgaben nicht mitmacht, muss mit politischem und wirtschaftlichem Druck rechnen oder wird mit höhnischen Bemerkungen überschüttet. Wer sich hingegen auf Seiten der Amerikaner engagieren will, kann das jederzeit tun – freilich zu amerikanischen Bedingungen und ohne Einfluss auf die politischen Grundentscheidungen, wie selbst Großbritannien, der Hauptverbündete der USA, ein ums andere Mal feststellen musste. Daran haben die Probleme, in die sich die USA im Irak verstrickt haben, im Prinzip nichts geändert. Die Ära wechselseitiger Konsultativverpflichtungen im Nordatlantischen Bündnis ist vorbei, und die Nato-Osterweiterung erweist sich im Nachhinein als ein Schritt, der den Einfluss der Verbündeten aus den Zeiten der Ost-West-Konfrontation deutlich gemindert hat.2
In dieser Situation mehrten sich die Appelle an die USA, sie sollten sich mit der Rolle eines wohlwollenden Hegemon begnügen, die sie bislang innegehabt hätten, und nicht die einer imperialen Macht anstreben. Um solchen Warnungen Nachdruck zu verleihen, wurde auf die unkontrollierbaren Risiken von Imperien, auf die Gefahr ihrer Überdehnung und schließlich auf den unvermeidlichen Zusammenbruch aller bisherigen Imperien hingewiesen. «Während in der Vergangenheit», so Michael Mann, ein in den USA lehrender Brite, «die Macht Amerikas hegemonial war, also in der Regel vom Ausland akzeptiert und häufig als legitim betrachtet wurde, kommt sie jetzt aus den Gewehrläufen. Das untergräbt die Hegemonie und den Anspruch, ein ‹wohlwollendes Empire› zu sein.»3 Wer versuche, die hegemoniale gegen eine imperiale Position auszutauschen, riskiere nicht bloß, mit diesem Projekt zu scheitern, sondern laufe Gefahr, auch die Hegemonie zu verlieren. Hegemonie und Imperium wurden in zahllosen Varianten gegeneinander ausgespielt, fast immer verbunden mit dem Hinweis, es sei besser, Hegemon zu bleiben als die imperiale Herrschaft anzustreben.
Mit einem Mal wurde die Debatte, die als eine über die Interessen und Absichten der USA in der Golfregion begonnen hatte, mit einer Fülle von historischen Argumenten und Vergleichen geführt, die allesamt dazu dienten, das irritierend Neue an der Politik der USA sowie den weltpolitischen Konstellationen durch Analogien mit früheren Entwicklungen ins Vertraute und Überschaubare zurückzuholen. Die Geschichte des Imperium Romanum wurde zur Folie, vor der die Chancen und Risiken der amerikanischen Politik beurteilt wurden; die Struktur des British Empire diente als Modell, an dem die imperialen Herausforderungen und die zu ihrer Bewältigung erforderlichen Fähigkeiten der USA gemessen wurden; und schließlich wurde der ein gutes Jahrzehnt zurückliegende Zusammenbruch der Sowjetunion als Beispiel für die Folgen imperialer Überdehnung bemüht, wie sie auch den USA drohe, wenn sie den eingeschlagenen Weg fortsetzten.4 Aber die historischen Verweise und Beispiele wurden eher assoziativ als systematisch bemüht, und fast durchweg sollten sie längst zuvor bezogene Positionen stützen. Sie dienten eher der historischen Illustration von Argumentationen als der empirisch gehaltvollen Vergewisserung dessen, was wir aus der Geschichte früherer Weltreichsbildungen lernen können.
Nun ist die Parallelisierung zwischen der amerikanischen und der römischen Geschichte schon darum nahe liegend, weil sich die USA von ihrer Gründung an auf die römische Republik berufen und sich selbst in deren Tradition gestellt haben.5 Es handelt sich hierbei also um die kritische Überprüfung einer Parallele, die im Selbstbewusstsein und Selbstverständnis der amerikanischen politischen Elite von jeher einen zentralen Platz eingenommen hat. Der Vergleich mit dem Britischen Weltreich wiederum liegt nahe, weil die USA überall dort, wo sich die Briten nach dem Zweiten Weltkrieg zurückzogen, deren Nachfolge angetreten und die vormals britischen Positionen übernommen haben – dazu gehört nicht zuletzt der Mittlere Osten, der in jüngster Zeit einen Großteil der politischen Aufmerksamkeit und des militärischen Potenzials der USA gebunden hat. Der Vergleich mit der Sowjetunion schließlich ist schon deshalb unvermeidlich, weil die USA und die Sowjetunion über gut vier Jahrzehnte Konkurrenten um die weltpolitische Vorherrschaft gewesen sind, bis die Russen unter Gorbatschow – erschöpft von den Rüstungswettläufen und entkräftet durch die Kosten, die für die Aufrechterhaltung des Imperiums angefallen waren – aus dem Wettstreit ausgeschieden sind.6
Für eine fundierte Analyse der Chancen und Risiken des amerikanischen Empire ist die Vergleichsbasis dieser drei Weltreichsbildungen jedoch zu schmal. Das Reich der russischen Zaren, das Osmanische und das Chinesische Reich – die imperiale Macht mit der bei weitem längsten Dauer – sind auf jeden Fall in eine vergleichende Betrachtung mit einzubeziehen. Die mongolische Reichsbildung des 13. Jahrhunderts sollte in einer Untersuchung über imperiale Handlungslogiken und -imperative ebenfalls nicht übersehen werden. Sie zerfiel zwar rasch wieder, aber ihre territoriale Ausdehnung machte sie zu einer der größten der Geschichte: Mit einer Fläche von 25 Millionen Quadratkilometern wurde das Mongolische Weltreich nur von dem der Briten übertroffen, das auf seinem Höhepunkt 38 Millionen Quadratkilometer umfasste, allerdings auf fünf Kontinente verteilt, während sich das Mongolenreich als territorial geschlossene Einheit über fast ganz Eurasien erstreckte. Auf dem Höhepunkt seiner Machtentfaltung reichte es vom Gelben Meer im Osten bis an die Ränder der Ostsee im Westen; lediglich Vorder- und Hinterindien sowie West-, Mittel- und Südeuropa blieben von der mongolischen Besetzung frei.7 Was die Antike anbetrifft, so sollten neben dem Römischen Reich auch die hellenistischen Großreiche im Osten ins Auge gefasst werden, und unter den seaborn empires ist außer dem britischen und dem spanischen Weltreich auch das portugiesische zu berücksichtigen, zumal es von den europäischen Kolonialreichen das erste war und als letztes von der politischen Landkarte verschwunden ist – seit dem 18. Jahrhundert freilich eher ein Protegé des Britischen Empire als eine eigenständige politische Macht.8
Diese Zusammenstellung zeigt ein grundsätzliches Problem vergleichender Untersuchungen zur Handlungslogik von Imperien: Zunächst muss die Frage beantwortet werden, was unter einem Imperium zu verstehen ist. Man könnte sie auch dahingehend zuspitzen, dass es um die Differenz zwischen Großreichen und Weltreichen geht. Womöglich ließe sich leichter eine Antwort darauf finden, wenn es in den vergangenen Jahrzehnten eine sozialwissenschaftlich ausgerichtete Imperiumsforschung gegeben hätte, die verlässliche Kriterien für Imperialität entwickelt hätte. Das ist jedoch nicht der Fall. Zwar sind eine unüberschaubare Fülle historiographischer Darstellungen zu einzelnen Imperien sowie bemerkenswerte komparative Arbeiten zum Imperialismus entstanden9, aber die Frage, was ein Imperium ist und worin es sich von der in Europa ausgebildeten politischen Ordnung des Territorialstaates unterscheidet, ist so gut wie unbearbeitet geblieben. Das erklärt auch, warum der Imperiumsbegriff in der jüngsten Debatte über die US-amerikanische Politik eine eher beliebige, häufig bloß denunziatorische Bedeutung angenommen hat. Die Politikwissenschaft hat ihn nicht definitorisch umrissen und exemplarisch ausgefüllt, sondern der Beliebigkeit des publizistischen Alltagsbetriebs überlassen.
Was in langfristig angelegter wissenschaftlicher Arbeit nicht geleistet wurde, kann nicht auf einmal nachgeholt werden. Solange allerdings nicht klar ist, was Imperien sind und was sie nicht sind, was sie leisten müssen und worin sie sich von anderen Ordnungsstrukturen des Politischen unterscheiden, ist es nicht möglich, aus der vergleichenden Betrachtung von Weltreichsbildungen einen nennenswerten Gewinn für die Analyse der neuen Weltordnung und die Rolle der USA in ihr zu ziehen. Die Handlungslogik von Imperien ist nur zu verstehen, wenn annähernd klar ist, wodurch sich ein Imperium auszeichnet.
Eine knappe Merkmalsbeschreibung der Imperien
Was ein Imperium ist, soll zunächst vorsichtig gegen das konturiert werden, was es wahrscheinlich nicht ist. Ein Imperium ist erstens zu unterscheiden von einem Staat, genauer: vom institutionellen Flächenstaat, der gänzlich anderen Imperativen und Handlungslogiken unterliegt als ein Imperium. Das beginnt bei der Art der Bevölkerungsintegration im Innern und reicht bis zur Konzeption dessen, was als Grenze angesehen wird. Die für Staaten typische Grenzziehung ist scharf und markant; sie bezeichnet den Übergang von einem Staat zu einem anderen. Solche präzisen Trennungslinien sind im Falle von Imperien die Ausnahme. Zwar verlieren sich die Grenzen eines Imperiums heute nicht mehr in der Weite eines Raumes, in dem Stämme und Nomadenvölker das eine Mal imperialen Vorgaben folgten und sich ihnen das andere Mal widersetzten, aber auch seit dem Verschwinden der herrschaftsfreien Räume, in die hinein sich die klassischen Imperien ausdehnen konnten, sind imperiale von staatlichen Grenzen deutlich unterschieden.
Imperiale Grenzen trennen keine gleichberechtigten politischen Einheiten, sondern stellen eher Abstufungen von Macht und Einfluss dar. Zudem sind sie – im Gegensatz zu staatlichen Grenzen – halbdurchlässig: Wer in den imperialen Raum will, muss anderen Bedingungen genügen als der, der ihn verlässt. Das hängt mit der wirtschaftlichen wie kulturellen Attraktivität von Imperien zusammen; es wollen mehr hinein als heraus, und das hat Konsequenzen für das Grenzregime. US-Amerikaner reisen und arbeiten in aller Welt. Wer jedoch nicht die amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt, darf die USA nicht ohne weiteres betreten. Darin zeigt sich auch ein Statusunterschied: Die an Imperien grenzenden politischen Gemeinschaften haben nicht dieselbe Dignität wie das Imperium.
Der Halbdurchlässigkeit imperialer Grenzen entsprechen radikal verschiedene Interventionsbedingungen. So haben die USA seit dem Ausgang des 19. Jahrhunderts im mittelamerikanischen und karibischen Raum immer wieder in die Politik anderer Staaten eingegriffen, ohne damit rechnen zu müssen, dass diese ihrerseits auf US-amerikanischem Staatsgebiet intervenierten, weder wirtschaftlich noch politisch und schon gar nicht militärisch. Vor allem diese Asymmetrie unterscheidet imperiale von staatlichen Grenzen. Imperien kennen keine Nachbarn, die sie als Gleiche – und das heißt: als gleichberechtigt – anerkennen; bei Staaten hingegen ist das die Regel. Mit anderen Worten: Staaten gibt es stets im Plural, Imperien meist im Singular. Diese tatsächliche oder auch bloß behauptete Einzigartigkeit der Imperien bleibt nicht ohne Auswirkungen auf die Art ihrer inneren Integration: Während Staaten nicht zuletzt infolge der direkten Konkurrenz mit den Nachbarstaaten ihre Bevölkerung gleichermaßen integrieren – und das heißt vor allem: ihnen gleiche Rechte gewähren, ob sie nun im Kerngebiet des Staates oder in den Grenzregionen lebt –, ist dies bei Imperien nicht der Fall: Fast immer gibt es hier ein vom Zentrum zur Peripherie verlaufendes Integrationsgefälle, dem zumeist eine abnehmende Rechtsbindung und geringer werdende Möglichkeiten korrespondieren, die Politik des Zentrums mitzubestimmen. Im Fall der USA zeigt sich dies an all jenen Gebieten, die unter amerikanischem Einfluss stehen, aber nicht die Chance hatten, als Bundesstaat in die USA aufgenommen zu werden. Im karibischen Raum sind einige Beispiele dafür zu finden.
Imperiale Grenzen können alternativ zu denen von Staaten sein. Die europäischen Kolonialreiche waren innerhalb Europas durch Staatsgrenzen getrennt, während sie in Afrika und Asien imperiale Grenzen zu ihren Nachbarn – meist lockeren Herrschaftsverbünden – hatten. Beide Arten von Grenzen unterschieden sich deutlich voneinander, und durch sie war erkennbar, was jenseits ihrer begann: ein Staat oder ein Imperium. Imperiale können staatliche Grenzen aber auch überlagern und auf diese Weise verstärken: Zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR verlief einst eine Staatsgrenze, die gleichzeitig die Außengrenze des Sowjetimperiums war; erst diese Bündelung hat ihr den eigentümlichen Charakter verliehen, mit dem sie in die Geschichte eingegangen ist. Seitdem die gesamte bewohnbare Erdoberfläche politisch in Gestalt von Staaten geordnet ist, gibt es nur noch ein komplementäres, kein alternatives Verhältnis mehr zwischen beiden Arten von Grenzen: Imperiale Strukturen überlagern die Ordnung der Staaten, aber sie stehen nicht mehr an deren Stelle. Das macht es mitunter so schwer, Imperien zu identifizieren. Wer Imperialität lediglich als Alternative zu Staatlichkeit denkt, wird zu dem Ergebnis kommen, dass es heute keine Imperien mehr gibt. Wer dagegen von einer Überlagerung der Staaten durch imperiale Strukturen ausgeht, wird auf Macht- und Einflussgefüge stoßen, die nicht mit der Ordnung der Staaten identisch sind. Dass sich imperiale Strukturen eher im informalen Bereich ausmachen lassen, ist auch eine Folge der eigentümlichen Grenzsituation von Imperien. Staatengrenzen stellen häufig eine Bündelung von politischen und wirtschaftlichen, sprachlichen und kulturellen Grenzen dar. Das verleiht ihnen ihre Stärke und macht sie zugleich hart und inflexibel. Imperiale Grenzen dagegen lassen sich als ein Geflecht beschreiben, in dem politische und wirtschaftliche Grenzziehungen voneinander getrennt sind, kulturelle Differenzen gestuft werden und sprachliche ohnehin irrelevant sind. Das nimmt Imperiumsgrenzen an Formalität und erhöht ihre Flexibilität.
Weiterhin ist das Imperium – zweitens – zu konturieren gegen die Dominanzstrukturen der Hegemonie, wobei jedoch hinzuzufügen ist, dass die Übergänge zwischen hegemonialer Vorherrschaft und imperialer Herrschaft fließend sind. Dennoch ist es sinnvoll, beide voneinander zu unterscheiden. Hegemonie ist danach Vorherrschaft innerhalb einer Gruppe formal gleichberechtigter politischer Akteure; Imperialität hingegen löst diese – zumindest formale – Gleichheit auf und reduziert die Unterlegenen auf den Status von Klientelstaaten oder Satelliten. Sie stehen in einer mehr oder weniger erkennbaren Abhängigkeit vom Zentrum.
In den zurückliegenden Jahrzehnten ist die Stellung der Sowjetunion im Warschauer Pakt und die der USA in der Nato durch die Kontrastierung von Imperium und Hegemonie beschrieben worden: Die Sowjetunion sei von Satellitenstaaten umgeben gewesen, deren Bewegungen vom Zentrum bestimmt wurden10, die Nato dagegen galt als ein System prinzipiell gleicher Alliierter, innerhalb dessen den USA als dem bei weitem größten und stärksten Partner eine herausgehobene Bedeutung zukam – etwa dadurch, dass sie grundsätzlich den Oberbefehlshaber der Streitkräfte stellten, während die anderen Mitgliedsstaaten den Posten des Generalsekretärs besetzen durften. In der Kontrastierung von Nato und Warschauer Pakt zeigt sich auch, dass die Unterscheidung zwischen Hegemonie und Imperium in der Ost-West-Konfrontation politisch-ideologisch aufgeladen wurde.
Eine andere, aufgrund der großen zeitlichen Distanz politisch eher unverfängliche Exemplifizierung des Unterschieds zwischen Hegemonie und Imperium ist die Verwandlung des Delisch-Attischen Seebundes in die athenische Thalassokratie. Danach handelte es sich bei dem ursprünglichen Seebund um ein gegen die persische Dominanz an der kleinasiatischen Westküste und im ägäischen Raum gerichtetes Bündnis, in dem alle Partner gleiche Rechte besaßen. Freilich leisteten sie von Anfang an sehr unterschiedliche Beiträge: Manche zahlten nur Geld, andere stellten einige Schiffe, aber das Hauptkontingent der Kriegsflotte kam stets aus Athen.11
Die faktische Ungleichheit der Beiträge und Fähigkeiten blieb nicht ohne Folgen für die innere Verfassung des Bundes, der sich zunehmend aus einer hegemonía in eine arché verwandelte: Aus der Vorherrschaft wurde Herrschaft.12 Athen stellte den Befehlshaber der Streitkräfte und den Schatzmeister des Bundes, es legte die Höhe der Beiträge fest, dominierte die Handelsgerichtsbarkeit und setzte durch, dass seine Gewichte und Maße im gesamten Bundesgebiet verbindlich waren. Obendrein unterhielt es Garnisonen in den Städten der Bündnispartner und erlangte so Einfluss auf deren innere Verhältnisse. Schließlich verlegte es die Bundeskasse von Delos nach Athen, ließ den Treueid nicht länger auf «Athen und seine Bündner», sondern auf «das Volk von Athen» ablegen und verlagerte die Entscheidung über Krieg und Frieden von der Bundesversammlung auf die athenische Volksversammlung. Aus dem Hegemon war ein Despot geworden, wie die Korinther erklärten, als sie den Lakedämonischen Bund zum Krieg gegen Athen aufstachelten.13
Es ist nahe liegend, die Neupositionierung der USA innerhalb «des Westens» vor dem Hintergrund der Verwandlung des Delisch-Attischen Seebundes in die athenische Thalassokratie zu beschreiben. Zwar war sie weder von der räumlichen Ausdehnung noch der zeitlichen Dauer her ein wirkliches Imperium, aber viele Elemente imperialer Politik sind bei ihr wie durch ein Brennglas zu beobachten – nicht zuletzt, weil diese Entwicklung von dem Historiker Thukydides Schule machend beschrieben worden ist. Deswegen wird nachfolgend immer wieder von der athenischen Seeherrschaft die Rede sein, auch wenn sie nur eingeschränkt unter dem Oberbegriff des Imperiums verbucht werden kann.
Schließlich ist das Imperium – drittens – gegen das zu konturieren, was seit dem 19. Jahrhundert als Imperialismus bezeichnet wird. Die Unterscheidung zwischen Imperiums- und Imperialismustheorien ermöglicht es zunächst, die normativ-wertende Perspektive so gut wie aller Imperialismustheorien zu verlassen und einen stärker deskriptiv-analytischen Blick auf die Handlungsimperative von Imperien zu werfen. Obendrein fassen der Imperialismusbegriff sowie die zugehörigen Theorien die Entstehung von Imperien grundsätzlich als einen vom Zentrum zur Peripherie hin verlaufenden Prozess, womit eine Einsinnigkeit der Entwicklungsrichtung unterstellt wird, die bei der Beobachtung realer Imperien eher hinderlich ist.
Imperialismus heißt, dass es einen Willen zum Imperium gibt; gleichgültig, ob er aus politischen oder ökonomischen Motiven gespeist wird – er ist die ausschlaggebende, wenn nicht die einzige Ursache der Weltreichsbildung. Dagegen steht das bekannte Bonmot des englischen Historikers John Robert Seeley, der 1883 erklärte, das Britische Empire sei «in a fit of absence of mind», einem Augenblick der Geistesabwesenheit, entstanden.14 Gerade in ihrer strategischen Einseitigkeit – Seeley wollte damit zu einer bewusst imperialistischen Politik aufrufen, da er befürchtete, das Britische Weltreich werde sonst zwischen den neuen Großmächten USA und Russland zerrieben – verweist diese Formulierung darauf, in welchem Maße die Imperialismustheorien die Zielstrebigkeit und Bewusstheit jener Akteure überzeichnen, die auf irgendeine Weise in die Entstehungsgeschichte von Imperien verwickelt waren. Eine grand strategy hat kaum einer Imperiumsbildung zugrunde gelegen. Die meisten Imperien verdankten ihre Existenz einem Gemisch von Zufällen und Einzelentscheidungen, die oftmals auch noch von Personen getroffen wurden, welche dafür politisch gar nicht legitimiert waren. So gesehen ist fast jedes von ihnen «in a fit of absence of mind» entstanden.
Der Blick aufs Zentrum, wie er in den Imperialismusvorstellungen dominiert, muss durch den Blick auf die Peripherie ergänzt werden – auf die dortigen Machtvakuen und wirtschaftlichen Dynamiken, die Interventionsbitten der in Regionalkonflikten Unterlegenen und die Entscheidungen der vor Ort Verantwortlichen. In der Formel vom «Imperium auf Einladung», die in jüngster Zeit für die Ausdehnung der amerikanischen Macht- und Einflusssphäre geprägt worden ist15, soll vor allem die Initialfunktion der Peripherie bei der Entstehung von Imperien zum Ausdruck kommen. Es gibt zweifellos eine imperiale Dynamik, die aus dem Zentrum zur Peripherie drängt und den eigenen Machtbereich immer weiter expandiert; daneben ist jedoch ein von der Peripherie ausgehender Sog zu bemerken, der ebenfalls zur Ausdehnung des Herrschaftsbereiches führt. Welche von beiden Wirkungen die stärkere ist, kann nur von Fall zu Fall entschieden werden. Während Imperialismustheorien voraussetzen, dass die Dynamik des Zentrums maßgeblich sei16, wird hier davon ausgegangen, dass die genauere Beobachtung der Peripherie nicht nur im Hinblick auf vergangene Imperien bedeutsam ist, sondern auch für die Analyse der US-Politik in den letzten Jahrzehnten.
Weltreiche und Großreiche
Der Versuch, mit den Mitteln der Kontrastierung gegen andere politische Ordnungen die Konturen des Phänomens «Imperium» genauer zu bestimmen, wird in den nachfolgenden Kapiteln weitergeführt. Zuvor sollen jedoch noch einige heuristische Kriterien festgelegt werden, mit der sich Weltreiche gegen regionale Reiche oder kurzlebige Imperiumsbildungen abgrenzen lassen.
Da ist zunächst die zeitliche Dauer eines Imperiums, das mindestens einen Zyklus des Aufstiegs und Niedergangs durchschritten und einen neuen angefangen haben muss.17 Das Kriterium des längeren Bestehens eines Imperiums wird damit an der institutionellen Reform- und Regenerationsfähigkeit festgemacht, durch die es sich gegenüber den charismatischen Qualitäten seines Gründers (oder der Gründergeneration) verselbständigt. Damit ist klar, dass der napoleonischen Großreichsbildung im Folgenden keine größere Aufmerksamkeit gewidmet wird, ebenso wenig wie den noch schneller gescheiterten Vorhaben des italienischen Faschismus und des deutschen Nationalsozialismus oder dem japanischen Versuch, eine «Ostasiatische Wohlstandssphäre» aufzubauen.
Schwieriger ist diese Entscheidung im Falle des Wilhelminischen Kaiserreichs, das – selbst wenn man dessen imperiale Politik nicht mit seiner Gründung 1871 im Spiegelsaal von Versailles, sondern erst mit der Entlassung Bismarcks durch WilhelmII. beginnen lässt – um einiges länger gedauert hat als die im Wesentlichen auf die Anfangserfolge von Kriegen beschränkten Imperialprojekte Mussolinis und Hitlers. Wenn man die Wilhelminische und die nazistische Imperialpolitik schließlich als zwei aufeinander folgende, nur durch die Niederlage im Ersten Weltkrieg getrennte Zyklen zusammennimmt, scheint einiges dafür zu sprechen, Deutschland in die Reihe der Imperien aufzunehmen. Dann hätte obendrein ein Elitenaustausch stattgefunden, und das genannte Kriterium der Regeneration wäre erfüllt. Ähnliches ließe sich von der japanischen Großreichsbildung sagen, falls man deren Anfänge auf den japanisch-russischen Krieg von 1905 zurückführt. Aber auch dann wird man einschränkend hinzufügen müssen, dass eine wirkliche Weltreichsbildung in beiden Fällen erst sehr spät begonnen hat und von relativ kurzer Dauer war. Obendrein lässt sich aufgrund des frühen Scheiterns von Deutschland und Japan nicht definitiv klären, ob es dabei um Weltreichs- oder regionale Großreichsbildung ging. Im Unterschied zu Michael Doyle, der Deutschland und Frankreich in seiner vergleichenden Analyse der Großreichsbildungen einen zentralen Platz eingeräumt hat, werden beide hier nur als Beispiele für failed empires herangezogen.18
Neben dem Kriterium der zeitlichen ist das der räumlichen Ausdehnung wichtig: Eine Macht, die nicht über ein beachtliches Herrschaftsgebiet verfügt, wird man nicht ernstlich als Imperium bezeichnen können. So wäre die Donaumonarchie von ihrer Dauer her fraglos als eine imperiale Macht anzusprechen, aber kaum von ihrer räumlichen Ausdehnung her. Es handelte sich vielmehr um ein mitteleuropäisches Großreich, das im so genannten Konzert der europäischen Mächte mit Staaten wie Frankreich auf einer Ebene stand, doch keine Hegemonie innerhalb Gesamteuropas anstrebte. Seine Vormachtstellung beschränkte sich – selbst zu der Zeit, als die Habsburger die deutsche Kaiserkrone trugen – auf den mitteleuropäischen Raum. Eine Ausnahme bildet Kaiser KarlV., der zugleich König von Spanien und Herr der Niederlande war und über wesentlich größere Ressourcen als die später in Wien residierenden Kaiser verfügte. Mit der Trennung der spanischen und der deutschen Linie des Hauses Habsburg im Jahre 1556 sind die Merkmale der Imperialität auf Madrid übergegangen.19 Das berühmte «AEIOU», die Imperialformel Austriae est imperare in orbe ultimo (auf deutsch: «Alles Erden ist Oesterreich unterthan»), war danach nur noch eine historische Reminiszenz.20
Nun ist das Kriterium der räumlichen Ausdehnung auf Kontinentalimperien sehr viel leichter anzuwenden als auf Seeimperien, deren Macht und Einfluss sich weniger in der Zahl der beherrschten Quadratkilometer manifestiert als in der Kontrolle von Waren-, Kapital- und Informationsströmen sowie wirtschaftlicher Knotenpunkte.21 Hochseehäfen und gesicherte Handelsrouten, die ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen und das Vertrauen der Geschäftspartner in eine weltweit akzeptierte Währung sind bei Seereichen für die Machtentfaltung erheblich wichtiger als die physische Kontrolle von Territorien.22 Auf diesen zentralen Unterschied imperialer Machtbildung, der im Gegensatz von Land- und Seeimperien seinen Niederschlag gefunden hat, wird noch ausführlicher zurückzukommen sein. Hier ist zunächst nur von Interesse, dass geoökonomische Faktoren nicht als eine von der imperialen Machtbildung unabhängige Größe anzusehen sind. Die Kontrolle des Handels kann ebenso eine Quelle imperialer Macht sein wie die Beherrschung von Gebieten und Räumen. Spanien etwa verfügte am Ende des 16. Jahrhunderts über keine international bedeutende Handels- und Bankenstadt. Es war deshalb nicht in der Lage, die europäische Weltwirtschaft zu kontrollieren, und somit konnte es den Aufstieg Englands zu einem konkurrierenden, schließlich überlegenen Imperium nicht verhindern.
Gerade der Blick auf den beginnenden Niedergang Spaniens und den Aufstieg Englands zeigt aber auch, dass die Kontrolle der Waren- und Kapitalströme und die Beherrschung von Territorien nicht ohne weiteres voneinander zu trennen sind: Da Spanien bei dem Versuch scheiterte, die Herrschaft über die Niederlande zurückzugewinnen, beziehungsweise dort, wo die Spanier die territoriale Kontrolle wiedererlangten, der Handel zum Erliegen kam und die Wirtschaftsströme gleichsam einen Bogen um die spanisch dominierten Gebiete machten, verloren sie die ökonomische Kontrolle über Europa und damit auch ihre internationale Kreditfähigkeit. Eine Reihe von Staatsbankrotten war die Folge. Ein Sieg der Armada im Jahre 1588 und eine Invasion Englands wäre die letzte Chance Spaniens gewesen, auf dem Umweg über die Beherrschung von Territorien die Kontrolle über die Wirtschaftsströme zurückzuerlangen. Als dies fehlschlug, war der Scheitelpunkt der imperialen Machtentfaltung Spaniens überschritten.
Noch stärker als bei staatlichen sind bei imperialen Machtbildungen geopolitische und geoökonomische Faktoren ineinander verwoben. Weil sie immer wieder zusammenwirken, müssen sie auch gemeinsam betrachtet werden. Dabei können dann kleine Faktoren militärischer Überlegenheit, wie sie 1588 etwa aus der besseren Metallurgie der Engländer beim Guss von Kanonen resultierte, den Ausschlag für Aufstieg und Niedergang eines Imperiums geben.23 Vor allem aber zeigt das Beispiel, dass sich das Weltreichskriterium der räumlichen Ausdehnung nicht auf die physische Kontrolle von Räumen beschränken lässt, sondern auch in deren virtueller Kontrolle bei der Lenkung von Waren- und Kapitalströmen bestehen kann. Das Kriterium der räumlichen Ausdehnung ist somit mindestens ebenso komplex wie das der zeitlichen Dauer.
Das leitet über zu einem der schwierigsten Probleme bei der Bestimmung von Weltreichen, der Frage nämlich, was unter «Welt» zu verstehen ist. Es scheint nahe liegend, darunter die Erde in ihren globalen Ausmaßen zu begreifen. Das hätte zur Folge, dass eigentlich nur die USA, und auch sie erst nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, als Weltreich gelten dürften. Allenfalls wäre ihnen noch das Britische Empire als Vorläufer hinzuzufügen. Damit wäre einer vergleichenden Betrachtung von Weltreichen die Grundlage entzogen. Im Prinzip argumentieren jene Autoren so, die auf der historischen Einzigartigkeit der USA bestehen: Erstmals sei hier, wenngleich eher mit den Mitteln informeller Dominanz als denen formaler Herrschaft, eine erdumspannende Macht entstanden – womit dann jede weitere Beschäftigung mit der Geschichte der Weltreiche für das Verständnis der gegenwärtigen Lage bedeutungslos wäre. In gewisser Hinsicht folgen Michael Hardt und Antonio Negri in ihrem Buch Empire (2002) diesem Argumentationsmodell, wobei das von ihnen identifizierte neue Empire freilich nicht mit der amerikanischen Macht deckungsgleich ist; vielmehr hat es sich jenseits politischer Grenzen und Souveränitäten als neue Netzwerkstruktur formiert.
Nun zeigt allerdings schon ein etwas genauerer Blick auf die Macht der USA, dass sie nicht nur aus der Beherrschung des Erdraums, sondern ebenso aus der des Weltraums erwächst. Das bezieht sich auf die satellitengesteuerten Marschflugkörper, die das US-Militär in die Lage versetzen, an jedem Ort der Erde militärisch einzugreifen, aber auch auf die amerikanische Fähigkeit, die Expansionsphantasien und technologischen Visionen der Menschheit zu bündeln und zu kanalisieren – von der Landung auf dem Mond über die dauerhafte Stationierung von Menschen in einer Erdumlaufbahn bis zur Besiedlung des Mars. Der Weltbegriff bekommt infolgedessen transglobale Züge.24 Die Transglobalität ist eine wesentliche Machtressource des amerikanischen Imperiums. Doch das ist kein Grund dafür, dessen Unvergleichbarkeit mit früheren Imperien zu behaupten.
«Welt» ist eine relative und variable Größe, die nicht durch Invarianten wie den geographischen Umriss von Kontinenten oder die physischen Ausmaße des Globus festgelegt werden kann. Die Gestalt der Ökumene wird durch das jeweilige Blickfeld und den Horizont von Zivilisationen bestimmt, also eher durch kulturelle und technologische als durch rein geographische Faktoren.25 Was «Welt» jeweils ist, hat mit der Ausdehnung von Handelsbeziehungen, der Dichte von Informationsflüssen, der Ordnung des Wissens, den nautischen Fähigkeiten und vielem mehr zu tun. So hat sich der Weltherrschaftsanspruch der Imperien von der Antike bis heute immer stärker ausgeweitet, und infolgedessen ist inzwischen auf dem Globus tatsächlich nur noch Platz für ein einziges Imperium – gemäß dem Merkmal, wonach Imperien auf ihrer Einmaligkeit und Einzigartigkeit bestehen müssen.
Von der Antike bis in die Neuzeit hinein war Platz für mehrere Imperien, ohne dass dies deren Anspruch auf Imperialität dementiert hätte. Das Chinesische und das Römische Reich bestanden über Jahrhunderte als «Parallelimperien»26 nebeneinander; ihre Legitimitätsansprüche wurden dadurch in keiner Weise eingeschränkt. Die von beiden Imperien beherrschten «Welten» berührten einander nicht. Dagegen stellte die Koexistenz der byzantinischen mit den karolingischen, ottonischen und salischen Kaisern deren imperiale Legitimität in Frage: Sie gehörten derselben «Welt» an, und in der konnte es eigentlich nur einen kaiserlichen Oberherrn geben. Dementsprechend haben sie einander zumindest auf der zeremoniellen Ebene den Anspruch auf Ebenbürtigkeit abgestritten.27
Relativ unproblematisch wiederum konnten bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein das Britische Empire und das Reich der russischen Zaren koexistieren; die von ihnen beherrschten «Welten» waren voneinander getrennt und vor allem hinreichend unterschiedlich. Das bezieht sich nicht nur auf die von Briten und Russen jeweils dominierten Räume, wobei es zu einer Teilung Asiens in eine Nord- und eine Südhälfte entlang der großen Gebirgsketten vom Kaukasus bis zum Himalaja kam28, sondern mehr noch auf die Art der von beiden ausgeübten Herrschaft: Das über administrative, wenn nötig militärische Kontrolle integrierte Kontinentalimperium der Russen und das wesentlich über wirtschaftlichen Austausch zusammengehaltene britische Imperium der Seewege bedrohten sich nicht gegenseitig und stellten einander auch legitimatorisch nicht in Frage – jedenfalls solange die Russen darauf verzichteten, ihrem «Drang zum warmen Meer» freien Lauf zu lassen.
Das war bei den Nachfolgeimperien der Briten und Russen, den USA und der Sowjetunion, in dieser Form nicht mehr der Fall: Schon durch ihre jeweilige Leitvorstellung, ihre Mission, leugneten sie die Existenzberechtigung des anderen. Obendrein konkurrierten sie in denselben Räumen und Sphären: vom Vorstoß der Sowjetunion auf die Weltmeere durch den Aufbau einer beachtlichen Kriegsflotte bis zum Wettlauf um die Vorherrschaft im Weltraum. Für die USA und die Sowjetunion war, im Unterschied zum Britischen Empire und zum Zarenreich, die Existenz des jeweils anderen eine Einschränkung des eigenen imperialen Führungsanspruchs. Sie teilten eine gemeinsame «Welt», während Zarenreich und Britisches Empire in ihren eignen «Welten» herrschten.
Was zwischen die koexistierenden «Welten» des britischen Seereichs und des russischen Kontinentalimperiums jedoch nicht mehr passte, war ein Dritter, der in dem verbliebenen Zwischenraum ein weiteres Imperium zu errichten suchte. Zwangsläufig musste er mit einem der beiden Imperien in Konflikt geraten, und der uferte regelmäßig in einen großen Krieg aus, in dem sich schließlich auch das andere Imperium gegen ihn wandte. Man kann es mithin als die Handlungslogik der beiden auf ihre je eigenen «Welten» beschränkten Imperien bezeichnen, dass sie nach einer Zeit des Beobachtens und Abtastens gegen den Dritten zusammenarbeiteten und ihn an der Machtentfaltung hinderten. Das wiederholte sich von Napoleon über WilhelmII. bis zu Hitler und Kaiser Hirohito, und dabei war es gleichgültig, mit welchem der beiden Imperien der Dritte die strategische Konfrontation suchte. Für Napoleon war es von Anfang an das Britische Empire, während WilhelmII. und Hitler die Auseinandersetzung mit den Briten möglichst zu vermeiden suchten, indem sie ihre Vorherrschaftsansprüche entweder auf den europäischen Kontinent beschränkten oder nach Osten richteten. Napoleon und Hitler sind wesentlich im Osten gescheitert, WilhelmII. dagegen hat Thron und Reich im Konflikt mit dem Westen verloren. Japan schließlich, dem es zu Beginn des 20. Jahrhunderts gelungen war, sich gegen Russland durchzusetzen, scheiterte im Zweiten Weltkrieg an den USA, die auch hier die strategische Kooperation mit der Sowjetunion gesucht hatten. In allen Fällen freilich legten die Imperative des See- wie des Kontinentalimperiums ein Zusammenwirken gegen den Dritten nahe, und die Handlungsimperative, die aus den jeweiligen imperialen «Welten» erwuchsen, setzten sich gegen alle Ziele und Absichten durch, die dem entgegenstanden.29
Wie lassen sich diese imperialen «Welten», deren äußere Begrenzungen relativ leicht erkennbar sind, näherhin beschreiben? Was kennzeichnet sie im Innern, und worin unterscheiden sie sich von nichtimperialen Welten? Und nicht zuletzt: Gibt es Merkmale, die den Binnenräumen von Kontinental- und Seeimperien gemeinsam sind?
Auf das für imperiale Räume charakteristische Zentrum-Peripherie-Gefälle wurde bereits hingewiesen; bei den Imperien, die auf der Beherrschung von Räumen beruhen, ist es offenbar ebenso anzutreffen wie bei denen, die ihre Macht vor allem aus der Kontrolle von Strömen gewinnen. Daneben findet sich in der Literatur immer wieder der Hinweis auf den multiethnischen beziehungsweise multinationalen Charakter von Imperien. Diese Charakterisierung ist jedoch problematisch, weil einerseits trivial – ausgedehnte Reiche umfassen zwangsläufig mehrere ethnische beziehungsweise nationale Gemeinschaften – und andererseits politisch definiert, denn darüber, was ethnische und nationale Unterschiede sind, ob sie akzeptiert oder unterdrückt werden, verfügt letztlich das imperiale Zentrum: als ein Machtinstrument im Sinne des divide et impera.30
Vor allem im europäischen Rahmen ging es im Verhältnis zwischen den westeuropäischen Nationalstaaten und den mittel- und osteuropäischen Reichen stets auch um die Frage, was deren jeweilige Stärken und was ihre Schwächen seien: nationale Geschlossenheit oder multiethnische Vielfalt. Hatte sich unter dem Eindruck der notorischen Schwäche des Osmanischen Reichs sowie der zentrifugalen Tendenzen in der Donaumonarchie und im Zarenreich zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Auffassung durchgesetzt, der Nationalstaat sei dem multiethnischen Reichsverband im Konfliktfall überlegen – eine Auffassung, die durch den Ausgang des Ersten Weltkriegs als bestätigt angesehen werden konnte –, so haben der Aufstieg der USA und der Sowjetunion sowie die weltpolitische Marginalisierung der europäischen Nationalstaaten das Pendel wieder in die entgegengesetzte Richtung zurückschwingen lassen. Offenbar handelt es sich hier um Eindrücke und Vorstellungen, die den jeweiligen Zeitumständen geschuldet sind, und nicht um empirisch belastbare Kriterien wissenschaftlicher Analyse.
Ein Blick auf den prozentualen Anteil des dominierenden Volkes innerhalb eines Imperiums zeigt, dass daraus kaum Schlüsse bezüglich der räumlichen Ausdehnung und zeitlichen Dauer des Reichs gezogen werden können: So betrug der Anteil von Han-Chinesen im Chinesischen Reich die längste Zeit über um 90 Prozent; der Anteil der Russen innerhalb des Zarenreichs lag 1897 bei 44 Prozent, der der Deutsch-Österreicher in der Donaumonarchie während der letzten Volkszählung von 1910 bei etwa 24 Prozent und der der Briten in ihrem Weltreich 1925 bei 10 Prozent.31 Zumindest in kurz- und mittelfristiger Perspektive lassen diese Zahlen kaum weiter reichende Schlussfolgerungen zu. Ein allgemeines Kriterium von Imperien ist daraus nicht zu gewinnen.
Imperialer Interventionszwang, Neutralitätsoptionen und der Melier-Dialog bei Thukydides
Aufschlussreicher als der multiethnische beziehungsweise multinationale Charakter von Imperien ist der Umstand, dass es für die Zentralmacht innerhalb der von ihr beherrschten imperialen «Welt» offenbar einen Zwang zur politischen und militärischen Intervention gibt. Einem solchen Zwang kann sie sich nicht entziehen, ohne ihre Position zu gefährden. Mit anderen Worten: Ein Imperium kann sich gegenüber den Mächten, die zu seinem Einflussbereich gehören, nicht neutral verhalten, und dementsprechend hat es eine starke Neigung, ihnen diese Möglichkeit ebenfalls nicht zuzugestehen. Nur innerhalb einer «Welt»-Ordnung, die vom Staatenmodell geprägt ist, besteht eine solche Neutralitätsoption. Ein Imperium dagegen, das bei Konflikten innerhalb seiner «Welt» oder an deren Peripherie fortgesetzt neutral bleibt, verliert zwangsläufig seinen imperialen Status. Auch das unterscheidet Imperien von Staaten. Viele der jüngsten Irritationen im amerikanisch-europäischen Verhältnis dürften daraus erwachsen sein, dass dieser Unterschied nicht genügend beachtet wurde.
Dass Imperien und in etwas schwächerer Form auch Hegemonialmächte unter permanentem Interventionszwang stehen, hat wesentlich mit dem Glaubwürdigkeitsproblem zu tun, dem sie in ganz anderer Weise ausgesetzt sind als nichtimperiale Mächte. Ein berühmtes Beispiel dafür ist der Konflikt zwischen Athenern und Meliern, wie ihn Thukydides in seiner Geschichte des Peloponnesischen Krieges geschildert hat.32 Dabei geht es um den Wunsch der Melier, sich aus dem Krieg zwischen Athen und Sparta herauszuhalten. Die Melier erklärten, Athen könne die Neutralität der kleinen Insel in der Ägäis, einem von Athen beherrschten Raum, doch ohne weiteres akzeptieren; im Krieg gegen Sparta falle die melische Beteiligung ohnehin weder politisch noch militärisch ins Gewicht, während die Großzügigkeit der Athener, wenn sie die Melier nicht in den Krieg hineinzwängen, allenthalben gerühmt werde. Dagegen wiesen die Athener darauf hin, dass, gäben sie in diesem Falle nach, auch andere Verbündete eine ähnliche Entscheidungsfreiheit fordern würden. Die Macht Athens würde in kürzester Zeit zerbröseln, oder es wäre in zahllosen Fällen gezwungen, seine politische Autorität mit Waffengewalt wiederherzustellen. Deswegen sollten die Melier ihren Befehlen gehorchen, oder ihre Stadt werde vernichtet werden. Vielleicht hätte Athen die melische Neutralität tolerieren können, wenn es nicht mit einem starken Flottenverband vor Melos erschienen wäre. So aber bestand die Möglichkeit eines Rückziehers nicht mehr, ohne dass Athens Autorität erheblichen Schaden genommen hätte. Jeder Kompromiss mit den Meliern wäre auf einen Prestigeverlust hinausgelaufen, und Athen hätte dadurch an Macht und Einfluss verloren.
Man hat über den Melier-Dialog gesagt, sein wesentliches Kennzeichen sei das Aneinander-Vorbei-Reden beider Seiten.33 Das ist sicher richtig beobachtet, aber die scheinbaren Missverständnisse resultieren wesentlich aus der Inkongruenz einer imperialen Handlungslogik mit den Erwartungen einer kleineren gegenüber einer größeren Macht. Athen hat den Wunsch der Melier, als gleichberechtigter Partner anerkannt zu werden, nicht akzeptiert.
In der Literatur zu Thukydides wie zur Geschichte des athenischen Seereichs finden sich zwei konträre Interpretationen: Die eine besagt, dass Thukydides den Athenern durch den Ausgang der melischen Angelegenheit Recht gegeben habe: Melos fiel, die Männer wurden getötet, die Frauen und Kinder in die Sklaverei verschleppt. Gegen die Logik des Tatsächlichen, wie sie von den Athenern vertreten wurde, hätten die Melier zu ihrem eigenen Schaden wesentlich auf Hoffnungen und Wünsche gesetzt, und das habe sie zu einer Fehleinschätzung der Lage verleitet, die schließlich ihr Untergang gewesen sei. Diese Interpretation begnügt sich nicht damit, das Pathos des Faktischen in der athenischen Argumentation herauszustellen. Vielmehr gibt sie den Athenern auch in der Sache Recht: Angesichts der schwierigen Situation der Stadt im Krieg mit den Spartanern, der Wankelmütigkeit einiger Bundesgenossen sowie des Umstandes, dass Renitenz fast immer Schule macht, sei ihnen gar nichts anderes übrig geblieben, als Melos zu einer Entscheidung für oder gegen die imperiale Macht im ägäischen Raum zu zwingen; jedes noch so kleine Zugeständnis wäre ein folgenreicher Fehler gewesen. Demnach bestünde die fehlende Neutralitätsoption von Imperien darin, dass sie, wenn sie ernsthaft herausgefordert werden, ihre «Welt» mit der Alternative des Für oder Wider die Vormacht überziehen und ein neutrales Heraushalten als verdeckte Feinderklärung ansehen müssen. US-Präsident Bushs Satz «Who’s not for us is against us» wäre dann eine offenherzige Darlegung imperialer Logik.
Dem steht jene Interpretation des Melier-Dialogs gegenüber, derzufolge sich dessen Bedeutung nicht unmittelbar aus den Ereignissen um Melos erschließt, sondern erst aus der Einbettung in die Gesamtdarstellung des Krieges bei Thukydides. Hier spielt der im Anschluss an den Melier-Dialog beginnende Bericht über die athenische Expedition gegen Syrakus eine zentrale Rolle, die den Anfang vom Ende der athenischen Machtstellung markiert. In maßloser Selbstüberschätzung habe Athen mit diesem Flottenunternehmen seine Fähigkeiten und Kräfte überdehnt und damit selbst seinen Zusammenbruch eingeleitet.34
Wie aber hatte es überhaupt zu einer so verhängnisvollen Abweichung vom ursprünglichen Kriegsplan des Perikles kommen können? Der nämlich hatte in kluger Abwägung der Potenziale Athens und Spartas den Athenern eine Politik der strategischen Defensive verordnet, wonach sie während des Krieges auf jede weiter reichende Eroberung verzichten und sich einstweilig mit dem Status quo bescheiden sollten35; wenn sie sich daran hielten, sei ihnen am Ende der Sieg im Kampf gegen die Peloponnesier sicher. Dieser Interpretation zufolge ist es die bereits im Melier-Dialog zum Ausdruck kommende Hybris – die «Arroganz der Macht»36, um eine viel zitierte Wendung William Fulbrights aufzugreifen –, an der Athen gescheitert ist. Die athenische Argumentation gegenüber den Meliern wäre demnach statt vom Pathos des Faktischen von Verblendung bestimmt, die auf direktem Weg in die politisch-militärische Katastrophe führen musste: Während die Athener von politischer Glaubwürdigkeit redeten, hätten ihre Worte und Taten in Wahrheit vom Verlust der politisch-moralischen Selbstbindungen gezeugt, auf denen der Zusammenhalt des Seebundes stärker beruht habe als auf militärischer Macht. Mit ihrem Schwinden habe sich die athenische Hegemonie in ein Imperium verwandelt; erst danach hätten sich die Bündnispartner vom lastenden Druck der Vormacht zu befreien versucht.
Die beiden Interpretationen des Thukydides bringen ziemlich genau die gegensätzlichen Beurteilungen der US-amerikanischen Politik während der letzten Jahre zum Ausdruck: Einerseits wurde sie auf die Imperative zurückgeführt, die von der Logik des Imperiums vorgegeben werden; andererseits warf man den USA vor, sie hätten ihre moralische Glaubwürdigkeit durch rücksichtslose Machtpolitik zerstört – der amerikanische Einfluss in der Welt sei sehr viel sicherer auf moralische Glaubwürdigkeit gegründet als auf den Einsatz von Flugzeugträgerverbänden, Marschflugkörpern und Bodentruppen. Vor allem Jürgen Habermas hat in mehreren Artikeln und Interviews die letztgenannte Auffassung vertreten.37 Was dabei freilich unterstellt wird, ist eine weitgehende Entscheidungsoffenheit, in der die verantwortlichen Politiker die eine oder die andere Antwort auf eine Herausforderung geben können. Diese Annahme ist die Grundlage dafür, dass von den meisten Kritikern bestimmte Personen für die US-amerikanische Politik verantwortlich gemacht worden sind. So geht auch Habermas davon aus, die USA hätten nach dem Ende des Ost-West-Gegensatzes vor der Wahl gestanden, «ob die übrig gebliebene Supermacht zu ihrer Führungsrolle auf dem Weg zu einer kosmopolitischen Rechtsordnung zurückkehren oder in die imperiale Rolle eines guten Hegemons jenseits des Völkerrechts zurückfallen würde»38, und er macht dafür, dass sie sich für Letzteres entschieden haben, vor allem den Einfluss neokonservativer Berater auf die Bush-Administration verantwortlich.
Demgegenüber misst eine Herangehensweise, die nach der Logik des Imperiums und den aus ihr erwachsenden Handlungsimperativen fragt, den Einflüssen und Entscheidungen von Personen eine geringere Bedeutung zu. Vielmehr beschäftigt sie sich mit den Strukturen und Vorgaben, die deren Handlungsspielraum definieren. Deswegen fragt sie nicht danach, welche Relevanz das christliche Erweckungserlebnis für die Politik George W. Bushs hat, untersucht nicht die Rolle von Paul Wolfowitz, dem stellvertretenden Verteidigungsminister in der Bush-Administration, und geht auch nicht davon aus, dass der Einfluss der Neokonservativen auf die US-Politik von alles entscheidender Bedeutung sei. Weiterhin interessiert sie sich nicht sonderlich für die psychische Verfasstheit der USA nach den Anschlägen vom 11. September 2001.39 Stattdessen sucht sie nach den Handlungslogiken imperialer Macht.
Gewiss setzen sich solche Imperative nie von alleine durch, und sie können von den politischen Akteuren stets auch verfehlt oder missverstanden werden. Moralische Glaubwürdigkeit etwa gehört zweifellos zu den Ressourcen imperialer Macht. In dieser Perspektive ist sie allerdings nicht der Maßstab der Politik – sie ist eines ihrer Mittel: Die Logik des Imperiums weiß moralische Glaubwürdigkeit sehr wohl als Machtfaktor einzusetzen, aber sie würde sich nie selber an ihr messen lassen.
Was die imperiale Logik ausmacht, was ihre Vorgaben sind und welche Möglichkeiten es gibt, sich ihr zu entziehen – all dies soll nachfolgend an vergangenen Imperien untersucht und zur Diskussion gestellt werden.
2. IMPERIUM, IMPERIALISMUS UND HEGEMONIE: EINE NOTWENDIGE DIFFERENZIERUNG
Nach wie vor steht die Betrachtung der Imperien unter den Vorgaben der Imperialismustheorien, in deren Sicht die Entstehung großer Reiche allein auf das Wirken expansionsorientierter Eliten zurückzuführen ist: Aus Prestigebedürfnis, Streben nach Machtsteigerung oder Gier nach noch größerem Profit hätten einige große Staaten eine Politik der wirtschaftlichen Durchdringung fremder Räume oder der machtpolitischen Annexion betrieben, als deren Ergebnis die europäischen Kolonialreiche entstanden seien. Bis heute stehen sie im Mittelpunkt der meisten Diskussionen über Imperien; deshalb sollen sie hier etwas genauer in Augenschein genommen werden.
Beschäftigt man sich allein mit der politischen Publizistik im Europa des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts, kann man tatsächlich den Eindruck gewinnen, Imperienbildung sei das alleinige Ergebnis der imperialistischen Bestrebungen von Eliten.1 Die Konkurrenz der europäischen Mächte untereinander war dabei entscheidend: Wer, so die Befürchtung, bei dem Rennen um die Vergrößerung der politischen und wirtschaftlichen Macht zurückbleibe, verliere nicht bloß seinen Konkurrenten gegenüber an Terrain, sondern sei insgesamt auf die Bahn des Niedergangs geraten.2 Nur wer sich im Wettlauf um die attraktivsten Anteile der Weltherrschaft und die wichtigsten Ressourcen und Märkte der Weltwirtschaft behaupte, könne als eigenständige politische Macht überleben. Nationalismus, Sozialdarwinismus und ein Klima der Nervosität3 versetzten Europa sowie die Flügelmächte Russland und die USA in einen Zustand fiebriger Erregtheit: Mit einem Mal schien die Zukunft des Kontinents von der Verteilung von Macht- und Einflusszonen außerhalb Europas abzuhängen.
Die Phase wilder, hektischer Konkurrenz kann im Nachhinein kaum als eine Abfolge rationaler, wohlbedachter Entscheidungen begriffen werden, und letztlich hat der Kolonialismus den Europäern keineswegs das eingebracht, was sie von ihm erhofften. Im Hinblick auf die ökonomischen Imperialismustheorien widerspricht das dem zu erwartenden Ergebnis: Der Imperialismus wird in ihnen als eine der brutalsten Formen von Ausbeutung und Unterdrückung beschrieben, die es in der Geschichte gegeben hat. Das ist der Kolonialimperialismus zweifellos gewesen, aber trotz seiner gewalttätig-exploitiven Methoden hat er tendenziell so viel gekostet, wie er eingebracht hat. Volkswirtschaftlich betrachtet, war er eine große politisch-ökonomische Fehlkalkulation.
Die selbstzerstörerische Dynamik des Kapitalismus: die ökonomischen Imperialismustheorien
Wie lässt sich eine solche Fehlkalkulation erklären, zumal sie nicht auf ein Land oder den europäischen Kontinent beschränkt blieb, von wo aus es zum berühmt-berüchtigten Scramble for Africa kam4, sondern weltweit anzutreffen war? Auch die japanische und die amerikanische Politik wurden damals vom imperialistischen Fieber befallen: Japan griff auf das ostasiatische Festland über, vor allem auf die Mandschurei, wo es mit Russland in Konflikt geriet; die Folge war der russisch-japanische Krieg von 1904/05, den man als einen klassischen imperialistischen Krieg bezeichnen kann. Und die USA setzten sich nach dem spanisch-amerikanischen Krieg von 1898 nicht nur im mittelamerikanisch-karibischen Raum fest, sie annektierten auch die Philippinen, wo sie in einen mehrjährigen, verlustreichen Guerillakrieg hineingezogen wurden.5
Wurde jene Fehlkalkulation durch eine Hysterie bewirkt, die sich epidemieartig ausgebreitet hat und es den Eliten unmöglich machte, ihre Interessen rational zu verfolgen? Gaben tatsächlich Überakkumulation beziehungsweise Unterkonsumption in den ökonomisch fortgeschrittensten Ländern den Ausschlag dafür, dass immer neue Märkte für Waren und Anlagemöglichkeiten des Kapitals erschlossen werden mussten, wie speziell die marxistischen Imperialismustheoretiker behaupteten? Oder war, wie Joseph Schumpeter meinte, der Imperialismus des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts ein letztes Aufbegehren vormoderner Eliten, die sich dem neuen Geist von Handel und Wandel nicht beugen wollten und deswegen Eroberungsprojekte in Gang setzten, bei denen eigentlich erkennbar war, dass sie sich nie und nimmer lohnen würden?6
Im Prinzip gibt es für den Schub der Großreichsbildungen im 19. Jahrhundert und die mit ihm verbundenen Konflikte zwei Erklärungsmöglichkeiten: eine, die von der grundsätzlichen Irrationalität dieser Entwicklung ausgeht und den Einbruch der Irrationalität in eine sich zunehmend rationalisierende Welt als das Problem ansieht; und eine, die den Imperialismus als rationales Agieren der mächtigsten Akteure innerhalb der kapitalistischen Welt versteht, wobei die Konkurrenz des nationalen Kapitals sowie dessen Amortisationserfordernisse die Richtung der imperialistischen Expansion vorgeben. Letzteres erklärt dann auch, warum es in den entsprechenden Theorien nur zum geringeren Teil um Entstehung und Aufstieg der großen Reiche geht, sondern vor allem um die Frage, ob der Kapitalismus eine Zukunft habe und, wenn ja, ob dies eine Epoche der Barbarei sein werde, wie Rosa Luxemburg prophezeite, oder ob sich die kapitalistische Dynamik durch sozialpolitische Reformen bändigen lasse, wie John Atkinson Hobson meinte.
Hobson, der an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert als Erster eine rein ökonomisch fundierte Imperialismustheorie entwickelte, an der sich die meisten späteren Imperialismustheoretiker abgearbeitet haben, war der Auffassung, imperialistische Politik sei, gesamtgesellschaftlich betrachtet, keineswegs gewinnbringend. Er hielt sie, im Gegenteil, für ein überaus verlustreiches Geschäft. In keinem Fall stünden die Erträge des Handels mit den wirtschaftlich unterentwickelten, teilweise nicht einmal erschlossenen Territorien in einem vertretbaren Verhältnis zu den Militär- und Verwaltungskosten, die der Unterhalt des Empire verschlinge, von den Investitionen in die Infrastruktur jener Räume ganz zu schweigen.
Aber wer war dann am Aufbau derart unrentabler Imperien interessiert? Weder die Steuerzahler noch die Händler oder Unternehmer, meinte Hobson, sondern allein das Finanzkapital, das nach profitablen Anlagemöglichkeiten suche. Imperiale Expansionspolitik eröffne solche Möglichkeiten – jedenfalls wenn der Staat entsprechende Garantien gebe und bereit sei, in den überseeischen Gebieten militärisch zu intervenieren und die Investitionen gegen Aufstände und Bürgerkriege zu sichern, zur Not sogar die politische Kontrolle dort zu übernehmen.7 Um den Staat und die Mehrheit seiner Bürger dazu zu bringen, dem Finanzkapital ertragreiche und sichere Investitionsmöglichkeiten in Übersee zu eröffnen, manipuliere dieses die öffentliche Meinung; es habe nationalistische Instinkte geweckt und eine proimperialistische Stimmung in der Bevölkerung geschürt, durch die das Interesse einiger Kapitalisten an überseeischen Investitionen zu einer nationalen Aufgabe erhoben worden sei. Im Grunde war der Imperialismus für Hobson also ein Projekt der inneren Umverteilung in ökonomisch fortgeschrittenen Gesellschaften.
Anders als die späteren marxistischen Imperialismustheoretiker war Hobson nicht der Auffassung, der Kapitalismus werde ohne die Expansion nach Übersee und die politisch-militärische Absicherung des dort investierten Kapitals zusammenbrechen. Er war vielmehr überzeugt, das Problem der Unterkonsumption in den kapitalistischen Ländern lasse sich mittelfristig durch eine aktive Sozialpolitik lösen, die zu einer Hebung der Massenkaufkraft führen werde. Die politische Domestikation des Kapitalismus und die Entwicklung effektiver Sozialsysteme war danach die Alternative zum aggressiv-imperialistischen Ausgreifen in alle Welt.
John Maynard Keynes, der Theoretiker der antizyklischen Wirtschaftssteuerung, ist durch Hobsons Imperialismuskritik in vielfacher Hinsicht angeregt und beeinflusst worden. Rosa Luxemburg und Wladimir Iljitsch Lenin dagegen haben in den parteiinternen Auseinandersetzungen mit den sozialreformerischen beziehungsweise gewerkschaftlich orientierten Bestrebungen ihrer Parteien die Perspektive einer «sozialdemokratischen» Reformierbarkeit des Kapitalismus entschieden zurückgewiesen und dessen immanenten Zwang zu imperialistischer Expansion herausgestellt. Ihre Imperialismustheorien hatten von vornherein die Funktion, den Fokus ganz auf die Überwindung des Kapitalismus zu richten: Er musste revolutionär besiegt werden, und dafür, dass das gelingen konnte, sorgte die imperialistische Konkurrenz: Die großen Mächte würden miteinander in Krieg geraten, sich schwächen und so den Sieg der sozialistischen Revolution ermöglichen.