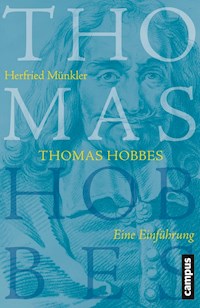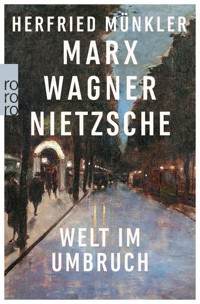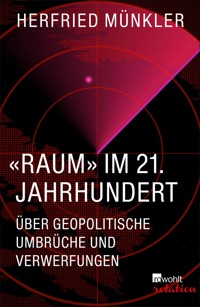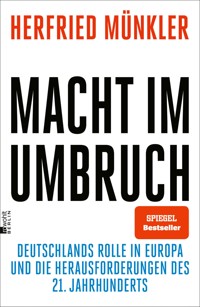
24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wir alle spüren, dass Deutschland eine Macht im Umbruch ist, ein Land, das tiefgreifende Veränderungen erfährt. Was bedeutet der Wandel der Welt für das Selbstverständnis Deutschlands, vor welchen Herausforderungen stehen wir, und was müssen die Deutschen jetzt tun, um nicht abgehängt zu werden, sondern aktiv gestalten zu können, innen- wie außenpolitisch? Herfried Münkler kreist die neuralgischen Punkte der deutschen Politik ein und entwirft hellsichtig eine Strategie für das künftige Agieren. Die Frage nach der neuen Rolle Deutschlands wird wesentlich davon abhängen, ob es dem größten Land in der Mitte Europas gelingt, seine ökonomische, politische und kulturelle Macht so einzusetzen, dass ein Auseinanderfallen Europas verhindert werden kann. Hierfür sind nicht nur grundlegende Reformen dringend nötig, Deutschland und die EU müssen sich auch als widerstandsfähig gegen Russland, selbstbewusst im Umgang mit China und, falls es nötig werden sollte, als unabhängig von den USA erweisen. Eine tiefschürfende, richtungsweisende Analyse, die zeigt, wie Deutschlands Rolle neu gedacht werden kann und muss, wenn Europa sich im 21. Jahrhundert im Spiel der großen Mächte behaupten möchte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 611
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Herfried Münkler
Macht im Umbruch
Deutschlands Rolle in Europa und die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts
Über dieses Buch
Wir alle spüren, dass Deutschland eine Macht im Umbruch ist, ein Land, das tiefgreifende Veränderungen erfährt. Was bedeutet der Wandel der Welt für das Selbstverständnis Deutschlands, vor welchen Herausforderungen stehen wir, und was müssen die Deutschen jetzt tun, um nicht abgehängt zu werden, sondern aktiv gestalten zu können, innen- wie außenpolitisch?
Herfried Münkler kreist die neuralgischen Punkte der deutschen Politik ein und entwirft hellsichtig eine Strategie für das künftige Agieren. Die Frage nach der neuen Rolle Deutschlands wird wesentlich davon abhängen, ob es dem größten Land in der Mitte Europas gelingt, seine ökonomische, politische und kulturelle Macht so einzusetzen, dass ein Auseinanderfallen Europas verhindert werden kann. Hierfür sind nicht nur grundlegende Reformen dringend nötig, Deutschland und die EU müssen sich auch als widerstandsfähig gegen Russland, selbstbewusst im Umgang mit China und, falls es nötig werden sollte, als unabhängig von den USA erweisen.
Eine tiefschürfende, richtungsweisende Analyse, die zeigt, wie Deutschlands Rolle neu gedacht werden kann und muss, wenn Europa sich im 21. Jahrhundert im Spiel der großen Mächte behaupten möchte.
Vita
Herfried Münkler, geboren 1951, ist emeritierter Professor für Politikwissenschaft an der Berliner Humboldt-Universität und eine unverzichtbare, prägende Stimme in den Debatten unserer Gegenwart. Viele seiner Bücher gelten als Standardwerke, etwa «Imperien», «Die Deutschen und ihre Mythen», «Der Große Krieg» oder «Die neuen Deutschen» (mit Marina Münkler), allesamt Bestseller. Zuletzt erschien «Welt in Aufruhr», das ebenfalls lange auf der «Spiegel»-Bestsellerliste stand. Herfried Münkler wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Wissenschaftspreis der Aby-Warburg-Stiftung, dem Carl Friedrich von Siemens Fellowship, dem Preis der Leipziger Buchmesse und dem Bruno-Kreisky-Preis für das politische Buch.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, April 2025
Copyright © 2025 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
ISBN 978-3-644-02172-3
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Marina
Einleitung: Geopolitik, Verteidigung der Demokratie, deutsche Bedenklichkeit
Vor wenigen Jahren noch hätte man ein Buch über die Rolle Deutschlands in Europa und der Welt mitsamt den politischen Herausforderungen, denen sich die Deutschen stellen müssen, kaum mit einem Widerstreit der großen Mächte oder einem Umbruch der Macht in Verbindung gebracht. In einer vor zehn, zwanzig Jahren verfassten Darstellung hätte als Thema der Bedeutungsverlust von Grenzen und Grenzregimen dominiert, des Weiteren der ständig wachsende Austausch von Gütern und Wissen im globalen Rahmen, dazu die Vorbildfunktion von Schwellenländern bei der Überwindung von Armut und Rückständigkeit, und das alles wäre obendrein von der Vorstellung des Fortschritts als analytischer Leitidee durchtränkt gewesen. Wenn vom Auf und Ab der großen Mächte die Rede gewesen wäre, dann mit Blick auf die Vergangenheit.[1] Der Blick auf die Gegenwart und Zukunft der Mächte hätte jedoch unter der Annahme gestanden, dass deren politische Feindschaft inzwischen in wirtschaftliche Konkurrenz überführt worden sei, dass für ihre politische Position in der Welt Wirtschaft, Wissenschaft und Technologie sehr viel wichtiger seien als die zahlenmäßige Größe ihrer Armeen und der Anteil des Wehretats am Bruttoinlandsprodukt. Wenn es denn überhaupt so etwas wie einen Widerstreit der großen Mächte gab, dann wurde er in den Laboren und Forschungsabteilungen der führenden Unternehmen ausgetragen, weswegen die Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung für die Zukunftsaussichten einer Großmacht als sehr viel relevanter galten als die Investitionen in die Modernisierung der Waffensysteme. So war das vor nicht allzu langer Zeit.
Man muss sich das noch einmal in seiner ganzen Bandbreite vor Augen führen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was sich im Verlauf des zurückliegenden Jahrzehnts verändert hat und welche Folgen das für unseren Erwartungshorizont hat – und noch haben wird. Einige dieser Veränderungen waren disruptiv[2] und sind uns schlagartig als solche klar geworden, wie das etwa Ende Februar 2022 bei Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine der Fall war. Kurz danach war bereits von einer «Zeitenwende» die Rede, auch wenn zunächst an der Politik der deutschen Regierung nicht erkennbar war, dass sie sich bewusst war, was sie da erklärt hatte. Daneben gab und gibt es aber auch Entwicklungen, die sich langsam und unauffällig vollzogen haben und erst nach einiger Zeit als grundstürzende Veränderungen der politischen Konstellationen sichtbar wurden: Der quantitative Rückgang der Demokratien und die Vermehrung der autoritär-autokratischen Regime im Weltmaßstab[3] gehören ebenso dazu wie der allmähliche und anfangs nicht weiter thematisierte Anstieg der Migrationsbewegungen in Richtung Europa und Nordamerika, die im Jahr 2015 dann mit der europäischen Migrationskrise wie ein politischer Tsunami in die deutsche Gesellschaft einbrachen und seitdem den öffentlichen Diskurs beherrschen.
Die Beobachtung, dass die demokratischen Ordnungen weltweit in die Minderheit geraten sind und es selbst in der Europäischen Union nicht mehr selbstverständlich ist, dass es sich bei ihr um eine Gemeinschaft demokratischer Rechtsstaaten handelt, weil einige der Mitgliedstaaten lieber «illiberale Demokratien» sein wollen als Wächter individueller Freiheitsrechte, hat die selbstzufriedene Sorglosigkeit, wonach die politische Zukunft liberal und demokratisch sein werde, in Zweifel gezogen; stattdessen steht die Frage nach der Zukunftsfähigkeit des Liberalen und Demokratischen wieder auf der Agenda.[4] Das war in Deutschland schon einmal Ende der 1920er, Anfang der 1930er Jahre der Fall. Die sich ausbreitende Vorstellung, wonach der Zustrom von Migranten die Aufnahme- und Integrationsfähigkeit der westlichen Gesellschaften auf Dauer überfordere, hat die Bedeutung von Grenzen und die Errichtung von Kontrollregimen an diesen Grenzen wieder ins Zentrum der politischen Aufmerksamkeit gerückt. An die Stelle des Strömens von Gütern und Kapitalien, Touristen und Globetrottern, deren Bewegungsfreiheit durch staatliche Grenzen unnötig behindert werde, wie die Modernisierungsagenda zu Beginn des 21. Jahrhunderts lautete, trat die Wertschätzung von Grenzen als Schleusen und Abwehrlinien einer sonst unkontrollierbaren Migrationsbewegung.[5] Diese Umkehrung der politischen Präferenzen vom Strömen zum Blockieren wurde durch die Covid-19-Pandemie weiter verstärkt, als die alten Staatsgrenzen nicht nur in Kontrollschleusen, sondern in regelrechte Barrieren verwandelt wurden – in dieser Form zwar nicht auf Dauer, aber die Grenzregime, die in Europa mit der Einrichtung des Schengenraums gänzlich verschwinden sollten, sind geblieben und werden bei wechselnden Begründungen wohl auch dauerhaft bleiben. Wir haben uns inzwischen wieder an sie gewöhnt.
Nur an die unvorhergesehene Rückkehr des Krieges nach Europa, und zwar des großen Krieges zwischen Staaten, können und wollen sich die meisten Deutschen nicht gewöhnen: die einen, weil sie nicht wollen, dass ein das Völkerrecht missachtender Angriffskrieg erfolgreich ist; die anderen, weil der zwischenstaatliche Krieg die Gefahr einer weiteren, womöglich nuklearen Eskalation in sich trägt und bei seiner Fortdauer eine räumliche Ausweitung zu befürchten ist. Einige von ihnen fordern, den Krieg möglichst umgehend durch Verhandlungen zu beenden, andere wollen dies sogar durch die Einstellung der deutschen Waffen- und Munitionslieferungen an die Ukraine erzwingen, wobei sie darauf setzen, dass die Ukraine dann innerhalb kürzester Zeit kapitulieren müsse.[6] Damit hat der deutsche Pazifismus, der in den 1980er Jahren die politische Landschaft geprägt hat, seinen Charakter verändert: Es ist keiner mehr der eigenen Friedfertigkeit, die ein Vorbild für andere sein soll, sondern einer, der anderen, in diesem Fall auch noch den Angegriffenen, die Kapitulation aufzwingen will, um seine Ruhe zu haben. Abgesehen davon, dass der Pazifismus damit seine moralische Unschuld verloren hat, wird die angestrebte Ruhe in einer vom Widerstreit der Mächte geprägten Welt, einer Welt im Umbruch, nicht mehr zu haben sein.
Bemerkenswert an dieser vor allem in Deutschland geführten Debatte ist nicht nur die emotionale Heftigkeit, mit der sie ausgetragen wird, sondern auch das forcierte Desinteresse der selbsterklärten «Friedensfreunde» an der deutschen und europäischen Geschichte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, als die Friedenssehnsucht in großen Teilen der europäischen Gesellschaft die Einschüchterungs- und Annexionspolitik Hitlers begünstigte und für den Diktator zur Carte blanche wurde, mit Hilfe der Wehrmacht fast ganz Europa zu unterwerfen. Heutzutage ist nicht nur die neue Friedensliebe der politischen Rechten bemerkenswert, die de facto eine Parteinahme für die aggressiv-militärische Politik Russlands und seinen Oberherrn Putin ist, einer Politik, die sich also von der einstigen Unterstützung der Hitlerschen Revisionspolitik durch die Konservativen und Rechten in Deutschland nicht grundlegend unterscheidet, sondern auch die von einigen Linken geübte Kritik an deutschen Waffenlieferungen für die Ukraine – ebenjener Linken, die in den Debatten der 1970er und 1980er Jahre über den Sieg des Faschismus in Europa noch die fehlende militärische Unterstützung des republikanischen Spanien im Abwehrkampf gegen die Putschisten unter General Franco als einen verheerenden Fehler der Franzosen und Briten kritisiert haben, weil sie den die Putschisten unterstützenden Diktatoren Mussolini und Hitler nicht Paroli geboten haben. Den Motiven für diese neue Querfront von rechts und links wird in den einzelnen Kapiteln dieses Buches immer wieder nachgegangen. Im Prinzip handelt es sich dabei um eine umfassende Geschichtsvergessenheit, wie Arthur Schopenhauer sie vor Augen hatte, als er seinen politischen Pessimismus auf die Formel brachte, aus der Geschichte könne man nur lernen, dass die Menschen aus ihr nichts lernen würden.[7]
Es ist deswegen naheliegend, im Verlauf der hier angestellten Überlegungen immer wieder einen Blick auf die deutsche und europäische Geschichte zu werfen, um Ähnlichkeiten und Unterschiede zur gegenwärtigen Entwicklung zu beobachten. Die dabei benutzte Methode des Vergleichs ist nicht zu vermengen mit einer Praxis des Gleichsetzens, was oft gegen den Blick in die Vergangenheit als Orientierung für die Zukunft eingewandt wird. Dieser Einwand ist die Folge einer begrifflichen Verwechslung, nämlich der von Vergleichen und Gleichsetzen, und Ausdruck eines methodisch unsauberen Denkens: Um zu dem Ergebnis zu kommen, dass zwei politische Konstellationen recht unterschiedlich, also keineswegs miteinander gleichzusetzen sind, muss man sie miteinander vergleichen und die dabei beobachteten Ähnlichkeiten und Unterschiede gegeneinander gewichten. Unsere Orientierung im Alltag beruht auf einem ständigen Vergleichen, und das komparative Verfahren, wie es von den Geschichts- und Sozialwissenschaften entwickelt wurde, ist eine methodisch angeleitete Verfeinerung dieses alltäglichen Vergleichens.[8] Der Vergleich ist die Grundlage der politischen Urteilskraft, auf die gerade Demokratien existenziell angewiesen sind. Sie sind infolge historischer Unkenntnis und politischer Ignoranz ihrer Bürger hochgradig verwundbare politische Ordnungen. Um es zu pointieren: ohne permanenten Vergleich keine politische Orientierung.
Ein wesentlicher Strang des Buches ist die Geopolitik, die im Zuge der Umbrüche und Veränderungen der letzten zehn Jahre einen bemerkenswerten Wiederaufstieg erfahren hat, auch in Deutschland, wo sie aus der öffentlichen wie fachwissenschaftlichen Debatte nahezu verschwunden war. Das war keineswegs in allen Ländern der westlichen Welt der Fall, vor allem nicht in den USA. In Frankreich und England hat man sich immer wieder mit geopolitischen Fragen beschäftigt und geostrategische Reaktionen auf diverse Herausforderungen entworfen und diskutiert.[9] Doch auch dort ist im Gefolge des Endes der bipolaren Konstellationen, die den Kalten Krieg geprägt haben, und der um sich greifenden Globalisierungseuphorie über einige Jahrzehnte hinweg Geopolitik in Geoökonomie oder Geoökologie aufgelöst worden,[10] was heißt, dass genuin politische Fragen den Imperativen der Wirtschaft oder denen einer nachhaltigen Lebensführung nach- und untergeordnet wurden.
Nun ist Geoökonomie seit jeher ein zentrales Element der Geopolitik, wie sich das auch in den geopolitischen Erkundungen der nachfolgenden Kapitel zeigt, insofern der Aufbau und die Behauptung einer Großmachtposition immer auf wirtschaftlichen Voraussetzungen beruht, etwa dem Zugang zu bestimmten Rohstoffen und Energieträgern. Deren Verfügbarkeit war immer schon ein Imperativ der Allianzbildung sowie der Sicherung von Einflusszonen, und das nicht nur mit Blick auf das aktuell Erforderliche, sondern auch perspektivisch mit Blick auf das, was künftig vonnöten oder eine Ressource sein könnte, um Konkurrenten und Gegenspieler in Abhängigkeit zu bringen. Die zurückliegende Phase, in der die Geopolitik im öffentlichen Diskurs zu einer nachgeordneten Kategorie der Geoökonomie geworden ist, war von der Vorstellung getragen, der Streit um knappe Ressourcen sei durch deren Zugänglichkeit auf dem Weltmarkt nicht nur abgemildert, sondern tendenziell überwunden. Das machte den ungeheuren Charme dieses Weltordnungsentwurfs aus, in dem ökonomische Macht ein sehr viel größeres Gewicht hatte als politische und militärische Macht.
Dadurch wurden politische Feinde in ökonomische Konkurrenten verwandelt – oder sollten es zumindest. Im Rückblick lässt sich feststellen, dass einige unerschütterlich an diese neue Ordnung einer generellen Verfriedlichung der Politik geglaubt und ihr Portfolio der Machtsorten daran ausgerichtet haben, während andere den Entwurf einer solchen Weltordnung nur als Deckmantel dafür benutzten, ihre Position in dem erwarteten Wiederaufleben eines «Wettstreits der großen Mächte» zu verbessern. Auf eine friedliche Weltordnung haben zumeist die Demokratien gesetzt, während die Autokratien sich auf das Wiederaufflammen von Streit und Kampf vorbereitet haben.[11]
Die Beharrlichkeit der mit einer bestimmten geopolitischen Ordnungsvorstellung verbundenen Ersetzung von politischer Gegnerschaft durch ökonomische Konkurrenz zeigt sich bis heute in der Aversion vieler gegen den Begriff der Feindschaft. Sie verweigern sich grundsätzlich einem politischen Denken in den Kategorien von Feindschaft, selbst da, wo man es tagtäglich mit feindseligen Handlungen und Drohungen eines autokratischen Machthabers zu tun hat, und bestehen darauf, dass der Begriff dafür verantwortlich sei, wenn das von ihm so Begriffene erst dadurch zur Realität werde.[12] Es handelt sich hier um eine Art von magischem Denken, das glaubt, durch das Vermeiden von Worten und Begriffen die Realität in seinen Bann schlagen zu können.
Nach all dem, was zurzeit erkennbar ist, wird der Widerstreit der großen Mächte einer zwischen den demokratischen Verfassungsstaaten und den autoritär-autokratischen Regimen sein. Dieser Gegensatz von Demokratien und Autokratien, der sicherlich nicht strikt bipolar und auch nicht immer eindeutig ist, sondern in dem sowohl die diversen Facetten des demokratischen Rechtsstaats als auch die der autoritären Regime eine Rolle spielen, verdichtet sich in Bündnissen, die nicht so fest und unverbrüchlich sind, wie es die des Kalten Krieges waren. Es gibt in ihnen offenbar die Möglichkeit des Bündniswechsels und damit ein globales Ringen um Zugehörigkeiten. Dieses Ringen wird unter Einsatz von politischer, wirtschaftlicher, militärischer und kultureller Macht ausgetragen.[13] Es wird sich vermutlich über Jahrzehnte hinziehen, und für den Ausgang dürfte entscheidend sein, welche von beiden Seiten besser in der Lage ist, die von ihr formierten Bündnisse zusammenzuhalten und sie auf die sich dynamisch verändernden Rahmenbedingungen einzustellen.
Es gibt keinen Grund zu der selbstgewissen Annahme, der Sieger werde ein weiteres Mal, wie 1945 und 1989, der demokratische Verfassungsstaat sein. Wenn historische Analogien bemüht werden, so ist die eines Kampfes zwischen Demokratien und faschistischen Regimen in den 1930er und 1940er Jahren näherliegend als die des friedlichen Zusammenbruchs der Sowjetordnung am Ende der 1980er Jahre. Auch ist dabei zu beachten, dass beim Sieg über die faschistischen Regime am Ende des Zweiten Weltkriegs ebenfalls ein totalitäres System, nämlich die stalinistische Sowjetunion, eine wichtige Rolle gespielt hat. Ob die Demokratien des Westens damals allein den Sieg hätten erringen können, ist durchaus fraglich, zumal wenn man die Möglichkeit in Betracht zieht, dass das Bündnis der Diktatoren, der Hitler-Stalin-Pakt, hätte Bestand haben können.
Die Demokratie im 21. Jahrhundert ist fragil, steht im ständigen Widerstreit mit Autokratien; offene Gesellschaften bleiben leicht verwundbar und sind daher auf Möglichkeiten angewiesen, Resilienzen auszubilden. Die Widerstands- und Erneuerungsfähigkeit der Demokratie zu stärken,[14] ist erheblich schwieriger und anspruchsvoller, als die Widerstandsfähigkeit des Verfassungsstaates zu stärken. Auf die zielt zwar der erste Angriff der inneren Feinde eines demokratischen Rechtsstaats, der «Verschwörungstheoretiker», Rechtsextremen und Populisten mit autoritären Zielsetzungen, doch der Angriff lässt sich abwehren, wenn das Institutionensystem des Verfassungsstaats im Widerstand gegen seine Feinde stabilisiert wird, wie nun mit der interfraktionellen Vereinbarung der Regierungsparteien mit CDU/CSU angestrebt. Als Beispiele für wirkungsvolle Attacken auf Demokratien dienen das Ungarn Orbáns und Polen in der Zeit der PiS-Regierungen, doch handelt es sich hier um junge, erst nach 1989 entstandene Rechts- und Verfassungsstaaten mit einem noch nicht über längere Zeit gehärteten Institutionensystem. Es ist richtig, dass Rechtskonservative und Rechtspopulisten als Erstes die obersten Gerichte des Staates und die freie Presse der Gesellschaft angreifen, um sie als Verteidiger der Demokratie und potenzielle Unterstützer der Opposition auszuschalten, aber nachdem man das an einer Reihe von Fällen hat beobachten können, sollte es möglich sein, beides, den Rechtsstaat wie die freie Presse, in einer Weise mit Abwehr- und Verteidigungsringen zu versehen, dass sie sich zu behaupten vermögen.
Sehr viel schwieriger ist dagegen die Verteidigung der Demokratie, wenn ihr auf längere Dauer die Demokraten abhandengekommen sind und die Ordnung der bürgerschaftlichen Partizipation von den Feinden der Demokratie zu deren Zerstörung genutzt wird. Eine Demokratie, in der die liberalen Demokraten dauerhaft in der Minderheit sind, lässt sich gegen die Anhänger eines autoritär-illiberalen Regimes nur schwer verteidigen; die einzige Aussicht auf ihre Wiederherstellung und Erneuerung liegt dann darin, dass eine Mehrheit der Wahlbürger vom autoritär-illiberalen Regime und dessen Leistungen enttäuscht ist und sich wieder den in die Minderheit geratenen Demokraten zuwendet, die sich nun an das mühsame und langwierige Projekt einer Wiederherstellung des Verfassungsstaats und einer Erneuerung der freien Presse machen müssen. Wie schwierig das ist, zeigt sich in Polen. Eine liberale Demokratie ist schneller und leichter zu zerstören als wiederherzustellen.
Werden die Demokraten in der Zeit ihrer politischen Einflusslosigkeit von außen unterstützt, so kann sich das beim Durchhalten gegen den illiberalen Autoritarismus als hilfreich erweisen. Gegen diese Unterstützer geht das autoritäre Regime freilich mit allen Mitteln vor, indem es sie verbietet oder enteignet. Ob ein autoritäres Regime ungehindert agieren kann, wie im Russland Putins, oder ob es dabei gewisse Grenzlinien beachten muss, wie im Ungarn Orbáns, dürfte dafür ausschlaggebend sein, ob eine ruinierte Demokratie wieder auf die Beine kommt oder aber auf Dauer zerstört ist. Die Mitgliedschaft Ungarns in der EU begrenzt die Spielräume Orbáns, weil das Land auf das Geld aus Brüssel und die europäischen Wirtschaftsverbindungen angewiesen ist. Das sind zwar nur indirekt anwendbare Instrumente zum Schutz von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, aber sie können doch eine gewisse Wirksamkeit entfalten. Dagegen verfügen autoritär-autokratische Regime über die Möglichkeit eines direkten Eingreifens und des unmittelbaren Zwangs gegen Demokratiebewegungen, wenn sie in Bedrängnis geratene verbündete autoritär-autokratische Führer retten wollen. Die Niederschlagung der Demokratiebewegung in Belarus mit russischer Hilfe und Rückendeckung ist hierfür ein Beispiel.[15]
Die Verwundbarkeiten des demokratischen Verfassungsstaats sind vielfältiger und größer als die autoritär-autokratischer Regime. Das ist die Folge dessen, dass Ersterer sich rechtliche Selbstbindungen auferlegt, während Letztere solche Selbstbindungen nicht kennen oder sie nach Belieben und Erfordernis aufheben. Demgemäß liegt die entscheidende Verteidigungslinie der Demokratie in der Herausbildung und Schärfung der politischen Urteilskraft ihrer Bürger. Es spricht vieles dafür, dass der Erfolg oder Misserfolg dieses Projekts einer Förderung von politischer Urteilskraft für die Selbstbehauptung einer Demokratie entscheidend ist. Bei der Stärkung der rechtlichen Instrumente, von denen angesichts der populistischen Bedrohung zurzeit viel die Rede ist, handelt es sich gewissermaßen um die Befestigung des Vorfelds, die Herstellung eines Glacis, um die Feinde einer Demokratie abzuwehren. Die entscheidende Schlacht wird jedoch im Ringen um die Demokratiepräferenz der Bürger geschlagen, und die entscheidet sich daran, ob eine Mehrheit der Bürgerschaft kurzfristigen Stimmungen folgt, die von den Populisten bespielt werden, ob für sie Angst, Wut und Zorn handlungsleitend sind, oder ob sie sich an längerfristig angelegten Politikangeboten zur Bewältigung von Herausforderungen orientieren und anhand dieser ihre Wahlentscheidung treffen. Es ist die politische Urteilskraft, die zu einer Entscheidung für die längerfristigen Politikangebote führt, aber das Vorhandensein von Urteilsfähigkeit ist seit einiger Zeit infolge von Veränderungen im Mediensystem, einer schwierigeren Wirtschaftslage, die zu sozialen Spaltungen führt, sowie einem geschwundenen Zukunftsvertrauen fraglich geworden.
Die Grenzen Europas stellen inzwischen eine geopolitische Herausforderung dar. Der lange währende Kampf zwischen der liberalen Demokratie und der autoritären Autokratie spielt sich nicht nur (wenngleich immer auch) im Innern der jeweiligen Ordnungen ab, sondern erfasst zugleich die Grenzräume zwischen den Bündnissystemen und hat dort im Fall der Ukraine die Gestalt des Krieges angenommen. Es ist dies ein Krieg um die politische Ordnung, um die Alternative zwischen Demokratie und Autokratie, aber zugleich ist es auch ein Krieg um werte- und geopolitische Fragen. Als Erstes geht es beim Ausgang dieses Krieges darum, ob Angriffskriege, die in der Charta der Vereinten Nationen geächtet sind, in Zukunft auch geächtet bleiben oder ob sie bei einem Erfolg des russischen Überfalls auf die Ukraine wieder ins politische Repertoire der Großmächte zurückkehren werden. Das dürfte auf dem Balkan eine Rolle spielen, aber auch im Baltikum, wo Russland versucht sein könnte, nach dem Ukraine-Modell vorzugehen, um wieder die beherrschende Macht der Ostsee zu werden.[16] Denn selbstverständlich wird sich eine zunächst noch kleine Anzahl von autoritären Machthabern sagen, was Putin kann, können wir auch, und bei entsprechender Gelegenheit versuchen, die Grenzen des Landes zu ihren Gunsten zu verschieben – allein mit der Androhung oder unter Anwendung militärischer Gewalt.
Die Renaissance militärischer Gewalt als Instrument bei der Verfolgung politischer Ziele würde indes kaum auf die europäischen Räume beschränkt bleiben, sondern globale Nachahmer haben. Es könnte sein, dass diejenigen, die jetzt einem Verhandlungsfrieden das Wort reden, bei dem die Ukraine zwangsläufig Gebietsabtretungen zustimmen müsste und Putin mit fetter Beute vom Kampfplatz gehen würde, langfristig genau das Gegenteil von dem bewirken, was die selbstsicheren Pazifisten als Ziel und Grund ihrer Wortmeldungen angeben: nicht die Durchsetzung des Friedens, den sie für sich annoncieren, sondern die Vermehrung und Intensivierung von Kriegen, in Europa und weltweit.
Des Weiteren ist der Krieg in der Ukraine ein Krieg um die östlichen Grenzen Europas, die in der Geschichte immer wieder umkämpft waren und von denen man gehofft hat, dass sie nach dem Zerfall der Sowjetunion als letztem Kolonialimperium europäischen Typs endgültig zur Ruhe gekommen seien. Handelt es sich beim Krieg in der Ukraine, wie viele meinen, um einen revisionistischen Krieg, in dem es um die Wiederherstellung des Reichs der russischen Zaren in Orientierung an dessen einstigen Grenzen geht, so ist zu befürchten, dass dies nicht der letzte Krieg um die Grenzverläufe zwischen der Europäischen Union und Russland sein wird und mit weiteren Revisionskriegen gerechnet werden muss. Die Wahrscheinlichkeit, dass Russland im Ostseeraum wiederholt, was es gegenwärtig am Schwarzen Meer versucht, wächst in dem Maße, wie es in der Ukraine erfolgreich ist, und sie schwindet entsprechend mit den politischen und militärischen Kosten, die Russland für seine Eroberungspolitik in der Ukraine zu entrichten hat. Trifft dieses Kalkül zu, so sind diejenigen, die jetzt einen von Putin diktierten Frieden mit den damit verbundenen Vorteilen für Russland fordern, mitverantwortlich für weitere von Russland begonnene Kriege im Osten Europas.
Wie auch immer: Die Frage der Grenzen, die nach 1989/91 erheblich an Bedeutung verloren hatte, ist politisch wieder brisant geworden, und es spricht vieles dafür, dass Grenzfragen auf unabsehbare Zeit die politische, wirtschaftliche und kulturelle Agenda der Europäer dominieren werden. Dabei gerät neben der Ost- auch die Südgrenze Europas als Raum der Instabilität in den Blick. Im Mittelmeerraum sind Kriege zumindest indirekt für die Herausforderungen verantwortlich, vor denen Europa steht, insofern sie im Nahen Osten und im subsaharischen Afrika Flüchtlingsströme in Gang setzen; diese führen bei den Europäern zu der Forderung, die Migrationsbewegung auf der südlichen Seite des Mittelmeers zum Stillstand zu bringen und nur ausgewählten Personen die Überfahrt zu ermöglichen. – Aber wie ist das zu bewerkstelligen? Welche Mittel sind hierbei zulässig, und welche verstoßen gegen die wertgestützten Selbstbindungen, auf die sich die liberalen Demokratien viel zugutehalten? Mit den Grenzen sind immer auch Fragen der eigenen Wertbindung verknüpft – im einen Fall durch die für ihre Verteidigung geführten Kriege, im anderen durch das Ziel der Entschleunigung und Ausdünnung von Migrantenströmen. Insofern korrespondieren Geopolitik und Wertfragen in einer Art und Intensität miteinander, wie sich das kaum jemand vorzustellen vermochte, als man vor mehr als drei Jahrzehnten glaubte, die Ära der machtgestützten Realpolitik sei zu Ende und eine Epoche der humanitären Wertepolitik habe begonnen. Um es zu pointieren: Die Grenzziehungen der geopolitischen Räume sind auch zu Grenzen der Geltung beziehungsweise des Geltendmachens von Werten geworden.
Kann Deutschland unter den skizzierten Rahmenbedingungen und angesichts der mentalen Verfassung eines Teils seiner Bürger wie seiner politischen Klasse eine Führungsrolle in der EU übernehmen? Bislang ist die Debatte über die Rolle der Bundesrepublik in der Union wesentlich als Ressourcenfrage geführt worden; sie hat sich auf das Problem konzentriert, ob die in Deutschland verfügbaren Mittel, vor allem die finanziellen, ausreichen, um der Europäischen Union bestimmte Ziele vorzugeben und deren Verfolgung auch auf den Weg zu bringen. Diese Frage ist relativ leicht zu beantworten: Wer sonst in der EU könnte das, wenn nicht Deutschland, dessen Nettoüberschuss bei den Zahlungen an die EU fast doppelt so hoch ist wie der des zweitgrößten Nettobeitragszahlers Frankreich? Die Ressourcenfrage ist nicht das große Problem, zumal es nicht eine alleinige Führungsrolle sein wird, die von den Deutschen übernommen werden muss, sondern eine in enger Kooperation mit anderen großen Mitgliedstaaten der EU. Es wird die Rolle eines primus inter pares sein, eines Ersten unter Gleichen, aber doch eben eines Ersten, dessen es beim Umbau und der Neuausrichtung der EU bedarf. Nur eine an Haupt und Gliedern reformierte Union wird die erstarrte und verholzte Gemeinschaft, wie sie sich zurzeit darstellt, in Bewegung bringen und in die Lage versetzen können, die Herausforderungen zu bewältigen, mit denen sie konfrontiert ist.
Die Zeit der Führbarkeit des Europaprojekts durch einen der Kleinsten unter den Mitgliedern, als ein ums andere Mal ein Luxemburger an der Spitze der Kommission stand, ist definitiv vorbei. Der Vorzug dieser luxemburgischen Führung war, dass sie die Rivalität zwischen Deutschland und Frankreich neutralisierte und als ein im buchstäblichen Sinn «Dazwischenstehender» der natürliche Vermittler zwischen den beiden größten EU-Staaten war. Für die deutsch-französische Lokomotive, die für Bewegung in der Union sorgte, bot sich ein Luxemburger auf dem Führerstand an. In einer veränderten Weltlage kann sich die Union eine solche Art von Führung durch einen der Kleinsten nicht länger leisten.[17]
Schwieriger zu beantworten als die Frage nach den verfügbaren und für die EU einsetzbaren Ressourcen Deutschlands ist die nach der Führungsfähigkeit deutscher Politiker. Die Mentalitätsfrage ist darum so brisant, weil die bisherige Art der Führung in Brüssel – sie lässt sich als «Führung von hinten» bezeichnen, insofern sie in Anbetracht der unterschiedlichen Interessen und politischen Optionen der EU-Mitgliedsländer im Wesentlichen auf das Schmieden von Kompromissen hinausläuft – nicht mehr genügt, um die Gemeinschaft voranzubringen und dabei auch noch auf einem Kurs zu halten, der nicht als Schlingerkurs auffällt. Das heißt freilich nicht, dass ein Führen von hinten überflüssig geworden wäre, denn auch in Zukunft wird ein Großteil der in Brüssel anfallenden Entscheidungen auf Kompromissen beruhen, die zuvor von tendenziell allen Mitgliedstaaten gemeinsam gefunden und festgezurrt werden müssen. Das funktioniert indes in der Regel nicht, indem man sich bloß zusammensetzt und nach dem Gemeinsamen unter den unterschiedlichen Interessen sucht. Es bedarf dazu eines Akteurs aus dem Kreis der Mitgliedstaaten, der die Kompromisssuche anleitet und in der Lage ist, mit Gratifikationen wie Sanktionen eine sich abzeichnende Lösung zu finalisieren. Auch das ist Führung, und zwar eine, die umso erfolgreicher ist, je weniger sie als solche sichtbar ist. Dieses Führen von hinten beherrschen deutsche Politiker und haben es in der Vergangenheit bereits immer wieder erfolgreich praktiziert. Sie können das sehr viel besser als ihre französischen Kolleginnen und Kollegen, in deren politischer Sozialisierung aufgrund des französischen Politiksystems der Kompromiss strukturell eine deutlich geringere Rolle spielt als in Deutschland.
Doch die Kompromissbildung reicht als Praxis politischer Führung in der EU nicht mehr aus: zum einen, weil sie mehr Zeit in Anspruch nimmt, als bei Herausforderungen von außen zur Verfügung steht, und zum anderen, weil einige Mitgliedstaaten der Union inzwischen als notorische Kompromissverweigerer auftreten oder den Preis ihrer Zustimmung so hoch treiben, dass er unbezahlbar ist. Entscheidungsverzögerung und Politikblockaden, wie sie bei einer Reihe mitteleuropäischer Staaten unter Anführung Ungarns auf der Tagesordnung sind, haben den Modus eines Führens von hinten an die Grenzen seiner Problemlösungsfähigkeit gebracht. Infolgedessen ist in wachsendem Maße ein «Führen von vorn» erforderlich. Doch das ist etwas, das weder der Mentalität noch den im Verlauf ihrer Karriere antrainierten Fähigkeiten deutscher Politiker entspricht. Entsprechende Personen werden vom politischen System in Deutschland «aussortiert»: Ihre Karrieren werden durch die Parteien, denen sie angehören, blockiert. Sie gelten als «eigensinnig» und «unberechenbar». Unberechenbarkeit aber ist die negativ akzentuierte Bezeichnung für Politiker, die schnelle Entscheidungen treffen, sich nicht an den Korsettstangen der Parteiprogramme orientieren, die nicht zuwarten, bis sich ein Konsens bei den zu findenden Antworten herausgebildet hat, und die auch sonst «ihren eigenen Kopf» haben, wie man sagt. Es gibt solche Politiker und Politikerinnen auch in Deutschland in der ersten Reihe der Politik, aber sie haben sich dort «eingeschlichen», indem sie ihre Entschlusskraft im Verlauf der politischen Karriere unter der Decke gehalten haben.
Doch abgesehen von Mentalitätsfragen: Ist Deutschland überhaupt geeignet, als Mitte und Zentrum des europäischen Gesamtraums von Portugal bis Finnland und von Skandinavien bis Zypern zu fungieren? Mit den Herausforderungen Europas an seinen Grenzen ist die Diversität des von diesen Grenzen umschlossenen Raumes verbunden. Eine Folge dieser Diversität sind die starken Zentrifugalkräfte, die auf die EU (und ebenso die NATO) einwirken. Seit den zwei Runden der Osterweiterung sind von ihrer sozioökonomischen Struktur und ihrer politisch-kulturellen Prägung her sehr unterschiedliche Staaten in der EU vereint – oder besser: versammelt. Manche der Staaten haben eine gemeinsame Geschichte, in der Konflikte durch das Europaprojekt beendet werden konnten. Das gilt vor allem für die Gründungsmitglieder der alten EWG, insbesondere für Deutschland und Frankreich, die einstigen Erb- und Erzfeinde. Andere hingegen sind sich auch im Verbund der EU fremd geblieben. Was hat Irland schon mit Bulgarien und Rumänien zu tun? Oder Finnland mit Portugal? Oder Spanien mit Polen? Am ehesten noch sind es die Deutschen, die mit tendenziell allen Ländern, die der EU angehören (vielleicht mit Ausnahme von Zypern und Malta), zu tun gehabt haben, und zwar im Guten wie im Schlimmen, in kulturellem und wirtschaftlichem Austausch wie in erbittert geführten Kriegen. Insofern ist Deutschland nicht nur in geografischer Hinsicht und von seinem ökonomischen Gewicht her Mitte und Zentrum der Union, sondern auch durch seine Geschichte und seine nach allen Seiten hin ausgestreckten Fühler, die wirtschaftlichen wie die politischen, die kulturellen wie, nicht zu vergessen, die touristischen.
Die Zentrifugalkraft des Diversen muss, damit die EU funktionieren kann, durch die Zentripetalkraft einer starken Mitte ausbalanciert werden. Wo das nicht der Fall ist, formieren sich innerhalb der Union regionale Substrukturen, die durch ähnlich gelagerte Herausforderungen und Interessenkonstellationen geformt sind und einen Anführer haben, der die jeweilige Sicht in Brüssel zur Sprache bringt. Im Ergebnis läuft das auf eine Steigerung der Zentrifugalkräfte hinaus. Die Kommission kann diese nur auszugleichen versuchen. Für ein verlässliches Miteinander bedarf es indes einer Zentralmacht, die ihre eigenen Interessen zurückzustellen bereit ist und den Zusammenhalt und die Handlungsfähigkeit der Union als ihre Hauptsorge begreift. Nach Lage der Dinge kann das nur Deutschland sein.
Aber Deutschland schafft das nicht allein, sondern ist dafür auf eine Reihe von Unterstützermächten angewiesen, die in einer reformierten und an Handlungsfähigkeit orientierten EU so etwas wie den innersten Kreis der Union bilden würden. Es müssen das nicht immer dieselben sein, sie können im Verlauf der Zeit wechseln. Aber sie müssen zuverlässig und, wenn auch in geringerem Maße als die Zentralmacht selbst, bereit und in der Lage sein, ihre nationalen Eigeninteressen dem europäischen Gesamtinteresse unterzuordnen.
Was aber sollte Deutschland dazu veranlassen, in der Europäischen Union die Aufgaben eines servant leader[18] zu übernehmen, einer Macht, die dadurch führt, dass sie sich wesentlich in den Dienst des Gesamtverbandes stellt, und sich dieser Rolle verlässlich und dauerhaft zu widmen? Der Blick in die Geschichte genügt: Die Versuche der Deutschen, ihre geopolitische Mittellage in Europa in Gestalt eines dominant leader auszunutzen, sind allesamt gescheitert und haben furchtbares Leid über die Welt, Europa und Deutschland selbst gebracht, seine Reputation schwer beschädigt und seine politische Stellung ruiniert. Die Geschichte, das kulturelle Gedächtnis mithin, legt den Deutschen nahe, dass es für sie von großem Nutzen ist, wenn sie ihre eigenen und unmittelbaren Vorteile nicht ungehemmt verfolgen, sondern sich auf die mittelbaren und langfristigen Vorteile konzentrieren, wenn sie als Vertreter des europäischen Gesamtinteresses und einer stabilen, selbstbewussten und politisch handlungsfähigen Europäischen Union auftreten. Dass dem in Deutschland tatsächlich so ist, ist freilich alles andere als selbstverständlich, sondern erwächst aus der Umsicht einer politisch aufgeklärten und mit der eigenen Geschichte vertrauten Bürgerschaft, einer Bürgerschaft, die sich nicht durch die Sirenengesänge des Populismus irritieren lässt, welche sich stets um kurzfristige Eigeninteressen drehen. Diese Mischung aus nationalistischer Rückwärtsgewandtheit, dem Festhalten an ebenso partiellen wie kurzfristigen Interessen, der wahlkämpferischen Bewirtschaftung von Stimmungen des Augenblicks, wie sie allenthalben für den Populismus typisch ist, lässt sich in Deutschland insbesondere an der AfD beobachten.[19] Deren weiterer Anstieg in der Wählergunst wäre eine erhebliche Gefahr für die hier angedachte Position Deutschlands in der EU und damit für den Zusammenhalt der Union.
Das Problem der Mitte ist nicht nur von historischem Interesse, sondern nach wie vor von einiger politischer Relevanz, auch wenn es in der Politikwissenschaft kaum einschlägige Untersuchungen dazu gibt. Die geopolitische Mittellage würde für Deutschland jedenfalls zum gravierenden Problem werden, wenn die Europäische Union zerbrechen oder in Agonie versinken sollte – womöglich sogar deswegen, weil sich die deutsche Politik nicht hinreichend als Zentripetalmacht bewährt oder die deutschen Wähler die Populisten so stark gemacht haben, dass die Bundesrepublik die Rolle eines servant leader nicht wahrnehmen kann. Es ist für die Deutschen dringend angeraten, sich kein weiteres Mal, und schon ganz und gar nicht mutwillig, in eine gefährliche Position zu begeben, in der sie auf sich allein gestellt sind. Denn sie sind angewiesen auf ein lebendiges Netzwerk von Freunden und Verbündeten.
Die Lage in der Mitte eines geopolitisch zusammengehörigen Raums abzuwägen, ist nicht a priori ein deutsches Problem. Das Theorem von der Mitte und den Flügelmächten ist in Frankreich entstanden, und zwar mit Blick auf den (mindestens) zwei Mal unternommenen Versuch Frankreichs, die Dominanzmacht Europas zu werden und so zum weltpolitischen Akteur aufzusteigen. Die Wahrnehmung, sich in der Mitte zwischen anderen Mächten zu befinden, hat insofern sicherlich eine kriegerisch-aggressive Seite und lässt sich als Mobilisierungsnarrativ funktionalisieren. Dieses ursprünglich französische Theorem ist in Deutschland aufgenommen und mit Blick auf Mitteleuropa variiert worden. In militärischen Kreisen hat man in Deutschland das zuvor ebenfalls in Frankreich entwickelte – wie auch praktizierte – Projekt einer «zweiten Front» im Rücken des Gegners als Theorem des Eingekreistseins begriffen und entsprechend diverse Optionen eines Ausbrechens aus der Einkreisung durchgespielt. In Frankreich und Deutschland sind tendenziell alle Möglichkeiten einer politischen Auflösung des Mitteproblems durchdacht und analysiert worden, ebenso wie die denkbaren militärstrategischen Antworten darauf. Sie alle blieben unbefriedigend oder endeten in politischen Katastrophen. Das Problem der geopolitischen Mitte lässt sich nur durch den Auf- und Ausbau einer wirtschaftlichen und politischen Gemeinschaft auflösen, was darauf abzielt, dass die bedrohte und sich ein ums andere Mal eingekreist fühlende Mitte von Freunden umgeben ist, die sie nicht zu fürchten braucht und gegen die sie deswegen auch nicht aggressiv auftreten muss.
In Zeiten, da die Bedeutung der EU für Deutschland gerade von Seiten eines erstarkten Rechtspopulismus in Frage gestellt wird, kann das nicht deutlich genug betont werden. Was wäre besser geeignet, die rechtspopulistische Vorstellung von einem Rückbau der EU zu einem «Europa der Vaterländer» als politischen Irrweg kenntlich zu machen, als die kritische Darstellung ebenjener strategischen Entwürfe, mit denen das deutsche Militär in zwei Weltkriegen versucht hat, aus der Mitte der Vaterländer auszubrechen, weil es sich von ihnen eingeschnürt und eingekreist fühlte?
Die Zukunft Deutschlands und Europas, beides Mächte im Umbruch, lässt sich nicht lösen von der Frage, ob «der Westen» eine Zukunft hat. Es geht dabei um das angekündigte Disengagement der USA in Europa und den von dem früheren US-Präsidenten Barack Obama angekündigten pivot to Asia, die Konzentration Amerikas auf den indopazifischen Raum, der von fast allen Politikern in den USA, Republikanern wie Demokraten, als die größte Herausforderung für ihre hegemoniale Position angesehen wird. Dem transatlantischen Westen, der mit dem Beginn des offenen russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine eine Wiederauferstehung erlebt hat (es ist allerdings mehr als fraglich, ob sie von langer Dauer sein wird), steht das geopolitische Gegenmodell des Eurasismus gegenüber, wie es vor allem in Russland ausgearbeitet worden ist. Der Eurasismus beschreibt den west- und mitteleuropäischen Raum mitsamt seinen Ausbuchtungen nach Norden und Süden als geografisches Anhängsel der nordasiatischen Landbrücke. Gemäß seiner derzeit in Russland virulenten Version soll Ostmitteleuropa erneut unter russischen Einfluss gebracht werden, und im restlichen Europa soll den nach dem Rückzug der USA von Moskau dann leicht erpressbaren Deutschland und Frankreich eine begrenzte Dominanz zufallen. Dieser geopolitische Gegenentwurf zum Westen hat auch eine wertepolitische Dimension, insofern das auf ein «Vorgebirge Asiens» (Paul Valéry) reduzierte Europa dann nicht mehr dem Lager der liberalen Demokratien, sondern dem der autoritären Regime angehören und gesellschaftspolitisch ultrakonservativen (wenn nicht reaktionären) Vorgaben folgen würde.
Eine solche Entwicklung mag derzeit zwar als unwahrscheinlich erscheinen, aber man sollte nicht übersehen, dass sowohl die AfD als auch das BSW antiwestliche und russlandaffine Präferenzen haben und insofern als Rollschuhe eurasischer Geopolitik in Deutschland dienen können. Die russlandfreundliche Ausrichtung beider Parteien und die dubiosen finanziellen Verbindungen zumindest der AfD nach Russland lassen beide als Statthalter des geopolitischen Eurasismus in Deutschland erscheinen.
Damit taucht die Vorstellung von der Mitte eines geopolitischen Raums in einer weiteren Dimension auf: der einer inneren Zerrissenheit zwischen zwei Richtungen, einer in Richtung Westen und einer in Richtung Osten. Beides hat in der deutschen Geschichte über lange Zeit eine große Rolle gespielt. Von der preußisch-russischen Annäherung in der Spätphase des Siebenjährigen Krieges, also von den Zeiten Friedrichs des Großen an, bis zu Bismarcks Rückversicherungsvertrag hat sich Preußen in einer bündnispolitischen Nähe zu Russland bewegt, und auch in der Weimarer Republik haben konservative bis reaktionäre Kräfte enge (insbesondere militärpolitische) Kontakte zur Sowjetunion gepflegt. Den Höhepunkt dieser Entwicklung stellt der Hitler-Stalin-Pakt mitsamt dem Geheimabkommen zur Aufteilung Ostmitteleuropas zwischen den beiden Diktatoren dar. Preußen gibt es als politischen Akteur zwar nicht mehr, aber es ist durchaus nicht so, dass die Westorientierung Deutschlands in Stein gemeißelt wäre, und schon gar nicht die Ostdeutschlands, wo sie ja überhaupt erst seit 1989/90 besteht. Aber sie ist auch in Westdeutschland nicht unverbrüchlich, wenngleich hier seit Gründung der Bundesrepublik eine sehr viel engere Orientierung nach Westen als nach Osten, und das heißt eine zum Verfassungsstaat und nicht zum autoritär-autokratischen Regime, vorherrschend war. Es ist unwahrscheinlich, dass die Attraktivität des Ostens die des Westens trotz billigerer Rohstoffe und Energieträger in absehbarer Zeit übertreffen wird, aber gänzlich auszuschließen ist das nicht. Der latente Antiamerikanismus der westdeutschen Linken könnte hier eine verhängnisvolle Rolle spielen.
Vieles wird davon abhängen, wie moderat das amerikanische Disengagement in Europa verläuft: Der worst case wäre ein schlagartiges Einklappen des US-Nuklearschirms bei gleichzeitigem Abzug des amerikanischen Militärs aus Europa. Die US-Soldaten in Europa waren der Garant für die Zuverlässigkeit der Vereinigten Staaten, denn als «amerikanische Geiseln» auf europäischem Boden standen sie im Kalkül des Kreml für die Ernsthaftigkeit der amerikanischen Schutzzusagen. Der best case wäre vermutlich ein sich abzeichnendes Tauschgeschäft, bei dem die USA mit reduzierten Kräften in Europa verbleiben und den nuklearen Schutzschirm weiterhin aufgespannt halten, während die Europäer im Gegenzug nicht nur ihre Verteidigungsanstrengungen erhöhen, sondern sich auch an der militärischen Sicherung des indopazifischen Raums beteiligen. Derlei scheint sich in den gemeinsamen Flottenmanövern der jüngsten Zeit sowie der zeitweiligen Verlegung deutscher Kampfflugzeuge bis nach Australien anzudeuten.
Im Fall eines amerikanischen Komplettrückzugs müssen die Europäer als Ersatz dafür eigene Fähigkeiten aufbauen, was bei der nuklearen Abschreckung eine sehr hohe Hürde ist. Im Fall einer Beteiligung am militärischen Schutz des indopazifischen Raums müssen sie Kräfte der Marine wie der Luftwaffe bereitstellen, die nach Südostasien verlegt werden können, ohne dass dies die Verteidigungsfähigkeit Europas gravierend beeinträchtigen würde. Die ruhigen Zeiten einer sicherheitspolitischen Sorglosigkeit sind für die Europäer vorerst vorbei, und das keineswegs nur wegen des Ukrainekriegs. Das Festhalten am Westen heißt entweder, in einem den westlichen Werten verpflichteten, aber geopolitisch auf sich allein gestellten Europa (westlichesEuropa) strategische Autonomie herzustellen oder aber die europäischen Anstrengungen zur Verteidigung des globalen Westens so zu steigern, dass sie auch für den indopazifischen Raum relevant sind. Das wird in jedem Fall viel Geld kosten und die Struktur der nationalen Haushalte in Europa grundlegend verändern.
Der transatlantische Westen war eine für die Europäer überaus kostengünstige Lösung ihrer Sicherheitsprobleme – nicht nur der äußeren, sondern auch der inneren, wenn man etwa in Rechnung stellt, dass nahezu alle Hinweise auf die Vorbereitung von islamistischen Terroranschlägen bisher von US-amerikanischen Diensten kamen, die das Internet in Europa offenbar sehr viel genauer überwachen als die Europäer selbst. Ein europäischerWesten oder ein globaler Westen als Alternative zu dem politisch auf der Kippe stehenden transatlantischen Westen bringt Herausforderungen mit sich, bei denen sich erst noch zeigen muss, ob die Europäer ihnen gewachsen sein werden – in finanzieller wie in politischer Hinsicht. Denn die US-Amerikaner haben bisher nicht nur einen Großteil der militärischen Fähigkeiten in der NATO bereitgestellt, sondern auch das politisch heikle Führungsproblem gleichsam «nebenher» gelöst: Als die bei weitem stärkste Macht waren und sind sie die Führungsmacht der NATO, weswegen es kein Gerangel unter den europäischen NATO-Staaten um diese Position gegeben hat. Sie war und ist vergeben, solange die USA NATO-Mitglied sind. Aber was, wenn sie das nicht mehr sein sollten? Dann wird das Verteidigungsbündnis nur handlungsfähig bleiben, wenn seine innere Struktur bei den europäischen Mitgliedern eine Hierarchisierung erfährt, in deren Konsequenz zwei oder drei Mitgliedstaaten in den schnell zu entscheidenden Fragen das Sagen haben und langwierige Konsultationen zwischen allen Mitgliedstaaten entfallen. Man kann sich vorstellen, dass das Vereinigte Königreich, Frankreich (beides Nuklearmächte) und Deutschland dazugehören würden, aber dann beginnt schon die Auseinandersetzung darüber, warum Spanien, Italien und Polen beziehungsweise die Türkei, das Land mit der zweitgrößten Truppenstärke in der NATO, nicht dem Führungszirkel angehören sollen.
Und wer soll dann den Oberkommandierenden der NATO stellen, der bis jetzt, den Vorgaben des Fähigkeitenbeitrags entsprechend, grundsätzlich ein US-General war, während der Generalsekretär des Bündnisses ein Europäer war, aus wechselnden Ländern kommend. Zuletzt waren es meist erfahrene Politiker aus kleineren NATO-Staaten, die zum Generalsekretär bestimmt wurden: zum einen, weil der Generalsekretär vor allem mit dem Zusammentreiben der europäischen Herde auf einen gemeinsamen Weg beschäftigt war und dafür ein routinierter Verhandler und Kompromisseschmied sein musste, und zum anderen, weil es keine Eifersüchteleien oder gar gegenseitiges Misstrauen gab, solange er aus einem kleinen Mitgliedstaat (Dänemark, Norwegen, Niederlande) stammte. Nach solchen politischen Vorgaben kann jedoch der Oberkommandierende der Streitkräfte nicht berufen werden, und darin zeigt sich, welch überragende Bedeutung die Mitgliedschaft der USA für die Führbarkeit eines aus zweiunddreißig Mitgliedern bestehenden Militärbündnisses hat. Nicht ohne Grund haben die Europäer die Führung ihrer Sicherheitspolitik einer nicht in Europa beheimateten Macht gerne anvertraut.
Das europäische Führungsproblem tritt offen zutage in der Europäischen Union, die formell eine Versammlung von Gleichen ist – in der Realität allerdings keineswegs. Aufgrund dieser kontrafaktischen Konstruktion ist die Führung der EU nicht formalisiert, sondern führungsrelevante Initiativen müssen von Fall zu Fall und immer wieder aufs Neue angeschoben werden. Für einen Akteur, der, wie bei Europa der Fall, eine globalpolitische Rolle spielen muss, ist das allzu spontaneistisch, zumal dann, wenn sich keiner findet, der bereit ist, sich bei der Bearbeitung eines Problems «den Hut aufzusetzen», da das für ihn mit zu hohen Kosten und einem großen Risiko des Scheiterns verbunden ist. Die Folge ist, dass das Problem dann unerledigt liegen bleibt oder der günstige Augenblick eines Eingreifens verpasst wird. So ist das notorische «Zu spät» zum Markenzeichen der EU geworden, ebenso wie eine «Politik der langen Bank», mit der die Probleme beiseitegeschoben, aber nicht gelöst werden. Nun lässt sich gegen diese Diagnose einwenden, dass es doch immer noch die Kommission gebe, die für die Führung der Union zuständig und verantwortlich sei. Dieser Einwand übersieht freilich, dass sich die Kommission überwiegend mit Routinefragen oder den Herausforderungen einer fernen Zukunft beschäftigt und dringliche Probleme, die überraschend auftauchen und außerordentliche Bedeutung haben, ungern und nur zögerlich anpackt. Die Führung durch die Kommission ist Teil der Diagnose des Zuspätkommens und einer Politik der langen Bank.
Im Widerstreit der großen Mächte, zu denen die Europäische Union von ihrem wirtschaftlichen Gewicht und ihrer wissenschaftlich-technologischen Relevanz her gehört, ist diese Art von Führung ineffizient und selbstzerstörerisch. Die EU braucht ein Zentrum, das mit realer Macht ausgestattet und schnell handlungsfähig ist. Und sie bedarf einer Form von Mitgliedschaft, die mindestens zwei, besser noch drei Stufen kennt und auf eine Differenzierung der Rechte und Pflichten hinausläuft. Eine solche strukturelle Reform in Richtung Zentrumsbildung wie Peripherisierung würde vermutlich auch das Problem der exzessiven Bürokratie reduzieren, an dem die EU in wachsendem Maße leidet. Die Bürokratisierung spiegelt das Defizit an politischer Führung der Union: Wo Führung von vorn fehlt, wuchert die Bürokratie; das Gestrüpp der Verordnungen und Ausnahmebestimmungen soll und muss verdecken, dass es der Union an politischer Entschlusskraft und Handlungsfähigkeit mangelt.
Doch diese Ersatzlösung ist selbst zu einem großen Problem geworden, nicht nur, weil sie keine Handlungsfähigkeit nach außen hervorbringt, sondern auch, weil sie in der Bevölkerung der EU-Mitgliedstaaten zu einer wachsenden Europadistanz geführt hat, die den populistischen Parteien zugutekommt. Die wiederum haben sich inzwischen zu einer Bedrohung der EU ausgewachsen. Schlechter hätte es kaum laufen können. Grundlegende Reformen sind also dringend angezeigt, und zwar keineswegs solche der Demokratisierung der EU, wie sie in der Vergangenheit immer wieder angemahnt wurden, sondern solche, die zu strategischer Autonomie und politischer Handlungsfähigkeit führen. Dabei muss Deutschland eine initiative Rolle spielen.
Wie lässt sich die Krise Europas meistern – auch in geopolitischer Hinsicht? Und warum müssen dabei die nationalen Interessen von der deutschen Politik neu formuliert werden? Was bedeutet der Wandel der Welt und der Umbruch der Machtverhältnisse für das Selbstverständnis Deutschlands, vor welchen Herausforderungen stehen wir, und was müssen die Deutschen jetzt tun, um aktiv gestalten zu können? Wie muss Deutschlands Rolle neu gedacht werden, wenn Europa sich im 21. Jahrhundert im Spiel der Weltpolitik behaupten möchte? Kann Deutschland, die größte Macht des Kontinents und selbst in einem tiefen Umbruch begriffen, die EU politisch führen? All dies wird wesentlich davon abhängen, ob es dem Land in der Mitte Europas gelingt, seine ökonomische, politische und kulturelle Macht so einzusetzen, dass ein Auseinanderfallen Europas verhindert werden kann. Hierfür sind nicht nur die genannten Reformen dringend erforderlich, sondern Deutschland und die EU müssen sich auch als widerstandsfähig gegen Russland, selbstbewusst im Umgang mit China und, falls es nötig werden sollte, als unabhängig von den USA erweisen. Alles andere läuft auf ein Versagen hinaus, das verheerende Folgen haben kann. Denn im Widerstreit der großen Mächte gibt es keine lange Bank, und ein wiederholtes Zuspätkommen wird in einer Welt im Umbruch nicht verziehen.
Kapitel 1Demokratie im 21. Jahrhundert
Demokratische Rechtsstaaten und autoritäre Regime: das globale Ringen um die politische Ordnung
Das Verhältnis zwischen liberaldemokratischen Rechtsstaaten und autoritären Regimen hat sich nicht so entwickelt, wie die meisten Beobachter es nach der Auflösung des Ostblocks und dem Zerfall der Sowjetunion erwartet haben: Damals dominierte die Vorstellung, die Anzahl der autoritären Regime werde im Lauf der Zeit immer kleiner und die der Demokratien kontinuierlich anwachsen. Vielleicht waren nicht alle so zuversichtlich wie der amerikanische Politikwissenschaftler Francis Fukuyama, der in seinem Buch The End of History and the Last Man die Auffassung vertrat, dass es fürderhin zur Verbindung von Demokratie und Marktwirtschaft keine weltgeschichtliche Alternative mehr gebe.[1] Damit wollte er nicht sagen, wie das mitunter missverstanden wurde, dass in Zukunft keine autoritären Regime und keine staatlich gelenkten Wirtschaftssysteme mehr vorhanden seien, sondern nur, dass diese im globalen Maßstab keine große Attraktivität mehr hätten und sich präsentieren müssten, als ob es sich bei ihnen um Varianten der Demokratie handele. Kurzum: Das Autoritäre müsse sich demokratisch verkleiden, um politisch einigermaßen durchzukommen. Mit Letzterem hat Fukuyama immerhin richtiggelegen; zahlreiche autoritär-autokratische Regime bedienen sich pseudodemokratischer Inszenierungen, von Putins Russland bis zum Mullahregime im Iran.
Auch zurückhaltendere und vorsichtigere Autoren, etwa Samuel P. Huntington, gingen von einer neuen «Welle der Demokratisierung» aus, wie es sie bereits im 19. und 20. Jahrhundert gegeben habe.[2] Im Unterschied zu Fukuyama nahm Huntington jedoch nicht an, dass es sich bei der neuerlichen Demokratisierungswelle um eine irreversible Entwicklung handele, an deren Ende es nur noch Demokratien und keine autoritären Regime mehr geben werde. Huntington hielt die Zukunft für offen und schloss nicht aus, dass die Welle der Demokratisierung wieder zurückströmen, die Anzahl der Demokratien also auch wieder abnehmen könne. Er erwartete eher eine Pendelbewegung oder ein Auf und Ab statt eines irreversiblen Wendepunkts der Geschichte.[3] Vermutlich hat aber auch Huntington nicht erwartet, dass die Ära der Demokratisierung so schnell wieder zu Ende gehen würde. Das ist seit Beginn des 21. Jahrhunderts der Fall: Die Zahl der Demokratien ist im globalen Rahmen rückläufig, das europäisch-amerikanische Vorbild hat, vergleicht man es mit der Orientierung an China, an Boden verloren, und selbst in den USA steht nicht fest, ob die Demokratie als institutionelle Ordnung eine zweite Präsidentschaft Trumps unbeschadet überstehen wird. Inzwischen ist von einer «demokratischen Regression» die Rede.[4] Tatsächlich werden wir uns auf einen globalen Wettstreit zwischen autoritären und demokratischen Systemen einstellen müssen, dessen Ausgang offen ist. Entgegen den Erwartungen Fukuyamas ist keineswegs sicher, dass die Demokratie als politische Ordnung das 21. Jahrhundert dominieren wird.
Auch in der Europäischen Union gibt es mehrere Staaten, Ungarn etwa, um nur den prominentesten Fall zu nennen, bei denen das Demokratische eher Fassade ist und das dahinter befindliche Autoritäre verdecken soll. In Ostmitteleuropa zeigt sich außerdem, dass demokratische Ordnungen in hohem Tempo von populistischen Parteien übernommen und in autoritäre Regime verwandelt werden können, wohingegen die umgekehrte Entwicklung zum demokratischen Rechtsstaat zurück mühsam und langwierig ist. Die Autoritären schaffen nämlich in der Zeit ihrer Herrschaft Strukturen, die sich so schnell nicht in demokratisch-rechtsstaatliche Ordnungen zurückverwandeln lassen. Zudem bringen sie oft Personen in einflussreiche Positionen, die sich weigern, ihre Machtstellung wieder aufzugeben und dabei zum offenen Verfassungsbruch bereit sind. Der Sturm aufs Kapitol, mit dem im Januar 2021 die Inauguration Joe Bidens als neuer Präsident der USA verhindert werden sollte und bei dem der abgewählte Präsident Trump eine überaus dubiose Rolle spielte, ist dafür das wichtigste Beispiel. In Polen ließ sich nach dem Wahlsieg der Bürgerplattform Ähnliches beobachten.
Offenkundig hat das Autoritäre, ist es erst einmal an die Macht gekommen, eine sehr viel größere Beharrungskraft als das Demokratische, was nicht zuletzt an der Bereitschaft liegt, demokratische Institutionen zu zerstören, während sich Demokratien damit schwertun, die Hinterlassenschaften eines autoritären Systems zu beseitigen. In der Demokratie kommt den leicht verwundbaren Elementen, etwa der freien Presse oder einer politisch unabhängigen Justiz, eine zentrale Bedeutung zu. Sind die erst einmal beschädigt, dauert es lange, bis sie wiederhergestellt sind. Solche Verwundbarkeiten sind jedoch konstitutiv für die Demokratie und können darum nicht präventiv beseitigt werden.
Bei dem neuerlichen Ringen zwischen demokratischem Rechtsstaat und autoritärem Regime ist deshalb, wie gesagt, nicht ausgemacht, dass die Demokratie am Schluss die Oberhand behalten wird. Es ist nicht prinzipiell ausgeschlossen, dass das 21. Jahrhundert zu einer Ära des allmählichen Niedergangs und schließlichen Verschwindens der Demokratie werden kann.[5] Historisch wäre ein solches Verschwinden keineswegs neu: Auch die attische Demokratie, die im 5. vorchristlichen Jahrhundert den Höhepunkt ihrer glanzvollen Entwicklung erreichte,[6] ist schon bald von Krise zu Krise gestolpert und am Ende der makedonischen Monarchie zum Opfer gefallen.[7] Die römische Republik, sicherlich mehr eine Oligarchie als eine Demokratie, ist in einer Abfolge von Bürgerkriegen derart geschwächt worden, dass sich mit dem Aufstieg Octavians, der sich dann Augustus nannte, die Herrschaft eines Einzelnen durchsetzte. Und die bürgerpartizipativen Ordnungen des späten Mittelalters, ebenfalls eher inklusive Oligarchien als Demokratien, haben sich in der frühen Neuzeit im Konflikt mit dem entstehenden Territorialstaat nicht zu behaupten vermocht. Demokratien beziehungsweise, umfassender, bürgerpartizipative Ordnungen haben, wenn man sich an den genannten Beispielen orientiert, keine sonderlich lange Lebensdauer – eine deutlich kürzere jedenfalls als autoritäre Ordnungen.
Die Demokratie ist nämlich, was häufig übersehen wird, eine überaus anspruchsvolle und insofern zutiefst gefährdete Regierungsform. Sie setzt nicht nur das Engagement der Bürger, sondern bei diesen auch eine beträchtliche politische Urteilsfähigkeit voraus. Sie beruht darauf, dass ein relevanter Teil der Bürgerschaft sich für öffentliche Belange einsetzt und dabei das Wohlergehen der Gesamtheit, das Gemeinwohl, im Auge hat. Der demokratische Bürger hat sich um das zu sorgen, was alle Bürger betrifft, und nicht nur um das, was ihn selbst und seinesgleichen angeht. Um dieses Gemeinwohl im Blick zu haben und bei der Konkurrenz zwischen Eigeninteresse und Gemeinwohlorientierung nicht prinzipiell dem Eigeninteresse den Vorzug zu geben, bedarf es indes eines Gemeinsinns, den die Demokratie aus anderen Quellen beziehen muss als aus den ihr eigenen Funktionsmechanismen. Das hat der Staatsrechtler Ernst-Wolfgang Böckenförde gemeint, als er die Formel prägte, die Demokratie beruhe auf Bestandsvoraussetzungen, über die sie nicht selbst verfüge.[8] Für Böckenförde war dies die Religion beziehungsweise das Christentum, das seiner Auffassung nach eine Hingabebereitschaft hervorbringe und pflege, die ein leistungsstarker und beharrungsfähiger Widerpart zu dem am Eigeninteresse orientierten alltäglichen Betrieb des modernen Menschen sei.
Würden alle sich gemäß der in den Wirtschaftswissenschaften stilisierten Figur des homo oeconomicus verhalten, so würde die Orientierung am Gemeinwohl schnell schwinden. Man muss jedoch bezweifeln, dass eine Ansammlung egoistischer Nutzenmaximierer in der Lage wäre, sich über einen längeren Zeitraum in einer Demokratie zu organisieren. Im Hinblick auf die Möglichkeit, ihre Interessen zu verfolgen, würden sie das wohl gern tun, aber sie würden, wenn denn alle egoistische Nutzenmaximierer sind, keinen finden, der die Zeit und die Mühe aufzubringen bereit wäre, die Gemeinschaftsaufgaben gemäß demokratischen Regeln und im Interesse aller anderen zu übernehmen. Sie können vielleicht einen aus ihren Reihen durch die Aussicht auf hohe Besoldung dazu bringen, in der Vorstellung, sie könnten ihn auf diese Weise als Besorger des Gemeinwohls «kaufen», aber das Eigeninteresse, das sie dabei als Vehikel der Gemeinwohlverfolgung nutzen, wird bald die Gemeinwohlorientierung des zu deren Pflege «Gekauften» unterhöhlen und sich gegen sie durchsetzen.
Infolgedessen verwandeln sich Demokratien eher schleichend als disruptiv in Oligarchien, in denen einige im eigenen Interesse tätig sind und die Mehrheit der Bürger nicht viel zu bestellen hat. Diese Mehrheit wiederum wird sich irgendwann darüber empören und ihre Rechte sowie eine demokratische Partizipation einfordern. Aber wenn sich im Zuge der Revolte keine Gemeinwohlorientierung bei einer großen Anzahl von Bürgern herausbildet, wird die Revolte nur auf den Austausch einer Herrschaftsclique gegen eine andere hinauslaufen, ohne dass die Demokratie auf längere Dauer wiederhergestellt wird. Sie ist dann nur ein kurzes Intermezzo zwischen zwei sehr viel längeren Perioden autoritärer Herrschaft, wie sich das im «Arabischen Frühling» und danach auch in einigen Ländern Mittelosteuropas gezeigt hat. Die Staatsstreiche und Umstürze, wie wir sie noch aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bei der Zerschlagung von Demokratien kennen, sind zunehmend abgelöst worden von einer allmählichen Untergrabung der demokratischen Ordnung durch Akteure, die sich vorzugsweise als Verteidiger und Retter der Demokratie stilisieren. An die Stelle des schlagartigen Umbruchs ist eine schleichende Aushöhlung getreten.
Eine zweite Erklärung für die prekäre Stellung der Demokratie gegenüber der «autoritären Verlockung»[9] hebt weniger auf die ethischen Dispositionen der Bürger ab, also den Gegensatz von Eigeninteresse und Gemeinwohl, sondern stellt die allgemeinen Dispositionen der Menschen ins Zentrum der Aufmerksamkeit: eine starke Neigung zur Bequemlichkeit (was nicht dasselbe ist wie die Ausrichtung am Eigeninteresse) sowie schlagartig zum Ausbruch kommende Aufwallungen von Wut und Zorn, die Peter Sloterdijk unter dem Oberbegriff einer «thymotischen Energie» zusammengefasst hat.[10] Im Zorn kommt ein aufgestauter Groll zum Ausbruch, der jedoch eher eine perspektivlose Entladung von Ärger und Wut ist als eine nachhaltige Neuausrichtung der Menschen an Demokratie und Rechtsstaat. Die Menschen verschaffen sich Luft, um danach wieder in den «alten Trott» zurückzufallen. So jedenfalls wird die Demokratie nicht erneuert und auf feste Füße gestellt; die Ausbrüche von Wut und Zorn führen vielmehr dazu, dass die Wütenden und Zornigen zur Gefolgschaft derer werden, die auf den Sturz der Verfassung hinarbeiten und darauf warten, dass ihnen all jene zulaufen, die sich bislang wenig oder gar nicht mit der Politik beschäftigt oder in ihr und für sie engagiert haben. Wut und Zorn sind dem Populismus in die Hände spielende Dispositionen, und im Hintergrund populistischer Bewegungen steht allemal das Autoritäre, das den Empörten Genugtuung verspricht.
Bequemlichkeit, die dazu führt, dass man die politische Betätigung anderen überlässt, die das dann «schon machen» werden, und die emotionale Aufwallung von Wut und Zorn sind hinsichtlich der Voraussetzungen und Gefährdungen der Demokratie freilich nur zwei Seiten ein und derselben Medaille: des Missverständnisses der Bürger, sie könnten sich unter den Bedingungen einer demokratischen Ordnung als Konsumenten verhalten und die Demokratie als eine große Wunscherfüllungsmaschine nutzen, ohne für ihre Funktionsfähigkeit einstehen zu müssen. Einige Theorien haben die Demokratie gemäß dem Anspruch, den realen Betrieb zu beschreiben und nicht normative Selbstentwürfe, nach diesem Konsumentenmodell erfasst.[11] Sie haben dabei die demokratische Ordnung auf eine Form von Output-Optimierung reduziert und sie unter eine inzwischen überall anzutreffende Formel gestellt: «Die Politik muss liefern.» Oder auch, inzwischen immer häufiger: «Die Politik hat nicht geliefert.» Das hat dann zur Folge, dass man sich nach anderen Lieferanten umsieht, auch und gerade nach solchen, die mit der Demokratie nichts im Sinn haben. Die Demokratie ist jedenfalls für die Bequemen keine geeignete Verfassungsform. Sie ist anstrengend und herausfordernd.
Die Disposition zu politischer Bequemlichkeit kommt autoritären Regimen und ihren Versprechen zupass. Auch autoritäre Regime schließen nämlich mit der Gesellschaft einen Vertrag, dessen Einhaltung die Grundlage ihrer politischen Stabilität ist.[12] Kurz gefasst lautet dieser Vertrag: Wir kümmern uns um euch und euer Wohlergehen, dafür müsst ihr uns vertrauen und solltet euch in die Politik nicht einmischen; zu politischen Veranstaltungen geht ihr nur, wenn ihr gerufen werdet – und zwar von uns und nicht von anderen. Dieser Vertrag kommt der Grunddisposition der Bequemlichkeit sehr entgegen: Die Bürger sind hier von zeitaufwendigem politischem Engagement und mühsamer Arbeit an ihrer Urteilsfähigkeit entlastet; das Einzige, was ihnen abverlangt wird, ist der gelegentliche Gang zur Wahl. Dabei wird von ihnen freilich erwartet, dass sie für die vom Regime aufgestellten Kandidaten stimmen, sodass die Wahl nichts anderes ist als eine Camouflage des Autoritären. Unterdessen verwandeln sich die Bürger, ohne dass es ihnen sogleich auffällt und sie besorgt (schließlich können sie ja wählen gehen), in Untertanen; deren Charakteristikum besteht darin, dass sie parieren.
Étienne de La Boétie, ein Essayist des 16. Jahrhunderts und Freund Montaignes, hat das als servitude volontaire, als freiwillige Knechtschaft bezeichnet, weil sich die vormaligen Bürger dabei Gesetzen und Regeln unterwerfen, die von anderen gemacht und ihnen auferlegt worden sind – die sie sich allerdings auch selber hätten geben können, wenn sie sich für das Politische interessiert und im politischen Betrieb engagiert hätten.[13] Sie sind keineswegs in die Knechtschaft hineingezwungen oder ihr unterworfen worden, sondern haben sie freiwillig angetreten, weil sie sich davon ein weniger anstrengendes und riskantes Leben versprochen haben. Das hat Boétie in der paradoxen Zusammenfügung von Freiwilligkeit und Knechtschaft auf den Begriff gebracht.
Ein auf diesem Gesellschaftsvertrag beruhendes Regime setzt auf die Versorgung der Bürger zum Zwecke ihrer Ruhigstellung. Es handelt sich dabei nicht unbedingt um eine Herrschaft des Zwangs und der Knechtung; es kann auch ein paternalistisches – oder maternalistisches – Regime sein, das die Bürger in Kinder verwandelt und als solche behandelt. Ein solches Regime gerät in Schwierigkeiten, wenn es seine Versorgungsversprechen und die Zusage, die Menschen weder mit großen Abgaben zu belasten noch mit Opferzumutungen zu behelligen, nicht mehr einhalten kann. Die Revolutionen im Europa der Neuzeit waren nicht zuletzt Reaktionen auf drastische Steuererhöhungen infolge einer überbordenden Verschuldung des Staates, oder sie resultierten aus Versorgungskrisen infolge von Kriegen und der Weigerung vieler junger Männer, weiterhin in den Krieg zu ziehen und dort mit Leib und Leben für eine Sache einzustehen, die sie im Verlauf des Krieges immer weniger als die ihre ansahen. Die Revolutionen im Frankreich des 18. und 19. Jahrhunderts sowie die in Deutschland und in der Donaumonarchie von 1848 und 1918 könnten sich in den autoritären Regimen der Gegenwart durchaus wiederholen.
Der Vertrag autoritärer Regime mit der Gesellschaft wird bei Versorgungskrisen als gebrochen wahrgenommen: Das Regime fordert den Menschen mehr, sehr viel mehr ab, als beim Eintritt in die «freiwillige Knechtschaft» vereinbart worden ist oder die Menschen es sich vorgestellt haben – und wenn das so ist, dann wollen sie mit einem Mal über Zweck und Verwendung der Steuern und Abgaben sowie den Sinn und die Dauer eines Krieges mitentscheiden.[14] Das war so der Fall in der Amerikanischen Revolution unter der Parole «No taxation without representation» – keine Besteuerung ohne Repräsentation im Londoner Parlament –, sodann in der Französischen Revolution von 1789, in deren Vorgeschichte König Ludwig XVI. Steuererhöhungen durchsetzen wollte, und auch in den mittel- und osteuropäischen Revolutionen von 1917 und 1918, denen das Reich der russischen Zaren, das Reich der Habsburger in Wien und das der Hohenzollern in Berlin zum Opfer fielen, nachdem sie zuvor Millionen ihrer Untertanen zu den Waffen gerufen und auf den Schlachtfeldern Europas geopfert hatten. Sie hatten ihren Gesellschaften damit mehr abverlangt, als der autoritäre Gesellschaftsvertrag vorgesehen hatte.