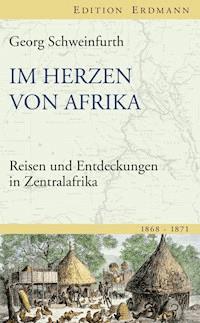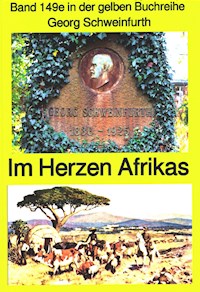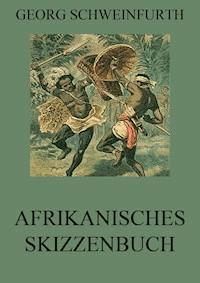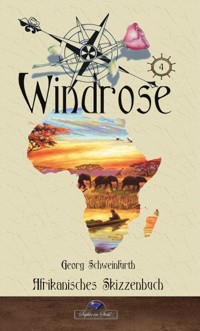
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Windrose
- Sprache: Deutsch
Georg Schweinfurt lebte von 1836 bis 1925 und war ein bedeutender deutscher Afrikaforscher. Das Buch erschien erstmalig 1874 und schildert seine dritte Reise von 1869 bis 1871 die ihn bis zu Äquator führte. Teilweise zog er auf dieser Reise mit den Karavanen afrikanischer Elfenbein- und Sklavenhändler. Er traf auch auf Kanibalen und war in Stammeskriege verwickelt. Es ist ein Klassiker der Literatur über die Völker, die Botanik und die Geografie Afrikas. Von der Weltanschauung und Denkweise gilt das Buch zwischenzeitlich als etwas überholt. Interessant waren die Geschichten, wie über die großen Viehherden der Afrikaner, ihren riesigen ergiebigen Ackerflächen, man beherrschte an einigen Orten auch die Herstellung von Eisen in sehr guter Qualität und hatte Kupfer. Es herrschte durchaus auch eine Klasse die wohlständig und teils fortschrittlich war. Beim Sklavenhandel handelte es sich um innerafrikanischen Sklavenhandel, nicht um Sklavenhandel mit Nordamerika. Einige Stämme hielten Sklaven, die Frauen waren auch meist gekaufte Sklavinnen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 378
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Herausgeber
Erik Schreiber
Windrose 4
Reiseerzählungen
Georg Schweinfurth
Afrikanisches Skizzenbuch
Verschollene Merkwürdigkeiten
Saphir im Stahl
Reiserzählungen 4
e-book 193
Georg Schweinfurth - Titel
Erscheinungstermin 01.11.2023
© Saphir im Stahl Verlag
Erik Schreiber
An der Laut 14
64404 Bickenbach
www.saphir-im-stahl.de
Titelbild: Archiv Andromeda
Lektorat Peter Heller
Vertrieb neobook
Herausgeber
Erik Schreiber
Windrose 4
Reiseerzählungen
Georg Schweinfurth
Afrikanisches Skizzenbuch
Verschollene Merkwürdigkeiten
Saphir im Stahl
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Nachschrift
Lebenslauf
I. Nächtliches Tierleben in der Oase
II. Fünf Tage in die unzugängliche Bergwildnis bei Kosser am Roten Meer (Ein Reise-Brief)
III. Die ältesten Klöster der Christenheit - St. Antonius und St. Paulus
IV. Bei den Höhlenbewohnern von Sokotra
V. Ein alter Staudamm aus der Pyramidenzeit
VI. Die Entdeckung des „Schweinfurth-Tempels“ am Möris-See
VII. Eine römische Wüstenstadt und die Steinbrüche am Mons Claudianus
VIII. Ein Überrest aus dem „goldenen Zeitalter“ Das alte römische Villenviertel von Hippone (Bona)
IX. Ägyptische Überbleibsel in Abessinien und im Sudan (Haartracht, Pomade und Salben)
X. Die Totenbestattung bei den Uräthiopen (Die Grabbauten der Blemmyes, Bega)
XI. Die neuen Versuche mit den alten Goldbergwerken der Ägypter
Vorwort
Widrige Zeitverhältnisse verhinderten mich viele Jahre lang, die gewohnten Reisen im Süden weiter fortzusetzen. Das zunehmende Alter machte sie ganz unmöglich. Aber Marksteine meiner Wanderungen waren geblieben. Tagebücher aus alter Zeit und verschollene Schriften, die ich über Gegenstände von dauernder Bedeutung veröffentlicht hatte, lagen in großer Anzahl vor. Das Verlangen, solche der Vergessenheit zu entreißen, belebte meine Erinnerung mit neuem Reiz. Das Paradies, aus dem wir nicht vertrieben werden können, beglückt uns immer mit dem Zauber seiner ewigen Frische.
Mein Buch „Auf unbetretenen Wegen in Ägypten“ bot mir zuerst erwünschte Gelegenheit, von meinen alten Schriften einige in geprüfter Fassung dem Leserkreis der Gegenwart vorzuführen. Ihr Inhalt fand Interesse, er war, weil nur wenigen Kennern zugänglich, im Allgemeinen so gut wie unbekannt geblieben. Jetzt bringe ich eine Auswahl aus dem genannten Werke, vermehrt um dort noch nicht veröffentlichte Artikel, von denen etliche über den Bereich von Ägypten hinausreichen. Das gab den Anlass zu einer entsprechenden Änderung des Titels.
Meine ersten Stichproben ins Unbekannte von Afrika betrafen vor vielen Jahren die Küstenstriche auf der Westseite des Roten Meeres. Diese sind, soweit sie Ägypten und Nubien angehören, noch bis auf den heutigen Tag von europäischen Reisenden so gut wie unbetreten geblieben.
Die in den „Unbetretenen Wegen“ enthaltene „Reise an der Küste des Roten Meeres“ ist hier weggeblieben. Sie erschien als besonderes Buch soeben in den „Wegen zum Wissen“ des Ullstein-Verlages.
Im Abschnitt I gebe ich eine Schilderung aus dem nächtlichen Tierleben der Libyschen Wüste. Wenn ich mich auch auf dem Gebiete der Naturkunde hauptsächlich der Botanik widmete, so hat mich die Tierbeobachtung immer auf das lebhafteste interessiert.
Bei meinen Bergbesteigungen (Abschnitt II) werde ich gewiss Strecken betreten haben, die nie ein menschlicher Fuß berührte, doch ist darauf kein besonderes Gewicht zu legen, denn dazu bieten noch viele andere Gebirge Gelegenheit. Die Nachsicht des Lesers werde ich anzurufen haben, wo bemerkenswerte Erlebnisse und überraschende Beobachtungen von einer Menge von Einzelheiten verhüllt sind, die nur für den Spezialgelehrten von Interesse sein können. Viele botanische Angaben sind deshalb gestrichen worden, und der Pflanzengeograph wird die ursprüngliche Veröffentlichung zu berücksichtigen haben. Über meine Veröffentlichungen bietet die Liste Auskunft, die der dritten Ausgabe meines Reisewerks „Im Herzen von Afrika“ (1918) beigegeben ist.
Der Abschnitt III war bisher für diejenigen eine Überraschung, die auf meinen Reisen kirchengeschichtliche Neuigkeiten aus dem Altertum nicht erwartet haben. Ich war seit Vansleb (1672) der einzige, der die alten Klöster ausführlich beschrieb. In dem ersten Bande des von Friedrich Bodenstedt als Almanach für das deutsche Haus herausgegebenen, aber nicht weiter fortgesetzten „Kunst und Leben“ erschien meine Arbeit an jetzt fast unauffindbarer Stelle. Die von der Kapelle des heiligen Antonius gegebene Abbildung ist die erste und einzige ihrer Art. Meine flüchtige Skizze durch nachträgliche Ausführung zu vervollständigen, habe ich nicht gewagt. Sie stellt eine der ältesten christlichen Kirchenräume dar, die aus den ersten drei Jahrhunderten noch vorhanden sind. Die von Weingarten aufgestellte Hypothese eines Nichtvorhandengewesenseins vom heil. Paulus von Theben, dem ägyptischen Nationalheiligen (weil Eusebius seiner nicht erwähnte), habe ich unbeachtet gelassen. In neuerer Zeit haben außer Paul Güßfeldt und mir auch andere Deutsche die alten Wüstenklöster besucht. 1901 waren dort Carl Becker, Bernhard Moritz und Josef Strzygowski zu gemeinschaftlichem Besuch.
Abschnitt IV, über die Höhlenbewohner von Sokotra, kann als Ergebnis einer aufschlussreichen Reise gelten, die ich im Anschluss an die Expedition des Dr. Riebeck 1881 im Golf von Aden ausführte.
Die im Abschnitt V beschriebenen Überreste des als Unikum aus dem Alten Reich stammenden Stauwerks bilden in diesem Bande den einzigen Gegenstand, dessen Besichtigung für die Wintergäste des Landes leicht zugänglich erscheint. Glückliche Funde werden sich dort vielleicht noch machen lassen, um die von mir aufgeworfenen Fragen nach dem Ursprung und den Umständen zu beantworten, unter denen ein so ungewöhnlicher Bau – von so kurzer Dauer – entstand.
Abschnitt VI gibt die Beschreibung eines von mir entdeckten Tempels gelegentlich einer Reise im Umkreise von Fajum. Der Name „Schweinfurth-Tempel“ rührt selbstverständlich nicht von mir her, sondern wurde von Robert Brown in dessen Buch zum ersten Male angewendet.
Das Kapitel VII mit den römischen Steinbrüchen, die ich als erster ausführlich beschrieb, obgleich vor mir bereits mehrere Archäologen den Platz besucht hatten, bietet der ungelösten Fragen viele. Sie betreffen vor allem das ehemalige Vorhandensein verwickelter Röhrenleitungen und eines Pumpwerks, das ein in der Kulturgeschichte jener Zeit noch wenig aufgeklärtes Verfahren betrifft. Ich habe auch die Frage angeregt, wie Archimedes in Ägypten zur Idee seiner Schraube (der Wasserschnecke) gelangt sein kann.
Abschnitt VIII handelt von den Ausgrabungsergebnissen in Tripolis, die das römische Villenviertel von Hippone (Bona) freilegten. Diese Beschreibung erregte damals die Aufmerksamkeit Kaiser Wilhelms II., der den Ankauf der Mosaiken wünschte. Berliner Gelehrtenkreise setzten dem jedoch Widerstand entgegen, wegen der „zu späten“ Entstehungszeit der Mosaiken, und diese äußerst wertvollen antiken Kunstdokumente gelangten für nur 40 000 Franken in französischen Besitz.
Abschnitt IX zählt die Überreste auf, die heute noch im äthiopischen Süden an eine ägyptische Vergangenheit erinnern. Besonders ausführlich wird auf die Merkwürdigkeit des Salbkegels (d. i. Pomadenklumpen auf dem Haupt der Frauen) eingegangen.
Von den in Abschnitt X zusammengestellten Grabbauten, die ich als die einzigen Denkmäler der hamitischen Völker bezeichnete, habe ich nach eigenen Beobachtungen nur wenige ausführlich beschreiben können. Sie würden aber für Ethnologen eine lohnende Aufgabe zu eigenen Forschungsreisen darbieten. Von der 1865 entdeckten großen Gräberstadt Maman habe ich Abbildungen einzelner Bauten gegeben. Im gesamten Nilgebiet gibt es nichts derartiges von gleicher Größe.
Was ich über die Wiederinbetriebsetzung der alten Goldminen der östlichen Wüste berichten konnte, betrifft schon die neueste Zeit. Zum Verständnis genügt das in der einleitenden Notiz zu XI Gesagte.
Georg Schweinfurth. Berlin-Schöneberg, Juli 1925.
Nachschrift
Es war dem greisen Verfasser nicht vergönnt, die Fertigstellung des Werkes zu erleben. Wohl haben ihm die Korrekturbogen noch vorgelegen, aber ehe zum Druck geschritten werden konnte, setzte der Tod seinem unermüdlichen Schaffen ein Ziel. Am Inhalt ist nachträglich nichts geändert worden; wir bringen genau nach den zu Lebzeiten Georg Schweinfurths uns übermittelten Weisungen dieses Werk heraus, das sein Schwanenlied geworden ist.
Berlin, im September 1925. Der Verlag.
Lebenslauf
Ich bin 1836 in Riga geboren, das in meiner Jugendzeit kaum den zehnten Teil seiner heutigen Bewohner hatte. Trotz der von vielen Russen und Letten bewohnten Vorstädte konnte man es eine durchaus deutsche Stadt nennen, und auf dem Gymnasium wurden, mit Ausnahme des Russischen, alle Fächer in deutscher Sprache gelehrt. Im Kreise meiner Geschwister und Verwandten habe ich nie russisch sprechen gehört, und ich erinnere mich nicht, dort je einen Nationalrussen verkehren gesehen zu haben. Mein Vater war aber Russland gegenüber von äußerst loyaler Gesinnung und hielt streng darauf, dass auch seine Kinder sich einer solchen befleißigten. Als Knabe habe ich mehrere Jahre in einer mitten in Livland gelegenen Erziehungsanstalt verbracht und später die oberen Klassen des Rigaischen Gymnasiums besucht. Frühzeitig ist in mir, durch das Lesen von Reisebeschreibungen angeregt, der Sinn für Forschungen und Entdeckungen in entlegenen Teilen der Welt erweckt worden, und ich suchte mich unauffällig an Strapazen und Entbehrungen aller Art zu gewöhnen, vornehmlich durch ausgedehnte Fußwanderungen, die ich ohne Begleitung in den heimatlichen (baltischen) Provinzen zur Ausführung brachte. 1857 bis 1860 studierte ich in Heidelberg. Nachdem ich in München und in Berlin die naturhistorischen Studien zum vorläufigen Abschluss gebracht hatte, wurden mir von der inzwischen Witwe gewordenen Mutter 10 000 Rubel überwiesen, um die längst geplanten Reisen in Afrika ausführen zu können. So betrat ich am 26. Dezember 1863 zum ersten Male afrikanischen Boden in Alexandria. Ich hatte mir die botanische Erforschung der Nilländer und der benachbarten Gebiete als das zu verfolgende Ziel gesteckt.
Meine erste Reise ins Unbekannte brachte zahlreiche Stichproben der Forschung zustande, die vom Roten Meer aus, das ich in kleiner Barke befuhr, mich an die Küsten von Ägypten und Nubien und in die benachbarten Gebirge führte. Dann zog ich von Suakin landeinwärts nach Kassala und nach Gallabat, wo ich die Regenzeit verlebte, und von wo aus ich später auf dem Rückwege über Sennaar nach Khartum gelangte. Auf dieser meiner ersten Afrikareise habe ich für die Pflanzengeographie wichtige Tatsachen feststellen können. Einige Beiträge zur Vervollständigung des Kartenbildes der durchreisten Gegenden wurden geliefert und, auf der Reise nach Kassala, Maman, die alte Gräberstadt der Bega, entdeckt. Im Sommer 1866, als die Schlacht von Königgrätz geschlagen wurde, war ich auf der Heimreise begriffen. Ich fand gewisse Schwierigkeiten, um über Wien zum Besuch meiner Familie nach Riga zurückzugelangen.
Ich war nun durch Studien und Erfahrung genügend vorbereitet, um mir beim weiteren Verfolg meiner Reisepläne, und in erfolgreichem Wettbewerb mit anderen, die von der Berliner Akademie der Wissenschaften vergebenen Mittel der „Humboldtstiftung für Naturforschung und Reisen“ zuwenden zu lassen, und so dem Ziel meiner Wünsche, den noch zum großen Teil unbekannten Gebieten am oberen Nil, nähertreten zu können. Alexander Braun, Reichert und du Bois-Reymond waren in der Akademie meine erfolgreichen Fürsprecher. Die mir gestellte Hauptaufgabe betraf die botanische Erforschung des Stromgebiets des Bahr-el-Ghasal. Daneben sollten auch geographische und ethnographische Forschungen im Auge behalten werden. Seitens der ägyptischen Regierung wurde meinem Unternehmen von Khartum aus nachdrücklichst Vorschub geleistet, und ich gelangte dadurch bei den im Forschungsgebiet tätigen Khartumer Elfenbeinhändlern zu derartigem Ansehen, dass alle in Liebenswürdigkeiten gegen mich wetteiferten, und in den Niederlassungen der Befehlshaber die bewaffneten Wanderscharen miteinander um den Vorzug stritten, meinen Plänen dienlich sein zu dürfen. Statt mich finanziell auszubeuten, lieferten sie kostenfrei Träger und Proviant. In den Stationen wurde mir ausgiebige Gastfreundschaft gewährt. Ich hatte mir in Khartum eine Art Leibgarde von vier zuverlässigen Nubiern besorgt, aber meine beschränkten Mittel (im ganzen überstiegen sie nicht viel die Summe von 25 000 Mark) hätten bei den weiten Wanderzügen im Innern nicht zur Bezahlung der vielen Träger gereicht, deren ich zur Fortschaffung meines umfangreichen Gepäcks bedurfte. Als nach Beendigung des wichtigsten Abschnitts dieser Reise, nach dem gegen Süden bis ins Land der Mangbettu geführten Vorstoß, ich fast meiner ganzen Habe (die Sammlungen waren zum Glück schon auf dem Wege nach Europa) durch eine Feuersbrunst beraubt worden war, für die der Verwalter des Khartumer Großkaufmanns, mit dem ich einen Vertrag abgeschlossen, verantwortlich war, wurde ich, da ich von einer Entschädigungsklage Abstand genommen hatte, großer Zahlungsverpflichtungen enthoben, die schwer zu befriedigen gewesen wären. Hätte ich damals über das Geld verfügen können, das mir später der englische Verleger für mein Buch zahlte, so wäre ich gewiss gern noch einige Jahre in Afrika geblieben und hätte alsdann in der kongowärts zum ersten Male von einem Europäer betretenen Richtung noch manche Entdeckung machen können, denn meine Gesundheit war unerschüttert geblieben.
Im Frühjahr 1872 war ich wieder nach Deutschland zurückgekehrt. Meinen ersten Reisebericht trug ich der Geographischen Gesellschaft von München vor, aber in Berlin, dem ich ganz angehörte, wurde mir von meinen akademischen Gönnern und seitens der Gesellschaft für Erdkunde mit den zahlreichen alten Freunden der wärmste und ehrenvollste Empfang bereitet. Besondere Beachtung ward meinen Reiseergebnissen in England zuteil. In der zu Brighton tagenden „British Association“ hatte Stanley, der kurz zuvor den verschollenen Livingstone aufgefunden, dessen Ansicht eifrigst verteidigt, dass der Lualaba nordwärts dem Gazellenfluss zuströme. Stanley versuchte damit den Nachweis zu liefern, dass von Livingstone nunmehr die wahre Nilquelle festgelegt sei. Seine Worte lauteten dem Sinne nach ungefähr folgendermaßen: „Was Colonel Grant da erzählt, setzt mich in Erstaunen. Ich habe noch nie davon gehört, dass ein Engländer bis zu jenen Gegenden vorgedrungen sei, und nun soll ›a Herr of some sort‹ dort gewesen sein und hat einen kleinen Fluß gesehen. Keine Spur davon! Ein Fluß, den ein Livingstone entdeckte (Lualaba), kann nur der Nil sein (d. h. andere wären seiner gar nicht würdig).“ Dem aber widersprach aufs entschiedenste Grant, der Reisegenosse von Speke, und er bewies, dass diese Hypothese infolge der vor kurzem durch mich gemachten Entdeckung eines sich mit verkehrter Stromrichtung dazwischen einschaltenden Flusses, des Uelle, durchaus unhaltbar geworden sei. Vom großen Kongo, dessen Festlegung auf unseren Karten in der Folge Stanley zum größten Entdeckungsreisenden Afrikas stempeln sollte, hatte man damals noch keine Ahnung.
Einige Jahre später, als Stanley von seiner großen Kongofahrt zurückkehrend mich in Kairo kennen lernte, hat er den kleinen Ausfall gegen mich in vornehmer Weise wieder gutgemacht. Von der englischen Kolonie in Kairo wurde ihm damals im Hotel Shepheard ein Festessen gegeben, das Sir George Elliott zustande brachte. Als Stanleys Gast war ich von diesem selbst dazu eingeladen und ich hatte zu seiner Rechten den Ehrenplatz. Stanley hielt sogar noch eine wundervolle Rede, in der er mich feierte.
Nach meiner Rückkunft aus Afrika im Sommer 1872 erfolgte die Veröffentlichung des umfangreichen Werkes „Im Herzen von Afrika“, dessen Entstehungsgeschichte vielleicht interessieren wird. Ich war im Rheinischen Hof, damals einem guten Hotel an der Ecke der Friedrich- und Leipziger Straße, abgestiegen und hatte dort die Bekanntschaft eines liebenswürdigen und sehr unterrichteten Deutschamerikaners, des Herrn Henry Jacoby, gemacht, der als Berichterstatter des New York Herald in Deutschland tätig war. Er nahm großes Interesse an meinen Erzählungen der Reiseerlebnisse und suchte mich alsbald für das Londoner Verlagshaus Sampson Low, Marston Low & Searle zu gewinnen, das damals durch Stanleys spannende Schilderung „Wie ich Livingstone auffand“ im Buchhandel der Welt eine große Rolle zu spielen begann. Der Titel meines geplanten Reisewerkes wurde bald festgestellt. Ich schlug die Fassung vor: „Im Herzen von Afrika“, wozu Jacoby verschiedene Varianten in Vergleich stellte, bis er, nach mit Kennermiene (wie bei einer Weinprobe) allerseits geprüftem Wortklang, zu dem Ergebnis gelangt war, dass im Englischen sich „The heart of Africa“ am besten ausnehmen würde.
„Ich werde gleich an Sampson Low schreiben, sagte Jacoby, ich werde als Honorar ... Pfd. Sterling verlangen“ (er nannte einige Tausende). Ich mahnte zum Maßhalten. Endlich kam man überein, den Betrag für sämtliche Editionen auf 2000 Pfd. Sterling festzusetzen. Freunde hatten bereits geglaubt, mir verlockende Aussichten auf deutschen Verlag eröffnen zu können. Ich erinnere mich wohl, wie Robert Hartmann mir von einem deutschen Verlag gesprochen hatte und von 600 Talern (oder waren es 800?), die sein Angebot seien. Nun stand ich einer ganz neuen Verlockung gegenüber, die mir zunächst phantastisch erschien. Aber es ging alles leichter, als ich gedacht, und es blieb bei der geforderten Summe. Die Antwort aus London traf bald ein und war zunächst in sehr entgegenkommender Weise an mich gerichtet. Herr Marston hatte sich offenbar bei den Londoner Botanikern über das „Vorleben“ des unbekannten Reisenden erkundigt. Es machte auf mich einen drolligen Eindruck, wenn er gar leichten Herzens Zutrauen zu meinen Leistungen zu bekunden schien, indem er sich auf ein aus so fremdem Lager abgegebenes Urteil stützte: – „Wenn Sie bei Schilderungen ihrer Reisen dieselbe Gewandtheit („the same facilities“) an den Tag legen, wie in der Botanik, so entsprechen Sie dem, was ich brauche“, hatte er geschrieben. Von meinen so umfangreichen Reiseberichten (seit 1864) in verschiedenen geographischen und naturhistorischen Zeitschriften – weil für den englischen Leser als nicht vorhanden betrachtet – nahm Mr. Marston nicht die geringste Notiz. Unnötigerweise hatte ich mir darüber Sorge gemacht und befürchtet, sie könnten dem Wert der englischen Veröffentlichung zum Schaden gereichen, dem Reiz der Neuheit Abbruch tun. Davon war bei den Verhandlungen keine Rede, man hielt sich in England nicht mit Nebensachen auf und verzichtete auf kleinliche Bemäkelung.
Was mir zur Empfehlung bei dem englischen Verleger sehr zustatten kam, war der Umstand, dass vor kurzem mein Name, allerdings bei einer mir ganz fremden Angelegenheit, in den englischen Zeitungen und in Verbindung mit Afrika rühmend erwähnt worden war. Die Times hatte einen zwei Spalten langen Artikel von Justus v. Liebig (1. Oktober 1872) gebracht, in dem ich als Zeuge für den Nährwert des Fleischextraktes angerufen wurde. Diesem waren bereits damals direkt nährende Eigenschaften in Abrede gestellt und nur anregende oder reizende zuerkannt worden. Jener erste Vortrag, den ich nach meiner Rückkehr in Deutschland über die Reisen 1868 bis 1871 zu halten hatte, fand vor der Geographischen Gesellschaft zu München, und zwar im Hörsaal des chemischen Laboratoriums statt. Unter den Zuhörern befand sich auch der Freiherr von Liebig. In dem Vortrage war unter anderem erzählt worden, wie ich im Lande der Niamniam aus dem Fleisch zweier am gleichen Tage erlegter Antilopen durch Zerhacken, Kochen, Filtrieren und schließliches Verdicken, durch Eindampfen mir einen Vorrat von zwei Flaschen sehr wohlschmeckendem Fleischextrakt herzustellen gewusst und wie dieser bei bald darauf eintretendem schlimmen Nahrungsmangel zu meiner Ernährung wesentlich beigetragen habe. Am folgenden Morgen, als ich den Botanischen Garten besuchte, wurde mir dort vom Inspektor der große Chemiker selbst vorgestellt. Er hatte mich offenbar erwartet, um mir zu sagen, dass ihn meine Mitteilungen über den selbstbereiteten Fleischextrakt und dessen erprobten Nährwert in hohem Grade interessiert hätten, und um nun daran die Frage zu knüpfen, ob ich wohl gestatten würde, dass er darüber in den Blättern berichte. So wäscht bei der Verkettung von Verdienst und Glück oft eine Hand die andere!
Es darf nicht wundernehmen, dass ich in der Folge von Freunden und Bekannten gelegentlich manches Wort des Tadels zu hören bekam, weil ich mich zur Veröffentlichung des Reiseberichtes zunächst an das Ausland gewandt hatte. Zu meiner Entschuldigung brauchte ich nur anzuführen, dass daraus weder der Wissenschaft Nachteil erwachsen, noch das Ansehen der deutschen Forschung in der Welt verringert worden ist.
Die große goldene Stiftermedaille der Londoner Geographischen Gesellschaft wurde mir nach dem Erscheinen meines „Im Herzen von Afrika“ für dieses Werk zuerkannt, wie die Begleiturkunde besagt, nachdem vor ihr die langjährigen botanischen Forschungen im Nilgebiet, die Feststellung der südwestlichen Begrenzung des Nilbeckens und die Entdeckung des Uelle jenseits dieser Wasserscheide, dann auch die Auffindung und Beschreibung des Zwergvolkes der Akka, als Bestätigung der alten Pygmäensage, unter den verdienstlichen Momenten namhaft gemacht worden waren. Außer den englischen in London und in Neuyork erschienenen Ausgaben meines Reisewerks sind auch italienische und namentlich mehrere französische Ausgaben der Öffentlichkeit übergeben worden. Als Kuriosum darf wohl auch die türkische Übersetzung angeführt werden, die in einem starken und illustrierten Band zu Konstantinopel erschien. Die erste deutsche Ausgabe von 1874 in zwei Bänden war bald vergriffen und ich musste später (1878) eine etwas gekürzte zweite in einem Bande zurechtmachen.
In den vier ersten Monaten des Jahres 1874 befand ich mich wieder auf Reisen in Afrika. Ich hatte zum Gegenstand meiner Forschungen die große Oase von el Chargeh gewählt und traf dort auf ihrem Rückzuge mit der von Gerhard Rohlfs zur Erforschung der Libyschen Wüste geleiteten Expedition zusammen.
Im August desselben Jahres beteiligte ich mich an der in Belfast abgehaltenen Tagung der British Association, wo ich über die besuchte Oase einen Vortrag hielt.
Auf Vorschlag von Heinrich Brugsch hatte mich der Khedive Ismail, laut Dekret vom 19. Mai 1875, mit der Gründung einer geographischen Gesellschaft in Kairo beauftragt, die ich am 2. Juni eröffnete, und die noch heute besteht. Ich blieb aber nur ein Jahr Vorsitzender dieser Gesellschaft und widmete mich, nachdem ich sie bei dem im August 1875 zu Paris abgehaltenen Kongress vertreten, dann eingehend der botanischen und geologischen Erforschung der östlichen Wüste, zu der ich im Frühjahr 1876 den ersten Streifzug, diesen in Gesellschaft von Paul Güßfeldt, ins Werk setzte. Ich habe in diesem Gebiet, mit Kamelen der Maase-Araber (gewöhnlich 12 an Zahl) 10 größere Reisen zur Ausführung gebracht und an Wegstrecke viele Tausende von Kilometern zurückgelegt. Zu der Kostenbestreitung hat mir das preußische Kultusministerium immer beträchtliche Unterstützung gewährt.
Auch im Westen des Niltals unternahm ich ausgedehnte Streifzüge. Viele Karten (30 Stück) entwarf ich von den durchreisten Länderstrecken, die bisher nicht aufgenommen worden waren, und die namentlich im Gebiet der östlichen Wüste zwischen 30° und 26° n. Br. noch als Terra incognita gelten konnten.
Dreizehn Jahre lebte ich als Privatgelehrter in Kairo ansässig und beschäftigte mich vorwiegend mit botanischen Studien. Ein großes Herbarium afrikanischer Pflanzen wurde in meiner Wohnung aufgestellt. Zusammen mit meinem alten Freunde Paul Ascherson, der fünfmal Ägypten besuchte, veröffentlichte ich 1887 im Bande II der Mémoires de l'Institut Egyptien eine Übersicht über die Flora von Ägypten, der 1889 noch ein Nachtrag beigefügt wurde.
Die geologischen und paläontologischen Ergebnisse meiner ägyptischen Streifzüge wurden dem für diese Fächer in Berlin vorhandenen Institut einverleibt, wo sie noch heute 14 Schränke füllen. Blankenhorn hat sie zum Teil auch in seiner 1921 erschienenen, alles Wissen vom Lande erschöpfenden Geologie von Ägypten verwertet.
Im Januar 1876 ist mir vom sächsischen Unterrichtsminister v. Gerber die Berufung auf den Lehrstuhl der Geographie an der Universität Leipzig angetragen worden. Ich war aber nicht gewillt, meine ägyptischen Forschungspläne nach Versuchen von so kurzer Dauer aufzugeben.
Im September 1876 war ich in Brüssel als Gast des Königs Leopold II. und als Mitglied der von ihm zusammenberufenen Afrika-Konferenz, die man als den Vorboten, ja als den ersten Akt der vom König mit so sicherem Zielbewusstsein ins Werk gesetzten Gründung des Kongo-Staats betrachten kann. Unter den 22 Teilnehmern befanden sich noch vier andere Deutsche: Oscar Lenz, Gustav Nachtigal, Ferdinand von Richthofen und Gerhard Rohlfs.
Im Jahre 1879 wurde unter Vermittlung des deutschen Konsulats in Kairo meine Naturalisation als Reichsdeutscher ermöglicht, nachdem ich durch einen Machtspruch des Fürsten Bismarck, trotz meines Verbleibs in Ägypten, als preußischer Staatsbürger Aufnahme gefunden hatte.
Im Hochsommer 1880 habe ich den Libanon durchzogen und im Jahr darauf mit Emil Riebeck eine botanische Erforschung der Insel Sokotra, dann auch einiger Teile der südarabischen Küste in Ausführung gebracht.
Im Herbst 1881 teilte ich auf dem in Venedig zusammenberufenen Geographischen Kongress mit A. de Quatrefages den Vorsitz der für die Ausstellung von Karten und Reisewerken eingesetzten Prüfungskommission.
Im Juni 1882 war ich nach einer dreimonatigen mit Kamelen ausgeführten Rundreise um Oberägypten nach Kairo zurückgekehrt, als alle Europäer, die dazu imstande waren, vor dem durch den ägyptischen Oberst Arabi-Pascha veranlassten Aufstand zu flüchten begannen. In Alexandria verbrachte ich, vor und nach der Beschießung der Stadt (d. h. der Forts) durch die englische Flotte, böse Tage und im Hause meines Freundes Eduard Friedheim war ich sogar mit diesem in arge Bedrängung durch den im Aufruhr befindlichen und bewaffneten Pöbel geraten, den wohl einzigen Lebensgefahr, der ich mich entsinne, in Afrika ausgesetzt gewesen zu sein. Es war am 11. Juli, als wir, im Begriff an Leinwandrollen aus den oberen Fenstern herabzugleiten, uns von den bewaffneten Volksmassen der Straße auf einen Balkon ausgesperrt sahen und gegen die Anstürmenden acht Stunden lang standzuhalten hatten. Wir flüchteten später nach dem großen Diakonissenhaus, das bis zur Landung der Okkupationstruppen als Zufluchtsstätte vieler Bedrängten einige Sicherheit darbot.
Im April 1883 konnte ich an Bord des deutschen Kreuzers „Cyklop“ (Kap.-Leutn. Kelch) von Alexandria aus eine behufs vorzunehmender Schießübungen ausgeführte Fahrt längs der Küste nach Westen mitmachen, die sich bis zu der damals zum türkischen Gebiet gehörigen Hafenbucht von Tobruk ausdehnte. Es war mir gestattet, an dieser selten betretenen Küste verschiedene Exkursionen zu unternehmen und meinen Sammlungen reiche Ausbeute zuzuführen.
Als altes Mitglied der englischen Antisklavereigesellschaft habe ich an den Vorsitzenden Charles Allen von Berlin aus die Aufforderung telegraphiert, es müsse schleunigst gegen die Mahdisten im Sudan vorgegangen werden, weil General Gordon sich in Khartum in äußerst bedrängter Lage befände und es jetzt die elfte Stunde sei, wenn man ihn noch retten wolle. Die Times vom 19. Juli 1884 brachte meine Nachricht als Alarmdepesche, und ich erlitt vielen Tadel wegen Übertreibung der Gefahr. Immerhin glaubte ich mich später rühmen zu dürfen, den Entschluss zum Feldzug wenigstens gefördert zu haben, denn Gordon ist doch nur infolge der verspäteten Hilfe umgekommen.
Obgleich von Anfang an ein sehr eifriges Mitglied der Deutschen Kolonialgesellschaft, war ich doch nicht in der Lage, ihren Bestrebungen von unmittelbar förderndem Nutzen zu sein, zumal, da ich kein einziges von unseren Kolonialgebieten aus eigener Anschauung kennen gelernt habe. Trotzdem wurde mir bereits im November 1886 unter dem Präsidium des Fürsten Hohenlohe-Langenburg die Ehrenmitgliedschaft dieser Körperschaft zuteil. Besonders bei zwei Anlässen bot sich mir eine Gelegenheit, in öffentlicher Rede die kolonialen Interessen zu vertreten. Bei der 59. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte hielt ich 1886 im Zirkus Renz zu Berlin einen Vortrag über „Europas Aufgaben und Aussichten im tropischen Afrika“, wo meine erregten Worte über unsere als „Abenteurer“ missachteten Vorkämpfer stürmischen Beifall fanden, wie mir ähnliches in meinem Leben nie zuteil geworden ist. Ich habe auch in einer am 17. August 1889 von der Deutschen Kolonialgesellschaft veranstalteten Protestversammlung gegen Englands Missachtung des vom Kongovertrag verheißenen freien Handelsverkehrs auf den Strömen, über „Deutschlands Verpflichtungen gegen Emin Pascha“ gesprochen und zur Begrüßung des aus Afrika zurückgekehrten Karl Peters am 25. August 1890 die Festrede gehalten. Nach Beendigung der von Karl Peters unternommenen Emin Pascha-Expedition war ich bis August 1891 Vorsitzender des Komitees der Peters-Stiftung, die zu einem die kolonialen Interessen in unserem Ostafrika fördernden Unternehmen (Dampfer auf dem See von Ukerewe) große Summen zusammenbrachte.
Der Vorsitz im „Institut Egyptien“ wurde mir 1887 übertragen. Diese vorwiegend französische Gesellschaft vertrat, in Tradition der vom General Bonaparte 1798 unter gleichem Namen aus den der französischen Expedition beigegebenen Gelehrten gebildeten Körperschaft, schon seit 28 Jahren in Kairo die wissenschaftlichen Interessen.
Am 1. Juli 1888 habe ich meine Wohnung in Kairo aufgegeben, um mich in Berlin ansässig zu machen. Damit meinen umfangreichen Herbarien eine bequeme Aufstellung gesichert würde, räumte mir der mit den Universitätsangelegenheiten im Kultusministerium beauftragte Ministerialdirektor Althoff das obere Stockwerk des an der Südostecke des damaligen Botanischen Gartens (jetzt des „Kleist-Parks“) gelegenen Häuschens ein, des sog. Steuerhäuschens, das ich 20 Jahre lang bewohnt habe, bis es im Jahre 1909 zum Abbruch gelangte, nachdem die große Gartenanlage nach Dahlem verlegt worden war. Auf des gütigen Althoff Betreiben wurden im neuerbauten Botanischen Museum zu Dahlem meinen Herbarien zwei große Stuben eingeräumt und sie kamen dort in ihren 102 Schränken zur Aufstellung. Gegen eine mir gewährte Rente wurde die Sammlung dem Staat vermacht und bei meinen Lebzeiten sollte sie von mir verwaltet werden.
Obgleich ich nun in Berlin als Einwohner eingeschrieben war, habe ich doch in den Winter- und Frühjahrsmonaten immer wieder Ägypten oder Nordafrika (Algerien und Tunesien) aufgesucht, um meinen botanischen Forschungen nachzugehen und die Sammlungen zu bereichern.
Die von mir längst sehnlichst erstrebte Ausbeutung von Jemen konnte ich in den Frühjahrsmonaten 1889 und in dem vorhergegangenen Winter zur Ausführung bringen: „in memoriam divi Forskalii“, meines Vorgängers von 1763, wie es die den eingesammelten Pflanzen beigegebenen Zettel bekunden. Von den durch Forskal in Jemen aufgefundenen und neubeschriebenen Pflanzenarten konnte ich an den nämlichen Standorten Belege einsammeln, die den ursprünglichen Originalexemplaren als gleichwertig zu betrachten waren.
Im Jahre 1891 wurde zum Studium von Kolonialfragen und zur vorbereitenden Besprechung von Regierungsvorlagen für den Reichstag in Berlin ein „Kolonialrat“ berufen, dem ich bis zu seiner am 18. Februar 1908 erfolgten Auflösung als Mitglied angehört habe. Als eine Art Ableger blieb vom Kolonialrat noch ein aus 11 Mitgliedern bestehender Sachverständigen-Ausschuss bestehen, zu dem ich gehörte, und dem als „Landeskundliche Kommission“ die Aufgabe zufiel, der kolonialen Zentralverwaltung Vorschläge zu Forschungsunternehmungen in den verschiedenen Gebieten zu unterbreiten. Die letzte Sitzung dieser von Hans Meyer präsidierten Kommission fand am 12. Juli 1919 statt.
In den Jahren 1891-94 unternahm ich drei ausgedehnte Streifzüge, den letzten mit Max Schoeller, Alfred Kaiser und Ernst Anderssen durch die von Italien als „Colonia Eritrea“ in Besitz genommenen Teile von Nordabessinien. Ich erwarb dort, ebenso wie in Jemen sehr umfangreiche Sammlungen von getrockneten Pflanzen und berichtete verschiedenes über meine Wahrnehmungen in deutschen und italienischen Zeitschriften.
Den Juli 1896 verbrachte ich bei meinen Verwandten am Seestrande von Riga, meiner Vaterstadt, die ich seit vielen Jahren nicht mehr aufgesucht hatte, da die Angehörigen sehr häufig nach Deutschland zu kommen pflegten. Ich wiederholte den Besuch im Juli und August 1900 und zum letzten Male im Juli 1905. Mein Vater war 1858 im Alter von 71 Jahren gestorben, die Mutter 1875 im Alter von 77 Jahren. Mein Bruder Alexander, der 12 Jahre älter als ich in Rom im Januar 1895 verstarb, ist, wie der Vater, nur 71 Jahre alt geworden. Er war von seltener musikalischer Begabung und, wie viele Kenner behaupteten, ein Künstler durch und durch. Obgleich er sich meist in Italien aufhielt, hatte er das vom Vater in Riga 1820 begründete Geschäft mit Erfolg fortführen können. Alexander hat eine Familienstiftung mit 12 Legaten hinterlassen, von denen ich eines bezog. Infolge der russischen Revolution ging es verloren.
In den Jahren 1902 bis 1907 war ich vornehmlich bemüht, mit möglicher Gründlichkeit in die Geheimnisse der ägyptischen Steinzeit einzudringen. Indes beschränkte ich mich auf stratographische und morphologische Studien. Vor allem waren es die Höhen und die Steinflächen auf der Westseite des Niltals beim alten Theben (Luksor), wo mir reiche Belehrung geboten ward und sich unerschöpfliche Fundgruben erschlossen für meine großen Sammlungen von wohlerhaltenen Steinwerkzeugen aller Art, die ausschließlich den archäolithischen (eolithischen) und paläolithischen Epochen der Vorzeit angehörten. Von 40 verschiedenen Fundstätten sind sie zusammengetragen worden und an 40 verschiedene Museen und Privatleute habe ich davon Mustersammlungen der Typen verschenkt. Auch bei meinem Aufenthalt in Sizilien und in Tunesien habe ich mich mit großem Eifer diesen von mir in früherer Zeit vernachlässigten Studien hingegeben.
Die Winter- und Frühjahrsmonate der Jahre 1901, 1906 und 1908 verbrachte ich abwechselnd in Algerien und in Tunesien. Ich hielt mich, außer in Algier und Tunis, hauptsächlich in Hamman Rira, Biskra, Hammam, Meskutin, Bona, La Calle und in Gafsa auf, wo die Flora meinen Sammlungen den größten Gewinn darbot.
Von meinen 40 jährigen Besuchen in Ägypten bin ich seit 1874 selten nach Berlin zurückgekehrt, ohne auch einige Kleinigkeiten von Altertümern mitzubringen. Meine Hauptaufmerksamkeit war immer auf pflanzliche Reste gerichtet, die sich in Gräbern unter den Totenbeigaben, aber auch an anderen Stellen vorfanden, und von denen ich Exemplare im Botanischen Museum ablieferte, wo sie in einigen Glasschränken ausgestellt sind. Eine noch unpublizierte Zusammenstellung (4 Kartons meiner Bibliothek), der mir aus dem alten Ägypten nach substanziellen Funden bekannt und nachweisbar gewordenen Pflanzen, umfasst nahezu 200 Spezies. Diese Zusammenstellung ist in dem ersten Bande der „Gartenpflanzen im alten Ägypten. Ägyptologische Studien von Ludwig Keimer, 1924“ ausführlich benutzt worden und soll auch in den späteren Bänden dieses Werkes zu Rate gezogen werden. Die deutschen Ägyptologen haben, auf A. Ermans Anregung, dafür, dass ich „ihren Gesichtskreis erweitert“, zu meinem 80. Geburtstag 1916 mir ein Anerkennungsschreiben gewidmet, das 35 Unterschriften trägt, und das ich als die hervorragendste Ehrung betrachte, die mir an diesem Tage zuteil geworden ist.
In verschiedenen Ländern bin ich Mitglied von 60 verschiedenen wissenschaftlichen Gesellschaften geworden. Ihrer dreißig haben mich zum Ehrenmitglied ernannt, und von diesen als erste die Gesellschaft naturforschender Freunde in Berlin am 9. Dezember 1862, als Gottfried Ehrenberg den Vorsitz führte. Zum Ehrendoktor der Medizin wurde ich von der Heidelberger Universität gelegentlich ihrer Zentenarfeier im August 1913 ernannt, wo ich 41 Jahre vorher meinen Dr. phil. gemacht hatte. Das Prädikat Professor (ohne Lehrauftrag) ist mir vom preußischen Kultusminister v. Puttkammer 1880 verliehen worden.
Januar und Februar 1909 habe ich in den Wüstentälern der Umgebung von Assuan die an den Sandstein und Granitfelsen angebrachten, den ältesten Epochen zugehörigen, zum Teil prähistorischen Graffito-Zeichnungen von Tierbildern aufgenommen, dann auch die dort verbreiteten paläolithischen, nicht aus Kieselstein, sondern aus Quarzit hergestellten Steinwerkzeuge entdeckt, die auch auf eine südliche Herkunft der Urbewohner Licht werfen können.
Nach 46 Jahren verbrachte ich 1912-13 zum ersten Male wieder Winter und Frühjahr in Europa, aber in dem milden Klima von Mentone, wo die Umgebung durch die Menge der prächtigsten Gärten mir besondere Anregung bot und meinen botanischen Sammlungen reichen Zuwachs brachte.
Im Dezember 1913 feierte die geographische Gesellschaft in Kairo das 50 jährige Jubiläum, das ihr Gründer in Afrika beging und Dr. Abbate Pascha überreichte mir als Vorsitzender, umgeben von den den verschiedensten Nationalitäten angehörigen Mitgliedern des Vorstandes, ein schön ausgeführtes Gedenkblatt.
Am 14. Mai 1914 habe ich auf Nimmerwiedersehen das schöne Sonnenland Ägypten und seine sympathischen Bewohner verlassen.
I.
Nächtliches Tierleben in der Oase
Im Westen des ägyptischen Niltals, auf einem Flächenraum, groß genug, um ganz Deutschland und Frankreich in sich aufzunehmen, breiten sieh Wüsten aus, wie man sie sich abschreckender nicht vorzustellen vermag. Eine derartige Öde und Einförmigkeit, und dazu von solcher Ausdehnung, sucht ihresgleichen auf dem gesamten Erdenrund, und wer sie gesehen, kann sagen, dass ihm die Wüste den Begriff der Unendlichkeit veranschaulicht hat, dem Weltmeere gleich mit seinem unabsehbaren Wasserspiegel.
Die neuere Geographie belegt diese Wüste mit dem Namen der Libyschen. Sie bildet das östliche Dritteil von jenem Meer des Sandes und der Steine, welches man als Sahara im Großen und Ganzen bezeichnet. – Die Libysche Wüste weist alle Schrecknisse des Durstes, des Hungers, der Ermattung in ihrer furchtbarsten Gestalt auf; sie bleibt in dieser Beziehung wohl außerhalb allen Vergleichs mit anderen Wüstengegenden. Tage, ja wochenlang kann der Reisende umherziehen, ohne etwas anderes zu erblicken, als den unabänderlichen Wechsel desselben blendenden Kalkgesteins und derselben dünenartigen Hügel von gelbem Sande; wiederholt führt der Weg stundenweit über eine Ebene von derartiger Vollkommenheit, dass auf ihr ein Zuckerhut sich ausnehmen würde wie ein Berg, und dass der Topograph Steine abzubilden hätte, wollte er an solchen Stellen seine Karte mit irgendwelchem Detail ausfüllen. Dem Auge des Wanderers bietet sich keine andere Erquickung dar, als das Blau eines nie getrübten Himmels.
Nach dem, was ich vorausgeschickt, wird es den Leser umsomehr überraschen, wenn ich ihm sage, dass selbst die scheinbar ödeste Wüste ihre Bewohner ernährt, und dass die Libysche eine Tierwelt beherbergt, welche sich aus sehr verschiedenen Klassen des Tierreichs zusammensetzt, von der Schnecke und dem Insekt, welche der kärgliche Tau der Nächte beglückt, bis hinauf zu dem hochentwickelten Raubtier, das einer sehr substanziellen Speise bedarf. Alle diese Tiere sind von der Natur mit einem Organismus ausgerüstet, welcher ihnen den Kampf gegen jene lebensfeindliche Starrheit der Wüste ermöglicht, der jedes andere Wesen erliegt. Wie bei den Pflanzen der Wüste, ist das Rätsel ihrer Erhaltung mehr in den Geheimnissen ihrer inneren Organisation als – abgesehen von den Schutzmitteln, welche sie selbst hin und wieder darbietet – in der Natur der äußeren Verhältnisse zu suchen, unter welchen sie leben. Nicht das Quantum oder die Qualität der zu ihrem Unterhalt dienenden Stoffe kommt bei ihrem Dasein in Betracht, wohl aber die Art und Weise, in welcher sie dieselben zu verwerten vermögen, das Maß des aus dem Dargebotenen gezogenen Nutzens. In dieser Hinsicht gleicht der karge Haushalt der Natur in den heißen Wüsten von Sand und Steinen auffallend demjenigen, welchen wir in den Eis- und Schneewüsten der Polarzone wiederfinden. Wo ein Kamel stark und fett wird, da kann das Pferd ebenso gut verhungern, wie auf den Weidegründen eines wohlgemästeten Moschusochsen von Grönland.
Dafür genießen aber auch diese von der Natur auf die äußerste Sparsamkeit im Betriebe ihrer Lebensverrichtungen angewiesenen Existenzen, in den Wüsten des Pols so gut wie in jenen der Sahara, gewisser Vorteile, auf welche viele Geschöpfe, die in Fülle und Mannigfaltigkeit der Kost schwelgen dürfen, anderswo verzichten müssen: es sind vor allem auf der einen Seite Ruhe und Ungestörtheit, auf der andern eine immense Weite des Reviers und ihre Leichtigkeit des Fortkommens auf demselben. Gazellen und Wüstenfüchse vermögen auf ihren nächtlichen Streifzügen unglaubliche Entfernungen zurückzulegen.
Aber, wird man fragen, diese einförmigen Flächen, auf welchen der geringste fremde Gegenstand sich von weitem so bemerkbar macht, bieten ihnen doch die größte Gefahr einer gegenseitigen Verfolgung dar? Mitnichten; denn die Natur kleidet alle diese Tiere in das Gewand der „schützenden Ähnlichkeit“, erteilt ihrem Kleide die Farbe des Bodens, auf welchem sie sich bewegen. In der Tat kann es im Allgemeinen als Regel gelten, dass den Tieren der höchsten Polarzone die Farbe des Schnees, denen der Wüste aber die Farbe des Sandes eigen ist. Man möchte versucht sein, sagt Brehm an einer ähnlichen Stelle, bei Betrachtung der Wüstentiere einmal gläubiger Nachbeter der Zweckmäßigkeitslehre zu sein.
Die Bewohner der Wüste, in Sonderheit die höher entwickelten, wissen aber auch noch durch andere, ihrer Lebensart eigentümliche Regeln den sich dem Dasein entgegenstellenden Gefahren aus dem Wege zu gehen. Sie bedienen sich unterirdischer Wohnungen und suchen sich ihre Nahrung unter dem Deckmantel der Nacht. Zu beidem zwingen sie außerdem die klimatischen Verhältnisse. Diese nördlichen Wüstenstrecken sind nicht nur durch die beispiellose Seltenheit des Regens, sondern auch durch ungewöhnliche Temperaturschwankungen ausgezeichnet. Man kann getrost sagen, dass der Regen in der Libyschen Wüste eine so seltene und lokale Erscheinung sei, wie der Nachtfrost in Deutschland zur Sommerzeit. Im Januar und Februar kann in diesen Wüsten bei Nacht das Thermometer einige Grade unter den Gefrierpunkt fallen; die mittlere Tageswärme dieser Monate bleibt weit hinter dem von Ländern derselben Breite zurück. Die Hitze der übrigen Monate ist groß. Nie eine regenspendende Wolke, nur die Nacht wirft alsdann ihre kühlenden Schatten über die stets durstende Erde, und sehnsüchtig harren die Pflanzen des wiederkehrenden Taus, dem ihnen der Nordwind bringt.
In ihren tiefen Gruben und Löchern genießen die Tiere des Vorzugs einer mittleren Jahrestemperatur; im Winter sind ihr Behausungen warm, im Sommer zur Tageszeit weit kühler als die äußere Luft. Das nächtliche Umherstreifen beschränkt ihren Wasserbedarf auf das niedrigste Maß. Es erklärt sich aus dem Angeführten von selbst, dass alles Tierleben in der Wüste mehr oder minder einen nächtlichen Charakter annehmen muss.
In der absoluten Wüste äußert sich indes das tierische Dasein überall als ein exzeptioneller Notstand; die Tiere fristen daselbst, wie die Pflanzen, eine eigentlich nur der Erhaltung des Individuums, nicht der Vermehrung gewidmete Existenz. Wie nun die Pflanzen gewisser Vegetationsmittelpunkte bedürfen, um die Wüste selbst immer wieder mit frischen Keimen zu versehen, die sich bald hier, bald dort die Bedingungen zu ihrer Existenz zu suchen haben, wie wir das Wüstenkamel alljährlich auf den fetten Kleeweiden des Niltals einer Stärkungskur unterzogen sehen, so schöpft auch das ephemere Tierleben der eigentlichen Wüste aus deren Vorratskammern, den Oasen, stets neue Lebenskraft. Es ist anzunehmen, dass ohne eine solche Schadloshaltung die Art in den meisten Fällen allmählich auf jeden weiteren Fortbestand zu verzichten hätte.
Solche Stützpunkte des Tier- und Pflanzenlebens sind die Oasen, welche gleich einsamen, kleinen Eilanden hin und wider, meist aber in ungeheueren Abständen voneinander, aus den öden Flächen des steinernen Meeres hervorstechen. Strabo vergleicht die Wüste mit ihren Oasen einem gefleckten Leopardenfelle, aber ein derartiges Bild würde, auf die Libysche angewandt, zu den übertriebensten Vorstellungen Anlass geben, denn diese Flecken sind winzig klein, sehr zerstreut und unregelmäßig verteilt. Die Oasen sind nicht Flecken, sondern Löcher in der steinernen Decke, welche der organischen Schöpfung die Basis eines quellreichen und Pflanzenwachstum ermöglichenden Bodens entzogen hat. Tief unter dem über tausend Fuß hohen Kalksteinplateau, das die Libysche Wüste darstellt, bewegen sich rätselhafte Wasserzüge von erstaunlicher Fülle. Da, wo nun dieses Plateau Lücken darbietet, die durch Einflüsse noch völlig unbekannter Natur entstanden, konnte sich das Wasser aus der Tiefe Bahn an die Oberfläche brechen. Der Mensch siedelte sich an den Quellen an, und indem er der Natur nachhalf, indem er durch künstliche Brunnenschachten einen immer reicher werdenden Wasservorrat erschloss, vermehrte er den Umfang dieser Zufluchtsstätten auch für die Pflanzen und Tiere. Manche Oasen wurden dergestalt zu kleinen, wohlbevölkerten Kulturdistrikten; später, als die Hilfe des Menschen nachließ, als Hunderte von Brunnen verschüttet waren, nahm auch die Wüste wieder von dem ihr abgetrotzten Boden Besitz; die wandelnden Sandhügel bedeckten das gewonnene Ackerland und nur wenig erhielt sich von der ehemaligen Kultur. In dieser Lage befindet sich zu unserer Zeit die Große Oase, welche man einige Tagereisen im Westen von Theben erreicht, und die deshalb auch den Namen der Oase von Theben führt.
Das Vorhandensein eines Restes von Kulturland, welches selbst heute noch immerhin seine fünf- bis sechstausend Menschen ernährt, musste natürlich daselbst die Bildung der oben erwähnten Verbreitungsmittelpunkte gewisser Tierarten begünstigen, welche wir in weitem Umkreise um die Große Oase, gleichsam strahlenförmig in die völlige Einöde der Wüste hinaus ihren Einfluss ausüben sehen. Zunächst erblicken wir am Rande der Wüste den Boden von zahllosen Löchern kleiner Nagetiere durchfurcht, von denen bei der überraschend großen Anzahl der in der Großen Oase vorhandenen Raubtiere, angenommen werden kann, dass sie einer fast unbegrenzten Vermehrung fähig seien. Es sind Springmäuse und Wüstenmäuse, welche hier ihr Wesen treiben, schwelgend im Überfluss aufgehäufter Lebensmittel, während ihre Artgenossen im Innern der Wüste von den wenigen dort vorhandenen Wurzeln, vom Miste der Zugvögel und dergleichen ihr Dasein fristen müssen und vielleicht nie einen Tropfen flüssigen Wassers zu kosten bekommen. Die großen Haine der Dattelpalme aber, welche den Hauptgegenstand der Oasenkultur ausmacht, wimmeln von großen Ratten der Alexandriner Art. Auf die Häufigkeit dieser Nager stützt sich vornehmlich die Existenz der in der Großen Oase und ihrer Umgebung angesiedelten Räuber größerer und kleinerer Art. Es sind ihrer daselbst fünf Arten, und da ihre Individuenmenge zu den bemerkenswertesten Eigentümlichkeiten dieses abgeschiedenen Erdenwinkels gehört, so lenkten sie vor allem meine Aufmerksamkeit während eines dreimonatigen Besuches auf sich.
Das größte von den fünf Raubtieren der Oase – denn die Hyäne fehlt daselbst des geringen Viehstandes und der mangelnden Kamele wegen – ist der nordafrikanische Wolf, den die Araber „Dib“ nennen. Alsdann folgen der Größe nach der libysche Luchs, der Nilfuchs, der Schakal und zuletzt der kleinste Repräsentant der wilden Hundefamilie, der dem Edelmarder an Größe gleichkommende Wüstenfuchs oder „Fennek“.
Lange kann ein Reisender Ägyptens Wüste durchwandert haben, bevor ihm von den räuberischen Vierfüßlern, die sie bewohnen, durch Zufall einmal mehr zu Gesicht gekommen wäre, als die Fußspur, welche sie hinterlassen. Große Geduld auf nächtlichem Anstände hat er zu bewahren, will er des einen oder anderen derselben irgendwo habhaft werden. Das sicherste Mittel zu diesem Zwecke gewähren ihm unsere Fallen und Fangeisen, denn diese zwar im übrigen so schlauen Naturkinder fallen ihnen infolge ihres ungewitzten Gemütes gar leicht zum Opfer.
Am besten hatten sich während meines letzten Besuchs in der Oase die größeren Fuchseisen oder Schwanenhälse bewährt, denn mit Ausnahme des verschlagenen Dib gingen alle die genannten Räuber unbedenklich in die Falle, selbst wenn der Apparat bloß offen auf den Sand gelegt worden war. Nur durfte seine Anwendung in einer und derselben Gegend nicht mehrere Tage hintereinander fortgesetzt werden; ungeachtet der sorgfältigsten Reinigung mieden alsdann alle Tiere das verräterische Eisen, als wäre die Kunde von einer seitens der Arglist des Fremden drohenden Gefahr schnell unter ihnen von Munde zu Munde gegangen. Wer aber nie, selbst wenn sie aufs sorgfältigste im Sande vergraben worden, in die Falle ging, war der von den Oasenbewohnern hinsichtlich seiner Gescheitheit dem Affen zur Seite gestellte Dib, der Wolf der Wüste. Stets umschleicht dieser voll Misstrauen den freiliegenden Köder, scharrt und tastet, sondiert wohl auch die Stelle von unten her, bis das tückische Eisen seinen Blicken freiliegt; man vermag ihm eben nur mit Hilfe der Kugel beizukommen.
Unmittelbar nach Sonnenuntergang beginnen die Dibs ihre Streifzüge, kehren aber bei völliger Dunkelheit wieder zu ihren Schlupfwinkeln zurück, denn ihr schwaches Gesichtsvermögen flößt ihnen alsdann ein Gefühl von Unsicherheit und Zaghaftigkeit ein. Dies ist auch der Grund, weshalb sie bei ihren Unternehmungen einer mondklaren Nacht den Vorzug zu geben und ihre Hauptcoups für das erste Morgengrauen zu reservieren pflegen. Allabendlich bei vorgeschrittener Dämmerung hallte die ganze Oase wieder vom abscheulichen Geheule der Dibs, welche sich am Rande des Kulturlandes zusammenrotten, um den daselbst besonders häufigen Wüstenmäusen, in Ermangelung einer besseren Beute, mit vielem Eifer nachzugraben. Andere wagen sich frech bis in die Gärten und Dattelhaine, wo sie sich mit den Hunden der Bewohner umherbalgen. Wenn die Dibs zu heulen beginnen, so geschieht es in der Regel a tempo und so unerwartet und plötzlich, dass der Reisende erst nach geraumer Zeit sich des täuschenden Eindrucks zu entschlagen vermag, als wären es wehklagende Kinderstimmen, die er vernimmt. Oft bin ich in solchem Falle erschrocken ins Freie geeilt, um die Ursache des Geschreis zu erfahren; das bald darauf einfallende Hundegebell musste mich immer wieder von neuem meines Irrtums belehren. In langgezogenen herzzerreißenden Tönen erscholl da ihr von Hunger und Brotneid eingegebenes Jammergeschrei; dazu gesellte sich noch der nächtliche Ruf des Käuzchens, welches überall im alten Gemäuer zu Hause ist, der Stimme eines alten Weibes nicht unähnlich. Die übrigen Räuber verrieten durch keinen Laut ihre den Taubenhäusern und Hühnerhöfen so gefährliche Nähe. Schweigsam schlichen sie ihre bedächtigen Wege.
Die Stimme des Wüstenfuchses habe ich nur in meinen eigenen Mauern zu hören bekommen, obgleich dieses Tier an Menge alle die Stammesgenossen in der Oase bei weitem übertrifft und stellenweise der Sandboden von seinen Fährten wimmelt, als wäre eine Hammelherde darüber weggezogen.