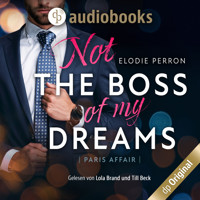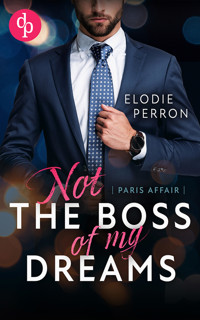5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dp DIGITAL PUBLISHERS GmbH
- Kategorie: Erotik
- Sprache: Deutsch
Das größte Glück. Der größte Schmerz. Die größte Liebe.
Ein erotischer Liebesroman vor der traumhaften Kulisse Südfrankreichs
Celeste Marshall kann ihr Unglück kaum fassen, als sie von ihrem reichen Vater ins südfranzösische Landhaus geschickt wird anstatt den Sommer mit ihm in New York zu verbringen. Als ob das nicht schon schlimm genug ist, wird sie dort von dem wortkargen, rauen Handwerker, der für ihren Vater arbeitet, beaufsichtigt. Yoann Pinot – unverschämt attraktiv, arrogant und unausstehlich – verweigert ihr die Bewunderung, die sie als verwöhnte Tochter aus reicher Familie von ihren Mitmenschen erwartet. Schnell wird ihr klar, dass sie Yoann nicht wie alle anderen so einfach um den Finger wickeln kann. Und selbst Jahre später, zurück in London und eine gescheiterte Ehe weiter, lässt sie der Sommer in Farouse – und vor allem Yoann – nicht los …
Erste Leserstimmen
„Eine sinnliche Geschichte mit echten Protagonisten mit Ecken und Kanten.“
„Das Meisterwerk Bonjour Tristesse trifft auf prickelnde Leidenschaft von Audrey Carlan.“
„gefühlvoll, spannend und sexy“
„Heiße Liebesszenen, Leidenschaft und Drama – bei dieser Geschichte bekommt man alles zusammen.“
„Die perfekte Urlaubslektüre über Liebe, Unterschiede, Enttäuschung und Hoffnung.“
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 379
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Kurz vorab
Willkommen zu deinem nächsten großen Leseabenteuer!
Wir freuen uns, dass du dieses Buch ausgewählt hast, und hoffen, dass es dich auf eine wunderbare Reise mitnimmt.
Hast du Lust auf mehr? Trage dich in unseren Newsletter ein, um Updates zu neuen Veröffentlichungen und GRATIS Kindle-Angeboten zu erhalten!
[Klicke hier, um immer auf dem Laufenden zu bleiben!]
Über dieses E-Book
Celeste Marshall kann ihr Unglück kaum fassen, als sie von ihrem reichen Vater ins südfranzösische Landhaus geschickt wird anstatt den Sommer mit ihm in New York zu verbringen. Als ob das nicht schon schlimm genug ist, wird sie dort von dem wortkargen, rauen Handwerker, der für ihren Vater arbeitet, beaufsichtigt. Yoann Pinot – unverschämt attraktiv, arrogant und unausstehlich – verweigert ihr die Bewunderung, die sie als verwöhnte Tochter aus reicher Familie von ihren Mitmenschen erwartet. Schnell wird ihr klar, dass sie Yoann nicht wie alle anderen so einfach um den Finger wickeln kann. Und selbst Jahre später, zurück in London und eine gescheiterte Ehe weiter, lässt sie der Sommer in Farouse – und vor allem Yoann – nicht los …
Impressum
Überarbeitete Neuausgabe August 2020
Copyright © 2025 dp Verlag, ein Imprint der dp DIGITAL PUBLISHERS GmbH Made in Stuttgart with ♥ Alle Rechte vorbehalten
E-Book-ISBN: 978-3-96817-010-7 Taschenbuch-ISBN: 978-3-96817-043-5
Copyright © 2019, Audible Studios Dies ist eine überarbeitete Neuausgabe des bereits 2019 bei Audible Studios veröffentlichten Audiobooks Celeste. Mein französischer Sommer.
Copyright © 2018, Elodie Perron im Selfpublishing Dies ist eine überarbeitete Neuausgabe des bereits 2018 bei Elodie Perron im Selfpublishing erschienenen Titels Rückkehr nach Farouse (ISBN: 978-1-71788-997-3).
Covergestaltung: Vivien Summer unter Verwendung von Motiven von shutterstock.com: © letovsegda, © tomertu, © WarmHoney_Niki, © Viorel Sima Korrektorat: Susanne Meier
E-Book-Version 13.10.2025, 12:50:06.
Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Sämtliche Personen und Ereignisse dieses Werks sind frei erfunden. Etwaige Ähnlichkeiten mit real existierenden Personen, ob lebend oder tot, wären rein zufällig.
Abhängig vom verwendeten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Unser gesamtes Verlagsprogramm findest du hier
Website
Folge uns, um immer als Erste:r informiert zu sein
Newsletter
TikTok
YouTube
Der Mann auf der anderen Straßenseite
Januar 2016
»Das war’s dann also«, sagt Roger. Da sein Tonfall offenlässt, ob er fragt oder feststellt, nicke ich nur und versuche zu verhindern, dass mir die Tränen in die Augen schießen. Eine Scheidung ist niemals einfach und unsere liegt gerade mal zehn Minuten zurück. Die Anwälte haben sich schon verabschiedet, aber wir stehen noch neben Rogers grauem Volvo auf dem Parkplatz des Central Family Court und sind bemüht, unserer Ehe ein würdevolles Ende zu geben. So war es immer zwischen uns – reif, erwachsen und ohne Leidenschaft. Das Letztere zumindest von meiner Seite.
»Holt Liz dich ab?«, frage ich.
»Nein. Sie arbeitet. Was ist mit dir? Triffst du dich mit Kathleen?«
»Um Himmels willen!« Jetzt muss ich trotz allem lachen. Meine einst so leichtlebige Schulfreundin ist zu einer schwer verheirateten Frau und gewissenhaften Mutter von Zwillingen geworden. Sie möchte ich heute ganz bestimmt nicht sehen. Nach meiner Beichte, dass meine Ehe am Ende sei, hatte sie mir die Hölle heißgemacht. Erzählte mir etwas von Verantwortung für den Anderen und einem Versprechen, das man gegeben hatte. Und dass ich Roger seine Affäre verzeihen sollte.
Ich habe dazu geschwiegen und mir gedacht: ›Aber es ist keine Liebe.‹
»Das ist vielleicht ein etwas schräger Vorschlag«, Rogers Stimme klingt zaghaft, so, als erwarte er von vornherein eine Abfuhr, »aber wollen wir zusammen essen gehen? Diesem beschissenen Tag wenigstens Rigatoni agli scampi abtrotzen?«
»Ich mag schräg«, erwidere ich. »Und ich mag Pasta.«
Eine halbe Stunde später sitzen wir uns im Chez Alphonse gegenüber. Es ist ›unser‹ Tisch, in der Nische hinter dem Tresen. Wir waren oft hier – so oft, dass wir uns einbilden, dem Besitzer etwas zu bedeuten. Auf jeden Fall kennt er unsere Namen und Lieblingsgerichte. Wir haben drei Hochzeitstage hier gefeiert, den vierten verbrachten wir schon getrennt voneinander. Vielleicht ist mir das Restaurant auch deshalb mit einem Mal so fremd. Der rustikale Holztisch, die rotkarierte Decke, die Kerze mit ihren malerischen Wachstropfen – ich verbinde nichts mehr damit. Und auch nicht mit Rogers freundlichem, gutmütigem Gesicht, das mir gleich zweimal in schwierigen Zeiten meines Lebens Sicherheit und Zuverlässigkeit versprochen hatte. Nur ein wenig Wehmut über das Scheitern des Lebensprojektes Ehe klingt in mir. Roger wird nach diesem Essen zu Liz fahren, der Frau, mit der er mich ein halbes Jahr lang betrogen hat und die ihn glücklich machen wird. Sie werden füreinander da sein, sich lieben und ehren bis ans Ende ihrer Tage. Meine Unfähigkeit, ihm das zu geben, was er verdient hätte, führte ihn letztlich zu dem Menschen, der ihn komplettiert.
Ja, ich habe viel Zeit damit verbracht, mir das Scheitern unserer Beziehung schönzureden.
Wir essen, ohne etwas zu sagen, doch die Art und Weise, wie Roger schweigt, zeigt mir, dass ihm etwas auf dem Herzen liegt. »Nun komm schon«, fordere ich ihn auf. »Was ist los?«
Er kann mir kaum in die Augen sehen, schaut von seinem Teller zur Gabel in seiner Hand, auf die Weinflasche und an die Wand. »Liz ist schwanger«, presst er schließlich zwischen zwei Bissen heraus. »Im dritten Monat.«
Ich rechne rasch zurück. Im Oktober holte er seine letzten Sachen. Ich verließ danach drei Tage lang nicht die Wohnung und er zeugte ein Kind. Roger war von uns beiden schon immer der Pragmatischere gewesen. Als Arzt musste er das wahrscheinlich auch.
»Herzlichen Glückwunsch. Ihr werdet wunderbare Eltern sein.«
»Es macht dir nichts aus?«
»Wieso sollte es?«
»Na ja, bei uns hat es nicht geklappt. Wir haben nie probiert –«
»Unsere Trennung lag weder an deinen Spermien noch an meinen Eizellen«, unterbreche ich ihn. Die Schärfe in meinen Worten rührt daher, weil er recht hat. Wäre ich wirklich und wahrhaftig davon überzeugt gewesen, dass unsere Bindung für die Ewigkeit sei, dann hätte ich einfach die Pille absetzen und schwanger werden können.
Das Kratzen der Gabelzinken auf unseren Tellern, als wir die letzten Rigatoni aufspießen, dröhnt wie ein Gewitter durch unser Schweigen. Erst als wir vor der Tür des Restaurants stehen, wendet sich Roger erneut an mich: »Du weißt, weshalb unsere Ehe gescheitert ist, nicht wahr?«
Sofort fahre ich alle Stacheln aus. Das habe ich noch nie an ihm gemocht – diese oberlehrerhafte Art, derer er sich mitunter befleißigt und bei der man nach jeder Antwort eine Zensurenvergabe erwartet.
»Dass du ein Verhältnis mit der Anästhesistin angefangen hast, könnte dazu beigetragen haben, meinst du nicht?«
Mit einem kurzen Kopfschütteln verwirft er meinen Einwand. »Weil während der ganzen Zeit dieser Mann auf der anderen Straßenseite stand. Wir waren nie allein in unserer Ehe, Celeste. Nicht einen einzigen Tag.«
Sein Auto mit ihm darin verschwindet zwischen all den Wagen auf der Straße. Gedankenverloren mache ich mich auf den Weg durch das Menschengewirr in der High Street Kensington. Ein Straßenmusikant versucht sich an Alone again und ich werfe zwei Pfund in seinen Sammelbecher. Nicht, weil er so gut singt, denn das tut er nicht, aber seine Songauswahl trifft meine Situation bemerkenswert genau. Obwohl ich schon längst zu Hause sein müsste, gehe ich in die Gärten, setze mich auf eine der Bänke am Round Pond und beobachte die Enten beim Putzen ihres Gefieders. Touristen laufen im Stop-and-go-Tempo am Kensington Palace vorbei, Jogger sprinten in ihren windschnittigen Plastikhüllen die Wege entlang, geschäftige Frauen und Männer hasten über den Kies, ihre Blicke auf den Boden gerichtet. Jeder dieser Menschen scheint im Hier und Jetzt zu sein, aber meine Erinnerungen schicken mich Jahre und Kilometer hinfort. Nach Farouse, zu Yoann. Er ist ›Der Mann auf der anderen Straßenseite‹, zumindest nannte Roger ihn so. Ich weiß nicht, wie ich ihn bezeichnen würde. Vielleicht als den Mann, der mein Herz in zu kleine Stücke gebrochen hat, um es jemals wieder zusammenzusetzen. Als ich die Augen schließe, verschwinden die Straßengeräusche und die kalten Londoner Januarböen. Fast kann ich den Wind Südfrankreichs auf meinem Gesicht spüren, warme Erde und salziges Meer riechen. Heute lächele ich bei dem Gedanken daran, aber vor acht Jahren war mir nach Heulen und Protestieren zumute. Ich war mit zwanzig ziemlich unausstehlich. Wahrscheinlich bin ich es immer noch.
Wie man New York verschwinden lässt
Mai 2008
»Pass auf, hörst du?«
»Natürlich pass ich auf. Warte, bis ich oben bin und dann kommst du nach.« Ich streife meine High Heels ab und setze meinen Fuß auf die unterste Sprosse des Rosenspaliers. Das Metall drückt sich kalt gegen meine nackte Fußsohle. Mit beiden Händen greife ich die Stangen zwischen den üppigen Blüten der Kletterrosen und danke insgeheim dem Gärtner, der eine Sorte ohne Dornen gepflanzt hat. Jetzt die nächste Sprosse. Und noch eine. Zum Glück ist mein Rock so kurz, dass er mich beim Klettern nicht stört. Und beim Tanzen sieht es heiß aus, wenn ich mich ein wenig nach vorne beuge.
Ich werfe einen Blick zurück, löse eine Hand und winke Kathleen wie ein tollkühner Pirat, der in die Wanten steigt. Sie schlägt sich die Hand vor den Mund, aber ich höre ihr furchtsames Quieken trotzdem.
Dicht an die Backsteinmauer gepresst, klettere ich dann vorbei an Rektor Palins Fenster im ersten Stock, aus dem bläuliches Fernseherlicht flimmert. Das mokant grinsende Gesicht von Simon Cowell füllt die Mattscheibe in Großaufnahme. Unglaublich! Palin sieht das Finale von Britain’s got Talent. Sollte mir der Typ jemals wieder mit seiner Litanei über die Wichtigkeit humanistischer Bildung kommen, werde ich mein neugewonnenes Wissen gegen ihn verwenden. Langsam klettere ich weiter und nähere mich meinem Fenster, das ich einen Spalt weit offengelassen habe, damit Kathleen und ich nach unserem samstäglichen Ausflug heimlich in unsere Schule zurückkehren können.
Die Royal School of Westminster, die wir besuchen und deren Name das Beeindruckendste an ihr ist, schließt ihre Tore nämlich auch am Wochenende um zehn Uhr abends. Und wer am nächsten Morgen nicht auf seinem Zimmer ist, bekommt Ärger, den wir uns gerade überhaupt nicht leisten können. Ich stehe sowieso schon auf der Böse-Mädchen-Liste, weil ich vor ein paar Wochen mein Auto im angetrunkenen Zustand gegen eine Garage gefahren habe, was in einer Gehirnerschütterung und einem einjährigen Führerscheinentzug geendet hat. Kathleen fliegt unter dem Radar, aber ihre Noten sind noch schlechter als meine.
Dabei soll unsere Schule Leute wie uns – mit reicher Familie, aus diversen Gründen eher uninteressiert an einer akademischen Laufbahn und deshalb auf dem Weg dorthin erfolglos – innerhalb von drei Jahren fit machen, damit wir vom ›rich white trash‹ zur Elite des Landes aufschließen können. Oder um wenigstens ein Studium zu beginnen. Ohne mir schmeicheln zu wollen, kann ich behaupten, mich dieser Indoktrination bisher erfolgreich widersetzt zu haben. Als Waffen stehen mir mein undurchdringliches Desinteresse und Vaters Reichtum zur Verfügung, denn das Internat lebt vom Schulgeld und den Spenden vermögender Menschen wie ihm. Also warum um Himmels willen sollte ich mich anstrengen?
»Ich komme jetzt auch«, flüsterruft Kathleen von unten. Das Spalier wackelt bedenklich und ich kralle meine Finger so fest um die Metallstangen, dass meine Knöchel weiß werden.
»Nein! Bleib, wo du bist. Das Ding hält gerade mal mich.«
»Was?«
»Bleib unten, Kath!« Aber schon folgt sie mir. Das Metall bebt unter meinen Füßen, die Verankerung löst sich wie in Zeitlupe aus dem roten Gemäuer und das Spalier, an dem Kathleen und ich uns schreiend festklammern, sinkt gen Boden.
Das war es jetzt also: Zwanzig Jahre Leben und nichts, worauf ich stolz sein könnte. Für einen winzigen, fröhlichen Moment kommt mir der Gedanke, dass ich vielleicht meine Mutter wiedersehen werde.
»Celeste!«
»Mama?«
»Ich bin’s.« Energisches Rütteln an meiner Schulter. »Wach auf, Mann! Du machst mir Angst!«
Ich öffne die Augen. Kathleen beugt sich über mich, ihr bleiches Gesicht leuchtet in der Dunkelheit wie der Mond und ihre langen Haare kitzeln mich.
»Bist du verletzt?«
Keine Ahnung. Mit beiden Händen taste ich meinen Oberkörper ab, atme tief ein. Die Rippen scheinen in Ordnung zu sein.
Als ich mich jedoch beim Aufsetzen abstütze, schießt ein scharfer Schmerz durch mein rechtes Handgelenk. Kathleen greift mir unter die Arme und zieht mich auf die Beine: »Komm, wir müssen weg, bevor Palin uns hier findet.«
»Zu spät, die Damen.« Die sonore Stimme unseres Rektors zittert vor Zorn, als er uns gegenübertritt. Mit einer Taschenlampe taucht er unser Elend in grellweißes Licht. Er trägt einen blau-weiß-gestreiften Bademantel mit einem Ankeremblem auf der linken Brustseite, dazu ein paar marineblaue Hausschuhe. Dieser Anblick, zusammen mit dem Schock über meinen gerade überstandenen Absturz, rufen bei mir die schlechteste aller möglichen Reaktionen hervor: Ich fange schallend an zu lachen. Kathleen lacht nicht. Palin auch nicht. Und ich bin so richtig am Arsch!
Mit einem Verband an meinem verstauchten Handgelenk und handtellergroßen blauen Flecken am ganzen Körper verlasse ich zwei Tage später die Krankenstube, von der aus ich umgehend in Palins Büro zitiert werde. Er sitzt in seinem üppigen braunen Ohrensessel, die Fingerspitzen aneinandergelegt, vor ihm auf seinem Schreibtisch ein Laptop. Als ich eintrete – mein Humpeln ist hoffentlich genauso mitleiderregend, wie es falsch ist – mustert er mich von oben bis unten.
»Miss Marshall. Nehmen Sie Platz.« Mit einer weit ausholenden Geste deutet er auf den Besucherstuhl, der aus Holz und schrecklich unbequem ist. Kaum, dass ich mich niedergelassen habe, dreht er den Laptop herum und ich erkenne, dass ich diesmal wohl mehr als die übliche ›Sie müssen sich endlich anstrengen, wenn Sie in dieser Gesellschaft etwas erreichen und ihr von Nutzen sein wollen‹–Predigt zu erwarten habe. Auf dem Monitor sehe ich meinen Vater. Sein sonst so liebes Gesicht zeigt sich abweisend und kühl. Die Lichter des Times Squares strahlen durch das Fenster hinter ihm. Es muss in New York ziemlich früh am Tage sein.
»Celeste.«
Mist, er hat seinen strengen Tonfall aufgelegt. Das bedeutet nichts Gutes.
»Paps.« Ich bemühe mich um ein fröhliches Lächeln und hebe meinen verbundenen Arm: »Ich freue mich so, dich zu sehen. Mir geht es wieder gut, die Hand ist nur verstaucht. Brauchst dir keine Sorgen machen.«
»Ich sorge mich nicht deshalb, sondern wegen deiner Einstellung.«
Palin gibt ein zustimmendes Grunzen von sich, was ihm einen bitterbösen Blick von mir einträgt. Das Verhältnis zwischen meinem Vater und mir geht ihn nicht das Geringste an.
»Ich habe lange mit Dekan Palin gesprochen.«
Genaugenommen ist er gar kein Dekan, sondern nur ein Rektor. Aber ich begreife, dass Vater ihm Honig um den nicht vorhandenen Bart schmieren muss, und verkneife mir eine Richtigstellung.
»Wir sind beide der Meinung, dass es dir nicht an Intelligenz mangelt.«
Als ob ich das nicht selbst wüsste. Zufrieden verschränke ich meine Arme vor der Brust und lehne mich zurück. Jetzt werden noch die üblichen Ermahnungen folgen, danach biete ich zerknirschte Reue dar und in drei Wochen fliege ich in den Sommerferien zu Vater nach New York, wo er momentan ein paar Millionäre bespaßt, deren Vermögen er als selbstständiger Fondsmanager und Börsenmakler verwaltet und vermehrt.
»Du scheinst nur keinerlei Interesse an irgendetwas zu haben. Keine Intentionen, wie dein zukünftiges Leben aussehen soll.«
»Bitte? Du weißt doch, dass ich eine Galerie führen möchte.«
Der vollständige Plan ist, dass Vater mir nach Abschluss der Schule eine solche Galerie kauft und ich dort Gemälde junger, aufstrebender Maler ausstelle. Die Vorstellung gefällt mir – ich stehe mit französischem Pony, im schwarzen, enganliegenden Pullover, in dem meine Brüste größer wirken, als sie es sind, vor abstrakten Bildern und formuliere Sätze wie: »Was uns dieser Künstler sagen will, ist, dass es eine Welt, so wie wir sie zu kennen glauben, nicht gibt, nie gegeben hat und niemals geben wird. Wir sind nur Phantasmagorien der Imagination eines Wahnsinnigen.«
Zugegeben, ich habe nicht viel Ahnung von Gemälden, aber dafür könnte ich einen Creative Director einstellen. Für mich bliebe dann mehr Zeit, um Small Talk mit meinen First-Class-Kunden zu halten und Champagner zu trinken.
Vater seufzt. »Eine Galerie, ich weiß. Vor einem halben Jahr sollte ich dir noch einen Fernsehsender kaufen.«
Auch eine schöne Möglichkeit. Ich, wiederum mit französischem Pony und im schwarzen, enganliegenden Pullover, in dem meine Brüste größer wirken, als sie es sind, halte einem korrupten, aalglatten Politiker mein Mikrofon vor die Nase und bringe ihn mit meinen messerscharfen Fragen dazu, sich selbst zu belasten.
»Das sind doch großartige Pläne, Paps. Ich weiß gar nicht, was du hast.«
»Es sind Kinderträume, Celeste. Du musst endlich auf eigenen Beinen stehen und in der Realität ankommen. Und damit meine ich nicht, dich aus der Schule zu stehlen, zu trinken und wie Spiderwoman die Wände hochzuklettern.«
Palin nickt und wirkt dabei wie ein Mafioso, für den Vater die Drecksarbeit übernimmt.
»Nun, um dieses Ziel zu erreichen, wäre es vielleicht hilfreich, wenn die Schüler hier …«, ich werfe Palin einen langen, vielsagenden Blick zu, »nicht wie Kinder behandelt werden würden. Schließzeit am Wochenende um zehn Uhr abends?«
»Nein, Celeste, nein. Das ist nicht der Punkt. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Du sollst während der Ferien in Ruhe über dein Verhalten nachdenken und deshalb wirst du mich nicht in New York besuchen –«
»Was?« Ich springe von meinem Stuhl auf und beinahe in den Laptop hinein.
»Du verbringst den Sommer in deinem Haus in Südfrankreich.«
Einen Moment dauert es, bis ich mich erinnere. Vor einem halben Jahr hatte Vater mir zu meinem Geburtstag eine Schenkungsurkunde für ein Haus irgendwo in der französischen Pampa überreicht. Dazu noch drei Fotos, die ein langweiliges, schlichtes Gebäude inmitten eines kleinen Gartens zeigten.
»Das ist nicht dein Ernst!«
»Dort ist es ruhig und friedlich. Du wirst für die Schule lernen und darüber nachdenken, was du aus deinem Leben machen kannst.«
»Aber Paps«, vor Enttäuschung fange ich fast an zu heulen, »das kann ich doch auch im Central Park oder in Macy’s. Bitte! Ich wollte dich doch so gerne sehen!«
Ich sehe ihm an, wie schwer es ihm fällt, mich vor den Kopf zu stoßen, aber die Hoffnung, die in mir aufflammt, erlischt mit seinen nächsten Worten.
»Meine Entscheidung steht. Du fliegst nach Toulouse, dort holt Yoann dich ab und bringt dich nach Farouse.«
»Wer?«
»Yoann Pinot. Er arbeitet für mich und wird sich während der Ferien um dich kümmern.«
»Auf mich aufpassen, meinst du.«
»Um dich kümmern.«
Bevor ich noch etwas erwidern kann, klingelt sein Smartphone. Er wirft einen raschen Blick auf das Display. »Tut mir leid, das hier ist wichtig. Wir sprechen uns morgen Abend wieder.«
Und einfach so beendet er die Skype-Verbindung. Kein New York! Kein Paps! Das kann doch nicht wahr sein!
»Ihr Vater und ich«, bricht Palins Stimme durch meine Verzweiflung, »wir glauben, dass ein wenig emotionale und geistige Einkehr genau das Richtige für Sie sein wird, Miss Marshall.«
Ich blicke auf und starre ihm direkt ins Gesicht. Es würde ihm nicht gefallen, wenn er wüsste, was meiner Meinung nach für ihn genau das Richtige wäre. Es beinhaltet meinen Fuß und seinen Hintern.
»Es freut mich, dass Ihr Bein so schnell geheilt ist«, wirft mir Palin auf meinem Weg zur Tür hinterher. Ich drehe mich um. »Was?«
»Ihr Bein. Als sie vor ein paar Minuten mein Büro betraten, hinkten Sie noch. Jetzt scheint alles wieder in Ordnung zu sein.«
Ohne ein Wort verlasse ich das Zimmer. Ich bin eine Zauberkünstlerin. Ich kann New York verschwinden lassen.
Mitten im Nirgendwo
Juli 2008
Ich hasse es hier. Ganz ehrlich! Schon in dem Moment, als ich aus dem Flugzeug steige und mir die heiße, staubtrockene Luft entgegenschlägt, reicht es mir. Das ist Gift für meine Haut. Die endlos erscheinende Warterei am Gepäckband macht es auch nicht besser. Schweiß rinnt mir den Rücken herunter, aber nicht nur mir. Alle in diesem halbherzig klimatisierten Terminal transpirieren und müffeln um die Wette. Wenn ich die Sommerferien wenigstens in Toulouse verbringen dürfte. Mit New York verglichen ist es zwar nur ein Nest, verfügt aber immerhin über Restaurants, Geschäfte und Zivilisation. Stattdessen werde ich in dieses Haus irgendwo in Okzitanien verbannt. Kann man sich eine Region vorstellen, deren Name noch mittelalterlicher klingt? Wahrscheinlich jagt man dort jeden Samstagabend Hexen mit Fackeln und Mistgabeln durch die Stadt.
Na ja, dann wäre wenigstens etwas los.
Endlich setzt sich das Gepäckband in Bewegung. Als gefühlt letzte Stücke kommen meine beiden Rollkoffer, die große Handtasche und das Beautycase ans Tageslicht. Damit bepackt, schleppe ich mich in die Ankunftshalle. Überall um mich herum begrüßen sich Familien und in diesem Moment vermisse ich Vater ganz besonders. Er würde mich in die Arme nehmen und sagen, dass er mich liebt. Stattdessen muss ich Ausschau halten nach dem Typen, der sich um meinen Sommerknast kümmert. Hausmeister und Aufpasser in einer Person sozusagen. Vaters Beschreibung war relativ vage: groß, schlank, dunkelhaarig. Diese Eckdaten treffen auf ziemlich viele Franzosen zu, aber als ich meine Blicke über all die hastenden, schleppenden, schwitzenden Reisenden gleiten lasse, sehe ich einen Mann von vielleicht Mitte zwanzig, auf den der Steckbrief passt und der sich ein Stück Papier vor die Brust hält. ›Celeste Marshall‹ steht darauf.
Bingo, mein Gefängniswärter! Etwas Orangefarbenes wäre heute passend gewesen und kein blaues Sommerkleid. Ich lasse meine Koffer stehen und gehe auf ihn zu.
»Sie sind Yoann Pinot?«
»Mademoiselle Celeste?«
Zur Bestätigung reiche ich ihm meine Hand, die er so kräftig drückt, dass ich beinahe zu Boden gehe. Mit einer Kopfbewegung in Richtung meines Gepäcks und einem kurzen »Nehmen Sie das!«, gebe ich ihm zu verstehen, dass er bei mir kein Geld fürs Faulenzen bekommt und gefälligst anzupacken hat. Auf dem Weg zum Ausgang überholt er mich mitsamt Koffern so schnellen Schrittes, dass ich nur mit Mühe hinterherkomme. Unser hastiger Abgang endet vor dem ältesten, unansehnlichsten Wagen auf dem gesamten Parkplatz – einem roten Pick-up, der mit Beulen übersät ist und dessen hintere Stoßstange von zwei Seilen gehalten wird.
»Ist das Ihr Ernst? Sie muten mir diese Schrottkarre zu?«
»Sie können auch laufen«, entgegnet Yoann, hebt meine Koffer hoch und befördert sie unsanft auf die Ladefläche des Wagens. Ich wäre nicht überrascht, würde er mich auf die gleiche Weise verstauen.
Um den Grad der sozialen Entwicklung dieses Mannes auszutesten, bleibe ich neben dem Pick-up stehen. Statt mir die Tür zu öffnen, nimmt er hinter dem Lenkrad Platz, beugt sich über den Beifahrersitz und kurbelt das Fenster herunter: »Wenn Sie den Griff benutzen, geht die Tür auf und Sie können einsteigen.«
Als ich auf den rissigen Ledersitz klettere, rollt mir eine leere Bierdose vor die Füße. Mir liegt die Bemerkung ›Sollten Sie mit Ihrem Nachnamen nicht eher Wein trinken?‹ auf der Zunge, ich verkneife sie mir jedoch. Bestimmt macht jeder Zweite irgendeinen dummen Scherz über seinen Familiennamen, da muss ich mich nicht auch noch einreihen.
Yoann dreht den Schlüssel herum und der Wagen startet mit einem so gewaltigen Knall, dass ich fast einen Herzinfarkt bekomme.
»Die Zündung«, erklärt er und fährt los.
Ich könnte auf dem Weg in eine furiose Weltstadt voller Entertainment, Spaß und interessanter Menschen sein. Stattdessen warten auf mich Okzitanien, ein Pick-up, der jeden Moment explodieren wird und Yoann Pinot.
Nachdem wir eine halbe Stunde auf der Autobahn Richtung Montpellier gefahren sind, unternehme ich einen Versuch, das unbehagliche Schweigen zu brechen: »Wo genau bringen Sie mich hin?«
Vater hatte mir zwar gesagt, in welchem Kaff sich mein Sommerhäuschen befindet, aber es interessierte mich zu wenig, um es mir zu merken. Irgendetwas mit ›K‹ am Anfang. Oder mit ›J‹.
»Farouse.«
»Gesundheit.«
»Bitte?«
»Ich dachte, Sie hätten geniest.«
Nein, da kommt kein Lächeln. Nur ein missbilligender Blick unter zusammengezogenen Augenbrauen. Und wenn schon!
Ich lehne den Kopf gegen die Fensterscheibe und beobachte, wie die grauen Schallschutzwände an mir vorbeiziehen. Was für eine herrliche Landschaft! Und am Himmel ziehen Wolken auf. Wahrscheinlich wird es die ganzen sechs Wochen lang stürmen und gewittern. Und ich mitten im Nirgendwo mit dem Mann zu meiner Linken. Rasch werfe ich einen Blick auf Yoann. Er ist schlank und drahtig, wirkt wie ein Rebell, der sich sein halbes Leben im Maquis versteckt hat. Sein weißes Hemd ist ungebügelt und seine Jeans an den Knien sehr dünn. Vollendet wird sein stylishes Outfit durch ein paar abgetragene Turnschuhe. Dass seine Finger immer wieder an den Ärmelmanschetten zupfen, zeigt mir, dass er nur selten ein Hemd trägt. Seine schäbige Aufmachung bedeutet für ihn wahrscheinlich ›in Schale geworfen, um die Tochter des Chefs vom Flughafen abzuholen‹. Normalerweise trägt er bestimmt graue Jogginghosen und gerippte Unterhemden. Nur der Kontrast zwischen dem Weiß des Hemdes und seiner sonnengebräunten Haut gefällt mir. Und seine vollen, welligen Haare, auch wenn die einen Friseurbesuch vertragen könnten. Die braunen Augen in seinem schmalen Gesicht, das durch einen Bartschatten sehr akzentuiert wirkt. Das und seine bis auf einen Höcker wohlgeformte Nase – ansonsten ist dieser Mann keinen zweiten Blick wert.
Vielleicht noch die kräftigen Hände, die sich fest um das Lenkrad schließen.
»Sie stehen mir also den Sommer über zur Verfügung?«, rette ich mich in Small Talk, um meine schweifenden Gedanken von diesen Händen zu lösen.
Er antwortet, ohne den Blick von der Fahrbahn zu nehmen. »Ich kümmere mich um das Haus und um Sie. Wenn Sie spezielle Wünsche bezüglich des Essens haben, geben Sie mir Bescheid. Aber wir sind nicht in Paris, also schrauben Sie Ihre Erwartungen herunter. Räuchertofu und Sojamilch gibt es hier nicht.«
»Meine Erwartungen befinden sich schon auf dem Nullpunkt, seit wir uns kennengelernt haben.«
Er nickt. »Gut so.«
Nach einer guten Stunde Fahrt, die wir in drückendem Schweigen verbringen, passieren wir endlich das Ortseingangsschild von Farouse, durchqueren das Kaff, fahren eine kleine Anhöhe hoch und eine weitere Viertelstunde lang vorbei an Weizenfeldern und Wiesen, bis Yoann endlich neben der Auffahrt zu einem Haus anhält. Sandfarbene Steinmauern blitzen hinter Pinien und Kiefern hervor. In einiger Entfernung strecken sich die Berge des Zentralmassivs in den Himmel. Ich springe aus dem Wagen und atme tief ein. Die Luft riecht nach Erde und Sommer. Das ist also Farouse. Echt nichts Besonderes.
Ein Kiesweg führt durch ein schmales Gartenstück zu meinem Haus, dessen robuste Schlichtheit mich im Original genauso wenig begeistert wie auf den Fotos. Die hellblauen Fensterläden sind geschlossen, in hüfthohen Terracottatöpfen wachsen im Schatten der Wände Kräuterbüsche und Wildblumen. Wirklich sehr originell in Südfrankreich.
Unbemerkt hat sich Yoann neben mich gestellt. Er betrachtet das Gebäude und zum ersten Mal, seit ich ihn kenne, liegt Wärme in seinem Blick: »Kommen Sie mit, ich zeige Ihnen alles.«
Diesmal hält er mir die Tür auf und wir treten in den kühlen Flurbereich. Einige Dielen knarren unter meinen Tritten. Ich werfe Yoann einen vorwurfsvollen Blick zu: »Die sollten Sie austauschen.«
Er sieht mich an, als sei ich nicht ganz zurechnungsfähig: »Holz arbeitet.«
Im Gegensatz zu ihm, denke ich.
Mein erster Blick fällt auf die Eichentreppe, die ins Obergeschoss führt. Rechts davon befindet sich das weitläufige Wohnzimmer, dessen rustikale, weißverputzte Wände und freigelegte Holzbalken fast über die hochwertige Einrichtung hinwegtäuschen, aber ich erkenne die Qualität der Möbel. Vater hat sich mein Geschenk etwas kosten lassen. Ein schlichtgehaltener Marmorkamin verspricht knisternde Wärme im Winter und der dunkelrote Berberteppich davor ist ein hübscher Farbfleck im Ensemble aus Weiß und Braun. Vom Wohnzimmer aus führt eine Glastür zur Gartenterrasse und zum enttäuschend kleinen Pool. Auf der linken Seite des Erdgeschosses befindet sich die Küche, die zauberhaft gestaltet ist – mit cremefarbenen Möbeln, Backsteinwänden und einer schmiedeeisernen Küchenkrone über der Kochinsel, von der Töpfe, Pfannen und getrocknete Kräuter hängen. Allerdings werde ich die Küche wohl eher meiden. Ich esse gern, aber koche ungern.
Der letzte Raum befindet sich zwischen Küche und Treppe und mein Versuch, ihn zu betreten, wird von Yoann verhindert, indem er sich vor der Tür postiert: »Das ist mein Zimmer.«
»Da mir das Haus gehört, ist es genau genommen mein Zimmer«, stelle ich richtig.
Statt einer Antwort verschränkt er die Arme vor der Brust. Meinetwegen, lasse ich ihm halt diesen Anschein von Privatsphäre. Außerdem macht er mir ein wenig Angst, wie er mich so ansieht, mit zusammengezogenen Augenbrauen und keinem Funken Humor im Gesicht.
Über die Treppe kommen wir zu meinem Wohnbereich, der das gesamte Obergeschoss einnimmt.
Schwere Gardinen im Schlafzimmer bieten neben den geschlossenen Fensterläden einen weiteren Schutz vor der Tageshitze. Mit Nelken gespickte Zitronenscheiben in Wasserschalen verbreiten frischen Duft, mintgrüne Tapeten und zierliche Möbel geben dem Raum das Flair eines englischen Landhauses. Auf einem weißen Schminktisch steht ein Weidenkorb mit Lavendelblüten. Sogar daran hat Vater gedacht.
Hübsch, denke ich widerwillig. Wirklich hübsch.
Das Wohnzimmer ist ähnlich nostalgisch eingerichtet, aber im kleinen Arbeitszimmer finden sich ein hochwertiger Computer, Drucker und Scanner sowie eine komplette Ausgabe meiner Lehrbücher. Vater scheint zu glauben, dass ich in meinen Ferien etwas für die Schule tun werde.
»Ich bringe gleich Ihre Koffer hoch«, reißt mich Yoann aus meiner Betrachtung. »Abendessen gibt es um sechs.«
»Das ist mir zu früh. Im Urlaub esse ich erst gegen zwanzig Uhr.«
»Bis dahin ist es kalt.«
Ob es an mir liegt, dass mich jede Äußerung dieses Kerls ärgert? Bestimmt nicht. Er ist einfach ziemlich unausstehlich. Und ich muss ihm wohl zeigen, wo sein Platz ist.
»Sie servieren das Essen Punkt zwanzig Uhr. Sie werden überhaupt alles ganz genau so machen, wie ich es will. Denn wenn ich nur ein Wort gegenüber meinem Vater sage, dann sind Sie Ihren Job los. Das ist für jemanden wie Sie wahrscheinlich eine üble Sache, aber ehrlich gesagt, ist mir Ihr Wohlergehen egal. Haben wir uns verstanden?«
Er sieht mich an und auf einmal legt sich ein breites Grinsen auf sein Gesicht. Als hätte er gerade einen richtig guten Witz gehört. Einen, der auf meine Kosten geht. Salutierend berührt er mit Zeige- und Mittelfinger seine Stirn und verlässt den Raum.
Nachdem ich mich im Badezimmer, das mit einer separaten Toilette, Regenwalddusche und freistehender Wanne akzeptabel ausgestattet ist, frischgemacht habe, skype ich Vater an. Von ihm, dem Urbild eines Briten, habe ich meinen Nachnamen, die blauen Augen und den Hang zu schrägem Humor. Von meiner französischen Mutter den Vornamen, ihre brünetten Haare und die Vorliebe für Rotwein.
»Hallo, mein Schatz. Bist du gut angekommen?« Er sitzt an seinem Schreibtisch, eine Tasse Kaffee in der Hand. Sie trägt den Aufdruck ›Bester Vater der Welt‹. Ich hatte sie ihm während unseres ersten Urlaubs nach dem Tod meiner Mutter von meinem Taschengeld gekauft.
»Ja, ohne Probleme.«
»Wie gefällt es dir in Farouse? Es ist gar nicht so schlimm, wie du zuerst befürchtet hattest, oder?«
»Es ist ganz toll. Wirklich. Echt. Einfach super.«
»Du findest es schrecklich.«
»Und wie!«
»Ach, Celeste …« Er nimmt einen hastigen Schluck Kaffee, scheint sich dabei an der Tasse festzuhalten.
»Ach, Paps«, ahme ich seinen genervten Tonfall nach. »Hier ist nichts. Nur Gras und Bäume. Ich werde vor Langeweile sterben und mumifizieren, wie die Frau aus diesem alten Film. Bei dem ich mich an Halloween mal so gegruselt habe.«
»Du meinst Psycho.«
»Genau. Das kannst du doch nicht wollen. Ich bin dein einziges Kind. Willst du mich nicht um dich haben?«
Gerade stellt er die Tasse ab, da friert das Bild ein. Mist! Wahrscheinlich hätte ich ihn mit dem nächsten Satz dazu gebracht, dass er mir ein Ticket nach New York kauft. Den Jackpot so dicht vor der Nase, wähle ich ihn hastig erneut an.
»Du bist ja immer noch keine Mumie«, ist sein Kommentar, als die Verbindung steht.
»Paps, bitte!«
»Hör auf zu quengeln. Die Abgeschiedenheit wird dir guttun. Dann kannst du in Ruhe darüber nachdenken, welches Verhalten deinem Alter angemessen ist.«
Mir liegt so einiges bezüglich der Angemessenheit dieses Urlaubs auf der Zunge, aber ich erkenne, wenn ich verloren habe.
»Außerdem bist du nicht allein. Im Dorf gibt es Gleichaltrige und Yoann ist ja auch noch da.«
Ich rolle mit den Augen, was er natürlich sofort richtig deutet: »Du hast Streit mit ihm angefangen?«
»Streit kann man das nicht nennen. Dafür ist er viel zu maulfaul. Warum hast du gerade den angeheuert? Soweit ich weiß, soll es auch charmante, attraktive Franzosen geben.«
»Yoann ist ein durch und durch anständiger Kerl und ein sehr fähiger Handwerker. Außerdem hat er mir das Leben gerettet.«
»Was?« Mein Herz setzt einen Schlag lang aus. Der bloße Gedanke daran, auch Vater zu verlieren, ist vernichtend.
»Na ja, Leben gerettet ist etwas übertrieben, aber als ich letzten Sommer das Haus besichtigen wollte, blieb der Mietwagen mitten auf der Landstraße stehen und mein Smartphone war nicht aufgeladen.«
»Oh Gott, Paps, dein Smartphone ist nie aufgeladen, wenn du es brauchst. Weißt du noch, als wir uns in St. Augustin treffen wollten, du mir das falsche Hotel genannt hattest und ich dich nicht erreichen konnte?«
»Das ist zwei Jahre her, Schatz.«
»Und noch immer hast du keine Lösung für dieses Problem gefunden.«
Ich fühle mich ganz albern erleichtert. Vater war nicht wirklich in Lebensgefahr. Ich hasse es, wenn er so übertreibt.
»Auf jeden Fall stand ich fast eine Stunde in der prallen Mittagssonne, bis endlich Yoann vorbeikam. Er hielt an, gab mir Wasser, ließ mich sein Smartphone nutzen und nahm mich mit nach Farouse. Wir kamen ins Gespräch, und als sich herausstellte, dass er schon auf dem Bau gearbeitet hat, bat ich ihn, mich zur Besichtigung zu begleiten. Er gab mir Tipps und nützliche Hinweise, ohne dafür eine Gegenleistung zu verlangen. Und da er einen Job suchte, bot ich ihm an, für mich zu arbeiten und das Haus zu renovieren.«
»Das ist eine rührende Geschichte und sogar Gandhi würde angesichts Yoanns Selbstlosigkeit vor Ehrfurcht erblassen, aber muss er wirklich hier leben? Er ist immerhin ein wildfremder Mann und du lässt ihn mit deiner Tochter allein.«
»Für Yoann lege ich meine Hand ins Feuer. Glaub mir, Schatz, ich kenne viele Menschen, und ich weiß, wann ich einen anständigen Kerl vor mir habe. Außerdem gibt es keine Stelle in diesem Haus, die er nicht bearbeitet hat. Im Grunde gehört es ihm genauso sehr wie dir und deshalb hat auch er ein Recht, dort zu wohnen.«
Diese Eloge ist ein gutes Beispiel für den Salonsozialismus meines Vaters, den er sich hin und wieder wie einen Orden an die Brust heftet. Seine Stimme kriegt in solchen Momenten einen feierlichen Klang und man vermeint, einen russischen Matrosenchor zu hören, der die ›Internationale‹ singt. Glücklicherweise hinderte ihn diese Einstellung nicht daran, sich um das Geld schwerreicher Leute zu kümmern und dabei selbst ein Vermögen zu machen.
»Außerdem ist er Bildhauer und braucht Platz. Ich habe ihm den Schuppen im Garten zur Verfügung gestellt, damit er künstlerisch tätig sein kann.«
»Aber wenn du das Haus doch mir geschenkt hast, Paps, sollte dann nicht ich darüber entscheiden, wer hier was machen darf?«
Sein Gesicht wird mit einem Mal so traurig, dass ich mir für meine Worte auf die Zunge beißen möchte.
»So habe ich dich nicht erzogen, Kind. So engherzig.«
Eigentlich hat nicht er mich erzogen, sondern Mutter. Zumindest bis vor zwölf Jahren. Dann ließ ein Autounfall sie aus meinem Leben verschwinden und daraufhin verschwand auch Vater – in seinem Büro, hinter seinen Akten, unsichtbar geworden wegen seines Kummers und seiner Unfähigkeit, ihn mit mir zu teilen. Meine Erziehungsarbeit wurde von den Lehrern all der sauteuren Internate geleistet, in die er mich abschob. Letztlich sind meine charakterlichen Schwächen also deren Schuld.
»Ist schon gut, Paps. Er kann ruhig weiter im Garten basteln. Vielleicht schraubt er ja für den Winter ein Vogelhäuschen zusammen.«
»Und wirst du wenigstens versuchen, dich wohlzufühlen?«
»Ja. Versprochen.«
Mit diesem Zugeständnis will ich ihn nur glücklich machen. Ich weiß ganz genau, dass ich hier eine schreckliche Zeit verbringen werde. Das wird umso deutlicher, als es um achtzehn Uhr an meine Tür klopft und ich auf dem Flur ein Tablett mit einer Schüssel Caesar Salad, ofenwarmem Baguette und einem Glas Rotwein vorfinde. Mich ärgert weniger, dass sich Yoann nicht an meine Vorgaben hält, sondern dass ich tatsächlich einen Wahnsinnshunger habe. Außerdem schmeckt es hervorragend.
Willkommen zu den schlimmsten sechs Wochen meines Lebens.
Am nächsten Morgen fällt es mir schwer, meine Unlust aufrechtzuerhalten. Die Sonne scheint golden unter den Gardinen ins Zimmer, ich bin hellwach und es sind Ferien. Also springe ich aus dem Bett und mache mich ungekämmt, im Schlafshirt und Flip-Flops, auf die Suche nach Yoann. Wenn mir einer die Laune verderben kann, dann er. Meinem guten Vorsatz kommt jedoch das Frühstück in die Quere, das ich in der Küche vorfinde: ein butterweiches Croissant, Himbeerkonfitüre, ein perfekt gekochtes Ei und in einer Thermoskanne der köstlichste Kaffee, den ich je getrunken habe. Keine Viertelstunde später befinden sich auf meinem marmeladeverkleckerten Teller nur noch ein paar Krümel. Wenn das so weitergeht, kehre ich als Tonne nach England zurück.
Nachdem ich Yoann im Haus nicht gefunden habe, streife ich durch den Garten, der viel weitläufiger ist, als er mir gestern Abend vorkam. Obwohl bei Weitem nicht so getrimmt wie ein englischer Rasen, wirkt er doch nicht verwildert. Eher – entspannt. Neben Rosenbüschen wachsen Wiesenblumen, morgentaunasse Kräuter verbreiten ihren würzigen Duft. Zu meiner Freude gibt es auch einige Olivenbäume. Sofort laufe ich zu ihnen und streiche über ihre grobe Rinde. Ich liebe diese knorrigen, staubgraublättrigen Bäume, die immer so aussehen, als würden sie gerade tanzen. Und der Pool ist zwar nicht sehr groß, aber man kann seine Bahnen darin ziehen und sich hinterher in einem der beiden Liegestühle von der Sonne bräunen lassen.
Okay, Celeste, rufe ich mich zur Ordnung, du sollst dich hier unwohl fühlen. Der Pool ist zu klein, der Garten zu unordentlich, die Bäume könnten beschnitten werden.
Hinter einer wuchernden Brombeerhecke stoße ich schließlich auf den Schuppen, in dem Yoann seinem Hobby nachgeht. Eine fast mannshohe Skulptur steht auf dem Rasen. Es sind nur mit groben Schweißnähten verbundene rostige Metallteile und doch sehe ich etwas darin. Eine Gestalt, die vornübergebeugt kniet, das Gesicht in den Händen verborgen. Je länger ich sie betrachte, umso mehr gibt sie ihren unsäglichen Kummer preis. Einen Kummer, den ich kenne. Genauso habe ich gekniet, genauso habe ich getrauert, damals, als mir Vater mit erstickter Stimme erzählte, dass Mutter gestorben war. Mein Hals wird eng, als läge eine Schlinge darum, und meine Augen beginnen zu brennen.
»Morgen.«
Ich zucke zusammen. Natürlich schleicht sich Yoann genau in diesem Moment an mich heran.
»Himmel, müssen Sie mich so erschrecken?« Ich mustere ihn mit einem abschätzigen Blick. Keine Jogginghosen, kein Unterhemd, sondern die Jeans von gestern und ein dunkelblaues T-Shirt.
»Müssen nicht. Aber es bot sich an.«
War das der Versuch eines Scherzes – oder besser gesagt, ein Versuch dessen, was dieser Kerl für einen Scherz hält? Na, das kann ich auch.
»Hier bewahren Sie also das Altmetall auf, bevor Sie es entsorgen?«
Nein, vergebliche Liebesmüh. Er nimmt meine Worte für bare Münze.
»Das ist eine meiner Skulpturen. Ist Ihnen möglicherweise zu abstrakt. Ich schätze, Sie mögen Jeff Koons. Oder Disney.«
Ich würde gerne widersprechen, aber da ich tatsächlich ein Faible für Zeichentrickfilme habe, halte ich den Mund.
»Und stellt Ihre Skulptur auch etwas dar?«
»Das ist Penelope.«
»Eine Freundin von Ihnen?«
»Die Gattin des Odysseus.« Yoanns Stimme klingt, als könne er nicht glauben, wie dumm ich bin. »Ich wollte den Moment einfangen, in dem sie nach Jahren der Einsamkeit und Stärke in ihrem Zimmer zusammenbricht und sich erlaubt, um ihren verschollenen Mann zu trauern.«
»Okay.« Keine Ahnung, was ich sonst sagen soll. Ich finde in seinen Worten nichts, worüber ich mich lustig machen könnte. Sanft berührt Yoann das rostrote Metall.
»Sie hat ihren Geliebten und Vertrauten verloren. Rings um sie herum nur Höflinge, die ihr schöntun und sie doch nicht ernst nehmen. Ihre Seele verhärtet. Irgendwann wird sie sich nicht mehr aufrichten können.«
Nie hätte ich gedacht, dass so viele Worte in diesem Mann Platz finden. Solche Worte. Hastig blinzele ich meine Tränen weg.
Yoann sieht mich über die Schulter hinweg an. Sollte er bemerken, wie aufgewühlt ich bin, dann überspielt er es meisterhaft. »Waren Sie mit dem Frühstück zufrieden?«
»Woher wissen Sie, dass ich schon gefrühstückt habe?«
Nachlässig deutet er mit dem Zeigefinger auf mich. »Ihnen klebt Himbeermarmelade auf der Wange.«
Hastig wische ich über mein Gesicht.
»Die andere Seite. Ja, genau da. Und – hat Ihnen alles geschmeckt?«
»Ja. Sehr. Der Kaffee …«
»Salz und Kakao. Jeweils nur eine Prise. Das Salz intensiviert den Geschmack, der Kakao macht ihn weicher.«
Mir wird das hier zu viel. Die Erinnerung an meine Mutter, ein gesprächiger Yoann, seine zarte Berührung des Metalls … Ohne ein weiteres Wort verschwinde ich auf mein Zimmer, ziehe mich an und mache mich auf den Weg nach Farouse. Der einstündige Fußweg führt mich vorbei an gelben Weizenfeldern, Mohnblumen und Zypressen. Die Erde ist so trocken, dass meine Schuhe nach ein paar Metern von rötlichem Staub bedeckt sind. Mit ihren hohen Absätzen sind sie ohnehin völlig unpassend auf diesem Stolperpfad. Ich ziehe sie aus und laufe erst vorsichtig, dann beherzter über den warmen Boden und die kleinen Steine. Das Zirpen der Grillen und die noch sanfte Hitze des Morgens begleiten mich auf meinem Weg.
Farouse selbst ist ein typischer südfranzösischer Ort: Am Ortseingang befindet sich die Renault-Werkstatt als ökonomisches Zentrum, an den Häusern aus sonnengedörrten Steinen ranken Bougainvillea. Ihr Purpur spiegelt sich auf den Pflastersteinen der engen Gassen, die durch die Tritte vieler Jahrhunderte abgenutzt und glänzend geworden sind.
Im Café auf dem Marktplatz, im Schatten der romanischen Kirche, mache ich halt, ziehe meine Schuhe über meine staubigen Füße und bestelle einen Cappuccino. Hier gibt es keine Hektik – wenn man einmal von den lauten und gestenreichen Gesprächen der Franzosen absieht – und meine Anspannung löst sich ein wenig. Wie soll ich mit Yoann umgehen?, überlege ich, während ich den Milchschaum löffele. Es scheint ihn nicht zu interessieren, wenn ich mich über ihn lustig mache, aber bei einer normalen Unterhaltung fühle ich mich unsicher. Am besten wäre es, jeden Kontakt zu vermeiden, aber das ist in meinem winzigen Haus schwer zu erreichen. Ich wusste ja, dass die Zeit hier fürchterlich wird.
Nach dem Kaffee bestelle ich mir eine Cola und sehe den Eiswürfeln darin beim Schmelzen zu. Während ich mir so den Tag vertreibe, bemerke ich aus den Augenwinkeln einen Mann. Er bemüht sich, unauffällig zu wirken, läuft zwischen den Gästen umher, hebt die Eiskarte an, die auf einem nichtbesetzten Tisch steht und studiert sie so sorgfältig, als wolle er sie auswendig lernen, aber letztlich pirscht er sich immer dichter an mich heran. Der Typ sieht ganz süß aus, ist vielleicht Anfang zwanzig, die Frisur im Emo-Style, was so gar nicht zu seinen hellen Haaren und der Stupsnase passt. Schließlich wagt sich Emo-Blondie vor: »Hi. Sorry, wenn ich störe …«
»Ja, du störst wirklich.«
Ich bin gespannt auf seine Reaktion. Männer, die sich nicht gleich einschüchtern lassen, gefallen mir. Auch der hier bemüht sich, tapfer zu sein, tritt aber nervös von einem Bein aufs andere. Unwillkürlich stelle ich mir Yoann in seiner Situation vor. Der würde sich setzen und noch nicht einmal ›Guten Tag‹ sagen.
»Ich bin Laurent.«
»Dann stört mich also Laurent. Gut zu wissen.«
»Du musst die Tochter von Monsieur Marshall sein.«
»Muss ich das?«
»Mein Vater hat den Verkauf eures Hauses beglaubigt und dein Vater hat danach noch bei uns zu Abend gegessen und Bilder von dir gezeigt. Daher kenne ich dich.«
Oh Gott, Paps!
Seufzend weise ich auf den Stuhl mir gegenüber: »Nimm Platz, Laurent.«
Er setzt sich und strahlt mich an. Der ist drollig. Wie ein Welpe.
»Charlotte, nicht wahr?«
»Celeste.«
Und so mache ich meine erste Urlaubsbekanntschaft: Laurent Dubois, Sohn einer gutsituierten Notars- und Lehrerinnenfamilie im Nachbarort. Er ist fünfundzwanzig, studiert Jura an der Universität Aix-Marseille, macht allerdings gerade ein studienfreies Jahr, um herauszufinden, ob das – so drückt er sich aus – wirklich sein Weg ist. Er zeigt sich hochbeeindruckt von mir. Und vom Reichtum meines Vaters. Vielleicht noch ein bisschen mehr von Letzterem. Wenn Männer mich anschauen, sehen sie immer eine hübsche Frau neben einem hübschen Sack Geld. Das sollte mich stören, aber ich bin es nicht anders gewohnt.
»Willst du an den Strand? Ich kenne da eine Ecke, an der sich nicht so viele Preks herumtreiben.«
»Preks?«
»Proleten, Billigtouristen, du weißt schon. Das Prekariat.«
Ich stehe auf und klemme zehn Euro unter mein Glas. »Klingt gut. Lass uns fahren.«
»Super. Wir müssten noch kurz zu mir und meine Badesachen holen –«
»Wieso? Ich habe auch keine dabei.«
Laurent starrt mich an – überrascht, unsicher. Er gehört eindeutig zu der Männerkategorie ›große Klappe, nichts dahinter‹. Aber egal. Ich will mir hier die Zeit vertreiben, nicht die Liebe fürs Leben finden.
Der Strand, den wir nach einer halben Stunde Fahrt in seinem silbergrauen Cabrio erreichen, ist menschenleer. Auf einer Grasnarbe im Schatten einer Pinie entledige ich mich meiner Kleidung und amüsiere mich darüber, wie Laurent erfolglos und großäugig versucht, nicht zu starren.
»Was ist? Willst du dich nicht ausziehen?«
»Doch, schon, aber …«
Auf meinen abschätzigen Blick hin, legt er seine Klamotten ab, entblößt einen schmalen, jungenhaften Körper und seinen erigierten Schwanz, der mich unvermittelt an den tapferen Zinnsoldaten denken lässt. Leider erregt mich der Anblick kein bisschen. Ich werde trotzdem mit ihm schlafen.
Das Wasser ist nur oberflächlich warm, schon wenige Zentimeter in der Tiefe ist es so kühl, dass ich fröstele. Dennoch tauche ich ab, gleite mit kräftigen Zügen hinaus. Als ich weit draußen wieder auftauche, steht Laurent immer noch am Strand. Ich winke ihm zu, hole tief Luft und verschwinde wieder. Ich liebe den Geruch des Meeres, wie sich die Sonne darin bricht und die Leichtigkeit, die es einem beschert. In solchen Augenblicken wünsche ich mir, ich könnte in das Dunkle sinken, einfach weiterschwimmen. Zu einem Fisch werden.
Nach gut zwei Stunden, in denen Laurent unter fadenscheinigen Begründungen keinen Fuß ins Wasser gesetzt hat, fahren wir zu mir. Ich habe keine Lust, seine Familie kennenzulernen, allerdings ist mein Begleiter nicht sonderlich erfreut, Yoann zu sehen, dem wir beim Heckeschneiden in der Einfahrt begegnen. Laurent bringt kaum eine Begrüßung über die Lippen und verhalten flüstert er mir zu: »Der arbeitet für dich?«
Ich zucke mit den Schultern: »Was soll ich machen?«, strahle ein breites Grinsen in Yoanns finstere Miene und ziehe mich mit Laurent auf mein Zimmer zurück.