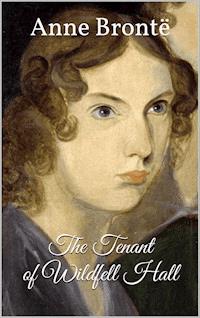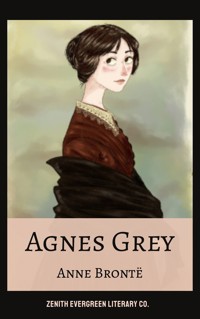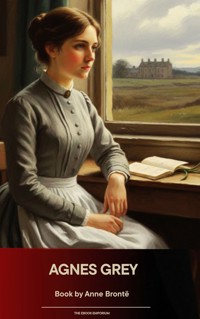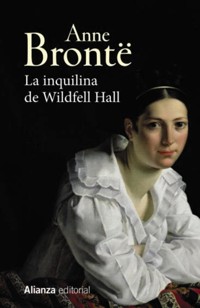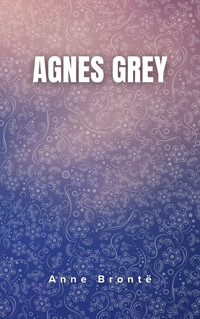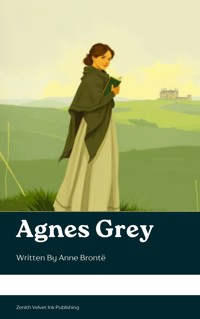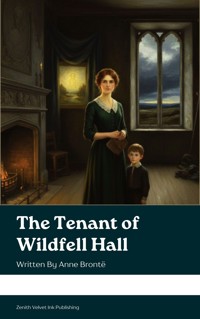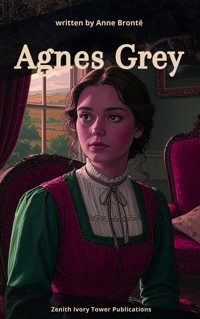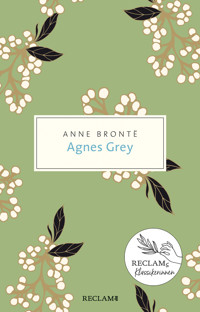
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Reclam Taschenbuch
- Sprache: Deutsch
Bescheiden, aber wohlbehütet in einer kleinen Pfarrei in Nordengland aufgewachsen, muss die junge Agnes Grey ihre Familie verlassen, um eine Stellung als Gouvernante anzutreten. Schon bald machen die verwöhnten Kinder und das respektlose Verhalten der reichen Herrschaften ihr das Leben schwer, aber mit Großmut und Geduld gelingt es Agnes, sich und ihren Idealen treu zu bleiben. Doch dann trifft sie den jungen Hilfspfarrer Edward Weston, und in Agnes erwachen zarte Gefühle. Aus autobiographischen Elementen formt sich ein persönlicher Blick auf das Leben einer unverheirateten, gebildeten Frau im viktorianischen England. Ein literarisches Frauenschicksal, das auch heute noch zu rühren vermag. – Mit einer kompakten Biographie der Autorin
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 377
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Anne Brontë
Agnes Grey
Reclam
Englischer Originaltitel: Agnes Grey (1847)
1990, 2020 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Durchgesehene Ausgabe 2020
Covergestaltung: Anja Grimm Gestaltung
Coverabbildung: shutterstock.com / Theraphosath
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2022
RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN978-3-15-961702-2
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-020593-8
www.reclam.de
Inhalt
Agnes Grey
Anmerkungen
Nachwort
Zeittafel
Agnes Grey
Kapitel 1
Das Pfarrhaus
In allen wahren Geschichten steckt ein Stück Belehrung, doch ist dieser Schatz häufig nur schwer zu entdecken und, wenn man ihn dann gefunden hat, oft so geringfügig, dass man sich fragt, ob der trockene, schrumpelige Kern überhaupt die Mühe wert war, die Nuss zu knacken. Es steht mir nicht an zu beurteilen, ob dies bei meiner Geschichte der Fall ist oder nicht. Manchmal glaube ich, sie könnte sich für einige Menschen als nützlich, für andere als unterhaltsam erweisen; aber das soll jeder selbst beurteilen. Geschützt durch meine Unbekanntheit, die mittlerweile vergangene Zeit und ein paar erfundene Namen will ich mutig darangehen, dem Leser ganz offen zu schildern, was ich nicht einmal meinem innigsten Freund enthüllen würde.
Mein Vater war ein Geistlicher aus dem Norden Englands, zu Recht geachtet von allen, die ihn kannten, und lebte in seinen jüngeren Jahren einigermaßen sorgenfrei von den Einkünften, die eine bescheidene Pfarrstelle und ein hübscher kleiner Besitz erbrachten. Meine Mutter, die ihn gegen den Willen ihrer Familie heiratete, war die Tochter eines Gutsherrn und eine intelligente Frau. Umsonst hielt man ihr vor Augen, dass sie im Falle einer Heirat mit dem armen Pfarrer auf ihre Kutsche, ihre Zofe, allen Luxus und alle Herrlichkeiten des Reichtums verzichten müsse, die für sie doch ganz selbstverständlich zum Leben gehörten. Eine Kutsche und eine Zofe waren sicherlich große Annehmlichkeiten, aber Gott sei Dank, besaß sie zwei Füße, die sie trugen, und zwei Hände, mit denen sie für sich selbst sorgen konnte. Ein vornehmes Haus und ausgedehnte Ländereien waren nicht zu verachten; sie aber würde lieber mit Richard Grey in einem kleinen Haus wohnen als mit irgendeinem anderen Mann auf der Welt in einem Palast.
Als ihr Vater merkte, dass alle Argumente nichts fruchteten, teilte er den Liebenden schließlich mit, sie sollten ruhig heiraten, wenn es ihnen gefiele; in diesem Falle aber verlöre seine Tochter auch den kleinsten Teil ihres Vermögens. Er erwartete, dass sich daraufhin die Leidenschaft der beiden abkühlen würde, aber er irrte. Mein Vater kannte den außergewöhnlichen Wert meiner Mutter zu gut, um sich nicht darüber im Klaren zu sein, dass sie allein schon ein kostbarer Besitz war; und wenn sie nur einwilligen wolle, sein bescheidenes Heim zu verschönern, wäre er glücklich, sie zu heiraten, ganz gleich zu welchen Bedingungen. Sie ihrerseits wollte lieber mit den eigenen Händen arbeiten, als von dem Manne getrennt zu sein, den sie liebte, den glücklich zu machen ihr eine Freude sein würde und mit dem sie schon jetzt eins war in Herz und Seele. So vergrößerte ihr Erbteil das Vermögen einer klügeren Schwester, die einen Krösus geheiratet hatte, während sie sich – zum Erstaunen und mitleidigen Bedauern aller ihrer Bekannten – in dem einfachen Pfarrhaus inmitten der Hügel von –– vergrub. Und doch glaube ich, dass man trotz alledem, trotz des vornehmen Wesens meiner Mutter und den Grillen meines Vaters in ganz England kein glücklicheres Paar finden würde.
Meine Schwester Mary und ich waren die beiden einzigen von sechs Kindern, die die Gefahren von Säuglingsalter und früher Kindheit überlebten. Da ich fast sechs Jahre jünger war, wurde ich immer als das Kind und der Liebling der Familie angesehen: Vater, Mutter und Schwester verwöhnten mich alle zusammen, nicht durch törichte Nachgiebigkeit, die mich widerspenstig und unbeherrscht gemacht hätte, sondern durch grenzenlose Güte, die mich hilflos und abhängig machte – untauglich, um es mit den Unbilden des Lebens aufzunehmen. Meine Mutter, die zugleich wohlerzogen, höchst gebildet und gerne beschäftigt war, übernahm die ganze Verantwortung für unsere Erziehung, mit Ausnahme von Latein, worin uns mein Vater unterrichtete, so dass wir nicht einmal zur Schule gingen; und da es in der Nachbarschaft sonst keinen Umgang gab, bestand unsere einzige Verbindung zur Welt in einer hin und wieder stattfindenden Tee-Gesellschaft mit den führenden Landwirten und Geschäftsleuten der Umgebung (um zu vermeiden, dass man uns als zu stolz einstufte, mit unseren Nachbarn zu verkehren) und einmal im Jahr einem Besuch bei unserem Großvater väterlicherseits, bei dem dieser, unsere gute Großmama, eine unverheiratete Tante und zwei oder drei ältere Damen und Herren die einzigen Menschen waren, die wir je zu Gesicht bekamen. Manchmal unterhielt uns unsere Mutter mit Geschichten und Anekdoten aus ihrer Mädchenzeit, die uns ungeheuren Spaß bereiteten und – wenigstens in mir – häufig den geheimen Wunsch weckten, ein bisschen mehr von der Welt zu sehen.
Ich dachte, dass sie sehr glücklich gewesen sein musste; doch sie schien niemals den alten Zeiten nachzutrauern. Mein Vater aber, dessen Gemüt von Natur aus weder besonders gelassen noch heiter war, quälte sich oft übermäßig bei dem Gedanken an die Opfer, die seine liebe Frau ihm gebracht hatte, und zermarterte sich den Kopf, indem er unaufhörlich Pläne schmiedete, wie er um ihret- und unseretwillen sein kleines Vermögen vermehren könnte. Vergebens versicherte ihm meine Mutter, dass sie vollkommen zufrieden sei, und wenn er nur etwas für die Kinder beiseitelegen würde, hätten wir doch reichlich von allem, jetzt und auch in Zukunft; aber Sparen war nicht die starke Seite meines Vaters. Er geriet zwar nicht gerade in Schulden (wenigstens passte meine Mutter gut auf, dass das nicht geschah), aber wenn er Geld hatte, musste er es auch ausgeben; er wollte gern ein behagliches Heim haben, seine Frau und seine Töchter sollten gut gekleidet und ihre Bedienung angemessen sein. Zudem war er barmherziger Natur und spendete gern den Armen, so wie es seinen Mitteln entsprach oder, wie manch einer denken mochte, auch darüber hinaus.
Schließlich jedoch wies ihm ein wohlmeinender Freund den Weg, wie er seinen Privatbesitz mit einem Schlag verdoppeln, ihn später sogar ins Unermessliche steigern könne. Dieser Freund war Kaufmann, ein Mann mit Unternehmungsgeist und unbestrittenem Talent, der durch einen Mangel an Kapital in seinem geschäftlichen Tatendrang etwas eingeengt war, aber großzügig vorschlug, meinem Vater einen angemessenen Anteil an seinen Gewinnen zukommen zu lassen, wenn dieser ihm nur alles anvertrauen würde, was er erübrigen könne; und wie hoch die ihm anvertraute Summe auch immer sei, er glaubte, sicher versprechen zu können, dass sie meinem Vater einen hundertprozentigen Gewinn brächte. Das bescheidene Erbvermögen wurde umgehend verkauft, der gesamte Gegenwert dem hilfsbereiten Kaufmann überantwortet, der seinerseits unverzüglich daranging, seine Fracht zu verladen und seine Reise vorzubereiten.
Mein Vater war, wie wir alle, begeistert über unsere vielversprechenden Aussichten. Denn zugegeben, gegenwärtig waren wir gezwungen, von den kargen Einkünften der Pfarrstelle zu leben. Aber mein Vater hielt es anscheinend nicht für nötig, dass sich unsere Ausgaben exakt darauf beschränkten, und so hatten wir durch einen Dauerkredit bei Mr. Jackson, einen weiteren bei Smith und einen dritten bei Hobson sogar ein besseres Auskommen als vorher. Meine Mutter vertrat allerdings die Ansicht, wir sollten im Rahmen unserer Möglichkeiten bleiben, denn letztendlich sei unsere Aussicht auf Reichtum doch recht unsicher, und wenn mein Vater sich bloß in allem ihrer Führung anvertrauen würde, solle er sich bestimmt nie eingeengt fühlen; dieses eine Mal aber war er nicht umzustimmen.
Welch glückliche Stunden verbrachten Mary und ich damit – ob wir nun mit unserer Arbeit am Feuer saßen, über die mit Heidekraut bedeckten Hügel wanderten oder unter der Hängebirke faulenzten (dem einzig bemerkenswerten Baum im Garten übrigens) –, über unser zukünftiges Glück und das unserer Eltern zu sprechen, darüber, was wir tun, sehen und besitzen würden; dabei hatten wir keine solidere Grundlage für unsere großartigen Gedankengebäude als die Reichtümer, die die erfolgreichen Spekulationen des ehrenwerten Kaufmanns uns hoffentlich bescheren würden. Unserem Vater ging es nicht viel besser als uns, nur gab er vor, die Sache nicht so ernst zu nehmen. Seine strahlenden Hoffnungen und überschwänglichen Erwartungen drückten sich in Späßen und witzigen Einfällen aus, die ich stets ausgesprochen geistreich und lustig fand. Unsere Mutter lachte vergnügt, wenn sie ihn so hoffnungsfroh und glücklich sah, aber sie fürchtete noch immer, dass sein Herz zu sehr an dieser Angelegenheit hing, und einmal hörte ich sie beim Verlassen des Zimmers murmeln: »Gebe Gott, dass er nicht enttäuscht wird! Ich weiß nicht, wie er das ertragen würde.«
Aber er wurde enttäuscht, und zwar bitterlich. Wie ein Donnerschlag traf uns die Nachricht, dass der Segler, an dessen Bord sich unser Vermögen befand, Schiffbruch erlitten habe und mit der ganzen Ladung, einem Teil der Mannschaft und dem unglücklichen Kaufmann gesunken sei. Ich grämte mich um ihn, ich grämte mich um den Einsturz all unserer Luftschlösser, aber mit der Schwungkraft der Jugend erholte ich mich bald wieder von dem Schock.
Mochte der Reichtum seine Reize haben, die Armut besaß jedenfalls keinerlei Schrecken für ein unerfahrenes Mädchen wie mich. Ja, um ehrlich zu sein, hatte der Gedanke, dass wir in die Enge getrieben und auf unsere eigene Findigkeit angewiesen waren, etwas Anregendes für mich. Ich hätte nur gewünscht, Papa, Mama und Mary wären der gleichen Ansicht gewesen; dann hätten wir alle, statt vergangenes Unheil zu beklagen, frohen Mutes darangehen können, es wiedergutzumachen, und je mehr Schwierigkeiten es gab, umso stärker würden wir dagegen kämpfen; je härter unsere derzeitigen Entbehrungen waren, umso lieber wollten wir sie ertragen.
Mary beklagte sich nicht, aber sie dachte unaufhörlich über das Unglück nach und geriet in einen Zustand der Niedergeschlagenheit, aus dem ich sie trotz all meiner Anstrengungen nicht aufrütteln konnte. Ich vermochte sie jedenfalls nicht dazu zu bringen, die Angelegenheit so wie ich von ihrer positiven Seite zu sehen; und ich fürchtete sogar, dass sie mir kindischen Leichtsinn oder blanke Gefühllosigkeit vorwerfen würde, und behielt die meisten meiner glänzenden Einfälle und aufmunternden Bemerkungen sorgsam für mich, wohl wissend, dass sie sie nicht schätzen würde.
Meine Mutter dachte nur daran, meinen Vater zu trösten, unsere Schulden zu bezahlen und unsere Ausgaben mit allen zu Gebote stehenden Mitteln einzuschränken. Meinen Vater aber hatte das Unglück vollkommen überwältigt: Gesundheit, Kraft und geistige Verfassung verschlechterten sich aufgrund des Schicksalsschlages, und er sollte sich nie wieder völlig davon erholen. Vergebens bemühte sich meine Mutter, ihn aufzumuntern, indem sie an seine Frömmigkeit, seinen Mut und seine Liebe zu ihr und uns appellierte. Gerade diese Liebe war seine größte Qual: Um unsertwillen hatte er so sehnlichst gewünscht, sein Vermögen zu vermehren, der Gedanke an uns hatte seine Hoffnungen so überstrahlt und trug nun so viel Bitterkeit zu seinem gegenwärtigen Kummer bei. Es quälten ihn Gewissensbisse, weil er den Rat meiner Mutter nicht befolgt hatte, der ihm wenigstens die zusätzliche Schuldenlast erspart hätte; vergebens machte er sich Vorwürfe, sie aus der Würde, der Behaglichkeit, dem Luxus ihres früheren Standes herausgelöst zu haben, während sie sich stattdessen an seiner Seite mit den Sorgen und Mühen der Armut abplagen musste. Es lag ihm bitter auf der Seele, diese prächtige, hochgebildete, einst so sehr hofierte und bewunderte Frau in eine emsig wirtschaftende Hausfrau verwandelt zu sehen, die sich mit Kopf und Händen unablässig alltäglichen Haushalts- und Wirtschaftsfragen widmen musste. Die Bereitschaft, mit der sie diesen Pflichten nachkam, die Heiterkeit, mit der sie den Rückschlag ertrug, die Güte, die sie davon abhielt, ihm auch nur die geringste Schuld zuzuweisen: All dies führte bei seinem selbstquälerischen Talent zu einer zusätzlichen Verschlimmerung seiner Leiden. So zehrte der Geist am Körper und brachte das Nervensystem in Unordnung, die Nerven wiederum verstärkten die geistigen Beschwerden, bis schließlich durch Wirkung und Gegenwirkung seine Gesundheit ernstlich beeinträchtigt war; und keiner von uns vermochte ihn davon zu überzeugen, dass unsere Zukunftsaussichten nicht halb so düster, so gänzlich hoffnungslos waren, wie er es sich in seiner krankhaften Phantasie vorstellte.
Der nützliche Ponywagen wurde verkauft, zusammen mit dem kräftigen, wohlgenährten Pony, unserem alten Lieblingstier, das laut einhelligem Beschluss seine Tage friedlich bei uns beenden sollte und von dem wir uns niemals hatten trennen wollen. Der kleine Wagenschuppen und der Stall wurden vermietet, der Dienstbursche und das tüchtigere der beiden Dienstmädchen (welches das kostspieligere war) wurden entlassen. Unsere Kleider wurden ausgebessert, gewendet und bis an die Grenzen der Schicklichkeit geflickt; unsere Mahlzeiten, auch bisher schon bescheiden, wurden nun in einem nie gekannten Ausmaß vereinfacht – mit Ausnahme der Lieblingsgerichte meines Vaters; Kohlen und Kerzen wurden peinlich genau eingeteilt: die zwei Kerzen auf eine einzige reduziert und auch diese nur sparsam gebraucht; auch mit den Kohlen im halbvollen Kamin gingen wir haushälterisch um; vor allem, wenn mein Vater wegen seiner Gemeindepflichten unterwegs oder krank ans Bett gefesselt war, saßen wir da, die Füße auf dem Ofenschirm, schoben von Zeit zu Zeit die verglimmenden Kohlen zusammen und schütteten gelegentlich etwas von den verstreuten Kohlestückchen und Kohlenstaub darüber, um die Glut nicht verlöschen zu lassen. Was unsere Teppiche anging, so waren sie mit der Zeit abgenützt und noch weitaus mehr geflickt und gestopft als unsere Kleider. Um die Ausgaben für einen Gärtner zu sparen, übernahmen Mary und ich es, den Garten in Ordnung zu halten; alle Küchen- und Hausarbeit, die von einem einzigen Hausmädchen nicht leicht zu bewältigen war, wurde von meiner Mutter und meiner Schwester erledigt, wobei ich sie gelegentlich ein wenig unterstützte: ich betonte ein wenig, denn obwohl ich meiner Ansicht nach bereits eine Frau war, in ihren Augen war ich noch immer ein Kind. Wie die meisten tatkräftigen, rührigen Frauen war meine Mutter nicht mit ebenso tatkräftigen Töchtern gesegnet, und zwar aus folgendem Grund: Da sie selber so klug und fleißig war, geriet sie nie in die Versuchung, ihre Angelegenheiten jemand anderem anzuvertrauen, sondern war im Gegenteil stets dazu bereit, für andere zu handeln und zu denken wie für sich selbst; und was es auch war, sie neigte stets zu der Ansicht, niemand könne es so gut erledigen wie sie selbst. Wann immer ich anbot, ihr zu helfen, erhielt ich eine Antwort wie: »Nein, Liebes, das kannst du nicht, es gibt hier wirklich nichts zu tun für dich. Geh und hilf deiner Schwester oder sieh zu, dass sie mit dir spazieren geht; sag ihr, sie soll nicht so viel herumsitzen und sich ständig im Haus aufhalten – sie wird sonst noch ganz mager und erbärmlich aussehen.«
»Mary, Mama sagt, ich soll dir helfen oder dich zu einem Spaziergang überreden; sie sagt, du wirst ganz mager und erbärmlich aussehen, wenn du ständig im Haus herumsitzt.«
»Du kannst mir nicht helfen, Agnes, und ich kann nicht mit dir nach draußen gehen – ich habe zu viel zu tun.«
»Dann lass mich dir doch helfen.«
»Das kannst du wirklich nicht, liebes Kind. Übe ein bisschen Klavier oder spiel mit dem Kätzchen.«
Es war immer genug Näharbeit vorhanden, aber ich hatte nicht gelernt, ohne fremde Hilfe ein Kleid zuzuschneiden, und so gab es außer einfachem Säumen und Zusammennähen auch auf diesem Gebiet wenig für mich zu tun. Denn beide versicherten, es sei für sie viel leichter, die Arbeit selbst zu machen, als sie für mich vorzubereiten; außerdem sähen sie es viel lieber, wenn ich mit meinen Studien fortführe oder mich amüsierte, schließlich hätte ich immer noch Zeit, wie eine würdige Matrone über meine Arbeit gebeugt zu sitzen, wenn mein kleines Lieblingskätzchen erst eine gesetzte alte Katze geworden wäre. Wenn ich auch unter diesen Umständen nicht viel nützlicher als das Kätzchen war, darf man meinen Müßiggang also nicht gänzlich verurteilen.
Trotz all unserer Sorgen hörte ich meine Mutter nur ein einziges Mal über unseren Geldmangel klagen. Als der Sommer nahte, sagte sie zu Mary und mir: »Wie schön wäre es für euren Vater, ein paar Wochen in einem Seebad zu verbringen. Ich bin überzeugt, die Seeluft und der Ortswechsel würden ihm unendlich guttun. Aber dafür haben wir freilich kein Geld«, fügte sie mit einem Seufzer hinzu. Wir beide hätten nur zu sehr gewünscht, dass dieser Plan in die Tat umgesetzt worden wäre, und beklagten zutiefst, dass dies unmöglich war. »Nun, nun«, sagte sie, »da hilft kein Jammern. Vielleicht können wir doch etwas tun, um das Vorhaben auszuführen. Mary, du kannst doch so herrlich zeichnen. Was hältst du davon, noch ein paar Bilder in deinem besten Stil zu malen, sie rahmen zu lassen und zu versuchen, sie mit den bereits fertigen Aquarellen an einen großzügigen Bilderhändler zu verkaufen, der ihren Wert zu schätzen weiß?«
»Ich würde mich freuen, Mama, wenn du sie für so gut hältst, dass man sie überhaupt verkaufen kann.«
»Zumindest ist es der Mühe wert, es zu versuchen, meine Liebe. Sorge du für die Bilder, ich will mich bemühen, einen Käufer dafür zu finden.«
»Ich wünschte, ich könnte auch etwas tun«, sagte ich.
»Du, Agnes! Nun, wer weiß? Du zeichnest doch auch ganz nett; wenn du ein einfaches Motiv wählst, wirst du, glaube ich, in der Lage sein, ein Bild zu malen, das wir alle voller Stolz ausstellen werden.«
»Aber ich dachte an etwas anderes, Mama, und zwar schon lange, nur wollte ich nicht darüber sprechen.«
»Wirklich? Dann sag uns bitte, worum es sich handelt.«
»Ich würde gern als Erzieherin arbeiten.«
Meine Mutter gab einen Ausruf des Erstaunens von sich und brach in Lachen aus. Meine Schwester ließ überrascht ihre Arbeit sinken und rief: »Du Erzieherin, Agnes! Wie kannst du dir nur so etwas ausdenken!«
»Nun, ich kann darin nichts Außergewöhnliches entdecken. Ich behaupte ja nicht, dass ich große Mädchen unterrichten kann, aber bei kleinen traue ich mir das zu, und ich würde es wirklich gern tun: Ich mag Kinder doch so sehr. Bitte erlaub es, Mama!«
»Aber Liebes, du hast noch nicht einmal gelernt, auf dich selbst aufzupassen, und es gehört mehr Verständnis und Erfahrung dazu, mit kleinen Kindern umzugehen als mit größeren.«
»Aber Mama, ich bin über achtzehn und durchaus in der Lage, auf mich und andere aufzupassen. Du weißt nur nicht, wie klug und vernünftig ich bin, weil ihr mich nie auf die Probe gestellt habt.«
»Nun überleg doch bloß mal«, sagte Mary, »was würdest du in einem Haus voll fremder Menschen anfangen, ohne dass ich oder Mama für dich sprechen oder handeln könnten, mit einer Kinderschar, auf die du wie auf dich selbst achtgeben müsstest, und ohne die Möglichkeit, jemanden um Rat zu fragen? Du wüsstest doch noch nicht einmal, was du anziehen sollst.«
»Du glaubst wohl, weil ich immer tue, was ihr wollt, ich hätte keine eigene Meinung; aber gebt mir die Gelegenheit zu zeigen, was ich kann – das ist alles, worum ich bitte.«
In diesem Augenblick kam mein Vater herein, und wir klärten ihn über den Gegenstand unserer Diskussion auf.
»Was, meine kleine Agnes als Gouvernante!«, rief er aus und musste trotz aller Niedergeschlagenheit bei dieser Vorstellung lachen.
»Ja, Papa, sag wenigstens du nichts dagegen. Ich würde es so gerne versuchen und bin überzeugt, dass es mir bestens gelingen würde.«
»Aber Liebling, wir könnten dich nicht entbehren.« Und mit Tränen in den Augen setzte er hinzu: »So groß unser Elend auch ist, diesen Schritt werden wir ganz bestimmt noch nicht tun.«
»O nein!«, sagte meine Mutter. »Es gibt überhaupt keinen Anlass dafür, es ist nur eine Laune von ihr. Also halt deinen Mund, du ungezogenes Mädchen, denn auch wenn du es so eilig hast, uns zu verlassen, so weißt du nur zu gut, dass wir uns nicht von dir trennen können.«
An diesem wie auch an vielen folgenden Tagen schwieg ich, aber ich gab meine Lieblingsidee noch immer nicht ganz auf. Mary holte ihre Malutensilien hervor und machte sich entschlossen an die Arbeit. Ich nahm meine auch, aber während ich malte, hatte ich andere Dinge im Kopf. Wie herrlich wäre es doch, Erzieherin zu sein! Ich würde in die Welt hinausgehen, ein neues Leben beginnen, selbständig handeln, meine ungenutzten Fähigkeiten einsetzen, meine unbekannten Anlagen erproben, meinen Unterhalt selbst verdienen und noch etwas darüber hinaus, um Vater, Mutter und Schwester hilfreich zu unterstützen, ganz abgesehen davon, dass ich sie von den Ausgaben für mein Essen und meine Kleidung entlastete; ich würde meinem Vater beweisen, wozu seine kleine Agnes in der Lage war, und Mama und Mary davon überzeugen, dass ich doch nicht ganz das hilflose, unbekümmerte Geschöpf war, das sie in mir vermuteten. Ach, und dann, wie reizend wäre es, mit der Betreuung und Erziehung von Kindern betraut zu sein! Was die anderen auch sagten, ich fühlte mich der Aufgabe vollauf gewachsen: Die genaue Erinnerung an die Gedanken, die ich selbst in früher Kindheit gehabt hatte, würden mir eine zuverlässigere Anleitung sein als die Lehren des erfahrensten Ratgebers. Ich brauchte lediglich das Verhalten meiner kleinen Schüler mit dem meinigen im selben Alter zu vergleichen, um es sofort zu verstehen, ihr Vertrauen und ihre Zuneigung zu gewinnen, die Reue der Sünder zu wecken, die Furchtsamen zu ermutigen, die Leidenden zu trösten, Tugend anwendbar, Belehrung wünschenswert und Religion schön und begreiflich zu machen.
– O lieblichs Tagwerk! Süß Bemühn!
Die junge, schwächliche Idee zurechtzulenken, zu formieren!
Die zarten Pflänzchen aufzuziehen und zuzusehen, wie sich die Knospen Tag für Tag entfalten!
All diese Beweggründe bestärkten mich darin, nicht nachzugeben, obwohl die Angst, meine Mutter zu verdrießen oder meinen Vater zu betrüben, mich ein paar Tage lang daran hinderte, das Thema wieder aufzugreifen. Endlich sprach ich noch einmal unter vier Augen mit meiner Mutter darüber und nahm ihr mit einiger Mühe das Versprechen ab, mich durch ihre Fürsprache zu unterstützen. Als Nächstes gab mein Vater widerstrebend seine Zustimmung, und daraufhin – auch wenn Mary noch immer seufzend ihr Missfallen bekundete – begann meine liebe, gute Mutter, sich nach einer Stelle für mich umzusehen. Sie schrieb an die Angehörigen meines Vaters und studierte die Zeitungsanzeigen – zu ihren eigenen Verwandten hatte sie schon seit langem jegliche Verbindung abgebrochen; seit ihrer Heirat bestand der einzige Kontakt in dem gelegentlichen Austausch förmlicher Briefe, und um nichts in der Welt hätte sie sich in einem solchen Falle an sie gewandt. Aber meine Eltern hatten sich so lange und so vollkommen von der Welt zurückgezogen, dass viele Wochen verstrichen, bis eine geeignete Stellung für mich gefunden wurde. Schließlich wurde zu meiner großen Freude bestimmt, dass ich die Betreuung der Kinder einer gewissen Mrs. Bloomfield übernehmen sollte, die meine gute, brave Tante Grey in ihrer Jugend gekannt hatte und die, wie sie versicherte, eine sehr nette Frau war. Ihr Mann war ein Kaufmann, der sich, nachdem er ein ansehnliches Vermögen erworben, zur Ruhe gesetzt hatte, sich jedoch nicht dazu bewegen ließ, der Erzieherin seiner Kinder mehr als fünfundzwanzig Pfund zu bezahlen. Ich aber war eher bereit, dies zu akzeptieren, als die Stelle abzulehnen – was meinen Eltern wohl lieber gewesen wäre.
Aber noch galt es, einige Wochen mit Vorbereitungen zuzubringen. Wie endlos langweilig kamen mir diese Wochen vor! Trotzdem war es im Großen und Ganzen eine glückliche Zeit, voll strahlender Hoffnungen und großer Erwartungen. Mit welch besonderem Vergnügen half ich beim Schneidern meiner neuen Kleider und später beim Kofferpacken! Aber in diese Vorkehrungen mischte sich auch ein Gefühl der Bitterkeit, und als sie beendet waren, als alles für meine Abreise am nächsten Morgen bereit war und die letzte Nacht zu Hause bevorstand, schien eine plötzliche Angst mein Herz zu weiten. Meine Lieben sahen so traurig aus und sprachen so freundlich mit mir, dass ich meine Tränen kaum zurückhalten konnte, aber ich gab immer vor, fröhlich zu sein. Ich hatte mit Mary meine letzte Wanderung übers Moor gemacht, den letzten Spaziergang im Garten und ums Haus; gemeinsam hatten wir zum letzten Mal unsere Lieblingstauben gefüttert – die schönen Tiere, die wir so zahm gemacht hatten, dass sie die Körner aus unseren Händen pickten; noch einmal hatte ich zum Abschied ihre silberglänzenden Rücken gestreichelt, als sie sich auf meinem Schoß zusammendrängten. Ich hatte meine ganz speziellen Lieblinge, die beiden schneeweißen Pfauentauben, zärtlich geküsst, den letzten Ton auf dem alten, vertrauten Piano gespielt und mein letztes Lied für Papa gesungen, d. h., wie ich hoffte, nicht wirklich das letzte, aber wie mir schien, das letzte für lange Zeit. Und wenn ich dies alles das nächste Mal tun würde, geschah es vielleicht mit ganz anderen Gefühlen; die Verhältnisse mochten sich ändern, dies Haus würde möglicherweise nie mehr meine feste Wohnstatt sein. Meine kleine Freundin, das Kätzchen, hätte sich bis dahin gewiss verändert: Schon jetzt war sie im Begriff, eine richtige Katze zu werden, und wenn ich an Weihnachten vielleicht zu einem kurzen Besuch zurückkäme, hätte sie wahrscheinlich ihre Spielkameradin und ihre eigenen fröhlichen Streiche vergessen. Zum letzten Mal hatte ich mit ihr herumgespielt, und während sie danach schläfrig in meinem Schoß lag und schnurrte, streichelte ich ihr weiches, glänzendes Fell mit einem Gefühl der Trauer, das ich nur schwer verbergen konnte. Als ich mich dann zur Schlafenszeit mit Mary in unser ruhiges, kleines Zimmer zurückzog, in dem meine Schubladen und mein Anteil des Bücherregals bereits leergeräumt waren und wo sie in Zukunft würde allein schlafen müssen – in trostloser Einsamkeit, wie sie es ausdrückte –, verzagte mein Herz noch mehr als zuvor: Ich hielt es für selbstsüchtig und unrecht, dass ich darauf bestanden hatte, sie zu verlassen, und als ich noch einmal neben unserem schmalen Bett niederkniete, betete ich inbrünstiger als je zuvor um Segen für sie und meine Eltern. Um meine Gefühle zu verbergen, vergrub ich das Gesicht in den Händen, die sogleich nass von Tränen waren. Als ich mich aufrichtete, merkte ich, dass auch sie geweint hatte. Doch keine von uns beiden sprach; schweigend begaben wir uns zur Ruhe, und in dem Bewusstsein, uns so bald voneinander trennen zu müssen, schmiegten wir uns noch enger aneinander.
Aber der Morgen weckte Hoffnung und Lebensgeister neu. Ich musste zeitig aufbrechen, damit der Wagen – ein Einspänner, den Mr. Smith, der Tuch-, Gemischtwaren- und Teehändler des Ortes, gemietet hatte – noch am selben Tag zurückkehren konnte. Ich stand auf, wusch mich und zog mich an, verschlang hastig mein Frühstück, nahm die zärtlichen Umarmungen von Vater, Mutter und Schwester entgegen, küsste zur großen Entrüstung von Sally, unserem Mädchen, die Katze, gab Sally die Hand, stieg in den Einspänner, zog den Schleier über mein Gesicht und dann, erst dann brach ich in Tränen aus. Der Wagen fuhr an; ich blickte zurück: Meine Mutter und meine Schwester standen noch in der Tür, sahen mir nach und winkten zum Abschied. Ich erwiderte den Gruß und bat Gott aus tiefstem Herzen, sie zu segnen. Dann fuhren wir den Hügel hinab, und ich konnte sie nicht mehr sehen.
»Ziemlich kalter Morgen für Sie, Miss Agnes«, bemerkte Smith, »und ein finsterer dazu; aber wenn wir Glück haben, schaffen wir es noch bis zu jenem Flecken, ehe der Regen losgeht.«
»Ja, hoffentlich«, antwortete ich, so ruhig ich konnte.
»Gestern Nacht ist auch schon ’ne schöne Menge runtergekommen.«
»Ja.«
»Aber vielleicht bläst ihn dieser kalte Wind ja weg.«
»Ja, vielleicht.«
Hier endete unsere Unterhaltung. Wir durchquerten das Tal und schickten uns an, den gegenüberliegenden Hügel hinaufzufahren. Während wir mühselig bergan krochen, sah ich noch einmal zurück: Da war der Kirchturm und dahinter das alte, graue Pfarrhaus, das von einem schräg einfallenden Sonnenstrahl in ein warmes Licht getaucht wurde – er war zwar nur schwach, aber das Dorf und die umliegenden Berge lagen in tiefem Schatten, und ich deutete diesen vorbeigleitenden Strahl als gutes Omen für mein Zuhause. Mit gefalteten Händen erflehte ich inbrünstig den Segen für seine Bewohner und wandte mich dann schnell ab; denn ich sah, dass die Sonne verschwand, und vermied tunlichst jeden weiteren Blick, um es nicht wie die übrige Umgebung im dunklen Schatten daliegen zu sehen.
Kapitel 2
Erste Lektionen in der Kunst des Unterrichtens
Als wir so dahinfuhren, hob sich meine Stimmung wieder, und ich wandte mich der Betrachtung des neuen Lebens zu, das ich nun beginnen würde. Aber obwohl die Septembermitte gerade erst überschritten war, machten die schweren Wolken und ein scharfer Nordostwind den Tag äußerst kalt und ungemütlich; auch erschien mir die Reise sehr lang, denn, wie Smith feststellte, die Straßen waren »sehr schwer«; sein Pferd war mit Sicherheit auch »sehr schwer«: Es schleppte sich die Hügel hinauf, schlich sie wieder hinunter und ließ sich nur dazu herab, in Trab zu fallen, wenn die Straßen völlig eben oder nur ganz leicht abschüssig waren, was in dieser rauen Gegend nur selten vorkam. Und so war es fast ein Uhr, als wir unseren Bestimmungsort erreichten. Doch als wir endlich das steil aufragende Eisentor passierten, gemächlich die glattgewalzte, zu beiden Seiten von grünen Rasenflächen und jungen Bäumen gesäumte Auffahrt hinauffuhren und uns dem neuen, doch stattlichen Herrenhaus von Wellwood näherten, das aus einem hochaufgeschossenen Pappelhain auftauchte, verließ mich der Mut, und ich wünschte, meilenweit weg zu sein. Zum ersten Mal in meinem Leben musste ich für mich selbst einstehen; es gab kein Zurück mehr. Ich musste dieses Haus betreten und mich mit seinen fremden Bewohnern bekannt machen. Aber wie machte man das? Sicher, ich war fast neunzehn, aber ich wusste sehr wohl, dass viele Mädchen von fünfzehn Jahren oder weniger über ein fraulicheres Benehmen und eine größere Ungezwungenheit und Selbstsicherheit verfügten, als ich sie aufgrund des zurückgezogenen Lebens und der schützenden Obhut von Mutter und Schwester besaß. Wenn Mrs. Bloomfield jedoch eine freundliche, mütterliche Frau war, würde ich auf Dauer schon Erfolg haben; mit den Kindern würde ich natürlich bald gut Freund sein und mit Mr. Bloomfield hoffentlich nur wenig zu tun haben.
»Nur ruhig, nur ruhig, egal, was kommen mag«, sagte ich mir im Innern und hielt mich so getreu an diesen Entschluss und war derart damit beschäftigt, meine Nerven zu beruhigen und das unbotmäßige Klopfen meines Herzens zu beschwichtigen, dass ich, nachdem ich in die Halle und zu Mrs. Bloomfield geführt worden war, beinahe vergaß, ihren höflichen Gruß zu erwidern. Erst später ging mir auf, dass ich meine wenigen Worte wie im Halbschlaf gesprochen hatte. Auch die Lady hatte ein etwas frostiges Verhalten an den Tag gelegt, wie ich nachher feststellte, als ich Zeit zum Nachdenken hatte. Sie war eine große, reservierte, stattliche Frau mit dichtem schwarzen Haar, kalten grauen Augen und ausgesprochen ungesunder Gesichtsfarbe.
Mit gebührender Höflichkeit zeigte sie mir jedoch mein Zimmer und ließ mir Zeit, mich etwas zu erholen. Beim Anblick meines Spiegelbildes war ich entsetzt: Durch den kalten Wind waren meine Hände angeschwollen und gerötet, meine Haare aufgelöst und zerzaust und mein Gesicht leicht purpurn gefärbt; zu allem Überfluss war mein Kragen schrecklich zerknittert, mein Kleid schlammbespritzt, und meine Füße steckten in einem Paar derber, neuer Stiefel; und da man die Koffer noch nicht heraufgebracht hatte, konnte dem allem auch nicht abgeholfen werden. Als ich mein Haar, so gut es ging, gebändigt und meinen widerspenstigen Kragen mehrmals zurechtgezupft hatte, machte ich mich daran, in den beiden Treppenfluchten meinen Weg zu suchen, wobei ich vor mich hin grübelte. Mit einiger Schwierigkeit fand ich den Raum, in dem Mrs. Bloomfield mich erwartete.
Sie führte mich ins Esszimmer, wo der Familientisch gedeckt war. Man setzte mir Beefsteak und ein paar lauwarme Kartoffeln vor. Während ich saß, saß sie mir gegenüber, beobachtete mich, wie es mir vorkam, und gab sich Mühe, eine Art Gespräch in Gang zu halten, das größtenteils aus einer Reihe von abgedroschenen Phrasen bestand, die sie mit steifer Förmlichkeit äußerte. Aber das mochte eher mein Fehler als der ihre sein, denn ich war beim besten Willen nicht in der Lage, mich zu unterhalten. In der Tat nahm das Essen meine Aufmerksamkeit fast völlig in Anspruch: nicht etwa wegen meines Heißhungers, sondern weil mir die Zähigkeit des Beefsteaks und meine klammen Finger zu schaffen machten, die fast gelähmt waren, nachdem sie fünf Stunden dem bitterkalten Wind ausgesetzt gewesen waren. Nur zu gern hätte ich die Kartoffeln gegessen und das Fleisch übriggelassen, aber da man mir ein großes Stück davon auf den Teller gelegt hatte, wollte ich nicht unhöflich sein. Nach mehreren ungeschickten und erfolglosen Versuchen, es mit dem Messer zu schneiden, mit der Gabel zu zerreißen oder mit beidem zusammen in kleine Stücke zu zerlegen, nahm ich schließlich – immer der Tatsache bewusst, dass die schreckliche Lady die ganze Prozedur verfolgte – wie ein zweijähriges Kind verzweifelt Messer und Gabel in beide Fäuste und machte mich mit all meinem bisschen Kraft ans Werk. Dies nun verlangte eine Entschuldigung, und mit dem schwachen Versuch zu lachen, sagte ich: »Meine Hände sind so taub von der Kälte, dass ich kaum mit Messer und Gabel umgehen kann.«
»Ich dachte schon, Sie fänden es kalt«, antwortete sie mit einer kühlen, stets gleichbleibenden Würde, die nicht gerade dazu angetan war, mich zu beruhigen.
Als die Zeremonie beendet war, führte sie mich ins Wohnzimmer zurück, wo sie läutete und nach ihren Kindern schickte.
»Sie werden feststellen, dass sie in ihren Kenntnissen nicht sehr weit fortgeschritten sind«, sagte sie, »denn ich hatte so wenig Zeit, mich selbst um ihre Erziehung zu kümmern, und wir dachten bis jetzt, sie seien noch zu klein für eine Gouvernante; aber ich glaube, es sind intelligente Kinder, sehr bereitwillig zu lernen, besonders der kleine Junge: Er ist, wie ich meine, der Beste von allen – ein großzügiger, edel gesinnter Knabe, der geführt, doch nicht angetrieben werden muss und der ausnahmslos die Wahrheit spricht. Betrug scheint er zu verachten.« (Nun, das hörte man gern.) »Seine Schwester Mary Ann braucht etwas Aufsicht«, fuhr sie fort, »obwohl sie im Großen und Ganzen ein sehr liebes Mädchen ist, aber ich möchte, dass sie so weit wie möglich aus dem Kinderzimmer ferngehalten wird, denn sie ist jetzt fast sechs und könnte die schlechten Angewohnheiten der Kindermädchen annehmen. Ich habe angeordnet, ihr Bett in Ihrem Zimmer aufzustellen, und wenn Sie so freundlich wären, sie beim Waschen und Anziehen zu beaufsichtigen und ihre Kleidung in Ordnung zu halten, braucht sie in Zukunft nichts mehr mit dem Mädchen zu tun zu haben.«
Ich erwiderte, dass ich das gern tun wolle, und im gleichen Augenblick betraten auch schon meine kleinen Schüler zusammen mit ihren beiden jüngeren Schwestern das Zimmer. Master Tom Bloomfield war ein hochaufgeschossener Knabe von sieben Jahren, mit drahtigem Körperbau, flachsblondem Haar, blauen Augen, einer kleinen Stupsnase und zartem Teint. Auch Mary Ann war groß, dunkelhaarig wie ihre Mutter, hatte aber ein rundes, volles Gesicht und hochrote Wangen. Die nächste Schwester war Fanny, ein sehr hübsches kleines Mädchen; Mrs. Bloomfield versicherte mir, dass sie ein besonders sanftes Kind sei und etwas Ermunterung brauche: Sie hätte bis jetzt noch gar nichts gelernt, würde aber in einigen Tagen vier Jahre alt und solle dann mit dem Lernen des Alphabets beginnen und mit den anderen ins Schulzimmer gehen. Blieb noch Harriet, ein kleines, rundes, fröhliches, verspieltes Ding von knapp zwei Jahren, zu dem es mich mehr als zu allen anderen hinzog – aber ausgerechnet mit ihr hatte ich nichts zu tun.
Ich sprach mit meinen kleinen Schülern, so gut ich konnte, und versuchte, mich liebenswürdig zu geben, aber, wie ich fürchte, ohne großen Erfolg, denn die Anwesenheit ihrer Mutter machte mich auf unangenehme Weise befangen. Ihnen dagegen ging jede Schüchternheit ab. Anscheinend waren es kecke, lebhafte Kinder, mit denen ich hoffentlich bald auf freundschaftlichem Fuße stehen würde, vor allem mit dem kleinen Jungen, von dessen vielversprechendem Charakter ich seine Mutter ja hatte sprechen hören. Mary Ann hatte ein gewisses affektiertes Lächeln und den ausgeprägten Wunsch nach Beachtung, was ich mit Bedauern registrierte. Aber ihr Bruder beanspruchte meine ganze Aufmerksamkeit für sich. Er stand, die Hände auf dem Rücken, kerzengerade zwischen mir und dem Kamin, plauderte unaufhörlich wie der größte Redner und unterbrach seinen Redefluss nur gelegentlich, um seinen Schwestern einen scharfen Tadel zu erteilen, wenn sie zu viel Lärm machten.
»O Tom, was für ein Schatz du bist!«, rief seine Mutter. »Komm her und gib deiner Mama einen Kuss. Und willst du dann nicht Miss Grey euer Schulzimmer und eure schönen, neuen Bücher zeigen?«
»Ich will dir keinen Kuss geben, Mama, aber ich will Miss Grey mein Schulzimmer und meine neuen Bücher zeigen.«
»Und mein Schulzimmer und meine neuen Bücher, Tom«, sagte Mary Ann. »Sie gehören genauso mir.«
»Sie gehören mir«, antwortete er entschieden. »Kommen Sie, Miss Grey, ich begleite Sie.«
Nachdem Schulzimmer und Bücher vorgeführt worden waren – nicht ohne Streitereien zwischen Bruder und Schwester, die beizulegen und zu schlichten ich mir die größte Mühe gab –, brachte mir Mary Ann ihre Puppe und begann, weitschweifig über deren vornehme Kleider, ihr Bett, ihre Kommode und sonstige Ausstaffierung zu schwatzen. Doch Tom hieß sie, den Mund zu halten, damit Miss Grey sich sein Schaukelpferd ansehen könne, das er unter großem Getöse von seinem Platz in der Ecke bis in die Mitte des Zimmers zog, wobei er mich mit lauter Stimme aufforderte, nun gut achtzugeben. Dann befahl er seiner Schwester, die Zügel zu halten, bestieg das Pferd und ließ mich volle zehn Minuten dastehen und zusehen, wie beherzt er mit Peitsche und Sporen umging. Während dieser Zeit bewunderte ich allerdings Mary Anns hübsche Puppe samt allem Zubehör; danach versicherte ich Mr. Tom, dass er ein ausgezeichneter Reiter wäre, aber hoffentlich Peitsche und Sporen bei einem echten Pony nicht so häufig einsetzen würde.
»Und ob ich das tue!«, sagte er und schlug mit noch größerem Eifer drauflos. »Ich werde es ihm geben wie der Teufel. Mein Wort drauf, der wird es spüren.«
Es war ganz abscheulich, aber ich hoffte, mit der Zeit eine Besserung bewirken zu können.
»Jetzt nehmen Sie Haube und Schal«, sagte der kleine Held, »und ich zeige Ihnen meinen Garten.«
»Und meinen«, sagte Mary Ann.
Tom hob mit drohender Gebärde seine Faust; sie stieß einen lauten, gellenden Schrei aus, lief auf meine andere Seite und schnitt ihm eine Grimasse.
»Du würdest deine Schwester doch wohl nicht schlagen, Tom! Ich hoffe, dass ich das nie sehen werde!«
»Das werden Sie aber manchmal: Ich bin gezwungen, es hin und wieder zu tun, um sie im Zaum zu halten.«
»Es ist aber nicht deine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sie sich ordentlich benimmt, verstehst du, das ist –«
»Nun gehen Sie schon und setzen Sie Ihre Haube auf.«
»Ich weiß nicht – es ist so trüb und kalt, wahrscheinlich fängt es an zu regnen –, und du weißt ja, dass ich eine lange Fahrt hinter mir habe.«
»Das ist egal – Sie müssen mitkommen; ich dulde keine Ausreden«, gab der kleine Gentleman wichtigtuerisch zur Antwort. Und da es der erste Tag unserer Bekanntschaft war, dachte ich, es würde nichts schaden, ihm nachzugeben. Mary Ann der Kälte auszusetzen war zu riskant, und so blieb sie bei ihrer Mama, zur großen Erleichterung ihres Bruders, der mich ganz für sich haben wollte.
Der Garten war groß und geschmackvoll angelegt. Außer mehreren herrlichen Dahlien blühten noch einige andere schöne Blumen, aber mein Begleiter ließ mir keine Zeit, sie genauer anzusehen: Ich musste mit ihm über den nassen Rasen in einen entfernten, abgelegenen Winkel gehen, die wichtigste Stelle des ganzen Geländes; denn sie beherbergte seinen Garten. Dort gab es zwei Beete mit den unterschiedlichsten Pflanzen. In dem einen stand ein hübscher kleiner Rosenstock; ich blieb stehen, um seine lieblichen Blüten zu bewundern.
»Ach, kümmern Sie sich nicht darum!«, sagte er verächtlich. »Das ist nur Mary Anns Garten, schauen Sie, dies hier ist meiner.«
Nachdem ich jede einzelne Blume betrachtet und mir über jede Pflanze eine ausführliche Abhandlung angehört hatte, durfte ich gehen; zuvor aber pflückte er mit großer Geste eine Narzisse und überreichte sie mir, als würde er mir eine ungeheure Gunst erweisen. Ich bemerkte im Gras rings um seinen Garten gewisse Vorrichtungen aus Stöcken und Bindfäden und fragte, was das sei.
»Vogelfallen.«
»Warum fängst du die Vögel?«
»Papa sagt, sie sind schädlich.«
»Und was machst du mit ihnen, wenn du sie gefangen hast?«
»Das ist verschieden. Manchmal gebe ich sie der Katze, manchmal schneide ich sie mit meinem Taschenmesser in Stücke, aber den nächsten will ich bei lebendigem Leibe braten.«
»Und warum hast du etwas so Entsetzliches vor?«
»Aus zwei Gründen: Einmal will ich sehen, wie lange er lebt, und dann will ich wissen, wie er schmeckt.«
»Aber weißt du nicht, dass es sehr böse ist, so etwas zu tun? Merk dir: Vögel können genauso fühlen wie du, und überleg mal, wie dir das gefallen würde.«
»Ach, das macht nichts! Ich bin kein Vogel und kann auch nicht spüren, was ich mit ihnen mache.«
»Aber eines Tages wirst du es spüren, Tom: Du hast bestimmt schon gehört, wohin böse Menschen gehen müssen, wenn sie sterben, und wenn du nicht aufhörst, unschuldige Vögel zu quälen, vergiss nicht, dann musst auch du dorthin und das Gleiche erleiden, was sie deinetwegen erlitten haben.«
»Pah! Das werde ich nicht. Papa weiß, wie ich sie behandle, und schimpft niemals deswegen mit mir; er sagt, dass er als Junge dasselbe gemacht hat. Letzten Sommer hat er mir ein Nest mit jungen Spatzen gegeben und zugesehen, wie ich ihnen Beine, Flügel und Köpfe abgerissen habe, und er hat nichts dazu gesagt, nur dass es ekelhafte Biester wären, und ich solle mir nicht an ihnen die Hosen schmutzig machen. Und Onkel Robson war auch dabei; der hat gelacht und gesagt, ich wäre ein feiner Kerl.«
»Aber was würde deine Mama dazu sagen?«
»Ach, der ist das egal! Sie sagt, es sei schade, die schönen Singvögel zu töten, aber mit den frechen Spatzen, mit Mäusen und Ratten könne ich tun, was ich will. Also, Miss Grey, Sie sehen, dass es nicht böse ist.«
»Ich glaube immer noch, dass es das ist, Tom, und vielleicht würden deine Eltern das genauso sehen, wenn sie einmal gründlich darüber nachdächten. – Aber«, fügte ich in meinem Innern hinzu, »sie können sagen, was sie wollen, ich für meinen Teil habe beschlossen, dass du nichts Derartiges mehr tust, solange es in meiner Macht steht, das zu verhindern.«
Als Nächstes führte er mich kreuz und quer über den Rasen, um mir seine Maulwurfsfallen zu zeigen, dann in den Heumietenhof, um mir die Wieselfallen zu zeigen, von denen eine zu seiner großen Freude ein totes Wiesel enthielt, und schließlich in den Stall, nicht etwa um mir die edlen Kutschpferde, sondern ein kleines, struppiges Fohlen zu zeigen, das, wie er mir mitteilte, extra für ihn gezüchtet worden war und das er reiten solle, sobald es gut genug zugeritten wäre. Ich versuchte, dem kleinen Burschen eine Freude zu machen, und hörte all seinem Geplapper geduldig zu; denn ich hatte mir vorgenommen, falls es in seinem Wesen überhaupt so etwas wie Zuneigung gab, diese zu gewinnen und ihm dann allmählich die Fehler in seinem Verhalten zu erklären. Aber nach der großzügigen, edlen Gesinnung, von der seine Mutter gesprochen hatte, suchte ich vergebens; wobei ich allerdings schon erkannt hatte, dass er ein gewisses Maß an Aufgewecktheit und Verstand besaß, wenn es ihm beliebte, diese zu gebrauchen.
Als wir ins Haus zurückkamen, war es beinahe Teezeit. Master Tom sagte mir, dass er, ich und Mary Ann zur Feier des Tages den Tee gemeinsam mit seiner Mama einnehmen würden, weil sein Vater nicht zu Hause war; denn bei solchen Gelegenheiten aß sie immer mittags mit ihnen statt um sechs Uhr. Schon bald nach dem Tee ging Mary Ann zu Bett; Tom aber beehrte uns mit seiner Gesellschaft und Unterhaltung bis um acht. Nachdem er gegangen war, klärte mich Mrs. Bloomfield weiter über Anlagen und Fähigkeiten ihrer Kinder auf, darüber, was sie lernen sollten und wie ich mit ihnen umzugehen hätte, und sie schärfte mir ein, etwaige Schwächen nur ihr gegenüber zu erwähnen. Meine Mutter hatte mich dagegen davor gewarnt, gerade ihr allzu viel darüber zu sagen, da niemand gern von den Fehlern seiner Kinder höre, und ich beschloss also, vollkommenes Stillschweigen darüber zu bewahren. Gegen halb zehn lud mich Mrs. Bloomfield zu einem bescheidenen Abendessen ein, das aus kaltem Fleisch und Brot bestand. Ich war froh, als es vorüber war, sie ihre Kerze für die Nacht ergriff und sich zur Ruhe begab. Denn obwohl ich sie gern als angenehm empfunden hätte, war ihre Gegenwart doch äußerst ermüdend für mich, und ich konnte mich des Gefühls nicht erwehren, dass sie kalt, ernst und abweisend war – das genaue Gegenteil der freundlichen, warmherzigen Frau, wie ich sie mir in meinen Hoffnungen ausgemalt hatte.
Kapitel 3
Noch ein paar Lektionen
Am nächsten Morgen erhob ich mich trotz der Enttäuschungen, die ich bereits erfahren hatte, mit einem Gefühl erwartungsvoller Heiterkeit; aber Mary Ann anzukleiden stellte sich als nicht ganz einfach heraus, denn ihr dickes Haar musste mit Pomade eingerieben, zu drei langen Zöpfen geflochten und mit Bänderschleifen zusammengebunden werden: eine schwierige Aufgabe für meine ungeübten Finger. Sie sagte, ihr Kindermädchen benötige nur halb so viel Zeit dafür, und schaffte es durch ihr ständiges ungeduldiges Herumzappeln, dass ich noch länger brauchte. Als ich mit allem fertig war, gingen wir ins Schulzimmer, wo ich meinen anderen Schüler vorfand, und ich plauderte mit den beiden, bis es Zeit war, zum Frühstück hinunterzugehen. Nachdem diese Mahlzeit beendet war und ich mit Mrs. Bloomfield ein paar höfliche Worte gewechselt hatte, kehrten wir ins Schulzimmer zurück und begannen mit unserem Tagespensum. Ich fand meine Schüler in der Tat sehr zurück, doch Tom, obwohl jeder Art von geistiger Anstrengung abgeneigt, war nicht ohne Talent. Mary Ann konnte kaum ein Wort lesen und war so gleichgültig und unaufmerksam, dass ich mit ihr so gut wie gar nicht vorwärts kam. Jedoch mit viel Mühe und Geduld erreichte ich, dass im Verlauf des Vormittags ein kleines Pensum geschafft wurde, und dann begleitete ich meine Schützlinge in den Garten und die angrenzenden Parkanlagen, damit sie sich vor dem Essen ein wenig erholten. Dort kamen wir leidlich miteinander zurecht, nur stellte ich fest, dass es ihnen gar nicht einfiel, mit mir zu gehen: Ich musste mit ihnen